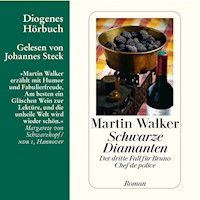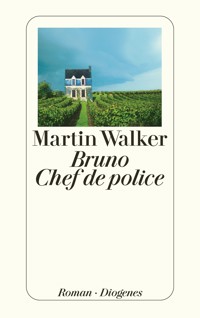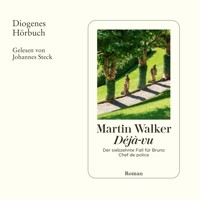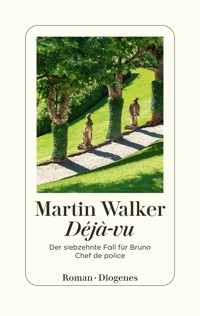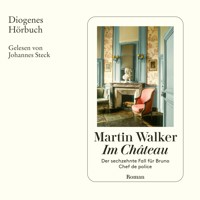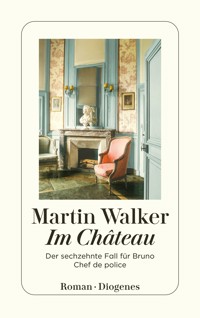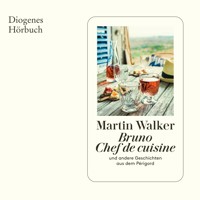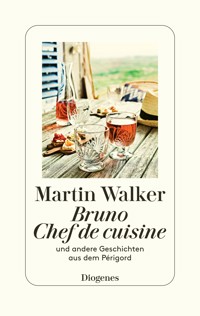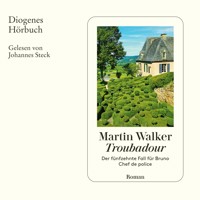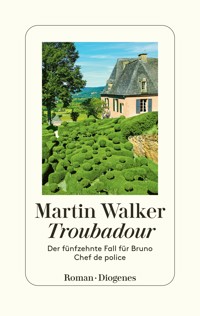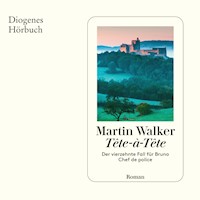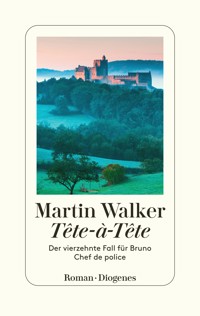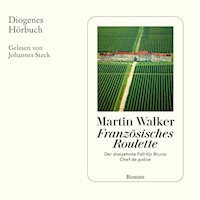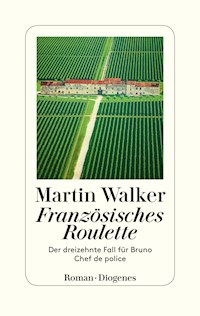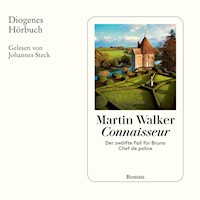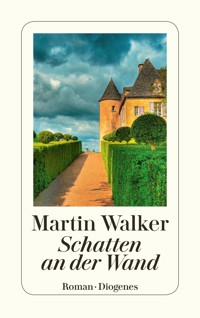
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Martin Walkers früher Roman über die Entstehung einer prähistorischen Höhlenzeichnung, deren Verwicklung in blutige Kriege und Intrigen zur Zeit der Höhlenmaler von Lascaux und während des Zweiten Weltkriegs. Die Geschichte gipfelt in dem erbitterten Kampf von fünf Menschen, sie heute zu besitzen. Denn wer diese Zeichnung findet, erhält den Schlüssel zur Aufklärung eines Verbrechens, das bis in die höchste Politik reicht und von dem bis heute keiner wissen darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Martin Walker
Schatten an der Wand
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
{5}1Zeit: Gegenwart
Jede interessante Frau hat eine ganz eigene Art zu lächeln, und Lydia Dean machte diese Erfahrung bei sich selbst, als sie ihr enges Mansardenbüro betrat und das Glas eines gerahmten Posters ihr Spiegelbild zurückwarf. Sie konnte sich das Lächeln ebenso gut eingebildet haben, denn es bestand keinerlei Anlass zu Fröhlichkeit. Entschlossen, niemanden merken zu lassen, wie sehr sie das Gespräch mit Justin bestürzt hatte, drückte Lydia die Tür fest hinter sich zu und blieb dann mitten im Raum stehen, um über den drohenden Ruin ihres Imperiums nachzudenken. Doch trotz der betrüblichen Aussicht auf Arbeitslosigkeit hob sich ihre Laune. Es war eine ironische Stimmung, inspiriert von ihrem Sinn für Absurditäten. Lydia staunte immer wieder über die hochgestochenen Begriffe, die ihr im unpassendsten Moment in den Sinn kamen. Imperium? Ruin? Dabei würde sie lediglich einen Job verlieren, der ihr ohnehin nicht gefiel, obwohl er ihr bisher immerhin ermöglicht hatte, mit Kunst angemessen zu verdienen.
Dabei war das Wort Imperium durchaus zutreffend, dachte sie mit Blick auf die Karte der antiken Welt, die vor ihr an der Wand hing. Ihr Territorium erstreckte sich vom alten Griechenland bis in die Anfänge der Zeitrechnung, von den Weiten Indiens bis zu den Säulen des Herkules. Sie {6}hatte die Länder der Hethiter und Hammurabis Königreich bereist und erforscht und konnte mehrere tote Sprachen aus dem kleinasiatischen Raum lesen. Als Studentin hatte sie an Ausgrabungen teilgenommen, Keramikscherben aus knochentrockenen Erdschichten geborgen und sogar ihre Zahnbürste eingesetzt, um sie zu säubern. Und nun sah es so aus, als wären ihre sauer erworbenen Fähigkeiten, sich gegenüber engstirnigen und nicht selten völlig inkompetenten Kulturbürokraten durchzusetzen, vergebliche Liebesmüh gewesen.
Wie um alles in der Welt hatte sie nur so ehrgeizlos sein können, als sie nach England zurückgekommen war, um ein Aufbaustudium in Kunstgeschichte anzutreten? Sie schimpfte in letzter Zeit häufig mit sich und sparte nicht mit Selbstkritik. Kunstgeschichte sei kein wirklich ernstzunehmendes Fach, haderte sie, nicht wie etwa Jura oder Informatik oder auch Betriebswirtschaft. Vielleicht hätte sie sich doch auf Archäologie konzentrieren sollen, dachte sie, erinnerte sich dann aber an staubige Zeltlager, Rückenschmerzen und aufdringliche Mitarbeiter mit unangenehmen Körpergerüchen. Es wäre wohl besser gewesen, sie hätte ihre Forschungen am Institut für mittelalterliche Kunst fortgesetzt, eine Arbeit, die sie wirklich liebte. Geld konnte doch nicht alles sein. Trotzdem musste jeden Monat die Hypothek bedient werden, und heute war ihr unmissverständlich mitgeteilt worden, dass das Auktionshaus auf ihre Mitarbeit zu verzichten gedachte, weil der Markt in ihrem Fachbereich bedauerlich wenig hergab. Präklassische Kunst umfasste alles, was vor den alten Griechen und Römern lag. Lydias Imperium erstreckte sich vom antiken {7}Ägypten bis nach Babylon, von Persepolis bis ins Heilige Land, es umfasste Kontinente und Jahrtausende, brachte aber trotzdem nicht entfernt die Erlöse ein, die selbst drittrangige Impressionisten mit ihren Bildern erzielten.
»Das hier – ich meine, Ihr Bereich – sieht – hmm – nicht gerade vielversprechend aus, tut mir leid«, hatte der Abteilungsleiter angesichts der bescheidenen Liste ihrer Vorschläge für das kommende Geschäftsjahr gesagt. Wie so viele Engländer drückte sich Justin schrecklich umständlich aus, insbesondere dann, wenn er schlechte Nachrichten mitzuteilen hatte. Wie sie wusste, ging es nicht nur um ihren Bereich; für die Flaute wurde sie persönlich verantwortlich gemacht. Man bezahlte sie nicht nur dafür, dass sie die Märkte abklapperte und die besten Angebote für ihr Auktionshaus ausfindig machte, sondern vor allem dafür, potentielle Verkäufer interessanter Sammlungen zu beeindrucken und reiche Kunden ans Haus zu binden. Obwohl keiner ihrer Vorgesetzten so unenglisch gewesen wäre, ihr reinen Wein einzuschenken, wusste sie, dass sie den Job nur ihrer Jugend und Attraktivität verdankte. Aber man erwartete auch von ihr, auf ihrem Gebiet jenen Hype zu erzeugen, der für Publizität und Gewinne sorgte. In dieser Hinsicht war sie bisher kläglich gescheitert, denn sie konnte nur ganz wenige Erfolge für sich verbuchen: einige armselige Verkäufe an Museen, die aber nur geringe Erlöse eingebracht hatten, eine Handvoll sumerischer Kunstgegenstände an eine Privatsammlung sowie die nicht unproblematische Vermittlung einiger Artefakte, die womöglich aus der Plünderung skythischer Grabhügel stammten.
»Wir haben Erwartungen in Sie gesetzt, die Sie leider {8}nicht erfüllen, Lydia«, hatte Justin abschließend bemerkt und dabei jenen hochnäsigen Ton angeschlagen, der jetzt öfter von ihm zu hören war, seit sie seine Einladung zu einem romantischen Dinner ausgeschlagen hatte. Unter den weiblichen Angestellten galt Justin als Frauenheld. Lydia fand ihn einfach nur pomadig in seinen blau gemusterten oder gestreiften Hemden, weißen Krägen und Manschetten. Inzwischen versäumte sie es nie, sich nach seiner Frau und den Kindern zu erkundigen.
Das Gespräch hatte sie aufgebracht und ihr deutlich vor Augen geführt, dass sie noch vor Ablauf des Jahres arbeitslos sein würde. Missmutig und niedergeschlagen ging Lydia an ihren Schreibtisch und streichelte gewohnheitsmäßig den Kopf der Katze aus Speckstein, die sie als Skulptur aus der Fünften Dynastie in Kairo erstanden hatte, eine Imitation natürlich, aber gelungen und anmutig. Ihre Karriere stand vor dem Aus. Vor dem Fenster ging ein Londoner Nieselregen nieder, und das trübe Dämmerlicht sprach den ersten Narzissenknospen Hohn, die sie am Morgen im Park gesehen hatte. Schlechtgelaunt blätterte sie in den Verkaufskatalogen und versuchte alle Gedanken an ihren dreißigsten Geburtstag in wenigen Monaten auszublenden. Über einen Berufswechsel nachzudenken erschien ihr wichtiger. Sie sollte Abendkurse besuchen, vielleicht noch einen weiteren Abschluss an einer Fernuniversität ansteuern, in Wirtschaftswissenschaften oder Jura. An einer Uni in den Vereinigten Staaten zu studieren konnte sie sich beim besten Willen nicht leisten. Außerdem war sie noch nicht bereit, nach Hause zurückzukehren, zumal ihre Mutter seit dem Tod von Lydias Vater äußerst knapp bei Kasse war. In den {9}USA gab es ohnehin viel zu viele Anwälte. Hier in England sah es besser aus. Anwälte verdienten gut und schienen immer gefragt zu sein. Und David war weder gelangweilt noch langweilig gewesen und konnte sogar durchaus amüsant über seine Arbeit als Patentanwalt sprechen. Doch an ihn wollte sie sich lieber nicht erinnern. Es war nett mit ihm gewesen, aber letztlich alles andere als wirklich befriedigend.
David gehörte der Vergangenheit an. Und nun drohte auch ihrer beruflichen Laufbahn ein vorzeitiges Ende. Deshalb war es für sie ein Lichtblick, als die Rezeptionistin anrief und Laufkundschaft anmeldete. Für ihre Kollegen von der Gemälde-, Möbel- und Schmuckabteilung waren Laufkunden eine Last. Sie fühlten sich gestört, wenn sie irgendein ramponiertes Erbstück taxieren sollten, vorgelegt von jemandem, dem die Gier ins Gesicht geschrieben stand. Lydia dagegen hatte nur selten mit solchen Leuten zu tun, und die wenigen, die bei ihr anklopften, kamen mit offensichtlichen Fälschungen, die einem naiven Soldaten oder Seemann in Kairo oder Bagdad angedreht worden waren. Meist sah schon die Rezeptionistin auf den ersten Blick, dass es sich um eine Fälschung handelte, doch sie zog es vor, Experten wie Lydia die Entscheidung zu überlassen.
Sie erreichte das Foyer, als gerade ein großgewachsener, sportlicher Mann in Tweedanzug und festen Schuhen in den Empfangsraum geführt wurde. Er schien noch keine vierzig zu sein, kleidete sich aber wie ein Sechzigjähriger. Das Paket, das er trug – sorgfältig eingewickelt in braunes Papier und mit einer Kordel verschnürt –, schien schwer zu sein, was ihn aber in seinen forschen Bewegungen, die Lydia geradezu militärisch vorkamen, nicht bremsen konnte. Seine {10}Krawatte war unauffällig und aus dicker Seide, das Haar kurz geschnitten, und sein Verhalten energisch, aber angenehm. Er verströmte einen Hauch von Karbolseife, was Lydia in Erinnerung an Davids penetrantes Deodorant mit Wohlwollen zur Kenntnis nahm. Lächelnd stellte der Mann das Paket auf dem Tisch ab und streckte ihr dann mit einem amüsierten Funkeln in den Augen die Hand entgegen. »Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Manners. Mein kürzlich verstorbener Vater hat mir etwas vererbt, und ich möchte wissen, ob es sich zu verkaufen lohnt.«
Intonation, Auftritt und Kleidung ließen darauf schließen, dass er aus vornehmen Verhältnissen stammte. Geldadel, teure Internate. Sie schüttelte ihm die Hand, stellte sich vor und zog die Tischschublade auf, um ihm eine Schere anzubieten. Doch er war schon dabei, den Knoten der Paketschnur zu lösen. »Ich glaube, es ist ein Mitbringsel von irgendeinem Kriegseinsatz«, erklärte er. »Indien, Mittlerer Osten, da wo mein Vater hauptsächlich gedient hat. Er war Soldat und hat sich vor dreißig Jahren in Wiltshire zur Ruhe gesetzt. Dieses Ding stand in meinem Elternhaus herum, solange ich denken kann.«
Lydia spürte, wie sich ihre Gesichtsmuskeln anspannten, als unter dem braunen Packpapier eine Kiste zum Vorschein kam. Deren Inhalt benahm ihr den Atem. Wunderschön – es gab kein anderes Wort dafür. Wann oder wo immer es geschaffen worden war, ob vor einer Woche in einer Fälscherwerkstatt oder vor Jahrtausenden – das Zusammenspiel von Form, Farbe und Textur machte sie schlicht sprachlos. Sie versuchte, sich ihre Neugier und Erregung nicht anmerken zu lassen, schloss die Augen und mahnte sich im {11}Stillen zu professioneller Zurückhaltung. Nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Standardkategorien – Kultur, Entstehungszeit, Ort und Stilistik – halfen ihr in diesem Fall ohnehin nicht weiter. Was ihr als Erstes in den Sinn kam, stellte sie bewusst zurück. Von ihr wurde eine sachliche Einschätzung verlangt. Als Herkunftsort kam das Ahaggar-Gebirge der Sahara in Betracht, oder vielleicht handelte es sich um ein Fragment aus dem Fries einer der Höhlenkirchen von Kappadokien. Sie versuchte, sich auch an das wenige zu erinnern, was sie über die Bildhauerei Äthiopiens und Simbabwes wusste, doch Afrika schien ihr die falsche Spur zu sein. Australien kam ebenfalls nicht in Frage. War es etwa jemenitischer Herkunft oder aus den Dekkan-Höhlen in Indien? Allerdings schien diese Tierdarstellung nicht so recht ins hinduistische Bestiarium zu passen. Der Kiefer war zu kräftig, der Schwung der Hörner ließ auf Angriffslust schließen, nicht auf Verteidigungsbereitschaft. Und es war nicht einfach ein Stier, sagte sie sich, als sie die Augen wieder öffnete und den mächtigen Nacken und die tödlichen Hörner betrachtete. Es war das wilde Tier schlechthin. Unwillkürlich kamen ihr Bilder von einem Spanienurlaub in den Sinn, von der Corrida des San-Isidro-Festes in Madrid, von stampfenden Pferdehufen und einem Koloss wie diesem, der Angst und Schrecken verbreitete.
Noch während sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, verspürte sie einen Anflug von Entrüstung. Das Bild – ein Steinfragment mit einer Kantenlänge von ungefähr dreißig mal dreißig Zentimetern – gehörte bestimmt zu einem größeren Werk, das jemand ergaunert oder mit einem Brecheisen aus einer Felswand gebrochen hatte. Ein Wunderwerk {12}war verschandelt worden. Solche Räuber waren für Lydia die schlimmsten, da sie in ihrer Habgier nicht einmal davor zurückschreckten, eine antike Kirche zu zerstören, um an ein einzelnes Fresko heranzukommen. Sie musterte ihren Kunden mit kühlem Blick, was der aber nicht zu bemerken schien. Er war sichtlich stolz auf sein Erbstück, das auf einem dunklen Samtpolster in dem Schaukasten ruhte, trat einen Schritt zurück und schaute sie hoffnungsvoll an, wie in Erwartung eines Kompliments.
Lydia holte tief Luft, unschlüssig, was sie sagen sollte, und betrachtete wieder die kruden, in die Länge gezogenen, aber irgendwie trotzdem noblen Umrisse des gehörnten Tiers in verblichenen Rot- und Schwarztönen mit weiteren Zeichenspuren am Rand der Steinplatte, wo sie aus einem größeren Ganzen herausgebrochen worden waren. Sie konnte nicht anders, sie musste die Abbildung berühren und glaubte fest, eine Kraft würde aus dem Stein durch ihre Finger strahlen und ihr über Ursprung und Herkunft Auskunft geben. Auch ohne konkrete Anhaltspunkte war sie intuitiv davon überzeugt, ein Original vor Augen zu haben. Wie konnte sie nur in Erwägung gezogen haben, eine andere berufliche Laufbahn einzuschlagen? Keinem Anwalt wären solche Eindrücke und Empfindungen, ein solches Hochgefühl jemals gegeben, höchstens allenfalls Ärzten, wenn sie ein Leben retteten, oder Lehrern, wenn ein Schüler dank ihrer Hilfe Lernfortschritte erkennen ließ. So wie jetzt hatte sich Lydia schon lange nicht mehr gefühlt.
»Haben Sie davon noch mehr, oder ist dies das einzige Stück?«, fragte sie.
»Das einzige«, antwortete er. »Es stand im {13}Arbeitszimmer meines Vaters, auf einem Bücherregal. Er hat sich darüber nie ausgelassen, und ich weiß nur, dass es ein Kriegsmitbringsel ist – von einem gefährlichen Einsatz. Und dass er den Schaukasten selbst hergestellt hat. Meiner Mutter gegenüber hat er angeblich einmal gesagt, die Zeichnung sei mindestens siebzehntausend Jahre alt.«
»Wohl kaum«, entgegnete Lydia höflich. Ihre Stimme klang fast wieder normal, und auch ihre Gedanken kehrten in gewohnte Bahnen zurück. »Wenn es ein Felsbild aus der nordafrikanischen Ahaggar-Region ist, wird es nur ein paar hundert Jahre alt sein. Als kappadokische Arbeit wäre sie vor ungefähr tausendsiebenhundert Jahren entstanden. Aber siebzehntausend Jahre? So alt ist keine uns bekannte Zivilisation, die ein solches Werk hervorgebracht haben könnte. Vorausgesetzt, es ist überhaupt echt.«
Auf der Rückseite des Schaukastens befanden sich Schwenkschieber aus Messing. Sie schob sie zur Seite, um den Glasdeckel zu lösen, worauf der Besucher mit einem zuvorkommenden »Sie erlauben« die Steinplatte aus dem Kasten heraushob. Sie nahm ein Vergrößerungsglas aus der Schublade, richtete ein Spotlicht auf den Stein und untersuchte eine lange Brandspur am Rand. Von einem Brennbohrer vielleicht, mit dem die Platte aus dem Fels gelöst worden war? Siebzehntausend Jahre, dachte sie. Damit käme nur eine Möglichkeit in Betracht, und die wäre kaum zu fassen.
»Hat Ihr Vater in Frankreich oder Spanien gedient?«, fragte sie leise. Bei dem Gedanken an Lascaux und Altamira wurde ihr fast schlecht. An deren Schätze hätte sich niemand herangewagt. Die Franzosen würden die {14}Guillotine wieder einführen für den, der es versuchte. Zu Recht. Lydia würde freiwillig das Fallbeil schärfen.
»Ja. Er hat in Frankreich gekämpft, 1944, zur Zeit der Invasion.« Er musterte sie aufmerksam und schlug kaum merklich einen etwas schärferen Ton an.
»Im Périgord etwa? In der Dordogne?« Unter der Lupe waren die Umrisse des Stieres deutlich ausgeprägt. Aus Ton, vermutete sie. Nicht mit Fingern gemalt, sondern mit einem farbigen Tonstück, das wie ein Bleistift angespitzt worden war. Um die Nackenmuskulatur darzustellen, hatte man eine dünne scheckige Schicht aufgetragen. Aber wie? Nachdenklich legte sie die Handknöchel an den Mund und versuchte sich an lange zurückliegende Vorlesungen zu erinnern. Ja, in diesem Fall war anscheinend die sogenannte Spuck- oder Blastechnik zur Anwendung gekommen. Verflüssigte Farbpigmente wurden in den Mund genommen und durch eine halbgeschlossene Faust spuckend aufgetragen. Die Platte schien aus Kalkstein zu bestehen. Lydia war keine Expertin für prähistorische Felszeichnungen, wusste aber, dass die Stierdarstellungen in den Höhlen von Lascaux zehn-, manchmal zwanzigmal größer waren als diese. Und sie war sich sicher: Eine Zeichnung wie diese war nie außerhalb ihrer Höhle vorgefunden worden. In keinem ihr bekannten Museum gab es ein Exponat solchen Formats. Wenn diese Felsplatte tatsächlich zur Lascaux-Kultur gehörte, war sie von unschätzbarem Wert. Unwillkürlich drängte sich ihr der Gedanke auf, dass dieses Stück womöglich ihre Karriere retten konnte. Falls sie es denn richtig anstellte, dachte sie. Andernfalls konnte ein Skandal das endgültige Aus für sie bedeuten.
{15}»Ja, ich glaube, er war in der Dordogne«, antwortete Manners. »Er gehörte einer Spezialeinheit an, die mit der französischen Résistance kooperiert hat. Im Sommer 1944, so um die Zeit der Landung der Alliierten in der Normandie, war er jedenfalls im Périgord. Er wurde später von den Franzosen mit der Ehrenlegion ausgezeichnet. Aber dieses Stück hier stammt doch nicht etwa aus Frankreich, oder?«
»Keine Ahnung«, erwiderte sie und spielte auf Zeit, um ihre Erregung unter Kontrolle zu bekommen. »Das lässt sich nachprüfen. Wenn es aus einer der französischen Höhlen stammt, könnte es tatsächlich siebzehntausend Jahre alt sein, vielleicht sogar älter. Jedenfalls wäre es im höchsten Grade sträflich, ein solches Artefakt auf den Markt zu bringen. Wir könnten es unmöglich veräußern.« Sie richtete sich auf und schaute Manners mit festem Blick ins Gesicht. Da war kein Blinzeln mehr in seinen Augen. Sie verrieten keinerlei Regung, was sie irritierte. »Es handelt sich eben nicht um ein einzelnes, bewegliches Kunstwerk. Diese Steinplatte wurde aus einem größeren Felsgemälde herausgebrochen, und das ist nicht nur nach kunsthistorischen Maßstäben, sondern wahrscheinlich auch juristisch ein Verbrechen.«
Er musterte sie schweigend, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, als wollte er zu einer Erwiderung ansetzen. Sie fand seine Selbstsicherheit sehr attraktiv und spürte, wie sie errötete. Sorgfältig wickelte er die Kordel, mit der das Paket verschnürt gewesen war, zu einem kleinen Strang, verknüpfte geschickt das lose Ende und warf ihn auf den Tisch. Dann faltete er ebenso sorgfältig das braune Packpapier zusammen, wischte sich die Hände mit einem sehr {16}sauberen Taschentuch, das er aus dem Ärmel seines Jacketts zog, und nahm schließlich selbst die Lupe zur Hand, um die Steinränder zu inspizieren. Er hatte sehr feingliedrige Hände.
»Wenn Sie den Stein jetzt wieder mit nach Hause nehmen und zurück aufs Bücherregal stellen, kann Ihnen niemand etwas anhaben«, sagte sie und fragte sich, ob diese Empfehlung dem Fremden gegenüber nicht deplatziert war. Natürlich wollte sie nicht, dass er mit dem Stein verschwände. Aber wenn er ihn bei ihr zurückließe, würde sie Meldung darüber machen müssen. Das Gespräch mit dem unangekündigten »Laufkunden« war plötzlich sehr kompliziert geworden. »Aber das sollten Sie lieber nicht tun. Nicht, weil Sie mit diesem Erbstück viel Geld machen könnten, sondern weil ich es einfach nicht richtig fände.«
»Ich kann doch nichts dafür. Ich hab das verdammte Ding doch nur geerbt«, erwiderte er. Er warf einen Blick auf den Stein und schaute sie dann wieder an. »Entschuldigung! Das mit dem verdammten Ding war natürlich nicht ernst gemeint. Im Gegenteil, es ist phantastisch. Das war mir schon als kleiner Junge bewusst. Ich bin früher immer ins Arbeitszimmer meines Vaters gegangen, um es mir anzusehen. Wenn ich anschließend draußen auf den Weiden war, habe ich mich oft gefragt, warum sich dieser auf Fels gezeichnete Stier wirklicher anfühlte als die Kühe, die ich zum Melken in den Stall treiben musste, auch wenn sie Butterblume oder Jenny gerufen wurden.« Er räusperte sich. »Wie lässt sich die Echtheit bestimmen? Mit einer Kohlenstoffdatierung?«
»Kohlenstoffdatierung funktioniert nur bei organischen {17}Materialien wie Tüchern oder Pflanzen. Das hier ist Fels«, antwortete sie knapp. »Ich müsste Experten konsultieren, ihnen Fotos schicken und nachprüfen, ob irgendwelche Höhlen mit Felszeichnungen mutwillig beschädigt wurden. Aber noch einmal: Wenn ich mich bezüglich Herkunft dieses Fragments nicht irre, so gibt es dafür keinen Markt. Es ist kein herkömmliches Stück präklassischer Kunst, sondern ein Artefakt aus der Steinzeit, aus den Anfängen der Menschheit. Die zuständigen Behörden sind sehr streng in solchen Sachen.« Mr Manners verzog keine Miene und schien ihre Entrüstung in keiner Weise zu teilen. »Stellen Sie sich vor, jemand würde eine der Steinstelen von Stonehenge verkaufen wollen«, fuhr sie fort in der Hoffnung, ihn mit dieser englischen Analogie überzeugen zu können. »Angenommen, Ihr Vater hat diesen Stein an sich genommen, möglicherweise aus dem Schutt einer eingestürzten Höhle – selbst dann würde ihm der französische Staat wohl nachträglich den Verdienstorden aberkennen.« Manners nickte, schien aber immer noch nicht wirklich zu begreifen. Stattdessen schaute er sie voller Bewunderung an, mit männlichem Interesse, was für sie alles noch heikler machte. Sie musste deutlicher werden. »Ich gehe davon aus, Sie sind in guter Absicht gekommen, um den Wert eines Kunstgegenstandes schätzen zu lassen. Aber ich muss Sie warnen. Wenn Sie ihn zu verkaufen versuchen, werden Sie in ernste Schwierigkeiten geraten. Anstelle eines warmen Geldregens erwartet Sie womöglich eine Gefängnisstrafe.«
»Verstehe, solche Sachen stehen also nicht zum Verkauf und erscheinen auch nicht auf Auktionen«, sagte er. »Und weil es keinen Markt dafür gibt, hat so etwas auch keinen {18}Wert. Ich besitze ein seltsames und anstößiges Erinnerungsstück und muss mich damit abfinden, dass mein Vater womöglich ein Schurke war.«
»Vor allem, glaube ich, haben Sie eine Verpflichtung«, entgegnete Lydia. »Wir sollten herausfinden, ob das Fragment echt ist und, wenn ja, woher es stammt. Vielleicht gibt es in irgendeiner der bekannten Felszeichnungen eine Leerstelle; auf Anhieb weiß ich das nicht. Wie auch immer, Ihr Erbstück gehört in ein Museum. Manchmal wird ein Finderlohn gezahlt, womit aber in diesem Fall nicht zu rechnen ist, weil wohl der Tatbestand der Sachbeschädigung vorliegt.«
Sie betrachtete wieder das Fragment und bemerkte, wie der Kiefer des Tieres und eines der Hörner der natürlichen Struktur der Gesteinsoberfläche angepasst waren und da-mit den Eindruck lebendiger Plastizität vermittelten. An der Stelle, wo Kiefer und Hals ineinander übergingen, waren die Umrisse verwischt, was Bewegung suggerierte. Lydia war selbst noch nicht in der echten Höhle von Lascaux gewesen, nur in der nachgebildeten, die der französische Staat hatte anfertigen lassen, weil die zahllosen Touristen und deren Atemluft das Original zu beschädigen drohten. Aber sie erinnerte sich an diesen Trick der verwischten Kontur zur Darstellung von Bewegung und daran, wie die prähistorischen Künstler ihre Zeichnungen der Oberfläche des Steins anzupassen versucht hatten. Wenn es sich bei dem Stier um eine Fälschung handelte, so war es eine bemerkenswert gute.
»Was schlagen Sie vor? Soll ich den Stier tatsächlich wieder mit nach Wiltshire nehmen und aufs Regal stellen?«
{19}»Nein«, antwortete Lydia entschieden. »Ich schlage vor, sie lassen ihn hier bei mir. Ich stelle Ihnen eine Empfangsbestätigung aus und werde einen oder zwei Experten zu Rate ziehen. 1944, als Ihr Vater den Stein gefunden hat, kannte man nur einige wenige bemalte Höhlen. Auch die von Lascaux war erst 1940 entdeckt worden. Falls Ihr Erbstück aus dieser Region oder aus den spanischen Höhlen von Altamira stammt, haben wir relativ schnell Gewissheit. Wenn nicht, müssen wir die Frage nach dem Ursprung neu aufrollen. Stilistisch passt es zu Lascaux, und damit hätte Ihr Vater recht, was die Entstehungszeit anbelangt. Aber selbst wenn das Fragment aus einer ganz anderen Gegend stammt, werden Sie es wohl kaum verkaufen können, jedenfalls nicht offiziell.«
»Wie lange wird es dauern, bis wir Klarheit haben?«, fragte er. »Oder, anders gefragt, wie lange werden Sie den Stein behalten wollen?«
»Ich werde ein paar Digitalfotos davon machen und sie per E-Mail den besagten Experten zukommen lassen. Eine Antwort könnte schon in ein, zwei Tagen vorliegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich auch einen Experten für die Ahaggar-Gemälde zurate ziehen und noch ein paar weitere Möglichkeiten erwägen. Ich selbst weiß nur wenig über das Leben der Cro-Magnon-Menschen, kenne aber Leute, die sich damit auskennen.«
»Cro-Magnon? War das nicht dieser Urmensch mit der fliehenden Stirn und den wulstigen Brauen, der Missing Link zu den Primaten?«
»Nein, der Cro-Magnon-Mensch war uns schon sehr ähnlich, was Schädelform und Gehirnvolumen angeht, und {20}mit seinen Höhlenmalereien hat er uns ein erstes Zeugnis menschlicher Kultur hinterlassen. Die fliehende Stirn hatte der Neandertaler. Er wurde von den Cro-Magnon-Menschen verdrängt – wie, wissen wir noch nicht so genau. Aber selbst dessen Gehirnvolumen war so groß wie unseres, sogar größer, wenn ich mich recht erinnere. Vieles spricht dafür, dass sich Neandertaler und Cro-Magnon-Mensch vermischt haben.« Lydia bemerkte, dass sie beim Sprechen eine Locke um den Finger wickelte, ein nervöser Tick von ihr, der auch Manners aufzufallen schien. Sie senkte den Arm und fuhr hastig fort: »Was ist Ihnen lieber? Dass Sie den Stein hierlassen und eine Quittung dafür bekommen oder wieder mit nach Hause nehmen? Auf alle Fälle möchte ich ein Foto davon machen, wenn Sie einverstanden sind.«
Manners setzte sich lässig auf den Tischrand. Zum ersten Mal ging ein Lächeln über sein Gesicht. Ein offenes, freundliches Lächeln. »Aber warum machen Sie sich so viel Umstände, wenn Sie das Stück am Ende doch nicht für mich verkaufen können? Warum schicken Sie mich nicht gleich in ein Museum und sparen sich die Mühe?«
»Vielleicht sollte ich das«, antwortete sie und erwiderte sein Lächeln, charmant und sehr professionell. »Aber weil Sie mich damit aufgesucht haben, fühle ich mich jetzt irgendwie dafür verantwortlich. Und wenn es tatsächlich aus einer Felswand herausgebrochen wurde, sollten wir es zurückgeben.«
»Finden Sie, dass das ebenso für ägyptische Tempelstatuen gilt und dass auch die Elgin Marbles von der Akropolis an Griechenland zurückgegeben werden sollten?« Seine Frage klang neugierig, nicht provozierend.
{21}»Das ist etwas anderes. Die Elgin Marbles wurden rechtmäßig erworben und waren damals, als sie exportiert wurden, im Britischen Museum besser aufgehoben als in Athen. In unserem Fall aber hat wahrscheinlich die Politik ein gewichtiges Wort mitzureden, das alle konservatorischen oder künstlerischen Argumente überwiegt. In meinen beruflichen Kreisen gilt die Regel: Aus Grabstätten, Tempelanlagen oder auch aus einer Höhle geraubte Artefakte sind für den Handel tabu und müssen den zuständigen Behörden gemeldet werden. Hehlerei steht unter Strafe, und danach hat sich auch der Kunstbetrieb zu richten. Ganz davon abgesehen gibt es hier ja auch noch ein paar moralische Bedenken«, sagte sie und deutete auf das Fragment.
»Denken Ihre Kollegen in anderen Auktionshäusern gleich wie Sie? Oder haben Sie sich die amerikanische Haltung zu eigen gemacht, nämlich die Angst vor drohenden Strafprozessen?«
»Ich kann nur hoffen, dass meine Kollegen genauso denken, auf beiden Seiten des Atlantiks. Es geht nicht einfach um drohende Strafprozesse, sondern um fairen Handel«, entgegnete sie schnippisch, und plötzlich beschlich sie der Verdacht, dass das Ganze womöglich von ihren Vorgesetzten inszeniert worden war, um ihr auf den Zahn zu fühlen. »Wollen Sie nun eine Quittung, ja oder nein?«
»Ja, ich bitte darum«, antwortete er. »Übrigens werde ich am Freitag wieder in der Stadt sein. Würden Sie mit mir zu Mittag essen?« Er lächelte wieder. »Sie waren mir überaus behilflich, und ich möchte mich gern erkenntlich zeigen.«
»Freitags haben wir leider immer sehr viel zu tun«, antwortete sie fast automatisch und holte einen {22}Quittungsblock und einen Kugelschreiber aus der Schublade. »Aber ich erwarte Sie gerne hier um zwölf. Schreiben Sie mir doch bitte Ihre Telefonnummer auf, damit ich Sie auf dem Laufenden halten kann, falls ich schon vorher zuverlässige Informationen habe.«
Lydia machte ein Dutzend Fotos von dem Fragment, wog es und nahm seine Maße, bevor sie den Hausmeister bat, den Stein nach oben in ihr Büro zu bringen. Per E-Mail schickte sie dann die Fotos an Professor Horst Vogelstern in Köln und an das Musée National de Préhistoire in Les Eyzies, in der Dordogne, dem Herzen der französischen Höhlenregion. Es war von Denis Peyrony gegründet worden, dem französischen Spezialisten für Ur- und Frühgeschichte, der als Erster das Panneau der Pferde in der Höhle von Font-de-Gaume identifiziert hatte. Inzwischen war das Museum als Zentrum für die Erforschung der frühen Menschheit weltweit bekannt. Sie adressierte die E-Mail an Clothilde Daunier, eine Kuratorin, die Expertin für Lascaux und die anderen Höhlen in der Umgebung. Lydia kannte sie nur vom Hörensagen. Horst Vogelstern hingegen, eine führende Autorität in Sachen prähistorischer Kunst, kannte sie persönlich; sie hatte ihn bei einem Empfang im Anschluss an einen Vortrag am Courtauld-Institut, wo sie studiert hatte, kennengelernt. Aus Höflichkeit schickte Lydia auch eine E-Mail an ihren alten Professor am Ashmolean Museum in Oxford, der zwar auf einem anderen Forschungsgebiet tätig war, aber immerhin interessiert sein würde. Zumindest würde er definitiv bestätigen können, dass das Fragment nicht aus Afrika stammte. Sie erwog auch kurz, {23}ehemalige Kommilitonen zu benachrichtigen, von denen sie wusste, dass sie mit Höhlenmalereien befasst waren – darunter ein langweiliger Ire, der jetzt in Australien lehrte, und ein unerträglicher Kerl aus Kalifornien, der sich auf Paläoarchäologie spezialisiert hatte –, verwarf den Gedanken jedoch gleich wieder. Es hatte keinen Sinn, an alte Verbindungen anzuknüpfen. Sie nahm zwei Bücher aus dem Regal – Ann Sievekings The Cave Artists und André Leroi-Gourhans Dawn of European Art – und vertiefte sich darin, bis der Nachtwächter sie gegen zehn an die Zeit erinnerte. Weil sie unbedingt noch einmal einen Blick auf das Fragment werfen wollte, ging sie nach oben in ihr kleines Büro, begleitet von dem freundlichen Nachtwächter, einem ehemaligen Soldaten, mit einem kunstvoll gezwirbelten weißen Schnurrbart.
»Soll ich Ihnen das Ding ins Lager bringen, Miss?«, fragte er. Er musterte die Scherbe. »Ist wohl was Besonderes, stimmt’s?«
»Ich glaube, ja, Mr Woodley. Vermutlich was ganz Besonderes.« Sie fühlte sich wohl in Gesellschaft des alten Mannes und lächelte.
»Erstaunlich, wie Sie an solchen Sachen feststellen, ob sie echt sind oder nicht«, sagte er und drehte die Schreibtischlampe, um ihr Licht auf den Stein strahlen zu lassen. »Scheint ziemlich alt zu sein.«
»An die siebzehntausend Jahre, wenn ich richtig liege.«
»Donnerwetter! Tja, dass es vor den alten Griechen auch schon Kunst gab, verwundert einfach immer wieder. Nun, diese Zeichnung da hat jedenfalls meinen ganz persönlichen Test bestanden, Miss.«
»Wie meinen Sie das, Mr Woodley?«
{24}»Ich spür’s halt. In der ersten Woche meiner Anstellung hier wurde ein Rembrandt gebracht, und da bekam ich dieses Kribbeln auf der Haut. Das werde ich nie vergessen. Mit Kunst hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel im Sinn. Bin einfach selten damit in Berührung gekommen. Aber, wie gesagt, da hatte ich plötzlich dieses Kribbeln. So war es auch bei dem El Greco im letzten Jahr, und jetzt habe ich es wieder.« Staunend schüttelte er den Kopf. »Siebzehntausend Jahre. Kaum vorstellbar. Ich glaube, genau das macht uns zu Menschen: dass wir Kunstwerke erschaffen.«
Schweigend betrachteten beide den Stein, beeindruckt von der Kraft des urtümlichen Tieres und voller Bewunderung für den Geist, das Auge und die Hände dessen, der etwas geschaffen hatte, das stärker war als das Leben selbst. Diese Hörner konnten töten, diese Lenden zeugen, diese Beine angreifen. Der Hausmeister hatte so recht mit seinem Gespür, dachte sie. Was für ein wildes, kraftstrotzendes Tier und dabei keine dreißig Quadratzentimeter groß! Sie glaubte, Schrecken und Angst jenes fernen Vorfahren nachfühlen zu können, der ihm mit Speer oder Steinaxt gegenübergetreten war. Indem er den Stier so prächtig darstellte, hatte der Künstler auch dem frühen Menschen, der Jagd auf ihn machte, ein Denkmal gesetzt.
»Sie haben recht, Mr Woodley«, sagte sie leise und dachte daran, wie töricht der Gedanke von ihr gewesen war, einen Beruf aufzugeben, der solche Momente gewährte. »Genau das macht uns zu Menschen.«
»Ich passe auf das gute Stück für Sie auf, Miss. Im Lager ist es sicher. Und Sie sollten jetzt besser nach Hause gehen.«
{25}Sie fuhr mit der U-Bahn nach Fulham in ihre kleine Wohnung und dachte, als sie die Tür öffnete, an die große Höhle von Lascaux. Anstelle der langweilig gewordenen Monet-Reproduktion, die sie begrüßte, hätte sie jetzt viel lieber ein Poster jener Stiere von Lascaux an der Wand hängen gehabt. Sie mochte ihre Wohnung nicht besonders, zumal die Miete unverschämt hoch war. Trotzdem hatte sie sich zur Pflicht gemacht, das Wohnzimmer und die Küche immer aufgeräumt zu hinterlassen. Der Kaffeebecher und das Saftglas standen abgewaschen auf dem Abtropfbord. Sie schaltete das Radio ein, hörte wie immer Classic FM und versuchte, als sie das Geschirr wegstellte, das Musikstück zu identifizieren, gespielt von irgendeinem Ensemble für Barockmusik. Sie gab auf. Ihr Vater hätte sich wahrscheinlich für sie geschämt, denn er hatte sie von frühester Kindheit an mit Musik vertraut gemacht. Im Unterschied zu den anderen Zimmern war das kleine Schlafzimmer völlig unaufgeräumt. Sie warf Strumpfhosen, Jeans, T-Shirts und Bettwäsche auf einen großen Haufen und brachte sie nach unten in den gemeinschaftlich genutzten Waschraum im Keller des umgebauten alten Hauses. Ihr blieben fünfunddreißig Minuten, bevor die Wäsche in den Trockner gepackt werden müsste. Was tun? Fernsehen, essen? Im Kühlschrank waren nur Ketchup, eine Flasche Wein, zwei Flaschen Mineralwasser, etwas Joghurt und eine verschrumpelte Zitrone. Es wurde langsam Zeit, dass sie ihren Alltag besser plante.
Lydia aß Joghurt, beschloss dann, die Wäsche erst am nächsten Morgen in den Trockner zu tun, und ging zu Bett. Ohne einen Blick in ihre Bettlektüre Die Hethiter geworfen {26}zu haben, machte sie die Augen zu und war wenig später eingeschlafen. Ihr letzter Gedanke galt der Zeit in ihren eigenartigen Abläufen. Die ältesten Höhlenmalereien, nämlich die in der Grotte de Villars, waren von dem legendären Prähistoriker Abbé Breuil auf ein Alter von rund dreißigtausend Jahren geschätzt worden. Die C-14-Datierung der in der Höhle von Lascaux gefundenen Holzkohle ließ darauf schließen, dass die großen Gemälde dort etwa siebzehntausend Jahre alt waren, also fünfzehntausend Jahre vor Christus. Sie hatte sich immer noch nicht an die inzwischen übliche Bezeichnung »v.u.Z.« gewöhnen können. Vor unserer Zeitrechnung. Es hatten demnach schon weitere fünfzehntausend Jahre vor Lascaux Menschen in den Tälern der Vézère und Dordogne gelebt, gejagt, Höhlenwände bemalt und fortgesetzt, was ihre Vorfahren begonnen hatten. Irgendwann musste es dann zu einem wahren Ausbruch von Talent und Genie gekommen sein, die die bewundernswerten Leistungen von Lascaux ins Werk gesetzt und die Entwicklung der Menschheit über die nächsten siebzehntausend Jahre eingeleitet hatten. Die Menschen betrieben Ackerbau, schmiedeten Eisen, gründeten Städte, bauten Schiffe und lernten, politisch zu denken. Alles veränderte sich, und das Leben schien einen Gang zuzulegen. Wie in einem Video im Schnellvorlauf, dachte Lydia. Eine Zeitrechnung vor und nach Lascaux – »v.L.« beziehungsweise »n.L.« – erschien ihr durchaus sinnvoll. Vor und nach dem Aufkommen von Kunst.
Die erste Antwort auf Lydias E-Mails kam am nächsten Morgen, als sie an ihrem Schreibtisch Kaffee trank und sich {27}detaillierte Notizen über den Stein machte, der neben ihr auf einem Stuhl thronte. Abgesehen von Gewicht und Abmessungen, den Farben und Formen gab es nicht viel zu sagen. Jedenfalls nichts, was sich in einfache Worte hätte kleiden lassen. Der Stier war schwarz und dunkelrot, mit Schattierungen in gedämpftem Rot und Gelb, die ihn gleichsam modellierten. Weitere Linien deuteten darauf hin, dass sich die Zeichnung über die Ränder des Fragments hinaus fortsetzte, ließen aber offen, was sie darstellen mochten. Dann war da noch eine durch drei Punkte und einen halb hingetupften vierten angedeutete, wie mit dem Lineal gezogene Linie. Lydias flüchtigen Studien am Vorabend nach waren solche Muster bislang nur in Lascaux gefunden worden, nirgendwo sonst. Doch es gab keinerlei Hinweise auf Beschädigungen in den Höhlen von Lascaux, keine Lücke, in die das Manners-Fragment hineingepasst hätte.
Auf ihrem Stuhl zurückgelehnt, ließ die junge Frau die Abbildung auf sich wirken und versuchte sich ein Urteil über den künstlerischen Wert der Zeichnung zu bilden, ohne sich von deren Alter beeindrucken zu lassen. Plötzlich klingelte das Telefon. Sie erkannte Horst an seiner Stimme. Sein Englisch war ebenso flüssig und fehlerfrei wie ihres und verriet nur einen leichten deutschen Akzent. Horst erkundigte sich nach ihrem Befinden und klang sehr viel freundlicher, als es ihre frühere Plauderei am Abend eines Empfangs hätte erwarten lassen. Aber schon bald ließ er durchblicken, dass er von den Fotos fasziniert war.
Ja, das Fragment sei noch in ihrem Besitz, auf ihrem Schreibtisch, sagte sie ihm. Nein, vom Museum in Les Eyzies habe sie noch nichts gehört, aber sie vermute, dass {28}der Stein von Lascaux stamme, auch wenn er so klein sei. Nein, ihr Auktionshaus werde ihn nicht zum Verkauf anbieten, sondern lediglich Echtheit und Herkunft zu klären versuchen.
»Ich weiß, woher er kommt«, sagte Horst, »nämlich tatsächlich von Lascaux. Der Stil und die Details sind unverkennbar. Ungewöhnlich ist nur die Größe. Eine so kleine Stierdarstellung habe ich dort noch nicht gesehen. Es könnte also sein, dass jemand eine weitere Höhle gefunden hat mit Zeichnungen im Stil der Kunst von Lascaux. Aber wieso wendet sich dieser Jemand an ein Auktionshaus? Es dürfte doch allgemein bekannt sein, dass ein solcher Stein nicht verkauft werden kann. Wer ist die Person, die bei Ihnen war? Was wissen Sie über diesen Mann?«
Sie beschrieb Manners und berichtete, dass der Stein aus dem Nachlass seines Vaters stammte, der 1944 möglicherweise als Soldat im Périgord stationiert gewesen war. »Anscheinend versteht er nicht viel von Höhlenmalerei«, fügte sie hinzu. »Er hatte jedenfalls kein Problem damit, dass ich den Stein aufbewahre und Erkundigungen einhole. Im Übrigen macht er einen durchaus seriösen Eindruck auf mich. Ich glaube kaum, dass er aus geplünderten Kunstschätzen Geld zu schlagen versucht. Wie dem auch sei, ich kann ihn weiter befragen, wenn ich ihn wiedersehe – er kommt am Freitag wieder vorbei, um zu hören, was wir herausgefunden haben.«
»Ich würde gern dazukommen und ihn kennenlernen«, sagte Horst, der in seinem Kalender zu blättern schien, denn es raschelte in der Leitung. »Ich könnte ein Seminar und zwei Sprechstunden verlegen und am Donnerstag den {29}Flieger nehmen, um Sie rechtzeitig zum Abendessen einzuladen. Bis dahin werden wir von Les Eyzies gehört haben, was man dort von dem Stein hält.«
»Ich habe gerade meine Agenda nicht zur Hand und weiß nicht, ob ich am Donnerstag Zeit habe«, beeilte sie sich zu antworten. »Vielleicht warten wir besser ab, was Les Eyzies sagt.«
»Ich möchte mir die Gelegenheit, den Stein zu sehen, nicht entgehen lassen. Freitagmorgen wäre vermutlich meine letzte Chance, bevor dieser mysteriöse Fremde zurückkommt und ihn wieder mitnimmt. Ich rufe Sie wieder an, sobald sich Clothilde bei mir gemeldet hat.«
Eine Stunde später hatte Lydia die Französin am Apparat. Sie war förmlicher und sehr viel vorsichtiger als Horst. Anhand der Fotos, sagte sie, sei für sie nicht zu erkennen, ob es sich um ein Fragment von Lascaux handeln könnte; es wäre jedenfalls sehr interessant. Nein, aus einer anderen bekannten Höhle sei es bestimmt nicht. Es gebe zwar etliche, die an vielen Stellen beschädigt seien, aber das fragliche Stück passe nirgendwohin. Dann wollte sie noch wissen, ob Lydia oder ihr Haus irgendjemand anderen darüber informiert hatte.
»Nur Horst Vogelstern in Köln und Professor Willoughby in Oxford«, antwortete Lydia. »Horst hat mich vorhin angerufen und in Erwägung gezogen, dass der Stein vielleicht aus einer noch unbekannten Höhle stammen könnte. Was wir hier haben, begeistert ihn offenbar sehr. Er will kommen und sich den Stein ansehen, bevor der Besitzer am Freitag zurückkehrt.«
»Typisch Horst«, schnaubte Clothilde. »Er will {30}unbedingt einen großen Coup landen und berühmt werden. Wussten Sie, dass er Sponsoren sucht für eine Fernsehserie über prähistorische Kunst? Die Entdeckung einer neuen Höhle wäre ein gefundenes Fressen für ihn. Er hätte dann wahrscheinlich seine eigene TV-Show, könnte einen Bestseller schreiben und reich werden. Horst ist ein tüchtiger Wissenschaftler, aber manchmal ein bisschen zu ehrgeizig und versponnen.«
»Sie scheinen ihn gut zu kennen«, entgegnete Lydia, überrascht von Clothildes Bemerkungen, die auf ein sehr persönliches Verhältnis schließen ließen.
»Allerdings«, platzte es aus Clothilde heraus. Fast entschuldigend und so, als wäre sie Lydia eine Erklärung schuldig, fuhr sie fort: »Wir haben hier in Les Eyzies zwei Jahre sehr eng zusammengearbeitet. Wir waren glücklich miteinander, aber das ist jetzt vorbei. Wie’s halt so kommt.«
Lydia konnte es ihr nachfühlen. Die Sache mit David lag kaum ein Jahr zurück.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Ich wollte nicht indiskret sein. Wenn Ihnen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unangenehm ist, werde ich Horst mitteilen, dass ich, was diesen Fund betrifft, alles Weitere Ihnen und Ihrem Museum überlasse.«
»Ach was. Horst und ich sind inzwischen gute Freunde und Kollegen. Ich wollte nur ein bisschen Vorsicht anmahnen, weil er unbedingt auftrumpfen und groß herauskommen möchte und deshalb zu vorschnellen Urteilen neigt. Wahrscheinlich redet er sich schon eine neue Höhle ein, obwohl noch nicht einmal die bekannten vollständig ausgewertet sind. Es hat Jahre gedauert, bis die richtigen Leute {31}mit der richtigen Beleuchtung vor Ort waren und die Malereien an den Wänden entdeckt haben. Unsere Höhlen hier sind sehr groß, Lydia. Durch die in Rouffignac kann man sogar auf Schienen fahren, und es sind gerade einmal vierzig Jahre vergangen, seit an den Wänden unter den Graffiti, die von Touristen eingeritzt worden sind, unsere Kunstschätze freigelegt werden konnten.« Clothilde legte eine kurze Pause ein. »Aber was viel wichtiger ist: Sie dürfen nicht zulassen, dass der Besitzer den Stein wieder mitnimmt. Womöglich würden wir ihn nie mehr zu Gesicht bekommen. Er ist nationales Kulturgut, verstehen Sie? Wie Ihre Kronjuwelen und der Tower of London.«
»Es sind nicht meine Kronjuwelen. Ich bin Amerikanerin.«
»Na schön, dann eben wie Ihre Verfassung oder das Haus von George Washington. Es sind die ältesten Dinge, die uns zu dem machen, was wir sind. Dieser Stein gehört Frankreich. Vielleicht sollte ich mir einen Gerichtsbeschluss besorgen und ihn beschlagnahmen lassen.«
»Sie scheinen von seiner Echtheit überzeugt zu sein und davon, dass er aus Ihrer Gegend kommt«, meinte Lydia erstaunt. »Ist das nicht auch ein bisschen vorschnell geurteilt? Wie auch immer, der Besitzer war nicht abgeneigt, mir den Stein zu überlassen – auch dann nicht, als ich ihm sagte, dass es meine Pflicht sei, seine Herkunft ausfindig zu machen und dahin zurückzuführen.«
»Wer weiß, vielleicht ändert er seine Meinung. Wir müssen klar Stellung beziehen. Ich würde gern noch diese Woche nach London kommen, den Stein in Augenschein nehmen und unserer Botschaft ein Rechtsersuchen vorlegen. {32}Wir werden von uns aus das Kultus- und Außenministerium in Paris kontaktieren. Keiner hier im Museum weiß genau, wie in solchen Sachen verfahren werden muss.«
»Ich finde, Sie sollten sich erst einmal beruhigen«, sagte Lydia. »Mir scheint, Sie unterstellen irgendwelche kriminellen Absichten, dabei handelt der gegenwärtige Besitzer in treuem Glauben. Wenn sich herausstellt, dass der Stein nicht gestohlen wurde, werden wohl keine rechtlichen Schritte in Betracht kommen. Wir sollten uns erst einmal über die Gesetzeslage informieren und uns dann weiter über den Fall unterhalten.«
»Ist mir recht«, entgegnete Clothilde. »Trotzdem werden wir die zuständigen Behörden einschalten müssen. Und dann meldet sich bestimmt auch die Politik bald zu Wort. Unser Präsident kommt aus dem hiesigen Teil Frankreichs und ist an Lascaux persönlich sehr interessiert. Nun, wie Sie schon sagten, wir sollten abwarten und zusehen, was von offizieller Seite kommt. Jedenfalls würde ich morgen gern nach London kommen und den Stein sehen. Die Fotos lassen eine ernsthafte Einschätzung nicht zu. Ich könnte die erste Maschine von Périgueux nach Paris nehmen und noch vor Mittag in Ihrem Büro sein. Wären Sie damit einverstanden?«
Natürlich war sie das. Doch dann fragte sich Lydia, wie sie ihrem Vorstand, dem Justiziar und wahrscheinlich auch den beiden Direktoren die internationalen Verwicklungen erklären sollte, die sie heraufbeschworen hatte. Das ganze Aufsehen würde sich für das Haus nicht im Geringsten bezahlt machen. Im Gegenteil, womöglich musste es draufzahlen. Ein Verkauf war nicht in Sicht, nur Ärger. Und das {33}bestätigte ihr auch der Justiziar am Telefon in einem Gespräch, das keine zehn Minuten dauerte.
Sie stand von ihrem Schreibtisch auf und hielt inne. So nicht. Sie sollte lieber an die positiven Möglichkeiten denken. Was hatte Clothilde über Horst gesagt? Dass die Entdeckung einer noch unbekannten Höhle der Durchbruch für ihn wäre? Vielleicht könnten auch sie und das Auktionshaus davon profitieren. Schließlich war sie diejenige, die das Fragment als Erste identifiziert und mit Lascaux-Kunst in Zusammenhang gebracht hatte. Sie wollte schon bei der Pressestelle anrufen, zögerte dann aber. Das Fragment gehörte Manners. Ihm müsste sie wenigstens vorher Bescheid geben. Auf der Visitenkarte, die er ihr gegeben hatte, stand eine Nummer, unter der sie ihn jedoch nicht erreichen konnte. Seine Londoner Adresse war die des Cavalry-Clubs. Als sie dort anrief, wurde sie um etwas Geduld gebeten; Major Manners sei in der Bar, man werde ihn an den Apparat holen. Er schien sich zu freuen, ihre Stimme zu hören.
»Ihr Stein hat große Anziehungskraft«, sagte sie. »Zwei der namhaftesten Experten, denen ich die Fotos zugesandt habe, wollen noch diese Woche nach London kommen, um ihn sich anzusehen. Beide glauben, dass er so alt ist wie die Höhlenmalereien von Lascaux. Einer vermutet, er könnte aus einer noch nicht entdeckten Höhle stammen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass er aus einer bekannten Höhle stammt, die noch nicht vollständig erforscht worden ist. Auf jeden Fall werden die französischen Behörden darauf pochen, dass Sie den Stein zurückgeben, weil er wahrscheinlich Teil des französischen Kulturgutes ist.«
{34}»Sie waren sehr schnell, Miss Dean. Dafür bin ich Ihnen dankbar, und ich hoffe, ich darf mich mit meiner Einladung zum Mittagessen revanchieren. Habe ich richtig gehört? Als Sie sagten, die französischen Behörden pochten auf Rückgabe, hat es so geklungen, als wollten Sie mir Angst machen.«
»Jedenfalls hat das Museum von Les Eyzies bereits das französische Kultusministerium informiert, und dort wird jetzt die Rechtslage sondiert. Zuerst wird festgestellt werden müssen, ob Ihr Stein tatsächlich aus Frankreich kommt. Auch wenn daran kein Zweifel mehr zu bestehen scheint, bleibt diese Frage so lange offen, bis die Höhle identifiziert ist, aus der er stammt. Darüber hinaus muss geklärt werden, ob er widerrechtlich außer Landes gebracht wurde. 1944, also in dem Jahr, als sich Ihr Vater in Frankreich aufgehalten hat, gab es noch kein gesetzliches Verbot für die Ausfuhr von Kulturgütern. Das Gebiet der Dordogne wurde von den Deutschen kontrolliert. Deshalb werden wohl die meisten Gerichte zu der Auffassung kommen, dass das Souvenir Ihres Vaters legitime Kriegsbeute beziehungsweise Eigentum der britischen Armee ist. Der Justiziar unseres Hauses weiß auch nicht weiter. Die Eigentumsrechte werden wohl nicht eindeutig geklärt werden können. Es liegt also wahrscheinlich in Ihrer Hand, was nun mit dem Stein geschieht. Jedenfalls wird Ihnen niemand einen Vorwurf machen können.«
»Brauche ich einen Anwalt?«
»Vielleicht. Wenn Sie an Ihrem Erbstück festhalten wollen, könnte Sie das im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung womöglich teuer zu stehen kommen. Aber {35}vielleicht lässt sich ein Vergleich aushandeln. Unser Haus würde sich für Sie starkmachen. Abgesehen davon wird sich wohl auch der französische Staat ausrechnen können, dass ein Gerichtsverfahren in dieser rechtlich vagen Angelegenheit letztlich teurer werden würde als die Zahlung eines Finderlohns oder Honorars.«
»In welcher Höhe etwa?«
»Auch das ließe sich aushandeln. Wenn die Echtheit des Fragments erwiesen ist und Frankreich es zurückhaben will, könnten vielleicht an die zehntausend Pfund herausspringen. Vielleicht sogar mehr.«
»Und wie hoch wäre Ihre Provision?«
»Der Standardsatz beträgt zwanzig Prozent. Aber die stehen nicht mir, sondern dem Haus zu. Es ist dessen Expertise, die Sie bezahlen müssten.«
»Und wenn ich mich von einem Agenten vertreten ließe?«
»Auch dann fallen zwanzig Prozent an. Ich könnte Ihnen ein paar gute unabhängige Agenten empfehlen.«
»Ich hätte da bereits jemanden im Auge. Nämlich Sie, Miss Dean. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit den frogs. Je mehr sie springen lassen, desto besser. Wie wär’s jetzt mit einem gemeinsamen Mittagessen?«
»Danke, aber wahrscheinlich nicht mehr diese Woche, die wohl noch ziemlich hektisch werden wird. Außerdem kann ich nicht so einfach meine Firma ausklammern und auf eigene Faust für Sie aktiv werden. So funktioniert das nicht. Eine andere Frage noch: Wie kämen Sie mit öffentlicher Aufmerksamkeit zurecht? Ich glaube, das könnte helfen. Sensationeller Fund, britischer Kriegsheld, so was {36}in der Art. Da wir beide wünschen, dass der Stein nach Frankreich zurückkehrt, gilt es jetzt, den Preis in die Höhe zu treiben, und dazu könnten die Medien einiges beitragen.«
»Von mir aus gern. Die Sache liegt ganz in Ihren charmanten Händen, Miss Dean. Passen Sie gut auf den alten Stein auf, und holen Sie das Beste für mich heraus. Wir sehen uns dann am Freitag um zwölf, und vielleicht sind dann ja auch Ihre europäischen Experten da.«
Lydia rief den Hausmeister an mit der Bitte, den Stein in den Tresor zu schließen, füllte den erforderlichen Depotbeleg aus und trug an der Stelle, die nach dem Schätzwert fragte, mutig »zehntausend Pfund« ein. Sie überwachte den Abtransport, zeichnete ab und suchte, zuversichtlich wie schon seit Wochen nicht mehr, Justin in seinem Büro auf. Ohne anzuklopfen, trat sie ein und informierte ihn darüber, dass sie womöglich den gewünschten Medienhype bieten konnte. Nach einer geschäftigen halben Stunde mit Justin, einem Anwalt, dem Pressesprecher und beiden Direktoren, die anschließend unbedingt den Stein sehen wollten, verabschiedete sich Lydia und kehrte unverzüglich in ihr Büro zurück, um sich mit dem Kunstkorrespondenten der Times in Verbindung zu setzen.
Clothilde Daunier war kaum größer als eins sechzig, abzüglich des fast zehn Zentimeter hohen Aufbaus ihrer kastanienbraunen Haare, die so kunstvoll nachlässig in Fasson gebracht waren, wie es nur ein teurer Friseur vermochte. Dazu passte bestens, was sie anhatte. Sie hatte eine lebhafte Art, ein breites Grinsen, und Lydia fand sie auf Anhieb {37}sympathisch, wobei sie auf ihre Kleidung ein bisschen neidisch war.
»Ich dachte schon, Sie brächten den französischen Botschafter, die Fremdenlegion und die halbe Anwaltschaft von Paris mit«, sagte Lydia und schenkte Kaffee ein. Sie war gut gelaunt und freundlich gestimmt nach den vielen Komplimenten, die sie am Vormittag von ihren Kollegen gehört hatte. Einer der Direktoren war sogar zu ihr ins Büro unterm Dach gekommen, um sie persönlich zu ihrer vorzüglichen PR-Arbeit zu beglückwünschen.
»Sie wären wohl alle gern mitgekommen«, lachte Clothilde und kramte in einer tiefen Hermès-Tasche, aus der sie dann eine Weinflasche und ein kleines, mit Gummi versiegeltes Einmachglas hervorholte. »Für Sie, foie gras aus dem Périgord und dazu eine Flasche Monbazillac. Vergessen Sie Ihre englischen Regeln, wonach süße Weine als Aperitif gereicht werden, und trinken Sie diesen Tropfen leicht gekühlt zur Stopfleber.«
Sie setzte sich, entnahm der Tasche auch noch einen dünnen Aktenordner mit Fotos und Fotokopien und steckte sich eine Marlboro an, ehe Lydia auf das im Haus geltende Rauchverbot hinweisen konnte. »Wussten Sie, dass ich mit Monique Peytral zusammengearbeitet habe, der Künstlerin, die die Gemälde von Lascaux rekonstruiert hat?« Lydia schüttelte den Kopf. Sie wusste nur, dass die Höhle eins zu eins nachgebaut worden war, um die Originalzeichnungen vor schädlichen Mikroben und dem Kohlendioxid der Atemluft unzähliger Touristen zu schützen.
»Ich war technische Beraterin bei der Nachgestaltung des Saals der Stiere und des axialen Seitengangs. Wir haben so {38}gute Arbeit geleistet, dass den meisten Touristen gar nicht bewusst ist, vor Kopien zu stehen. Mit anderen Worten, ich kenne Lascaux in- und auswendig. Darum weiß ich mit Sicherheit, dass Ihr Stier ein Lascaux-Stier ist. Was Sie als Punktreihe beschreiben, ist ein ganz typisches Muster. Ihr Fragment geht mit größter Wahrscheinlichkeit auf Künstler aus Lascaux zurück. Darauf würde ich sogar jede Wette eingehen, wenn der Stier nicht so klein wäre. Keine Ahnung, woher er kommt. Wir haben die Höhle aufs Gründlichste untersucht und kennen jede Stelle. Wäre ein Stück aus den Wänden herausgebrochen worden, wüssten wir es. Es könnte sich also um eine Kopie handeln, so wie die von Monique. Vielleicht hat auch Horst recht mit der Vermutung, dass es aus einer noch unbekannten Höhle stammt. Das wäre sensationell. Möglich auch, dass der Stein aus einer der bekannten Höhlen aus der Umgebung herkommt, was weniger sensationell und nur für einige wenige Forscher von Interesse wäre. Falls das Fragment ursprünglich Teil einer größeren Wandzeichnung war, müsste es eine Höhle geben, von der wir noch nichts wissen. Alles ist möglich, aber zuerst muss ich es sehen.«
Lydia rief den Hausmeister an, bat ihn, den Stein nach oben zu bringen, und reichte Clothilde die aktuelle Ausgabe der Times. Auf der ersten Seite wies ein kleiner Aufmacher auf einen größeren Artikel auf Seite drei hin, illustriert mit einem der Stierfotos, die Lydia gemacht hatte. In der Schlagzeile hieß es: Meisterstück aus französischer Höhle in Großbritannien aufgetaucht. In den Text eingeschoben war ein schmeichelhaftes Foto von Lydia, aufgenommen von der hauseigenen Pressestelle. Clothilde {39}überflog den Artikel und betrachtete die Bilder. Als sie schmunzelnd zu Lydia aufblickte, rief der Hausmeister zurück und meldete, der Stein sei verschwunden. Nachdem er ihn am Vorabend den Direktoren vorgelegt hatte, war er nicht mehr in den Tresor zurückgebracht worden.
»Wer hat den Empfang abgezeichnet?«, fragte Lydia.
»Mr Justin, Miss«, antwortete der Hausmeister. »Wahrscheinlich liegt das Ding noch im Sitzungszimmer.«
Justins Leitung war besetzt. Mit dem vagen Gefühl, auf eine Krise zuzusteuern, eilte Lydia über den Korridor in sein Büro. Im Vorzimmer versuchte seine wie immer makellos gekleidete Sekretärin zwei Telefonate gleichzeitig zu führen und zerraufte sich die Haare dabei. Lydia schaute im Büro nach. Justin war nicht da. Sie kehrte ins Vorzimmer zurück und baute sich vor der Sekretärin auf, die ihr das Wort »Sitzungszimmer« zuhauchte.
Lydia hastete durchs Treppenhaus und traf vor dem Sitzungszimmer zwei uniformierte Polizeibeamte an. Die Türen standen sperrangelweit auf. Aufgebrachte Stimmen schallten nach draußen. Der Raum war voller Leute, darunter die beiden Direktoren des Hauses; die anderen kannte sie nicht. Der Boden war mit Papieren übersät. Auf einem Regency-Tisch standen Champagnergläser, auf dem kostbaren Teppich lagen mehrere umgekippte Flaschen. Es hatte offenbar am Vorabend eine Feier gegeben, zu der sie nicht eingeladen worden war. Typisch Justin, dachte sie mürrisch, als ihr Blick auf den Sicherheitsbeauftragten der Firma fiel. Er stand vor Justin, der an einem georgianischen Schreibtisch saß, den Kopf in die Hände gestützt. Er blickte zu ihr auf, als sie noch zögernd im Türrahmen stand.
{40}»Es geht um Ihren verdammten Stein, Lydia«, rief er über den Lärm hinweg. »Er ist weg. Verschwunden über Nacht. Hier wurde eingebrochen.«
»Was soll das heißen, eingebrochen?«, fragte sie in die plötzlich eingetretene Stille hinein. »Warum ist der Stein nicht in den Tresorraum zurückgebracht worden?«
»Das Sitzungszimmer war verschlossen. Jemand hat die Tür aufgebrochen. Gestohlen wurde nur dieser elende Stein.«
»Wie Sie sehen, ist die Polizei hier. Mit Verstärkung im Anmarsch«, sagte der Direktor, der sich für die Öffentlichkeitsarbeit engagierte. »Und ständig geht das Telefon. Die halbe Fleet Street und die BBC wollen wissen, was es mit diesem Ort auf sich hat, den Sie« – er warf einen Blick in die Times – »als die Sixtinische Kapelle prähistorischer Kunst bezeichnen.«
»Der Ausdruck stammt nicht von mir«, entgegnete Lydia heftig. »Den hat der französische Historiker und Kirchenmann Abbé Breuil geprägt, als er Lascaux zu beschreiben versuchte.«
»Ihr Abbé kann mir gestohlen bleiben. Wichtiger ist Folgendes: Der Korrespondent der Times ist stinksauer, weil Sie ihm nur die halbe Geschichte erzählt haben. Er hat heute Morgen erfahren, dass der jüngst verstorbene Colonel Manners, der Vorbesitzer dieser Steinscherbe, bei den Franzosen in so hohem Ansehen stand, dass der gegenwärtige Präsident der Republik vor zwei Wochen angereist ist, um als Privatmann an seiner Beerdigung teilzunehmen. Das kommt morgen ganz groß heraus. Ihnen verdanken wir, dass uns jetzt ein hässlicher Skandal ins Haus steht.«
{41}»So kann man es wohl sagen«, schnappte Lydia, verärgert darüber, dass ihr nun die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. »In meinem Büro sitzt zurzeit eine Expertin vom französischen Nationalmuseum für Vorgeschichte, die den Stein sehen möchte. Und für heute Mittag hat sich ein bedeutender Wissenschaftler aus Deutschland angesagt. Auch er interessiert sich für das, was ich für das wichtigste Kunstwerk halte, das wir jemals in unserem Haus hatten. Dieser Meinung scheinen Sie ja auch zu sein, wenn ich den Anlass der Feier richtig deute, die gestern Abend hier stattgefunden hat. Während Sie Champagner geschlürft haben, ist uns der Stein abhandengekommen.«
»Nicht abhandengekommen«, ächzte Justin, der mit nervösen Händen den Beleg glattzustreichen versuchte, der seine Unterschrift trug und ihn für den Verlust verantwortlich machte. »Gestohlen.«
{42}2Im Tal der Vézère, ca. 15000 v. Chr.
Morgens hing immer Nebel über dem Fluss, der die Kalkklippen umspülte und rasch durch das Hügelland strömte, das seinen Lauf bestimmte. Und auch nachdem die Sonne, wie nun zu Beginn des Frühlings, den Nebel aufgelöst hatte, schwebte den ganzen Tag über ein Dunstschleier im Tal, der sich gegen Abend noch verdichtete, wenn die Feuer aufgeschichtet wurden, um die nächtliche Kälte abzuwehren. Dieser andauernde Dunst hatte einen eigentümlichen Geruch, der das Wild auf Abstand hielt und die Jäger jeden Tag aufs Neue zwang, auf der Suche nach Rentierherden weite Strecken zurückzulegen. Denn die Tiere hatten immer schon gespürt, dass Rauch Feuer bedeutete und Feuer Gefahr. Nun lernten sie, den Geruch von Feuer auch mit der Gegenwart von Menschen in Verbindung zu bringen, die sich offenbar auf Dauer in diesem Tal niedergelassen hatten.
Die Bäume, die in der Nähe des Flusses gestanden hatten, waren verschwunden, mit Flintsteinen mühsam gefällt und verfeuert. An seichten Stellen des Flusses hatte man Steine aufgeschichtet, um ihn leichter überqueren zu können. Und immer waren da die Rauchschwaden und vor allem der Lärm, der von den Menschen kam. Sie waren von allen Lebewesen die lautesten. Ihre Kinder lachten und {43}kreischten beim Spielen. Die Frauen riefen ihnen ständig etwas zu, schwatzten untereinander und sangen eigentümliche Lieder, wenn sie zum Fluss gingen, um Wasser zu holen, was dreimal am Tag der Fall war. Die Männer brüllten triumphierend, wenn sie mit einem erlegten Rentier zurückkehrten, das sie, kopfüber mit den Läufen an eine Stange gebunden, auf den Schultern trugen. Und immerzu war ein Hämmern wie von Spechten zu hören, weil Männer unermüdlich Flintsteine zu Werkzeugen bearbeiteten. Lärm und Rauch, gefällte Bäume und der immerwährende Geruch von Feuer an den Ufern, die sie ausplünderten – das waren die Wesensmerkmale der Menschen.
Der Hüter der Stiere schaute über den Fluss und sah von zahllosen Feuern Rauch aufsteigen und über dem Tal schweben, so weit sein Auge reichte. Er wusste, dass die Menschen mehr auszeichnete als ihr lärmendes Wesen und die Spuren ihrer Anwesenheit. Mehr als Sprache und Verständigung, mehr als die Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten und für Nahrung zu sorgen, war es der Sinn für weihevolle Verehrung ihrer Tätigkeit, der sie zu etwas Besonderem machte. Dieser Sinn zeigte sich leuchtend und lebendig, stolz und verheißungsvoll an den Wänden der Höhle hinter ihm. Der Hüter der Stiere blickte auf seine Hände, spreizte die Finger und betrachtete die rot und gelb verfärbte Haut. Er hob eine Hand an den Mund, nahm den Geruch der Farben wahr, leckte an den Fingern und fragte sich zum wiederholten Mal, ob er die Verschiedenheit der Farben auch schmecken könnte. Als er das weiche Moos zur Hand nahm, mit dem er die Stiere schwärzte, glaubte er, deren Kraft und Dunkelheit regelrecht zu riechen und zu schmecken. Er {44}wähnte sich von der vertrauten Gegenwart der Tiere berührt und stimmte den Sprechgesang an, mit dem er sein Tagwerk begann, das Lied, das er den Stieren gewidmet hatte.
Singend ging er vor dem kleinen Feuer, das zu seinen Füßen glomm, auf die Knie. Linker Hand lag die Feder am Boden, das feinste seiner Werkzeuge, rechts das Mooskissen, das gröbste. Hinter dem Feuer lag etwas Dung des heiligsten aller Tiere. Er hatte ihn, noch frisch und warm, eigenhändig mit den Farben, die er gebrauchen würde, vermischt und dann zu kleinen Kugeln gerollt. Während er sang, blies er ins Feuer und legte, passend zu den Formeln seines Lieds, zuerst die Feder, dann das Moos in die Glut. Mit scharfem Geruch versengte die Feder sofort. Er wartete, bis von dem feuchten Moos Dampf aufstieg, und legte dann ehrfürchtig ein rotes und ein gelbes Dungkügelchen in die Flammen. Schließlich richtete er sich auf, breitete die Arme aus und beendete seinen Gesang, als die Sonne durch die Nebelschwaden stach und gelbglitzernde Strahlen über den Fluss warf. Mit geschlossenen Augen und gebeugtem Kopf stellte er sich die großen Flanken vor, die er an diesem Tag zeichnen wollte, ihre Kraft und Festigkeit, und im Geiste sah er schon die bewegten Formen, die er auf der Wand abbilden würde. Hellwach und geläutert träumte er von den Stieren.
»Vater, du musst kommen«, störte ihn plötzlich eine helle Stimme, die sich vor Aufregung überschlug. Oder vielleicht auch vor Angst. Der Hüter der Stiere schreckte auf und musste an sich halten vor Ärger darüber, dass der Junge so töricht und respektlos war, diesen Ort {45}aufzusuchen, den er nicht sehen durfte. Immerhin hatte das Kind das Ende des Liedes abgewartet. So viel verstand es vom Ritual, auch wenn es erst dann einen Platz unter den Arbeitern in der Höhle haben konnte und dazugehörte, wenn es erwachsen war und sein erstes Tier getötet hatte. Aber schon jetzt zeichnete der Junge unablässig mit einem Stöckchen Figuren in den Staub am Boden, offenbar geboren für diese Arbeit, was den Vater stolz machte. »Die Frauen …«, krächzte der Junge. »Es ist Mutter.«
»Geh!«, rief der Hüter der Stiere, nicht länger verärgert, vielmehr voller Sorge über den Ausgang der bevorstehenden Geburt. »Ich darf jetzt nicht weg. Ich muss meine Arbeit tun und komme später.«
Er schaute dem Jungen nach, der eilig den Hang hinunterlief, auf das Feuer am Ufer zu, wo sich die Frauen versammelt hatten. Kindergeburten verliefen oft tödlich. Seine erste Frau war, als sie niederkam, gestorben, diese, seine zweite, hatte ihm zwei Söhne geschenkt. Jetzt wurde ein weiteres Kind erwartet. Er wandte sich ab und ging auf die Höhle zu, passierte geduckt den niedrigen Einstieg und blieb eine Weile reglos stehen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Es standen allzu viele Gerüststangen im Weg, als dass er hätte blindlings drauflos tappen können. Endlich sah er die kleinen Lampen mit den Wacholderdochten brennen und hörte über sich einen anderen Maler, der auf dem Gerüst kauerte und seiner Arbeit nachging. Es war der Hüter der Pferde, der andere Priester, dessen Werke durchaus bewundernswert waren, wenn sie auch seine eigenen nicht erreichten. Der Hüter der Pferde hatte eine Tochter, bald alt genug, um vermählt zu werden, ein {46}junges, frisches Mädchen, das ihn, den ranghohen Hüter der Stiere, verehrte. Ein Lächeln trat in sein Gesicht, als sich seine Augen auf das spärliche Licht der Lampen eingestellt hatten und der Kopf des größten Stieres aus dem Dunkeln auftauchte.
Es war sein Werk, zum ehrenden Gedenken der Auerochsen. Und zum ersten Mal musterte er nun seine bislang größte Leistung, zufrieden damit, wie Bewegung und Form zum Ausdruck kamen, was ihm insbesondere in der Gestaltung der Hörner gelungen war. Das hintere war nur eine einfache Kurve, während das vordere, mit ähnlichem Schwung zu Anfang, nach oben hin einen anderen, fast gegensinnigen Verlauf nahm. Dadurch schien sich der Kopf zu bewegen und war nicht mehr nur von der Seite zu sehen wie bei den Hirschen und Pferden, sondern es drohte ein mächtiges Biest gleichsam aus der Felswand anzugreifen. Er seufzte beglückt und nickte, zufrieden mit dem, was er sah, und richtete den Blick auf seine jüngste Arbeit, die Linie, wo Brust und Vorderläufe des Stiers ineinander übergingen.