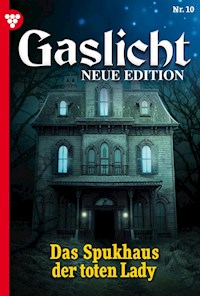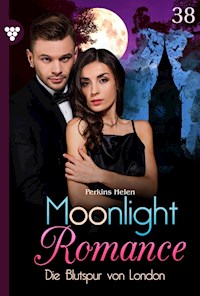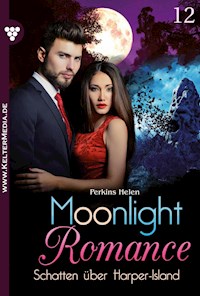
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Moonlight Romance
- Sprache: Deutsch
Es ist der ganz besondere Liebesroman, der unter die Haut geht. Alles ist zugleich so unheimlich und so romantisch wie nirgendwo sonst. Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen, Vampire und andere unfassbare Gestalten und Erscheinungen ziehen uns wie magisch in ihren Bann. Moonlight Romance bietet wohlige Schaudergefühle mit Gänsehauteffekt, geeignet, begeisternd für alle, deren Herz für Spannung, Spuk und Liebe schlägt. Immer wieder stellt sich die bange Frage: Gibt es für diese Phänomene eine natürliche Erklärung? Oder haben wir es wirklich mit Geistern und Gespenstern zu tun? Die Antworten darauf sind von Roman zu Roman unterschiedlich, manchmal auch mehrdeutig. Eben das macht die Lektüre so fantastisch... Niemand war in ihrer Nähe, sie war ganz allein hier. Die ersten Sterne flimmerten nun am Firmament, ein Kauz schrie ganz in der Nähe klagend. Es raschelte im Unterholz, und der kalte Wind bog die Weiden, die verzweifelt zu seufzen schienen. Es war eine unheimliche Atmosphäre. Sarah beschloss umzukehren. Sie hatte sich offenbar getäuscht, denn hier war außer ihr niemand. Also dirigierte sie ihr Pferd in die entgegengesetzte Richtung und trieb es ein wenig an, denn sie wollte nun schnell zurück nach Ivy-House. Das Moor hatte bei Dunkelheit eine bedrückende Ausstrahlung, die Sarah nicht gefiel. Sie hatte bereits ein gutes Stück Weg zurückgelegt, als ihr Pferd völlig unvermutet scheute und sogar wiehernd auf die Hinterhand stieg. Sarah war von Kindesbeinen an eine geübte Reiterin. Doch es geschah so schnell und ohne Vorwarnung, dass sie nicht in der Lage war, darauf zu reagieren. Im nächsten Moment rutschte sie aus dem Sattel und fiel kopfüber zu Boden. Sie spürte einen harten Schlag an der Stirn, sah Sterne und verlor gleich darauf das Bewusstsein. Ihr Pferd rannte panisch davon. Es dauerte nicht lange, dann näherten sich Schritte der Bewusstlosen. Jemand beugte sich langsam über sie ... Der Himmel über Harper-Island hatte sich an diesem Sommerabend mit Schleierwolken bezogen. Nach einem warmen Tag, dem die Seeluft hier, auf einer der Scilly-Islands vor der Spitze von Cornwall, die stickige Hitze genommen hatte, wurde es nun mit dem auffrischenden Wind, der landwärts blies, recht kühl. Harper-Island war seit langer Zeit Privatbesitz. Das Eiland vor der Küste, südwestlich von Plymouth, war die größte der Scilly-Inseln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Moonlight Romance – 12 –Schatten über Harper-Island
Helen Perkins
Niemand war in ihrer Nähe, sie war ganz allein hier. Die ersten Sterne flimmerten nun am Firmament, ein Kauz schrie ganz in der Nähe klagend. Es raschelte im Unterholz, und der kalte Wind bog die Weiden, die verzweifelt zu seufzen schienen. Es war eine unheimliche Atmosphäre. Sarah beschloss umzukehren. Sie hatte sich offenbar getäuscht, denn hier war außer ihr niemand. Also dirigierte sie ihr Pferd in die entgegengesetzte Richtung und trieb es ein wenig an, denn sie wollte nun schnell zurück nach Ivy-House. Das Moor hatte bei Dunkelheit eine bedrückende Ausstrahlung, die Sarah nicht gefiel. Sie hatte bereits ein gutes Stück Weg zurückgelegt, als ihr Pferd völlig unvermutet scheute und sogar wiehernd auf die Hinterhand stieg. Sarah war von Kindesbeinen an eine geübte Reiterin. Doch es geschah so schnell und ohne Vorwarnung, dass sie nicht in der Lage war, darauf zu reagieren. Im nächsten Moment rutschte sie aus dem Sattel und fiel kopfüber zu Boden. Sie spürte einen harten Schlag an der Stirn, sah Sterne und verlor gleich darauf das Bewusstsein. Ihr Pferd rannte panisch davon. Es dauerte nicht lange, dann näherten sich Schritte der Bewusstlosen. Jemand beugte sich langsam über sie ...
Der Himmel über Harper-Island hatte sich an diesem Sommerabend mit Schleierwolken bezogen. Nach einem warmen Tag, dem die Seeluft hier, auf einer der Scilly-Islands vor der Spitze von Cornwall, die stickige Hitze genommen hatte, wurde es nun mit dem auffrischenden Wind, der landwärts blies, recht kühl.
Harper-Island war seit langer Zeit Privatbesitz. Das Eiland vor der Küste, südwestlich von Plymouth, war die größte der Scilly-Inseln. Der Blick ging südlich über das Meer bis Brest und in entgegengesetzter Richtung auf die Spitze Cornwalls, das sogenannte Land’s End.
Die Insel besaß einen kleinen Privathafen, von dem aus eine Straße nach ››Ivy-House‹‹ führte. Das prächtige Herrenhaus aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wurde von zahlreichen Nutzgebäuden eingerahmt. Es gab Stallungen, mehrere Freigehege, Wirtschaftsräume und auch ein separates Wohnhaus für die Bediensteten. Der parkähnliche Garten, der ››Ivy-House‹‹ umgab, ging in die freie Landschaft über. Hinter dem Gebäude erstreckte sich ein kunstvoll angelegtes Parterre de Broderie, ganz im Stile der französischen Könige gehalten. Daran schlossen sich weite Rasenflächen mit stilsicher bepflanzten Borders an, über die unzählige mächtige Eichen, Buchen und Sumpfzypressen ihre Kronendächer spannten. Diese urzeitlich anmutenden Baumpatriarchen zeigten zugleich den Übergang vom Park in die freie Landschaft an. Dahinter schloss sich in westlicher Richtung eine Steilküste an, im Osten dagegen wurde das Land hügelig, beherrscht von niedrigen Bäumen und Gebüsch. Und schließlich im Herzen der Insel ein ausgedehntes Moorgebiet, das so tückisch war, dass die Bewohner der Insel es mieden.
Es gab viele Legenden, die sich um diesen Landstrich rankten. Meist spielten harmlose Reisende oder Wanderer darin die Hauptrolle. Vom Weg abgekommen verirrten sie sich im Moor und versanken schließlich im Morast des so genannten schwimmenden Landes. Oft waren dabei übernatürliche Kräfte im Spiel. Die Geschichten, die man sich in einer stürmischen Winternacht bei einem Pint Ale erzählte, sprachen von Irrlichtern, die die Fremden foppten und in ihr Verderben führten. Aber auch böse Feen und Trolle kamen darin vor. Sie lockten ihre Opfer ins Moor, entführten sie in ihre unterirdische Welt und versklavten sie dort. Je schauriger, je abstruser die Gestalten waren, die solche Geschichten bevölkerten, desto beliebter waren sie bei den Zuhörern.
An diesem Sommerabend verließ ein Mann heimlich ›Ivy-House‹ und folgte einem schmalen Fußweg, der vom Herrenhaus weg, direkt ins Moor führte. Im Zwielicht der steigenden Dämmerung verwischte seine Silhouette bald mit dem Grau des späten Abends. Während die ersten Nebelfeen aus den Mulden stiegen, ein Moorhuhn klagend schrie und über dem Horizont vor Land’s End bereits die ersten Sterne matt zu flimmern begannen, folgte der Mann zielstrebig dem Weg, der nun kaum noch zu erkennen war. Der einsame Wanderer schien sich hier gut auszukennen, denn er ging weder in die Irre, noch stolperte er. Sein Ziel war das Moor, er hatte hier eine Verabredung. Ob der andere sie auch einhalten würde? Es ging für den einsamen Wanderer um viel. Er war entschlossen, seine Interessen zu wahren, sich notfalls auch mit Druck und Härte durchzusetzen.
Ein schmales Lächeln legte sich um seinen Mund und er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Der Weg war hier nur noch ein Trampelpfad, der hauptsächlich von Wildtieren genutzt wurde. Und vielleicht auch von dem einzigen Menschen, der in dieser Gegend hauste. Bei dem Gedanken wurde der einsame Wanderer ernst. Ob sie wohl hier war, vielleicht ganz in der Nähe? Er blieb kurz stehen und lauschte. Nichts war zu hören. Nur der Wind, der durch die niedrigen Büsche strich, die den Weg begrenzten. Und der ferne Rufe der Möwen über dem Kanal. Sonst war es vollkommen ruhig. Beinahe unheimlich still.
Entschlossen setzte der Mann seinen Weg fort. Er hatte sein Ziel beinahe erreicht. Wie ein Schattenriss zeichnete sich die zackige Silhouette der abgestorbenen Mooreiche ein Stück vor ihm ab. Der Baum war vor Jahren von einem Blitz getroffen worden. Nur ein schwarz verkohltes Skelett war übrig geblieben, doch die starke Wurzel im Boden hielt den toten Baum auf seinem Platz fest. Er war zur Wegmarkierung geworden, auch wenn einige Bewohner von Harper-Island der festen Meinung waren, dass der Baum nicht ganz geheuer sei. Man erzählte von Trollen, die in seinem nun hohlen Stamm hausten und jeden mit einem Fluch belegten, der ihnen zu nahe kam.
Der einsame Wanderer hielt nichts von solchen Geschichten. Für ihn war der tote Baum einfach nur der Beweis, dass er sich nicht verlaufen hatte, sondern den vereinbarten Treffpunkt fast erreicht hatte.
Der Wind frischte auf, griff mit kalten Händen nach dem Mann, der völlig allein zu sein schien. Die Schleierwolken über dem Kanal lösten sich auf, der zunehmende Mond schob sich nun über das Wasser und streute Silbertaler darauf. Es wurde so dunkel, dass man die Umgebung mehr erahnen als erkennen konnte. Der Mann aber kannte sich bestens aus. Er passierte die Mooreiche und blieb dann stehen, denn er wusste, dass hinter dem Baum das schwimmende Land begann. Es war ein tückischer Landstrich, der sich ständig veränderte. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, ob da, wo gestern noch fester Boden gewesen war, nun kein Moorloch entstanden war. Unter dem harten Gras, das hier wuchs, lag oft metertiefer Morast. Selbst bei Tage war es nicht sicher, das Moor zu betreten. In der Dunkelheit aber konnte jeder weitere Schritt den sicheren Tod bedeuten.
Der Mann wartete. Während der Mond über dem Kanal allmählich höher stieg, regte sich ringsum nichts. Schon fragte er sich, ob er umsonst den Weg hierher gegangen war. Hatte der andere ihn versetzt? Hatte er gar nicht die Absicht gehabt, zu diesem Treffen zu kommen? Waren seine Worte nur Lippenbekenntnisse gewesen, ausgesprochen, um ihn hinzuhalten?
Wenn dem so war, würde der Betrüger dafür zahlen. So leicht war er nicht an der Nase herum zu führen, denn er hatte einen Trumpf in der Hinterhand. Und er war entschlossen, ihn auszuspielen, wenn der andere ihn wirklich betrügen sollte.
Ein Rascheln ganz in der Nähe erregte seine Aufmerksamkeit. Er wandte den Blick und schaute sich um. War es ein Tier, das durchs Unterholz schlich auf der Suche nach Nahrung? Nein, es klang anders, wie … Schritte. Tatsächlich, da kam jemand.
Kurz blitzte ein punktförmiges Licht auf, wie von einer Taschenlampe. Der andere schien den Weg nicht so gut zu kennen, er musste sich erst orientieren. Der Mann lächelte verächtlich. Er war plötzlich überzeugt, in der besseren Position zu sein. Und er hatte das deutliche Gefühl, dass er alles erreichen konnte, was er wollte.
Das grundlose Triumphgefühl verschwand ebenso schnell wie es gekommen war, ließ nur eine leise Unsicherheit zurück und die Gewissheit, wie wichtig es sein würde, vorsichtig zu bleiben.
Dem anderen war nicht zu trauen. Er musste nun buchstäblich mit allem rechnen, denn er hatte ihm sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, sich hier zu treffen, dermaßen abgeschieden, weit fort von allen anderen. Ging etwas schief, dann gab es keine Möglichkeit, Hilfe zu holen. Er war auf sich allein gestellt. Und sein Gegner hatte nun ebenfalls den Treffpunkt erreicht. Die Taschenlampe erlosch, als er neben ihn trat. Ein kurzer Händedruck, dann sagte der andere: »Es tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen, aber ich bin noch aufgehalten worden.«
»Ist schon gut, ich bin auch eben erst gekommen«, flunkerte er. »Hauptsache, du hast das, was ich will.«
»Gewiss.« Ein leises Lachen folgte, das seltsam deplatziert wirkte. »Du wirst dich wundern!«
»Ich verlange keine Unsumme für mein Schweigen, nur eine angemessene Bezahlung. Schließlich muss ich ja von etwas leben. Und du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ich werde dich nicht betrügen. Wir sind doch schon immer gut miteinander ausgekommen.«
»Natürlich. Wir sind Freunde«, versicherte der andere. Doch er betonte das Wort »Freunde“ merkwürdig.
»Also gib mir das Geld, damit ich von hier wegkomme. Bei aller Liebe, aber dieser Treffpunkt ist wirklich nicht nach meinem Geschmack.«
»Wäre es dir in ›Ivy-House‹ lieber gewesen, unter den Augen der anderen?«
»Natürlich nicht. Machst du Witze?«
»Niemals. Schon gar nicht beim Geld. Man sagt ja, dass da die Freundschaft aufhört. Nur gut, dass es bei uns anders ist.« Er deutete nach vorne. »Ich habe das Geld hinter dem Baum vergraben. Man weiß nie, wer einen beobachtet und dann seinen Anteil fordert. Hier draußen ist es sicher. Wir müssen es nur noch holen.«
»Nimm die Taschenlampe. Hinter der Mooreiche beginnt das schwimmende Land. Ich hab keine Lust, dort stecken zu bleiben.«
Der andere lachte wieder. »Sei doch kein Hasenfuß. Das Geld ist ja direkt beim Baum. Nun komm schon, du kannst mir leuchten, während ich es ausgrabe. Einverstanden?«
»Na schön, aber beeil dich. Ich will hier weg.«
»Dir ist es wohl nicht geheuer? Das schlechte Gewissen vielleicht? Also, ich habe damit kein Problem.«
»Klar, wenn man kein Gewissen hat …«
Der andere steuerte den Baum an, ging noch ein Stück und blieb dann stehen. Als er sich umdrehte, hielt er einen Klappspaten in der Hand. Doch er hatte nicht vor, damit etwas auszugraben. Er benutzte den Spaten als Waffe. Und um nächsten Augenblick explodierten vor den Augen seines Begleiters tausend Sterne …
*
Es war kalt, schwer und feucht. Sein Körper schien in einen alten Sack eingewickelt unter der Erde zu liegen. Doch er spürte noch etwas, sein Herz klopfte und er atmete. Er lebte. Aber es war, als sei er bereits tot. Er wusste nicht, wie lange er sich schon in diesem unnatürlichen Zustand befand, als er mühsam die Augen öffnete.
Zunächst sah er gar nichts. Dunkelheit umgab ihn, feuchte, stickige Luft, ein Geruch nach Moder und Fäulnis. Er hob die Arme, meinte, im nächsten Moment gegen einen Sargdeckel zu stoßen. All die Bilder aus den Horrorfilmen, die er irgendwann einmal gesehen hatte, kamen ihm in den Sinn.
Doch über ihm war nichts. Aber da war etwas anderes. Ein schmatzendes, saugendes Geräusch. Und dann so etwas wie ein träges Plätschern. Er riss die Augen weit auf. Und dann sah er doch etwas. Über dem Schwarz, das ihn umgab, lag ein helleres Grau und darin funkelte etwas.
Der Himmel, die Sterne! Diese Erkenntnis konnte ihn nur kurz trösten. Er war zwar frei, nicht unter der Erde gefangen, wie er zunächst geglaubt hatte. Doch er war trotzdem ein Gefangener. Und seine Lage schien nicht besser zu sein als die eines lebendig Begrabenen. Denn er befand sich im Moor!
Verzweiflung und Todesangst erfüllten ihn bei diesem Gedanken. Sie glichen einer hohen Welle, die ihn einfach unter sich begrub und damit jede Hoffnung fortnahm.
Wie war er hierher gelangt? Er dachte daran, dass er sich stets vorsichtig bewegt und ständig neu orientiert hatte. Im Grunde war es unmöglich, dass er ein Opfer des schwimmenden Landes geworden war. Und doch konnte es keinen Zweifel geben. Die feuchte Kälte, die ihn bis zur Brust einhüllte. Und die Leere unter seinen Füßen, die keinerlei Halt finden konnten …
Ein zittriger Seufzer entrang sich seiner Brust. Sollte es so enden? Hatte er denn einen dermaßen schweren Fehler begangen, als er sich selbst überschätzt hatte? Oder war sein Verhängnis vielmehr, dass er den anderen unterschätzt hatte?
»Hilfe!« Seine Stimme war kaum zwei Meter weit zu hören. Er klapperte mit den Zähnen, fühlte eine eisige Lähmung, die nach und nach von seinem ganzen Körper Besitz ergriff. Es konnte keine Rettung geben, das ahnte er. Zu tief steckte er bereits im Morast. Und es war niemand in der Nähe, der ihm hätte helfen können. Sein Mörder hatte gewiss längst das Weite gesucht.
Noch einmal versuchte er es, wider besseres Wissen: »Hilfe!« Schon etwas kräftiger gellte sein Schrei über das vom Mond beschienene Moor. Und doch war es sinnlos. Denn in der näheren Umgebung stand kein Haus, hier lebte niemand. Außer vielleicht … Er dachte an die Moorbewohnerin, die manchmal hier herum schlich und ihn womöglich gehört hatte. Kurz stieg neue Hoffnung in ihm auf und er schrie noch einmal aus Leibeskräften um Hilfe.
»Bemüh dich nicht, es ist sinnlos.« Die Stimme kam ganz aus der Nähe. Gleich darauf flammte ein Licht auf und blendete den Mann. Er kniff die Augen zu, doch er wusste auch so, wer ihn angesprochen hatte.
»Du bist noch hier? Ich dachte, du wärst zufrieden, nachdem du mich beseitigt hast. Und den Rest wird das Moor erledigen, habe ich recht?« Er lachte trocken auf. Nun blieb ihm nichts weiter als Galgenhumor, denn sein Gegner hatte ihn nicht nur in diese ausweglose Lage gebracht, er würde auch keine Gnade kennen, das ahnte er. Er wusste aber nicht einmal annähernd, wozu der andere fähig war. Allerdings sollte er es sogleich erfahren.
»Wo bleibt denn da der Spaß? Jemanden ins Moor zu werfen, das hat wirklich keinen Stil. Deshalb habe ich mir für dich etwas Besonderes ausgedacht.«
Er schwieg, denn er wollte dem anderen, der sich an seiner Verzweiflung weidete, keinen Gefallen tun.
»Du sagst nichts? Na gut, dann möchte ich dir jetzt eine Freundin von mir vorstellen. Sie hat schon auf dich gewartet. Und sie freut sich sehr, dass du ihr von nun an Gesellschaft leisten wirst …«
Die Taschenlampe erlosch. Während der Gefangene des Moores sich noch fragte, was sein Gegner damit meinte, hob der einen Arm an und stieß einen gutturalen Schrei aus. Er hielt etwas in der Hand, das plötzlich anfing zu glühen. Es sah ein wenig wie ein keltisches Kreuz aus, doch es schien auf dem Kopf zu stehen. Das Metall, aus dem es geschmiedet war, glühte rotgolden.