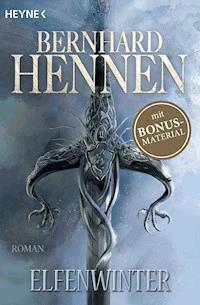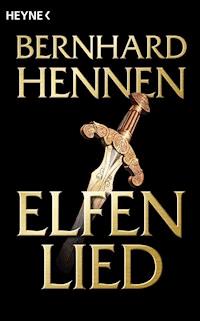12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Schattenelfen-Saga
- Sprache: Deutsch
Verzweifelt sucht Fürstin Alathaia nach einem Weg, ihr Reich Langollion zu retten. Ihre Intrigen scheinen zu fruchten: Durch Mord und Verrat steigt ihre Gesandte Adelayne zur Kaiserin auf. Plötzlich sind alle Machtverhältnisse umgekehrt und alle Bündnisse infrage gestellt. Doch Adelayne herrscht nicht allein und muss schon bald einen mörderischen Preis für ihren Thron zahlen. Und auf einmal wird jemand gänzlich Unscheinbares zur letzten Hoffnung der Elfen von Langollion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Im Kaiserreich am Gelben Fluss, dem ersehnten Bündnispartner der Fürstin Alathaia, droht ein Erbfolgekrieg zwischen Prinzessin Makiko und ihrem Bruder Jagon. Erst eine Hochzeit, wie sie das Reich der Damien nie zuvor gesehen hat, wendet alles. Die Elfe Adelayne gibt das Eherne Wort, ein Ehegelöbnis, das bis in alle Ewigkeit gilt. Sie will damit Langollion retten, und doch wird nichts so, wie sie es erwartet hat.
Bald schon wird die Bienenhexe Leynelle Opfer einer finsteren Hofintrige. Verzweifelt versucht der Meisterbogenschütze Laurelin, sie zu retten. Doch ihre Hinrichtung ist beschlossene Sache.
Der böse Rosengeist Matha Blouta nutzt währenddessen seine Macht über die Schatten, um Morde am Hof der Elfenkönigin Emerelle zu begehen. Emerelle verdächtigt Alathaia und forciert ihre Kriegsvorbereitungen. Die Invasion Langollions steht unmittelbar bevor …
Der Autor
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Mit seiner »Elfen«-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Bernhard Hennen lebt mit seiner Familie in Krefeld.
BERNHARD
HENNEN
SCHATTENELFEN
DAS EHERNE WORT
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Bernhard Hennen
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Uta Dahnke
Coverkonzept: Bernhard Hennen
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,
unter Verwendung einer Illustration von Kerem Beyit
Karten im Innenumschlag [>>]: Andreas Hancock
Illustration Elfenknoten: Olaf Sigel
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29392-5V001
www.heyne.de
Für die Reisende im Mondlicht
»Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du.«
(Mahatma Gandhi)
DIE STIMME DER SCHWESTER
Makiko betrachtete den sanft geschwungenen Dolch, der vor ihr in einem Kästchen mit rotem Seidenfutter lag. Nur eine einzige Öllampe brannte in ihrem Zelt. Das unstete Licht ließ es aussehen, als ob sich die bläulichen Wellen an der Oberfläche des hundertfach gefalteten Stahls bewegten.
Ein Vertrauter ihres Vaters hatte ihr bei Einbruch der Dämmerung das schwarz lackierte Kästchen gebracht. Die Klinge war eine eindeutige Aufforderung.
Makiko lauschte dem Lärm im Feldlager. Das Heer feierte den Sieg. Morgen würde ihr Vater, der Kaiser von Haiwanan, auf die eroberte Insel im Mündungsdelta des Gelben Flusses übersetzen. Die Hufeiseninsel, die erste der sieben Inseln Caistellas, war eingenommen, und das ausgerechnet dank der Elfe, deren Tod Makiko gefordert hatte.
Es war das erste Mal gewesen, dass sie vor dem Hofstaat ungefragt das Wort ergriffen hatte. Sie war nur eine Prinzessin. Sie sollte gut aussehen, gut Bambusflöte spielen und gut schweigen. Dazu war sie erzogen worden. Sie lebte, um eines Tages ein Bündnis mit einem anderen Reich durch das Eherne Wort zu festigen. Und sie lebte, weil sie vergleichsweise schöne Ohren hatte, jedenfalls für eine Damien.
Traurig dachte sie daran, wie oft ihr Vater in den letzten beiden Wochen hinter die Gräfin von Rosan getreten war, um deren spitze Elfenohren zu liebkosen. Morgen, wenn er aus Caistella zurückkehrte, würde er dieser spitzohrigen Adelayne das Eherne Wort geben. Zu dem Fest würde sie nicht eingeladen sein, das wusste Makiko. Mit dem Dolch sollte sie ihrem Leben vorher ein Ende setzen, schweigend und ehrenhaft, wie die Etikette am Hof es verlangte.
Sie strich über den Griff der Waffe, der mit Wasserbüffelleder umwickelt war. Sie war immer noch in das rote Gewand gehüllt, das sie während der Seeschlacht auf dem Hügel am Meer getragen hatte. Es hatte sich gut angefühlt, vor den Höflingen die Stimme zu erheben.
Makiko lächelte bitter, denn es war ihr Todesurteil gewesen. Sie hatte die Gunst ihres Vaters verloren, und sie wusste, sie würde sie niemals zurückgewinnen. Wenn sie sein Geschenk nicht nutzte, um mit eigener Hand seinen Willen an sich zu vollziehen, dann würde im Morgengrauen die Leibwache des Kaisers ihr Zelt umringen, und was dann käme, wäre unendlich viel grausamer als ein schneller Schnitt. Er hatte ihr am Morgen vor der Schlacht Shiho gezeigt, die auf dem Bambushügel in der Nähe eines Ameisenvolks gefesselt auf dem Erdboden lag. Das Wimmern der stolzen Dienerin klang Makiko noch in den Ohren. So würde sie nicht enden.
Du musst gar nicht enden!
Die Prinzessin lächelte. Sie hatte sich schon gefragt, wann sich die Stimme in ihr erheben würde. Ihr anderes, ihr rebellisches Ich.
Sie erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem die Stimme erwacht war. Die beiden Töchter der Fürstin Alathaia hatten mit prächtigem Gefolge den Kaiserhof besucht. Makiko hatte Sanassa und Morwenna verstohlen beobachtet. Die beiden waren so völlig anders als sie, stolz und selbstbewusst. Sie hatten die Gesandtschaft angeführt, und alle Männer ihres Gefolges hatten sich ihrem Willen gefügt. Vielleicht, weil die beiden Elfen waren …
Unsinn! Nicht die Ohren unterscheiden euch, sondern der Wille der beiden, nicht im Schatten zu stehen. Auch dein Wille kann der Keimling sein, aus dem ein selbstbestimmtes Leben erwächst.
Makiko strich über das Wasserbüffelleder. Es war in schmalen Streifen um den Griff des Dolches gewickelt. Es fühlte sich angenehm an, schmeichelte der Hand, die es berührte. Heute hatte sie versucht stark und selbstbestimmt zu sein. Es würde sie in dieser Nacht das Leben kosten …
Noch atmest du! Und es liegt bei dir, wie du handelst. Du hast noch Zeit bis zum Morgengrauen.
Unruhig stand Makiko auf. Sie ging durch ihr Zelt. Der hölzerne Boden knarrte unter ihren Schritten. In der Ferne ertönte begeistertes Johlen. Seit sie vor etlichen Monden das Feldlager aufgeschlagen hatten, hatte Makiko die Krieger noch nicht so aufgewühlt erlebt.
Unruhig ging sie zurück zu dem Tisch, auf dem das Lackkästchen mit dem Dolch wartete. Tief in Gedanken betrachtete sie das bläuliche Wellenmuster im Stahl. Ein Schnitt, und alle ihre Sorgen würden für immer im Vergessen versinken. Wie viele Stunden blieben ihr wohl noch bis zum Morgengrauen?
Sie nahm die Öllampe und ging hinüber in das zweite Zelt, das mit ihrem Quartier verbunden war. Schwerer Blütenduft hing hier in der Luft. Das goldene Licht der kleinen Flamme ließ allerlei Grüntöne im Dunkeln schimmern. In Töpfen und Schalen standen Dutzende Bäumchen und winzige Büsche, die kunstvoll zurechtgestutzt waren. Ihre Stämme wanden sich, elegant gekrümmt. Jedes einzelne Stück erfreute mit seiner Schönheit das Auge. Hierher kam Makiko zum Verweilen, wenn sie am Leben verzweifelte oder nur für sich auf ihrer Flöte spielen wollte.
Mitten im Zelt lag ein großes rotes Kissen. Darauf ruhte ihre Flöte. Sie ging hinüber und strich wehmütig über die verschlissene Seide. Seit ihrer Kindheit begleitete sie dieses Kissen auf jeder Reise des kaiserlichen Hofs. Es war ein Geschenk ihrer Mutter, an die sie sich kaum noch erinnern konnte. Sie war noch sehr klein gewesen, als ihre Mutter verschwand. Hatte auch sie ein Kästchen mit einem Dolch geschickt bekommen? Ihre Mutter hatte ihr immer erzählt, sie habe Zwillingsmädchen zur Welt gebracht und der Kaiser habe durch ein Los entschieden, wer von ihnen leben durfte.
Niemand hatte Makiko diese Geschichte bestätigen wollen. Geheimnisse wurden am Kaiserhof sehr tief begraben. Nur ihr Halbbruder, Prinz Jagon, hatte ihr gegenüber unter vier Augen einst Ähnliches bezüglich ihrer anderen Halbgeschwister angedeutet, die allesamt nie hatten heranwachsen dürfen.
Makikos Blick wanderte über die winzigen Bäume und Büsche. Es war eine Kunst, sie so zu hegen, dass sie immer klein blieben.
Eine Kunst, die dein Vater auch an dir ausübt.
Die Stimme in ihrem Kopf war immer kämpferisch. Makiko stellte sich vor, dass ihre Zwillingsschwester zu ihr sprach, dass über den Tod hinaus eine Verbindung zwischen ihnen bestand, und der Besuch der Töchter Alathaias hatte diese Stimme erweckt, denn die beiden waren, was sie hätte sein können, wäre sie nicht als Tochter des Gläsernen Kaisers geboren worden.
Es ist deine Entscheidung, was du bist.
Makiko lächelte. Das sagte sich so leicht. »Wer nur eine Stimme ist, liebe Schwester, der hat wahrlich nichts zu verlieren. Du musst …« Sie verstummte. In diesen Zelten war sie sich nie ganz sicher, ob sie belauscht wurde.
Ihr Blick fiel auf das Kistchen, das unter dem Tisch mit den blühenden Lilien stand. Es war ihr erst am Morgen gebracht worden. Der Schmied, der als Einziger gewusst hatte, was sich darin befand, trieb wahrscheinlich bereits als Leiche im Gelben Fluss. Die von ihr diesbezüglich gegebenen Befehle waren eindeutig gewesen.
Die Klinge deines Vaters oder deine eigenen Klingen, wofür wirst du dich entscheiden?
»Er würde mich nicht zu sich vorlassen, so sehr, wie ich ihn erzürnt habe«, murmelte sie halblaut.
Mitten in der Nacht werden die Herzen alter Männer weich. Er wird das Urteil über dich nicht aufheben. Er bleibt sich immer treu. Aber wenn du kommst, um dich zu verabschieden und ihm noch einmal sein Lieblingslied auf der Flöte zu spielen, wird er dich empfangen. Und er wird dich unterschätzen, wie immer.
Versonnen betrachtete sie das Kistchen.
Du bist so oder so zum Tode verdammt. Macht dich das nicht unglaublich frei? Was kannst du noch verlieren?
Makiko fühlte sich gefangen zwischen ihrer Erziehung und ihren widerstrebenden Träumen. Sie hatte ihrem Vater immer gefallen wollen. Und sie war so stolz gewesen, dass sie sein Spitzel sein durfte. Dass sie mit ihrer Musik von ihren Entdeckungen erzählte und nur er sie verstand.
Und deshalb wird er dich heute Nacht nicht fortschicken, wenn du ein letztes Mal für ihn spielen willst. Auch er ist ein Gefangener. Er kann nicht anders, als deinen Tod zu befehlen, wenn du ihm nicht gehorchst.
Makiko beugte sich zu einem kleinen Zitronenbäumchen und schnupperte an den Blüten. Dann betrachtete sie die Orchideen in ihrer wunderbaren Farbenpracht. Sie wusste, dass ihr Vater für manche dieser Pflanzen ein Goldstück bezahlt hatte, einen wahrhaft kaiserlichen Preis.
Sie beugte sich über die betörend duftenden weißen Rosen aus Alvemer. Die Blüten waren erstaunlich klein. Vielleicht, weil diese Rosen so weit im Norden gediehen. Am Ende des Tisches stand die Rubinrose. Sanassa und Morwenna hatten sie als eines von vielen Geschenken bei ihrem Besuch mitgebracht. Da ihr Vater nur wenig Sinn für Blumen hatte, auch wenn er ihren Anblick schätzte, war der kleine Rosenbusch an Makiko weitergereicht worden. Sie hatte ihn gestutzt und ihm mit Seidenbändern eine edlere Form gegeben.
Doch der Busch war ein Biest. So oft hatte sie sich an seinen Dornen gestochen! Sie hatte herausgefunden, dass der Ton der Blüten noch intensiver wurde, wenn sie sich den Dornen hingab. Zugleich fühlte sie sich dann berauscht. Alle Fesseln fielen von ihr ab. Alles schien möglich.
Makiko zog den Ärmel ihres roten Kleids zurück und schob ihre Hand durch den Kreis, zu dem sie die verschiedenen Rosentriebe verwoben hatte. Blutrot leuchteten die Dornen auf hellem Grün. Die Stimme ihrer Schwester wurde jedes Mal stärker in ihr, wenn sie sich selbst kasteite. So war es auch jetzt. Und sie kündete ihr von der Freiheit, die in dem Kistchen des toten Schmieds auf sie wartete.
UNTER BÄUMEN
Langsam glitt die Bolzenspucker durch das dunkle Wasser des Mangrovenwalds. Nervös nahm Swid seine Brille ab und polierte die Gläser mit einem Zipfel seines Hemds. Er spähte über das Schanzkleid des niedrigen Turms, der dem Tauchboot entwuchs, in die Nacht. Es schmerzte den Zwerg zu sehen, was unter Anleitung Laurelins aus seinem herrlich zweckmäßig gebauten Aal geworden war. Das Tauchboot war jetzt mit hohen Gräsern bedeckt, die samt Wurzeln und dicken Klumpen schwarzen Schlicks die eiserne Hülle des Tauchboots verbargen. Auch der Turm war mit Schlamm beschmiert, und seltsame Blumen rankten an ihm empor. Dank Alathaias Magie welkten die Sumpfgewächse in der schwülen Hitze nicht. Ein morscher Stamm lag quer zwischen den Gräsern. Für einen flüchtigen Beobachter mochte der Aal wie eine der Schilfinseln aussehen, die sich hier und dort aus dem brackigen Wasser erhoben.
Diese verfluchte stickige Hitze! Swid war froh, hier oben im Turm zu stehen. Unten im Aal war es noch viel schlimmer. Man saß herum, tat nichts, und schon das genügte, dass einem der Schweiß am Körper hinablief. Mit einem Seufzer setzte er sich die Brille wieder auf die Nase, wohl wissend, dass er kaum mehr sehen würde.
»Das würde ich lassen«, flüsterte Laurelin.
Der Elf kniete neben ihm. Er hatte sich Gesicht, Hände und Kleider mit dem schwarzen Schlamm der Mangroven eingerieben und war kaum mehr als ein Schatten.
»Warum?«, knurrte Swid übellaunig. Diese Reise zu dem verfluchten Echsentempel mitten im Waldmeer, den Fürstin Alathaia vor unzähligen Jahren schon einmal überfallen hatte, gefiel ihm gar nicht. Diese Mangroven, die aussahen und rochen, als würde hier alles außer den riesigen Bäumen bei lebendigem Leib verfaulen, waren kein Ort für Zwerge. Die ganze Mannschaft dachte so, und die Stimmung an Bord war bedenklich. Ein falsches Wort von den Elfen, und es würde zu einem handfesten Streit kommen.
Laurelin beugte sich zu ihm vor. »In den Gläsern der Brille bricht sich das Mondlicht. Für einen guten Schützen gibst du damit ein hervorragendes Ziel ab. Ein Pfeil genau zwischen die Augen … Ich würde das bei Nacht auf mehr als fünfzig Schritt schaffen.« Er deutete nach steuerbord. »Das Gebüsch dort ist weniger als fünfzig Schritt entfernt. Etwas raschelt da …«
Swid spürte, wie sich die Härchen in seinem Nacken aufrichteten, als berührte ihn eine eisige Hand. Er vermochte das Gebüsch, von dem Laurelin sprach, kaum zu erkennen. Dafür sah er auf einem dicken Ast, der sich tief über das Wasser beugte, Gestalten huschen. Schädelaffen, vermutete er. Sie galten als ein böses Omen.
Laurelin strich mit der Rechten über die Pfeile in seinem offenen Köcher. Swid hatte das beklemmende Gefühl, dass der Elf etwas wahrnahm, was ihm entging. Unwillkürlich zog er den Kopf zwischen die Schultern. Er nahm die Brille ab und kauerte sich etwas tiefer hinter die Brustwehr des Turms.
Ohne Brille sah er noch schlechter. Nebelschwaden trieben über dem Wasser. Der Mond stand am sternklaren Himmel. Es war eine helle Nacht, doch die weit ausladenden Baumkronen warfen tiefe Schatten auf dieses ungewöhnliche Gewässer, das weder Wald noch Meer, sondern beides zugleich war.
Unzählige Male hatten sie sich in den letzten Tagen in den seichten Gewässern festgefahren. Sandbänke, unter dem Wasser verborgenes Wurzelwerk und tote Bäume machten das Navigieren zu einer Qual. Ohne das starke schwenkbare Licht unter dem Boot zu nutzen, tasteten sie sich jetzt fast wie Blinde voran. Und Swid war immer noch nicht klar, welche Feinde sie hier am meisten fürchten sollten – die lästigen Stechmücken, die sie unablässig quälten, das Fieber, das drei seiner Männer gepackt hatte, die seltsam haarigen Biester, die er anfangs für besonders hässliche Kobolde gehalten hatte, die Alathaia aber Affen nannte, das Volk der Holden, das im Verborgenen lauerte und mit giftigen Blasrohrpfeilen schoss, oder die Echsen, deren Tempel sie wohl schänden würden, wenn sie denn ihr Ziel erreichten. Wie alle seine Männer, so hoffte auch Swid darauf, dass es reichlich Gold im Echsentempel geben würde, damit sich all diese Mühen am Ende auch lohnten.
Ein Keckern im Geäst über ihnen ließ Swid zusammenzucken. Nie war es still in diesem Waldmeer. Das waren die verdammten Affen! Er legte den Kopf in den Nacken, und kurz glaubte er, einen Totenkopf zwischen den Ästen zu sehen. »Einen Armbrustbolzen in die Fresse, das ist es, was du brauchst«, grummelte er vor sich hin, während sein Magen sich wie ein Eisklumpen anfühlte. »Und einen guten Schnaps für mich«, murmelte er weiter. Broja hatte an ihrem letzten Tag in Rosan einen Birnenbrand angeschleppt, der köstlich war. Davon ein Tröpfchen …
Wieder ging das keckernde Lachen los. Swid ballte wütend die Fäuste. Er sollte jemand anderen hier hochschicken. Er war einfach zu müde. Er sah zu schlecht. »Ich werde mal …«
Laurelin legte ihm eine Hand auf die Schulter und zischte leise: »Still. Wir werden beobachtet …«
Der Eisklumpen in seinem Magen begann zu wachsen. Nervös sah Swid sich um. Eine Stechmücke umschwirrte ihn. Ganz in der Nähe glitt etwas Großes durch das Wasser. Er sah die Welle, die davor hertrieb, ohne erkennen zu können, was es war.
Er zog den Stopfen aus dem Sprachrohr. »Zwei Strich steuerbord«, raunte er und wurde durch ein weiteres Zischen des Elfen verwarnt.
»Aye, Käpt’n«, erklang Grumgris vertraute Stimme durch das Blechrohr, und Swid spürte, wie der Aal leicht den Kurs änderte.
Wieder erscholl das Keckern über ihren Köpfen. Dieses Mal hielt es lange an, war wie ein auf- und absteigender Singsang, auf den irgendwo im Dunkel ein ähnlicher Ruf antwortete. Das Biest oben in den Ästen folgte ihnen.
Die Stämme der Bäume in diesem Abschnitt des Waldmeers waren so dick wie Festungstürme. Ihre Äste bildeten an manchen Stellen grüne Gewölbe, die sich so hoch über ihnen spannten, als glitten sie mit der Bolzenspucker durch einen Palast, der einst für Riesen erbaut worden war. Es war leicht, ihnen dort oben zu folgen. Aber Laurelin blickte gar nicht zum Astwerk empor, sondern spähte durch die Nebelschwaden nach steuerbord. Dort leuchtete ein fahles blaues Licht etwa zwei Schritt über dem Wasser, so schwach, dass es manchmal ganz hinter dem wogenden Dunst verschwand.
Swid fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen. Er hatte das Gefühl, als sei das Licht dort, um sie anzulocken. Sie sollten es meiden und den größtmöglichen Abstand halten.
Er hörte ein leises Scharren auf den Sprossen der Leiter, die in den Turm der Bolzenspucker führte. Alathaia schob sich durch das Luk. Wortlos spähte auch sie nach steuerbord, und Swid hatte das Gefühl, sie habe schon unten im Boot das Licht gespürt.
Die Fürstin deutete auf das fahle Leuchten. »Dort beginnt das letzte Stück des Weges zum Drachentempel.«
Dass ihre Feinde ihnen den Weg zum Tempel ausleuchteten, klang gar nicht gut, dachte Swid.
»Setze Kurs auf das Licht«, befahl Alathaia.
Swid beugte sich über das Sprachrohr. »Noch einmal drei Strich steuerbord. Langsame Fahrt.«
»Drei Strich steuerbord, langsame Fahrt. Aye, Käpt’n«, bestätigte Grumgri.
Aus dem Augenwinkel sah Swid wieder die Bugwelle im Wasser. Sie bewegte sich ein paar Schritt entfernt parallel zu ihnen, und dann verschwand sie plötzlich. Was immer da mit ihnen schwamm, war untergetaucht. Wie konnten Alathaia und Laurelin so ruhig bleiben? Hatten sie nicht bemerkt, dass hier irgendeine Bestie unterwegs war?
Swid schlug sich mit der flachen Hand auf den Hals, dass es nur so klatschte, und erntete dafür einen tadelnden Blick des Bogenschützen. Dafür konnte er spüren, dass er einen der kleinen Blutsauger zermalmt hatte. Immerhin eine Bestie weniger, dachte er zufrieden.
Das fahle Leuchten ließ nun die Umrisse einer Gestalt erkennen, die an einen Pfahl gefesselt zu sein schien. Der Nebel war dort dichter, als sollte er vor Blicken verbergen, wer dort auf sie wartete.
»Sie sind überall«, flüsterte Laurelin und wies mit einer vagen Geste zu den Ästen hoch über ihnen. »Und es sind nicht nur Schädelaffen.«
»Ich weiß«, sagte Alathaia mit einer Gelassenheit, die Swid noch erschreckender fand als die Worte des Elfen.
»Fahrt drosseln«, raunte er in das Blechrohr.
Der Pfahl war nun keine zehn Schritt mehr entfernt, die Gestalt ein hagerer nackter Elf. Der Kopf war dem Unglücklichen auf die Brust gesunken, die langen blonden Strähnen hingen ihm vorm Gesicht. Swid erschauderte. Da waren klumpige, dunkle Stellen im Haar und auch auf der Haut des Elfen. Arme und Beine waren nach hinten gebogen und schlangen sich auf unnatürliche Art um das Holz, das Wind und Wetter grau hatten werden lassen.
Der Aal wurde langsamer. Swid konnte spüren, wie seine Gefährten kaum noch in die Pedale traten. Und wie sie in der stickigen Hitze dort unten schwitzten.
Die fahle Haut der Gestalt am Pfahl schien von innen heraus zu leuchten, ein blasser Schimmer in der Dunkelheit. Sie waren jetzt so nah, dass Swid sehen konnte, wie sich im Fleisch der Arme und Beine als Wölbungen die Enden gebrochener Knochen abzeichneten. Die Flecken auf der Haut und im Haar waren Moos, das auf dem Körper des Toten wuchs. Der Zwerg hatte schon Geschichten darüber gehört, dass erschlagene Feinde als Trophäen ausgestellt wurden, aber er hatte so etwas Abstoßendes noch nie zuvor gesehen.
Ein kalter Hauch strich über Swids Wangen.
Laurelin zog neben ihm lautlos einen Pfeil aus dem Köcher und legte ihn auf die Sehne.
Über ihnen war der Himmel frei. Kein Astwerk verdeckte den Mond und die Sterne. Die Nebel zogen sich von der Bolzenspucker zurück und umgaben sie nun in einem weiten, wirbelnden Kreis.
Es lag eine Spannung in der Luft wie vor einem Sommergewitter. Swids Haut prickelte. Sein Barthaar sträubte sich, und im Dunkel sah er kleine blaue Funken darin tanzen, als wollte das Licht, das den Toten umgab, auf ihn überspringen.
»Ich spüre deine Furcht, Zwerg.« Die Kreatur am Pfahl hob den Kopf. Blaues Licht leuchtete aus den leeren Augenhöhlen und dem offenen Mund.
»Forayn Baumsteiger …«, entfuhr es Alathaia.
»Sieh mich an, Zwerg!« Die hohle Stimme des Elfen ging Swid durch und durch. Der Tote wandte den Kopf. Der Schädel war nach hinten verlängert. Er wirkte aufgedunsen. »So wie mir ergeht es ihren Gefolgsleuten. Sie hat mich zurückgelassen. Die Echsen haben mich in die Mangroven gezerrt, und meine Gefährten haben nicht nach mir gesucht. Sie haben mich im Stich gelassen. Ich habe hier gewartet … Jahrhunderte … So viele verlorene Seelen. Sie alle …«
Alathaia zog ihr Schwert, war mit einem Satz im Schilf auf der Außenhülle des Aals, vollführte einen zweiten Sprung und durchtrennte dem Elfen mit solcher Kraft die Kehle, dass sie ihm den Kopf vom Rumpf schlug. »Er lügt«, sagte sie entschieden. »Hier wirkt die schwarze Magie der Echsen. Ich habe niemanden im Stich gelassen.«
Swid nickte, ohne wirklich überzeugt zu sein.
Auch Laurelin betrachtete die Fürstin mit gerunzelter Stirn.
Ein kleines blaues Flämmchen erschien vor dem Bug der Bolzenspucker. Es schwebte kaum eine Handbreit über dem Wasser. Dann erschien noch eins und noch eins, bis sich eine ganze Reihe von blauen Lichtern vor ihnen erstreckte.
In ihrem Schein waren undeutlich die Stämme der Bäume zu erkennen. Wie gewaltige schwarze Säulen ragten sie empor und verloren sich in der Finsternis. Der Mond war hinter Wolken verschwunden, und Swid hatte das Gefühl, dass sie sich bereits im Inneren eines Tempels befanden, der dem Dunkel geweiht war.
Wieder erscholl das keckernde Lachen hoch in den Wipfeln, und Swid beschlich eine Ahnung, dass diese Kreaturen genau wussten, was die Besatzung der Bolzenspucker erwartete.
DER WEG DES LICHTS
Eine Reihe fahlblauer Lichter lockte sie tiefer in die Finsternis der Mangroven. Geschundene Gestalten, auf Pfähle geflochten, markierten den Weg zum Tempel. Alathaia hörte nicht mehr auf ihr Raunen, aber ihr entging nicht, dass diese Schreckensgestalten Laurelin und Swid beunruhigten. Sie hörten die Worte. Die Vorwürfe, die Verlockungen und Drohungen. Nicht allein Elfen wurden auf so schändliche Art zur Schau gestellt, es waren auch etliche Kobolde und einige Echsen darunter. Und dann erreichten sie eine Gruppe von drei Zwergen.
Swid starrte sie entsetzt an. Seine Augen hinter den Gläsern, auf denen das blaue Licht flackerte, wirkten noch größer als sonst.
»Hüte dich vor dem Tempel, Swid«, krächzte ein rothaariger Zwerg, in dessen dichtem Bart sich eine Winkerkrabbe eingenistet hatte, die sie mit der größeren ihrer beiden Scheren grüßte. »Sieh uns an! Das Gold darin ist verflucht und bringt nichts als Unheil!«
Alathaia legte dem Kapitän eine Hand auf die Schulter. »Sie fürchten uns, Swid, sonst würden sie nicht versuchen, uns zu erschrecken.«
Der geschundene Zwerg und seine beiden Leidensgenossen verfielen in ein keckerndes Gelächter, das an die Laute der Affen erinnerte, die ihnen hoch oben im Geäst folgten.
Alathaia spürte, wie Swid erzitterte, aber er blieb auf seinem Posten und gab leise Befehle durch das Blechrohr, wenn der Kurs der Bolzenspucker korrigiert werden musste. Die Reihe der Pfähle führte den Aal durch eine Allee aus gewaltigen Bäumen. Wurzelwerk, das selbst Orkanen trotzte, wand sich schlangengleich im Wasser, doch mitten zwischen den beiden Baumreihen war eine schmale Fahrrinne verblieben.
Es war wie bei ihrem letzten Besuch des Drachentempels, dachte Alathaia resigniert. Es war ihr erneut misslungen, die Echsen zu überraschen. Sie wurden ohne Zweifel erwartet. Bei dem gescheiterten Überraschungsangriff vor unendlich vielen Jahren, als sie noch nicht einmal Fürstin gewesen war, hatte die Schlangenkönigin das Echsenvolk und die Holden befehligt. Wer wartete nun in dem Tempel, der noch ein Relikt aus der Zeit war, in der die Himmelsschlangen über Albenmark geherrscht hatten?
Alathaia wusste, dass im Allerheiligsten des Tempels der Schädel eines jener Götterdrachen aufbewahrt wurde. Es gäbe keinen besseren Ort, um das Ritual durchzuführen, das sie für immer vor Emerelles Willkür schützen würde. Dort, im Allerheiligsten des Tempels, hatte sie einst die Macht der Karfunkelsteine vor dem Gift der Schlangenkönigin gerettet. Nun würden ebendiese Steine am nämlichen Ort ihr Fürstentum retten, wenn alles gut ging.
Flüsternd ließ der Zwerg noch einmal den Kurs der Bolzenspucker ändern.
Es war seltsam, dass sich Ilak ganz ruhig verhielt, dachte Alathaia argwöhnisch. Die Blutkönigin hatte einst hier im Waldmeer geherrscht. Es schien sie nicht zu berühren, dass sie nun zurückkehrte. Oder war sie so ergriffen, dass sie sich zurückhielt?
Plötzlich lag eine Spannung in der Luft. Die feinen Härchen an Alathaias Armen richteten sich auf. Jemand griff nach dem Goldenen Netz und hatte begonnen, einen Zauber zu weben.
»Sie wissen, dass wir kommen, Kapitän. Öffnet die Blende des Barinsteins unter der Bolzenspucker, und öffnet auch die Blenden der großen Fenster in der Kapitänskammer. Ich will, dass sie uns kommen sehen.«
Der Zwerg sah zweifelnd zu ihr auf. »Wir werden sehr gute Ziele abgeben. Vielleicht sollten wir uns in den Aal zurückziehen und das Turmluk dicht machen. Dann sind wir unangreifbar.«
»Ich wollte in aller Heimlichkeit hierherkommen, was offensichtlich nicht geglückt ist«, sagte Alathaia gefasst. »Nun werde ich hier nicht die Schnecke abgeben, die sich tief in ihr Haus verkriecht und hofft, dass ihr nichts geschehen wird. Die Bolzenspucker soll all ihre Lichter zeigen! Ich bin nicht dazu geschaffen, in aller Demut als Bittstellerin aufzutreten. Als ich das letzte Mal hierherkam, habe ich die Herrscherin des Waldmeers erschlagen.«
»Und genau das macht mir Sorgen«, murmelte Swid in seinen Bart, gerade so laut, dass sie es eben noch hören konnte. »Alle Blenden auf!«, rief er in sein Sprachrohr. »Wir zeigen alle Lichter der Bolzenspucker!«
»Was?«, hallte es blechern aus dem Rohr.
»Wir sind Zwerge!«, raunzte Swid. »Wir zeigen den verdammten Geschuppten, dass wir die Nachfahren der Helden sind, die die Himmelsschlangen erlegt haben.«
»Aye, Käpt’n«, rief Grumgri, hörbar begeistert. »Machen wir es wie der große Hornbori! Treten wir den Geschuppten in den Arsch, dass sie unsere Stiefelspitze auf der Zunge schmecken!«
Alathaia musste lächeln. Swid hatte seine Männer gut im Griff. Seine Zweifel hatte er für sich behalten und Entschlossenheit gezeigt. So sollte ein guter Anführer sein! »Wir kommen hier mit heiler Haut heraus, das verspreche ich dir, Kapitän.«
Die Worte waren ihr kaum über die Lippen gekommen, da leuchtete der Strahl der schwenkbaren Lampe unter dem Aal auf und schnitt golden durch das trübe Wasser. Knirschend öffneten sich die Blenden vor den Fenstern der Kammer des Kapitäns, die so geschnitten waren, dass sie von ferne wie glühende Augen aussahen. Wer es nicht besser wusste, konnte die Bolzenspucker für irgendeines der Ungeheuer aus den Weiten des Waldmeers halten.
»Laurelin, wirf das Schilfgras und den morschen Stamm vom Rumpf der Bolzenspucker«, befahl Alathaia. »Wir wollen den Echsen und den Holden unseren Aal in all seiner Pracht zeigen.«
»Aye, Fürstin«, erwiderte der Elf ungewohnt schneidig. Offensichtlich hatte er sich von der Begeisterung der Zwerge anstecken lassen.
Alathaia verließ den Turm und half ihm. Golden erstrahlten die Lichter der beiden Bugfenster.
Die Arbeit ging schnell von der Hand. Sie hatten den Rumpf des Aals fast abgeräumt, als Alathaia bemerkte, dass das keckernde Lachen, das sie seit Stunden begleitet hatte, verstummt war. Die Lichter des Aals wurden blasser, als tauchte die Bolzenspucker langsam in trübes Wasser ab. Nach wenigen Herzschlägen waren sie gänzlich verschwunden. Kein Licht war mehr zu sehen. Ein Prickeln, das sich zu einem Brennen steigerte, als würde ihr Leib mit Nesseln gepeitscht, überlief Alathaia. Es war so finster, als hätte man ihr die Augen ausgestochen.
»Was ist los?«, hallte Grumgris Stimme aus dem Blechrohr. »Hier unten ist es zappenduster, Käpt’n. Der Barinstein an der Decke ist kaputt.«
Eine halbe Meile vor ihnen erhob sich ein silberner Lichtstrahl senkrecht aus dem Tempel, der auf die Entfernung wie ein schwarzer Fels erschien. Hunderte feiner Blitze zweigten aus dem Silberstrahl ab. Sie krochen über die Äste der riesigen Bäume und tauchten den gewölbten Tunnel, den die mächtigen Zweige bildeten, in ein blasssilbernes Licht.
Konnte Alathaia eben noch ihre Hand nicht vor Augen sehen, so war nun alles überdeutlich erleuchtet: das bleiche Moos, das gleich langen Bärten von den Ästen der Bäume hing, der Tempel mit seinen drei Toren, die wie Drachenmäuler gestaltet waren, Hunderte von Schädelaffen, die sich schweigend auf den niedrigsten Ästen der Mangroven versammelt hatten, und unzählige Nachen, die aus allen Himmelsrichtungen dem Tempel entgegenstrebten.
»Ruhig«, befahl Alathaia und schob eine letzte Schilfinsel samt schlammigem Wurzelwerk von der Außenhülle des Aals. »Wir ziehen uns in den Turm zurück.«
Laurelin nickte.
Alathaia bemerkte, leicht irritiert, eine kleine Geflügelschere in der Hand des Bogenschützen. Doch dann dachte sie nicht weiter darüber nach, sondern wandte sich dem niedrigen Turm des Boots zu.
Swid hatte beide Hände auf das Schanzkleid gelegt, vermutlich, um sein Zittern zu verbergen. Sein Zähneklappern vermochte er nicht zu unterdrücken. »Die sind uns hundert zu eins überlegen.«
»Ich würde eher sagen, dass das Verhältnis noch schlechter ist«, entgegnete sie ruhig und nahm den Platz neben ihm ein. »Viel Feind, viel Ehr, ist das nicht so ein Zwergenspruch aus alten Zeiten?«
Swid tat einen verzweifelten Seufzer. »Etwas weniger Ehre wäre mir lieber.«
Der Drachentempel war jetzt noch etwa hundert Schritt entfernt. Etliche Nachen drängten sich vor ihnen in der Fahrrinne. Die flachen Boote waren vier bis sieben Schritt lang und kaum einen halben Schritt breit. Sie wurden vom Heck aus mit langen Stangen gestakt oder mit einem überkreuzten Ruderpaar vorangetrieben.
Immer noch war kein Laut zu hören.
Die Gestalten in den Nachen waren nackt, ihre Leiber mit Kalk eingerieben. Nur rings um die Augen hatten sie sich Ruß geschmiert, sodass ihre Gesichter wie Totenschädel aussahen.
Manche der Nachen näherten sich auf weniger als einen Schritt, doch stießen keine gegen den Rumpf des Aals. Die Boote waren mit Echsen und Kobolden aus dem Volk der Holden bemannt. Ab und an entdeckte Alathaia auch andere Geschöpfe. Bocksbeinige Faune, einen einzelnen Kentauren und eine Handvoll Blütenfeen. Selbst diese kaum fingerlangen Geschöpfe mit den Schmetterlingsflügeln hatten sich weiß bemalt.
Doch eines war anders als bei Alathaias letztem Besuch des Drachentempels: Nicht eines der Geschöpfe war merkwürdig verändert. Nicht eines hatte Krabbenbeine oder statt einer Hand eine Krebsschere. Auch entdeckte Alathaia nirgends überzählige Arme und Beine. Wer immer im Tempel herrschte und seine Zauber wob, hatte nicht die Unart der Schlangenkönigin übernommen, das Fleisch ihrer Untertanen zu formen und groteske neue Kreaturen zu erschaffen.
Jetzt waren sie nur noch wenige Schritt von der breiten Treppe entfernt, die vom Tempel bis zum Wasser hinabreichte. Die hohen gesplitterten Stufen waren einst für Kreaturen erschaffen worden, die deutlich größer als Elfen gewesen sein mussten. Sie waren zu hoch. Es würde unbequem werden, sie zu erklimmen.
Eine Schar Echsen mit roten Kehllappen erwartete sie auf den Stufen, aufrecht stehend, wobei sie sich auf ihren breiten Schwanz stützten. Sie trugen ein verwirrendes Geflecht aus Metallen und Edelsteinen, das ihre Brust ebenso bedeckte wie Teile ihres Nackens und ihrer Vorderbeine. Dazu kam bunter Federschmuck.
Alathaia senkte die Lider und öffnete ihr magisches Auge, um einen Blick auf das Goldene Netz zu werfen, das sich hinter der sichtbaren Welt verbarg. Ein Gespinst von Kraftlinien verband die Echsen miteinander. Sie woben ihre Zauber gemeinsam! Die Geschuppten scheuten nicht davor zurück, die Harmonie der Welt zu stören und den Preis dafür zu zahlen.
»Kurbelwelle halt«, raunte Swid in das Sprachrohr. »Ruder hart steuerbord.«
Mit letzter Fahrt beschrieb der Aal einen scharfen Bogen und schrammte an den Stufen des Tempels entlang.
Alathaia öffnete die Augen. Die Zauberweber der Echsen blickten erwartungsvoll von der Mitte der Treppe zu ihr herab. Jetzt sah sie das Gitterwerk von tiefen Furchen in ihrer Schuppenhaut. Das Goldene Netz hatte sie für ihre frevelhafte Magie gezeichnet.
Rings um den Aal lagen nun über hundert Nachen. Die Echsen und Kobolde starrten sie schweigend an. Immer noch war kein Laut zu vernehmen. Eine schier unerträgliche Spannung lag in der Luft.
Laurelins Blick huschte unstet von den Zauberwebern zu den stämmigen Echsenkriegern, die sich an den Toren des Tempels sammelten, und weiter zu den Holden und Echsen auf den Booten, von denen viele lange Blasrohre mit sich führten, als überlegte er, wie sie gegen die Übermacht bestehen sollten. Dabei, da war sie sich ganz sicher, würde es gar nicht notwendig werden, dass sie auch nur einen Schuss abgaben.
»Du wagsst disch wie derrr hier herrr, Al A Thaia von Lang Ollion?«, zischelte eine Echse, die einen großen Rubin auf der Brust trug. »Wirrr ha ben nischt vergessssen, wasss du getan hassst.«
Das hatte sie auch nicht erwartet, dachte Alathaia. Doch was in der Vergangenheit geschehen war, würde nichts im Vergleich zu dem sein, was sie nun tun würde, wenn sich ihr die Echsen in den Weg stellten.
»Opfere disch!«, zischte der Rubinträger. »Dann dürrr fen die an deren zzziehen.«
Dadurch, dass die Echsen und Holden so zahlreich gekommen waren, hatten sie, ohne es zu ahnen, Alathaias Macht vervielfacht. Die Fürstin konzentrierte sich auf das Wort der Macht, mit dem sie den Zauber entfesseln würde, der sich aus ihren Feinden nährte.
»Tötet sssie«, zischte die Echse, und der rote Hautlappen an ihrer Kehle erzitterte vor Zorn.
Die Krieger an den Tempeleingängen setzten sich in Bewegung, fast drei Schritt große Unholde mit Krokodilschnauzen, in Rüstungen aus runden Bronzescheiben und mit Waffen, die an die Hackmesser von Fleischhauern erinnerten.
Alathaia öffnete den Mund, doch ihre Zunge war mit einem Mal vollkommen starr. Kein Laut kam ihr über die Lippen.
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Laurelin die Geflügelschere an den kleinen Finger seiner Linken setzte und die Griffe zusammendrückte, während einer der Echsenkrieger ein Hackmesser nach ihr schleuderte.
BLUTIGES GLÜCK
Laurelin keuchte auf vor Schmerz. Er schob die Schere in seinen Gürtel und presste die verstümmelte Rechte auf den blutenden Stumpf. Und dann sah er es. So stark hatte der Fluch des blutigen Glücks, den er soeben freigesetzt hatte, noch nie gewirkt. Das Hackmesser, das der Echsenkrieger nach der Fürstin geschleudert hatte, verharrte einige Zoll vor Alathaia in der Luft.
Einige der Echsen, die sich mit Geschmeiden behängt hatten, wichen auf der Treppe zurück. Das silbrige Licht begann zu flackern, und es wurde schlagartig kälter. Raureif kroch leise knisternd über das feuchte Mauerwerk nahe dem Wasser.
Alathaia rief etwas, das Laurelin in den Ohren schmerzte. Es waren Laute, wie er sie noch nie gehört hatte, und ihre Wirkung auf die Echsen war verblüffend. Jetzt wichen sie alle zurück.
Die Fürstin bediente sich einer Sprache, die Laurelin regelrecht Übelkeit verursachte und ihn den Schmerz des abgetrennten Fingers vergessen ließ. Auch Swid stöhnte laut auf. Die Echsen aber knieten vor Alathaia nieder, und mit kurzer Verzögerung gingen auch all die anderen Kreaturen in ihren Nachen auf die Knie. Es sah aus, als würden sie sich der Fürstin von Langollion unterwerfen.
Wieder sprach Alathaia in dieser quälend fremden Sprache.
»Zieht euch zurück, Nestbrüder und Freunde!«, rief die Echse mit dem Rubinschmuck auf der Brust. »Es droht dem Tempel keine Gefahr.«
Laurelin spürte, wie ihm das warme Blut durch die Finger der Hand rann, die er auf seine neue Wunde presste, doch er hatte keinen Blick für die Verletzung. Staunend sah er, wie Bewegung in die Boote kam, die sie eingekreist hatten. Lautlos, wie sie gekommen waren, stakten sie in die Nacht.
»Warum hast du das getan?«
Laurelin brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass sie mit ihm sprach. »Ich habe es getan, um uns zu retten.«
Alathaia griff nach dem Hackmesser, das immer noch vor ihr in der Luft schwebte, und warf es beiläufig in das brackige Wasser. »Du hast ihn für uns geopfert. Das ist nobel, Laurelin.« Sie bückte sich und nahm den abgetrennten Finger auf. »Dein Edelmut soll dir vergolten werden.«
»Was ist hier geschehen?«, fragte Swid leise, als befürchtete er, ein lautes Wort könnte dieses Wunder ungeschehen machen.
»Sie haben verstanden, dass wir nicht gekommen sind, um jemanden zu töten oder den Tempel zu schänden. Wir sind eingeladen, die Wunder des Allerheiligsten zu schauen. Ich werde dich nicht vergessen.« Alathaia ergriff seine Hand, strich sanft darüber, und ein Prickeln lief ihm über die Haut. Dann entstieg die Fürstin dem Turm und betrat den gewölbten, eisernen Rumpf des Aals.
»Wir verhandeln mit den Echsen«, sagte Swid in sein Sprachrohr. »Deckwache hochkommen! Den Elfen steht es frei, sich der Fürstin anzuschließen.«
Laurelin stützte sich mit der rechten Hand am Schanzkleid ab und betrachtete seine Linke. Die Blutung war gestillt, und eine blassbraune Kruste bedeckte die frische Wunde.
Alathaia indes stieg nun mit seinem abgetrennten Finger die viel zu hohen Stufen zum Tempel hinauf.
»Was genau war das jetzt mit deinem Finger?«, fragte ihn Swid, während Xylon durch die Luke in den Turm heraufkam, sich kurz umsah und dann seiner Mutter folgte.
»Das ist so ein Trollfluch …« Laurelin stand nicht der Sinn danach, sich zu erklären. Am Ende würde er noch wie ein Angeber dastehen. Er hatte es getan, weil es richtig war. Weil er den Eindruck gehabt hatte, sie seien rettungslos verloren und nur sein Opfer könne dem Schicksal noch eine Wende geben. Und so war es gekommen. Das zu wissen, war ihm eine tiefe Genugtuung. Er musste sich nicht vor anderen damit brüsten. Zumal er sich sorgte, was als Nächstes geschehen würde. Bislang waren seine Wunder stets von Tragödien begleitet worden. Sein Jagdgefährte und Mentor Morwallon war von den Trollen grausam getötet worden. Kimmi, die Damien, die ihm auf seiner Flucht geholfen hatte, als er zu schwach gewesen war, sich noch auf den Beinen zu halten, war ums Leben gekommen, ebenso Golwyn, der samt seinem Fischerboot gesunken war, als ihn in der Bucht vor dem Drachengrab ein Pferdetritt tötete, und Melyssana, die auf dem Mondfest ins Mondlicht gegangen war. Wer ihm nahestand, war in tödlicher Gefahr, wenn das blutige Glück ihn rettete.
Nanduval stieg an ihm vorbei aus der Luke und strafte Swid mit einem grimmigen Blick. Es hatte Streit zwischen den beiden gegeben, als der Zwerg darauf bestanden hatte, dass der Hauptmann unter Deck bleiben müsse, wenn Alathaia in den Turm stieg. Swid hatte Sorge gehabt, der dann kopflastige Aal könnte kentern, wenn sich drei Elfen und ein Zwerg in dem kleinen Turm drängten.
Laurelin folgte dem Hauptmann, um weiteren Fragen zu entgehen. Es war ungewohnt, den Bogen mit der verstümmelten Linken zu halten.
Der Raureif auf den unteren Stufen schmolz dahin. Verdrossen sah er zum Tempel auf, der sich so massig wie ein Berg über ihm erhob. Die drei Portale waren wie weit aufgerissene Drachenmäuler gestaltet. Die ganze Fassade war mit Steinbildern bedeckt, die kämpfende Drachen zeigten. Entsprach das, was dort zu sehen war, auch nur annähernd der Wahrheit, dann hatte es einst Drachen gegeben, die weit über hundert Schritt lang waren und ganze Städte mit ihrem Flammenatem verbrannt hatten. Eine Schlacht um eine Brücke fiel ihm ins Auge. Es wirkte alles übertrieben, doch wusste er es besser, schließlich hatte er die Drachenschädel in Leynelles Höhle und im Grab der Blutkönigin gesehen.
Es widerstrebte ihm, den Tempel zu betreten, aber Xylon und Alathaia verschwanden bereits im mittleren Eingang. Sie waren von Echsen umringt.
Schützte der Fluch sie noch? Die verdammten Stufen zum Tempel waren dreimal so hoch wie gewöhnliche Treppenstufen. Es war eine Quälerei, sie zu erklimmen. Als er die Tore erreichte, waren die Fürstin, ihr Sohn und der Hauptmann schon verschwunden.
Ohne zu zögern, trat er ein. Es war schwülwarm im Tempel. Das Gemäuer hatte die Farbe von eingetrocknetem Blut. Auch hier waren die Wände mit Steinbildern geschmückt, welche die Herrlichkeit der alten Drachen feierten. Hier und da entdeckte er unter Echsen, Kobolden, Elfen und Trollen, die sich den Himmelsschlangen unterwarfen, auch Schlangenfrauen. Was mochte wohl der Grund dafür gewesen sein, dass sich Ilak gegen die Drachenherrscher gestellt hatte? Hier im Tempel sah es so aus, als seien die Schlangenfrauen treue Dienerinnen der Himmelsschlangen gewesen.
Etliche vergitterte Nischen unterbrachen die Steinbilder an den Wänden, die eine fortlaufende Geschichte über die Himmelsschlangen erzählten. Laurelin blieb kurz stehen, als er Drachen entdeckte, die ihre Flammen in Erdlöcher spien. Die Gestalten, die abwartend bei ihnen standen, schienen Elfen zu sein. Laurelin hatte an Bord der Bolzenspucker davon gehört, dass die Drachen vor langer Zeit die Zwergenstädte angegriffen hatten. Harr hatte seine Reisen in dem Aal in der Hoffnung begonnen, vielleicht eine der verlorenen Städte wiederzuentdecken …
»Lass alle Hoffnung fahren«, erklang eine heisere Stimme, die von den Wänden widerhallte.
Ein Stück voraus sah Laurelin zwei bleiche Hände, die sich an rostige Gitterstäbe klammerten. Er lauschte auf die Schritte der anderen. Er hatte keine andere Wahl, als an der vergitterten Nische vorbeizugehen, wenn er Alathaia einholen wollte.
Entschlossen ging er weiter. Als er auf gleicher Höhe mit dem Gitter in der Wand war, warf sich der Gefangene gegen die Eisenstangen. Die Angeln der Gittertür knirschten im Gemäuer. »Verflucht bist du! Verflucht sind alle, die einen Fuß in diesen Tempel setzen!«
Laurelin hielt den größtmöglichen Abstand zu dieser Kreatur, die nun ihre hageren Arme weit in den Gang hinausstreckte.
»Deine Fürstin hat dich verraten«, zischte der Gefangene.
Jetzt sah Laurelin ihn sich doch genauer an. Es war ein Faun mit verwahrlostem Bart. Eines seiner Hörner war abgebrochen. Fahlblaues Licht gloste in seinen Augenhöhlen.
»Du bemitleidest mich, Elf?« Der Faun lachte und stampfte mit seinen Hufen auf. »Du bist derjenige, den es zu bemitleiden gilt. Deine Fürstin betrügt dich. Du hast dir deinen Finger für nichts abgeschnitten, und das wird nicht das Ende deiner Qualen sein. Mir geht es gut. Mein Schicksal ist entschieden. Auf dich aber wartet noch ein schrecklicher Weg.«
Hingestammelter Unsinn eines Irren, dachte Laurelin bei sich. »Vielleicht hast du recht«, erwiderte er dann, »aber ganz sicher bin ich derjenige von uns beiden, der diesen Ort einfach verlassen kann, wenn ihm der Sinn danach steht.« Mit diesen Worten wandte er sich ab und folgte mit großen Schritten Alathaia.
Erst als er eine weite Halle erreichte, wurde er sich bewusst, dass sein Abgang vielleicht eine Flucht gewesen war. Er dachte daran, dass die Fürstin seinen Finger hatte. Irgendwie störte ihn das jetzt, obwohl ihm bislang egal gewesen war, was aus seinen geopferten Fingern wurde. Dass einer der beiden schon früher verlorenen Finger von einem Silberlöwen verschlungen worden war und der andere irgendwo in der Snaiwamark herumlag, war ihm immer noch gleichgültig. Aber warum hatte Alathaia seinen Finger aufgehoben? Was wollte sie damit? Begann das Gift der Worte des Fauns in ihm zu wirken? Es gab doch gar keinen Anlass anzunehmen, dass Alathaia ihn verriet.
Die Fürstin stand in der Mitte der Tempelhalle und blickte zu einer Öffnung hoch über ihren Köpfen empor.
Abgesehen von einigen Feuerschalen, in denen Holzscheite glommen, was die stickige Hitze noch weiter steigerte, war die Halle leer. Das unstete rötliche Licht ließ die Figuren der Steinbilder an den Wänden lebendig wirken. Schatten tanzten zwischen den tief in den Stein getriebenen Drachen, Trollen und Elfen.
In den Boden der Halle waren sich windende Schlangenleiber geritzt, die sich in einem Knäuel in der Mitte der Halle begegneten. Vermutlich markierten sie einen Albenstern. Sehnsüchtig dachte Laurelin an Leynelle. Wenn er ein besserer Zauberweber wäre und wenn er vor allem genau wüsste, wo sie jetzt war, dann könnte er in ein paar Schritten bei ihr sein.
Die Echse mit dem Rubinschmuck begann zischelnd auf die Fürstin einzureden. Dabei benutzte sie eine Sprache, die Laurelin nicht verstand. Das Rot des Hautlappens am Hals der Echse wurde intensiver. Die Krieger, die den Tempel bewachten, hatten sich ein Stück zurückgezogen und standen unterhalb eines Steinbildes, das überaus bizarr wirkte. Es zeigte ein Schiff, das von einer aufgedunsenen Kreatur, die darüber schwebte, mit unzähligen Fangarmen festgehalten wurde. Leicht hinter dem fliegenden Schiff war ein Drache zu erkennen, der es anzugreifen schien.
Nanduval und Xylon, die etwas links von ihm standen, kamen an seine Seite. »Der Drachenschädel ist fort«, raunte ihm der Hauptmann zu. »Wir sind vergebens hierhergekommen.«
»Sie werden uns sagen, wo der Schädel ist«, beschwichtigte ihn Xylon. »Der muss doch riesig sein. Sie können ihn nicht so weit fortgebracht haben.«
»Er lag auf einem Albenstern«, entgegnete der Hauptmann bitter. »Sie können ihn überallhin gebracht haben.« Er machte eine weitschweifige Geste. »Sie hätten den Tempel einreißen müssen, um ihn auf einem anderen Weg hier herauszuschaffen. Der Schädel war riesig. Noch größer als der in Leynelles Höhle.«
»Woher weißt du das?«, fragte Laurelin vorsichtig. Geschichten von Jägern und Trophäen kannte er reichlich, und meist wurden Letztere von Winter zu Winter ein wenig größer.
»Ich war hier!«, entgegnete Nanduval gereizt. »Ich gehörte zu den Auserwählten. Jenen, aus denen die Schattenkrieger hervorgegangen sind. Wir sind mit drei Booten voller Krieger gekommen. Und es war der übelste Kampf, in dem ich je gefochten habe.« Er sah zu den Echsenkriegern. »Die da drüben sind nichts im Vergleich zu den Kreaturen, die uns damals hier erwarteten.«
Laurelin hielt den Hauptmann eigentlich nicht für einen Aufschneider, aber …
»Wir werden tiefer in den Dschungel vordringen«, erklärte Alathaia entschlossen. »Der Schädel ist fortgebracht worden, um ihn vor Schändung zu schützen. Die Echsen vertrauen mir jetzt. Und du, Laurelin, wirst mit der Priesterin gehen und, ohne zu zögern, genau tun, was sie dir sagt.«
»Welche Priesterin?« Laurelin fühlte sich völlig überrumpelt. Die Worte des Fauns gingen ihm wieder durch den Kopf. Deine Fürstin hat dich verraten. Warum waren die Echsen plötzlich so freundlich? Was hatte Alathaia ihnen versprochen? Ihn?
»Zzzirke erwartet dich«, sagte die Fürstin und deutete auf die Echse, die den großen Rubin in ihrem Brustschmuck trug. »Geh jetzt mit ihr!«
MIT PRIESTERINNEN BADEN
»Ausss zzziehen!« Die Priesterin griff sich in den Nacken und löste das merkwürdige Schmuckstück aus Kettchen, Metallscheiben und Gemmen, das sie wie ein Hemd trug.
»Ähm … also …« Das ging doch etwas weit. Laurelin wusste nicht, was er hier sollte. Die Echsen hatten ihn endlose Treppen hinab in eine Kammer tief unter dem Tempel geführt. Es war so schwül, dass ihm das Atmen schwerfiel. Dutzende Öllämpchen brannten in der Kammer. Es roch seltsam. Vor ihnen war ein Loch im Boden, das mit einer grünlichen Flüssigkeit gefüllt war. Dahinter lag ein aus Stein gehauener Drachenkopf, zwischen dessen aufeinandergebissenen Zähnen Arme und Beine hervorlugten. Vermutlich irgendein Altar.
»Ausss zzziehen!«, forderte die Priesterin erneut. Sie legte ihren breiten Gürtel ab. Dann kniete sie nieder und öffnete eine kleine rote Ledertasche. Daraus entnahm sie etwas Längliches, Helles. Laurelin stockte der Atem, als er erkannte, was das war. Sein abgetrennter Finger!
Laurelin griff nach dem Amulett, das Alathaia ihm zurückgegeben hatte. Es erlaubte ihm, ein kleines Stück in die Zukunft zu sehen, solange es auf seiner nackten Haut lag. Er trug es immer über seinem Hemd, um seine Zaubermacht nicht aus Versehen zu nutzen. Es genügte, die Worte Blicke voraus auszusprechen oder auch nur zu denken, und seine Magie wirkte.
Die Echse deutete auf ihn und wedelte mit ihrer Hand, als glaubte sie, dass er diese Geste vielleicht besser verstehen würde als ihre Worte. Mit großen gelben Augen stierte sie ihn an. Die Pupillen waren waagerechte Schlitze. Ihr Blick war unheimlich.
Laurelin nahm das Amulett zwischen Daumen und Zeigefinger. Er sah zu dem Drachenkopfaltar hinüber, auf dem sein abgetrennter Finger lag, und versuchte vergeblich, nicht an die Einflüsterungen des Fauns zu denken. Dann senkte er den Blick. Das flache, mit Grünspan überzogene Amulett war wie ein stilisiertes Auge gestaltet. Die erhabenen Stellen glänzten in einem warmen Bronzeton. Blicke voraus, dachte er.
Ihm wurde leicht schwindelig. Einen Herzschlag lang wirkte es, als würden sich zwei Bilder, die nicht ganz zueinanderpassten, überlagern. Er sah sich in das schmierige Wasser steigen, obwohl er noch auf festem Boden stand. Ob die Echsen planten, ihn zu hintergehen, war nicht zu erkennen. Die Priesterin erwartete ihn in dieser Brühe. Sie machte eine Geste in Richtung der Krieger, die sie begleitet hatten. Dann endete die Vision.
Laurelin schluckte. Das hatte gar nichts gebracht. Er könnte einfach die Kammer verlassen, aber er wusste nicht, wie sicher der Frieden war, den Alathaia geschlossen hatte. Wenn er jetzt ging, würde die Priesterin das gewiss als Beleidigung auffassen. Dann mochte alles zunichte sein. Die Zukunft hatte ihm ja schon gezeigt, dass er nachgeben würde. Er legte den Bogen ab, dann beugte er sich vor und zog die Stiefel aus.
Er legte Köcher und Gürtel ab. Als er das Jagdhemd über den Kopf zog, gab die Echse einen Schnalzlaut von sich. Sie sagte etwas in einer Sprache, die er nicht verstand. Ihre Krieger reagierten mit einem Zischeln, das amüsiert klang.
Er streifte die Hose ab. Jetzt trug er nur noch das Amulett.
Die Priesterin machte eine einladende Geste.
Er trat an den Rand des Lochs. Unregelmäßig geformt, wirkte es wie eine natürliche Senke im Felsgestein.
Die Echse hatte den Kopf schief gelegt und sah ihn neugierig an. Zumindest vermutete er das. Ihre Züge waren zu fremdartig, um an ihnen Gefühlsregungen ablesen zu können. Ihr Leib war schlank. Die Schuppenhaut, die überwiegend von hellgrüner Farbe mit einzelnen roten Einsprengseln war, wurde unterhalb des Halses heller, bis sie an Brust und Bauch fast weiß war. Er konnte nichts entdecken, was auf ihr Geschlecht schließen ließ. Dass sie eine Priesterin war, musste er einfach glauben.
Entschlossen setzte er seinen linken Fuß in die grünliche Brühe. Blasen stiegen auf und zerplatzten an der Oberfläche. Das schmierige Zeug war angenehm warm. Der Fels unter seiner Sohle war steil geneigt und uneben.
Vorsichtig setzte er den zweiten Fuß in das Tempelbecken und streckte die Arme seitlich aus, um besser in der Balance zu sein. Die Priesterin quittierte seine Vorsicht mit einem Glucksen.
Er ignorierte das. Vorsichtig kam er ihr Schritt um Schritt näher. Die Brühe, durch die er sich bewegte, hatte eine andere Konsistenz als Wasser. Sie war schleimig. Einmal streifte ihn etwas an der linken Wade. Es tummelten sich also auch noch irgendwelche Viecher in diesem Becken. Laurelin kämpfte den Ekel nieder und richtete den Blick fest auf die Priesterin.
Ihre Augen verengten sich. Als er endlich vor ihr stand, griff sie nach dem Amulett an seinem Hals. Sie berührte es nur kurz, dann ließ sie es erschrocken los. »Dasss alt … Sssehr alt …« Sie schüttelte den Kopf. »Nicht gut!« Dann winkte sie ihren Wächtern. »Messsser!«
Er hatte es gewusst! Laurelin wandte sich um. Die Echsenkrieger waren erstaunlich flink. Sie bildeten einen Kreis um das Becken. Ihre Haumesser funkelten golden im Licht der Öllämpchen. Er würde aus diesem Drecksloch nicht herauskommen! Er war ihnen gutgläubig in die Falle getappt. Deine Fürstin hat dich verraten, ging ihm erneut die Stimme des Fauns durch den Kopf.
Eine der bulligen Echsen stieg ins Tempelbecken. Sie trug einen Dolch aus Obsidian auf den ausgestreckten Krallenhänden. Rote Lederbänder, von denen goldene Amulette hingen, waren um den Griff der steinernen Waffe gewickelt.
Die Priesterin nahm den Dolch. »Deine Hand!«, forderte sie.
Laurelin überlegte, ob er ihr die Waffe entwinden könnte. Mit dem Dolch an der Kehle der Priesterin würde er hier vielleicht herauskommen. Aber wohin? Vielleicht schaffte er es aus dem Tempel, aber den Mangroven würde er nicht entfliehen können, wenn alle Echsen und Holden Jagd auf ihn machten.
Er streckte die verletzte Hand aus.
Die Priesterin ergriff seine Linke und betrachtete sie lange. Sie drehte und wendete die Hand, fuhr mit den Krallen ihrer Finger über die feinen Linien in seiner Handfläche und sagte etwas zu ihren Kriegern. Dann sah sie ihn an. Ihre Pupillen waren so schmal, dass sie fast im Gelb ihrer Augen verschwanden.
»Du hassst ein grossssez Herzzz.«
»Heißt das, ein Echsengott wird sich über die Opfergabe freuen?«
Die Augen der Priesterin weiteten sich. Eine gespaltene, hellrote Zunge fuhr züngelnd aus ihrem Maul. Sie hob den Dolch.
Laurelin zuckte nicht zurück. Wenn er dieses Opfer für die anderen erbringen musste, dann sollte es so sein. Er wäre diesen Weg auch gegangen, wenn man ihn darum gebeten hätte, statt ihn voller Heimtücke hierherzuschicken.
Die Priesterin setzte die Schneide an die verschorfte Wunde, dort, wo er seinen kleinen Finger verloren hatte. Behutsam schnitt sie die Kruste fort. Blut tropfte in das schleimige Wasser. Blasen stiegen auf und trieben die roten Schlieren auseinander. Etwas bewegte sich an seinen Beinen. Fische? Der Schwanz der Echsenpriesterin rollte sich um seine rechte Wade. Sie legte den Kopf in den Nacken und rief etwas in dieser quälend fremden Sprache, derer sich auch Alathaia vor den Tempeltoren bedient hatte.
Immer mehr Blasen stiegen in der Brühe auf. Ein schwefliger Geruch breitete sich aus, und gelblicher Dunst sammelte sich über der Brühe. Ein Prickeln überlief Laurelin.
Die Stimme der Priesterin wurde schriller.
Das Prickeln zog sich in seinem Arm zusammen.
Dann war es nur noch in seiner Hand, als bohrten sich tausend feine Nadeln in seine Haut.
Die Stimme der Priesterin klang fordernd. Ihre Worte überschlugen sich, so hastig sprach sie.
Ein Schmerz, als würde ihm ein glühendes Eisen in die Wunde gerammt, ließ Laurelin aufkeuchen.
Die Echse verstummte. Der Schmerz ließ nach. Es stiegen kaum noch Blasen aus dem Tempelbecken auf. Der Finger, der eben noch auf dem Drachenaltar gelegen hatte, war verschwunden.
Die Priesterin nahm nun auch seine Rechte. Sie strich über die Narben, wo ihm der kleine Finger und der Ringfinger fehlten. »Ssschade, dasss du zzzo ssspät kommzzzt. Isssch hätte dir helfen können.«
Laurelin sah sie verwundert an. Seine Linke schmerzte noch immer. Die Wunde war mit frischer, rosiger Haut überzogen. Etwas wölbte sich darunter. Von dort ging der Schmerz aus.
»Manssschen Gessschuppten wachsssen ver lorene Glie der nach. An deren fällt es leicht Zau ber zu weben, die Verlor enes nach wachsssen lassssen.« Ihre Zunge schoss aus ihrem Maul hervor.
Ihr Antlitz war für Laurelin noch immer undeutbar, aber in ihrer Stimme lag aufrichtiges Bedauern, als sie erklärte: »Mein Volk wird den Tag feiern, an dem die Köni gin zzzurück kam. Isssch hätte dir ger ne mehr gege ben.«
AMEISEN UND SCHMETTERLING
»Da draußen ist die halbe Garde des Kaisers aufmarschiert. Und diejenigen, deren Gesicht man sieht, weil sie keinen Helm tragen, machen eine Miene, als hätten sie verfaulte Heringe gefrühstückt.«
Adelayne, Gräfin von Rosan, zeigte eine Gelassenheit, um die Broja sie beneidete. Zunächst hatte er geglaubt, diese Krieger seien eine Ehrengarde, um Adelayne zur bevorstehenden Hochzeit zu geleiten, aber etwas stimmte nicht mit den verdammten Damien. Bei so einer Aufgabe würde man doch lächeln und nicht dreinschauen, als fräßen einem die Sackratten am Gemächt.
Die Gräfin saß auf einem Klappstuhl vor einem wunderschönen Spiegel, den ihr der Kaiser geschenkt hatte. Eine Dienerin war damit beschäftigt, ihr goldene Schmetterlinge und Haarnadeln, von denen Perlenketten hingen, in die aufgetürmte Frisur zu stecken.
»Es ist wahrlich eine Qual, sich die Haare nach Art der Damien richten zu lassen«, bemerkte Adelayne ruhig. »Sei bitte so gut und hole Leynelle. Sie soll mich begleiten, wenn ich mich den Kriegern widme.«
»Ich fürchte, das kann ich nicht. In meinen Kreisen würde man sagen, das Mädel treibt sich herum … Ich kann mir allerdings vorstellen, wo ich sie finde. Soll ich zum anderen Flussufer übersetzen und sie holen?«
Adelayne zögerte kurz, dann schüttelte sie den Kopf, was die Dienerin, die an ihren Haaren arbeitete, zu einem Entsetzensschrei veranlasste. Zwei goldene Schmetterlinge fielen klirrend auf den Bretterboden des Zeltes. »Dann wirst du mich an ihrer Stelle begleiten«, entschied die Gräfin.
»Ich kann sie wirklich holen gehen«, insistierte Broja, dem die Vorstellung gar nicht gefiel, mit einem Trupp Gardisten herumzulaufen, denen irgendeine Laus über die Leber gelaufen war. Elfen gegenüber bewahrten sie stets einen Rest von Respekt, an Kobolden hingegen ließ jeder seine Launen aus.
»Du solltest dich vielleicht etwas angemessener kleiden«, empfahl Adelayne.
Broja sah an sich herab. An seiner roten Lederweste fehlte nicht ein einziger Knopf, seine kurze gelbe Hose wurde von einem Gürtel gehalten, und seine nackten Füße waren nur mäßig verschmutzt. Adelayne sah in ihrem roten Kleid mit den Goldstickereien, die auf ihrem Rücken einen Feuervogel zeigten, natürlich ungleich eleganter aus. »Nicht jedem stehen Kleider, wie du eins trägst«, sagte er freiheraus. »Ich bleibe, wie ich bin. Nicht jedem liegt es, sich zu verstellen.«
Die letzte Bemerkung brachte ihm einen bösen Blick durch den Spiegel ein. Es herrschte Schweigen, bis die Dienerin die Frisur der Gräfin vollendet hatte. »Also gehen wir.« Adelayne bedeutete ihm mit einer knappen Geste, ihr zu folgen.
Die Dienerin beeilte sich, ihnen vorauszueilen und die Klappe am Eingang des Zeltes zurückzuschlagen. Ihr Lagerplatz innerhalb des gewaltigen kaiserlichen Heerlagers umfasste nur sechs Zelte. Das größte gehörte Adelayne. Leynelle hatte ein kleines eigenes Zelt. Die übrigen vier teilte sich das Gesinde. Für ihn gab es keinen richtigen Schlafplatz. Er musste jeden Abend aufs Neue schauen, wo er unterkam.
»Hauptmann Tian, erfreut Ihr mich von nun an jeden Morgen mit Eurem Besuch?«, grüßte Adelayne den Anführer der Krieger.
Der Hauptmann presste verkniffen die Lippen zusammen. Sein schwarzes Haar war mit irgendeinem Öl behandelt, streng nach hinten gekämmt und zu einem Knoten hochgesteckt. Sein kantiges Gesicht wirkte angespannt.
Klarer Fall von Stock im Arsch, dachte Broja und war überaus zufrieden damit, dass wohl niemals irgendjemand auf die Idee kommen würde, ihn zum Befehlshaber einer Leibwache zu machen.
»Schön, dass Ihr heute Morgen nicht zum Reiten auffordert«, setzte Adelayne genussvoll ihre Sticheleien fort. »Womit kann ich Euch dienen, Hauptmann?«
»Ich muss Euch bitten, dass Ihr Euch mit mir in aller Eile zum Zelt des Lichts des Himmels begebt.«
»Was wünscht der Kaiser von mir?«
Wie sie den Kerl mit ihren Fragen piesackte, würde jedem Kobold zur Ehre gereichen, dachte Broja vergnügt. Der Damienhauptmann war ganz bleich vor Wut und Verzweiflung.
»Bitte, Herrin. Die Zeit drängt. Ich werde Euch all Eure Fragen beantworten, wenn wir vor dem Zelt des Kaisers stehen. Eure Anwesenheit ist von größter Bedeutung. Es eilt …« Er senkte demütig das Haupt. »Verzeiht mir, wenn ich Euch bedränge. Die Not gebietet es mir, mit der Etikette des Hofs zu brechen.«
Das klang nicht gut, dachte Broja.
Auch Adelayne war nicht mehr in der Stimmung, Tian zu reizen. Sie deutete entschuldigend auf ihr Kleid. »Ich fürchte, in diesem Gewand werde ich nicht mit Euch Schritt halten können.«
»Der Staub der Wege verdient es nicht, durch Eure Schritte geadelt zu werden.« Tian klatschte zweimal in die Hände. Ein Teil der Krieger, die Schulter an Schulter standen, wich zur Seite. Hinter ihnen war eine vergoldete Sänfte mit kirschroten Seidenvorhängen abgestellt. Nicht weniger als zwölf Trägerinnen in kurzen roten Kleidern warteten bei der Sänfte, bereit, sie auf den Bambushügel des Kaisers zu tragen.
»Ich hätte wissen müssen, dass Ihr vorbereitet seid, Hauptmann Tian«, sagte Adelayne in einem Tonfall, den man von jedem anderen als beleidigend empfunden hätte, bei dem man bei Adeligen aber geneigt war, ihn als Kompliment aufzufassen.
Fasziniert bemerkte Broja, wie sich der Hauptmann ein kurzes Lächeln gestattete, und beeilte sich, neben Adelayne Platz zu nehmen, kaum dass sie sich auf dem gut gepolsterten Sitz niedergelassen hatte.
Die Garde begann in leichtem Trab zu laufen. Die Trägerinnen hatten keine Mühe, mit den Bewaffneten Schritt zu halten, und es waren keine Rufe nötig, um den Weg für sie frei zu machen. Alle wichen den golden gepanzerten Kriegern in den weißen Waffenröcken aus.
Doch Broja bemerkte auch, dass überall kleine Grüppchen zusammenstanden und diskutierten. Etwas musste vorgefallen sein. In den Blicken, die ihnen folgten, lag Sorge.
Schnell erreichten sie den Bambushügel. Hier flankierten unzählige Krieger den Weg. Auf der rechten Seite standen die Leibwachen der Prinzessin, die das Rot der Morgenröte trugen, links die Gardisten des Kaisers, deren Waffenröcke so makellos weiß wie Kirschblüten waren.
Broja entging nicht, wie sich die rivalisierenden Wachen des Palasts anstarrten. Fäuste waren so fest um Speere geschlossen, dass die Knöchel weiß hervortraten, Hände lagen auf Schwertgriffen. Ein falsches Wort, und die Wachen würden übereinander herfallen. Was war hier los? Heute sollte der Kaiser Adelayne das Eherne Wort geben. Es sollte ein Fest gefeiert werden. Warum wirkten die Krieger so, als stünde ihnen der Sinn nach einem Gemetzel?
»Du solltest gleich besser deine Zunge im Zaum halten«, ermahnte ihn Adelayne, der die mörderische Stimmung ebenfalls nicht entgangen war.