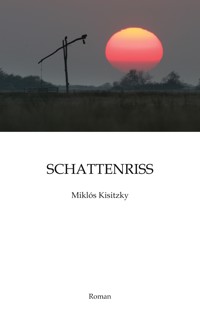
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter der glühenden Mittagssonne kommen Bélas Schritte plötzlich zum Stehen. Vor ihm liegt die Weite der sommerlichen Puszta, hinter ihm all das, was ihn auszumachen schien. Als Sohn und angehender Nachfolger eines in den 1970er Jahren aus Ungarn geflohenen, heute erfolgreichen Unternehmers hat es das Schicksal bisher gut mit ihm gemeint. Doch aufgrund äußerer Umstände gerät sein Leben aus den Fugen und er gelangt zu einer niederschmetternden Erkenntnis: All das, was er heute verkörpert, ist nicht mehr als das Ergebnis einer weitreichenden Entscheidung, die lang in der Vergangenheit zurückliegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unter der glühenden Mittagssonne kommen Bélas Schritte plötzlich zum Stehen. Vor ihm liegt die Weite der sommerlichen Puszta, hinter ihm all das, was ihn auszumachen schien. Als Sohn und angehender Nachfolger eines in den 1970er Jahren aus Ungarn geflohenen, heute erfolgreichen Unternehmers hat es das Schicksal bisher gut mit ihm gemeint. Doch aufgrund äußerer Umstände gerät sein Leben aus den Fugen und er gelangt zu einer niederschmetternden Erkenntnis: All das, was er heute verkörpert, ist nicht mehr als das Ergebnis einer weitreichenden Entscheidung, die lang in der Vergangenheit zurückliegt.
Miklós Kisitzky wurde 1979 in Budapest / Ungarn geboren. Nachdem seinen Eltern zu Zeiten des Eisernen Vorhangs die Flucht mit ihm in den Westen gelang, wuchs er in Deutschland auf. Er hält einen Abschluss als Diplom Bauingenieur und als Master in Real Estate. Er lebt in Hamburg und Zürich und arbeitet als Managing Partner in einer Immobilieninvestmentgesellschaft. „Schattenriss“ ist sein erster veröffentlichter Roman.
„Das Leben besteht nicht darin, gute Karten zu haben, sondern mit denen, die du hast, gut zu spielen.“
Josh Billings
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Törzskereszt - 1925
Debrecen - 1979
Ostfront / Törzskereszt – 1942 /43
Hamburg – 2002
Törzskereszt – 1948 / 49
Hamburg – heute
Budapest / Törzskereszt – heute
Glossar / Übersetzungen (in chronologischer Reihenfolge)
Prolog
Längst hat die Sonne den Zenit auf ihrer Bahn erreicht, als Béla irgendwo im Nirgendwo stehen bleibt. Vor ihm liegt die unendliche Weite der sommerlichen Steppenlandschaft, hinter ihm all das, was ihn und sein Leben bisher auszumachen schien.
Er sucht nach einem Anhaltspunkt, etwas, was ihm Orientierung bietet, eine Idee, ein Zeichen, einfach irgendetwas. Doch nichts als Stille, die hier und da durchbrochen wird vom leisen Surren umherfliegender Insekten.
Nach Stunden ziellosen Marschierens steht er, am Ende seiner Kräfte, mitten in der Einöde, einem endlosen Meer aus sonnengegerbten Gräsern und rissigen Böden, und weiß nicht weiter.
Wo zum Teufel will er eigentlich hin? Er weiß es nicht. Kann er zurück? Dafür fehlt ihm schlicht die Kraft.
Die Welt um ihn herum beginnt sich zu drehen, schneller, immer schneller. Die Weite verschwimmt im rasenden Karussell. Ihm wird schwarz vor Augen, er taumelt, seine Beine geben nach und er geht zu Boden.
Törzskereszt - 1925
*
„Bring das dem Neuen“, sagt der Alte mürrisch und stellt zwei mit Hafer gefüllte Eimer auf die Theke.
Árpád hievt die Behälter von der Anrichte und stolpert durch die Morgendämmerung zum Stallgebäude. Obwohl dem Jungen die Handflächen unter der Last brennen, hält er wie jedes Mal, wenn er sich unbeobachtet fühlt, auf der Schwelle für einen Moment inne. Er schließt die Augen und atmet tief ein, bis jeder Winkel seiner Lunge vom süßlichen Duft der Pferde durchtränkt ist. Erst als ihm die Henkel unter der Last zu entgleiten drohen, geht er weiter.
Árpád erreicht den Verschlag und stellt die Eimer auf den gepflasterten Boden. Während er sich die schmerzenden Finger reibt, schaut er hinauf zur Schiefertafel. Vitéz steht darauf mit Kreide geschrieben.
Zu jedem Pferd in diesem Stall hat Árpád eine ganz persönliche Verbindung, er kennt jedes Tier von den Nüstern bis zum Schweif. Allein am Rhythmus ihres Gangs vermag er sie voneinander zu unterscheiden. Er kann es kaum erwarten, Bekanntschaft mit dem Neuen zu machen.
Er holt das Zaumzeug aus der Kammer, hängt es an den Haken vor der Box und entsichert den Riegel am Tor. Mit aller Kraft stemmt er sich gegen die Schiebetür, die sich quietschend in Bewegung setzt. Der Hengst reißt den Kopf in die Höhe, schnaubt, tippelt umher.
Für Vitéz wäre es ein Leichtes, Árpád an der Wand des Verschlages zu zerquetschen oder ihn mit einem Tritt hinaus zu befördern. Er steht vor dem geöffneten Abteil, unsicher, ob es sein Herzschlag ist, der bis in die Tiefen seiner Magengrube pocht, oder das bedrohliche Stampfen der Hufe auf dem Boden. Immer wieder geht er in Gedanken den Ratschlag seines Vaters durch. Er müsse eine Verbindung zu dem Tier herstellen, sein Vertrauen gewinnen und eins mit ihm werden.
Er fasst sich ein Herz, streckt Vitéz die offene Hand entgegen und betritt die Box. Nervös tänzelt der Schimmel vor und zurück. Es gelingt Árpád, den Nasenrücken des Pferdes mit der Fingerspitze zu berühren. Der Hengst schüttelt den Kopf, prustet und kommt dann auf wundersame Weise allmählich zur Ruhe.
Die eine Hand auf die Stirn gelegt, die andere am Hals, verschmilzt Árpád mit Vitéz, dessen Anmut und Kraft ihn in den Bann ziehen. Durch die großen, dunklen Augen gewährt ihm das Pferd Einblick in seine Seele. Es lässt ihn teilhaben an seinem Drang nach Freiheit und seinem Verlangen, im Galopp die Weite der ungarischen Puszta zu überfliegen.
In der Zufahrt zum Herrenhaus ertönt eine Hupe. Kurz darauf fährt ein Automobil auf dem Hof vor. Árpád reizt es nachzusehen, was es damit auf sich hat, denn nur selten verschlägt es ein solches Gefährt in diese Gegend. Doch er besinnt sich eines Besseren. Sein Vater wird schnell ungehalten, wenn man ihn warten lässt.
Er leert die beiden Eimer in den Futtertrog und betrachtet den Hengst dabei, wie dessen Kopf darin verschwindet. Wie gern würde er sich auf den Rücken dieses stolzen Tieres schwingen und in die Ferne reiten. Es wird Zeit, denkt er und greift nach dem Zaumzeug. Doch das Unterfangen, den widerspenstigen Kopf des Pferdes durch die Lederriemen zu bugsieren, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Es bedarf mehrerer Anläufe, bis es ihm gelingt, den Kappzaum anzulegen. Widerwillig folgt ihm Vitéz auf den Gang hinaus.
„Bleib stehen, Junge!“, ruft eine Stimme.
Jancsi, der hünenhafte Gutsverwalter, schließt vom anderen Ende des Stalls zu ihm auf. Er wird begleitet von einem Mann, der sich auf einen Gehstock stützt. Zwar hat Árpád den Mann bislang nur ein einziges Mal gesehen, doch ändert es nichts daran, dass er den Baron sofort erkennt. Niemand sonst in dieser Gegend kleidet sich derart vornehm; keine Flicken, keine zerschlissenen Stellen an der Kleidung, makellos polierte Stiefel, die selbst im schwachen Schein der Petroleumlampen glänzen.
Stallburschen, die zufällig des Weges kommen, senken ihren Blick und suchen unter Andeutung einer ehrerbietigen Geste das Weite.
Als die beiden Árpád erreichen, trifft ihn eine Schelle, dass ihm die Schiebermütze ins Gesicht rutscht.
„Wirst du wohl die Mütze abziehen?“, faucht Jancsi. „Na, dir werde ich helfen!“
Schützend schlägt Árpád eine Hand über den Kopf, während er mit der anderen versucht, den nervösen Schimmel unter Kontrolle zu halten.
„Das reicht“, bremst der Baron den Gutsverwalter.
Árpád reißt die Kappe runter und presst sie vor die Brust. Mit gesenktem Blick steht er da und wagt es nicht, zu den beiden Erwachsenen aufzuschauen. Sterne funkeln vor seinen Augen und tausend Ameisen kribbeln ihm an der Wange.
Noch nie hat Árpád den riesigen Jancsi lächeln sehen, noch nie etwas Freundliches aus seinem Munde vernommen; nichts als Flüche und Befehle, und nur allzu gern verteilt er bei Respektlosigkeit Schläge. Die eigene Dummheit ärgert ihn mehr als die Schmerzen, die er in diesem Augenblick empfindet.
„Ist das der Neuzugang?“, fragt der Baron.
„Jawohl, mein Herr. Schauen Sie sich nur dieses Prachtexemplar an“, sagt Jancsi.
„Ein gesunder Bursche“, stellt der Baron fest. „Und wie es scheint, hat er Charakter. Ausgezeichnete Wahl.“
„Ergebensten Dank“, antwortet Jancsi.
„Kleiner, bring das Pferd hinaus auf die Koppel“, sagt der Baron. „Wir wollen deinen Vater nicht länger warten lassen.“ Als Árpád den Stalleingang erreicht, ruft ihm der Baron noch einmal hinterher: „Ach, noch etwas.“
„Sie wünschen?“, antwortet Árpád.
„Richte deiner Mutter aus, dass ich bei Gelegenheit wieder einmal ihrer Dienste bedarf.“
Die Lippen unter dem fein rasierten Bleistiftbart verziehen sich zu einem Lächeln.
„Sehr wohl“, antwortet Árpád.
Jancsi und der Baron setzen ihren Rundgang durch die Stallungen fort.
Was der Baron wohl von seiner Mutter möchte, fragt er sich. Sicher geht es um Tischdecken oder Kissen, die für das Herrenhaus bestickt werden müssen.
„Wie lang soll ich denn noch warten?“, grummelt Magor.
„Entschuldige“, antwortet Árpád und übergibt seinem Vater die Zügel. Der scheint vom Zwischenfall im Stall nichts mitbekommen zu haben, und so behält Árpád die ganze Angelegenheit lieber für sich.
Magor führt den Schimmel auf die Koppel und bleibt in der Mitte des Sandplatzes stehen. Árpád klettert auf den Lattenzaun und verfolgt jeden einzelnen Schritt seines Vaters: wie er die Longe am Kappzaum befestigt; wie er sich vor Vitéz aufstellt; wie er ihm die eine Hand flach auf das Nasenbein, die andere auf die Wange legt; wie er einen Augenblick verharrt und dem Hengst schließlich sanft den Hals entlangstreicht.
Auch Magor stellt die Verbindung her, lernt das Tier kennen, lotet die Energie zwischen ihnen aus. Er spricht mit ihm, nicht mit Worten, sondern mit der Kraft seiner Gedanken.
Er gibt ein Zeichen und Vitéz setzt sich in Bewegung. Auf ein Schnalzen wechselt der Hengst vom Schritt in leichten Trab. Nun lässt Magor der Leine mehr Spiel und die Kreisbahn, auf der das Halbblut mit gerecktem Haupt seine Runden dreht, wird größer.
„Sieh‘ zu, dass du mit den restlichen Arbeiten fertig wirst. Sonst kommst du zu spät zur Schule“, sagt Magor, ohne den Blick von den Bewegungen des Pferdes zu lösen.
„Kann ich nicht noch ein wenig bei dir bleiben?“
„Das werde ich dir kein zweites Mal sagen, verstanden?“
So sehr sich Árpád auch wünscht, seinem Vater weiter zuzuschauen, so sehr weiß er auch, dass er sich nicht traut, ihm zu widersprechen. Er steigt vom Zaun und geht den von Pappeln gesäumten Weg zurück. Wer braucht schon Schule? Das ist langweilig. Er möchte viel lieber Pferde ausbilden, so wie sein Vater.
Vor dem Treppenaufgang zum Herrenhaus stehen Jancsi und der Baron am Fahrzeug. Jancsi spricht mit einem der Diener in Livree, die gerade damit beschäftigt sind, das Gepäck zu entladen. Er hält ein Klemmbrett in den Händen, blättert in den Papieren mehrmals vor und zurück, schüttelt den Kopf und knallt dem Bediensteten genervt das Tableau gegen die Brust.
„Geh mir aus den Augen, bevor ich mich vergesse!“, fährt Jancsi ihn an. Der Gescholtene sieht zu, dass er wegkommt.
Ein Stallbursche erscheint mit zwei gesattelten Pferden auf dem Vorplatz und übergibt zuerst dem Baron und dann Jancsi die Zügel. Nachdem der Baron aufgesessen ist, zieht er eine goldene Taschenuhr aus seiner Tweedweste und wirft einen flüchtigen Blick darauf. Dann gibt er seinem Rappen einen Stoß in die Flanke und galoppiert vom Hof. Jancsi prescht ihm hinterher.
Die ersten Kinder verlassen bereits das Anwesen und machen sich auf den Weg zurück ins Dorf Törzskereszt. Árpád muss sich sputen. Nicht, dass er allzu viel Wert auf die Dinge legt, die der Lehrer ihm und den anderen Kindern Tag für Tag erklärt. Vielmehr ist ihm daran gelegen, den Belehrungen zu entgehen, die der schnaufende Dickwanst nur zu gern bei jeder Unpünktlichkeit mit dem Rohrstock verteilt.
Er eilt in den Stall und besorgt sich Schubkarre, Mistgabel und Besen. Nachdem er die ihm zugeteilten Boxen gereinigt und frisches Stroh verteilt hat, räumt er die Werkzeuge wieder an ihren Platz und macht sich ebenfalls auf den Weg ins Dorf.
Er folgt der gepflasterten Zufahrt, lässt die Nebengebäude hinter sich und passiert das schmiedeeiserne Tor, auf dessen weit geöffneten Flügeln das herrschaftliche Familienwappen des Barons in der Morgensonne glänzt.
Die Felder beidseits der schnurgeraden Landstraße sind bis an den Horizont übersäht mit Arbeitern. Endlose Reihen von Männern mit Sensen, die sich im stetigen Rhythmus durch die Felder schwingen; ihnen folgen Kolonnen von Frauen, die das Getreide sammeln und in Garben bündeln.
Was ihn wohl hinter dem Horizont erwarten würde, fragt sich Árpád, während er den Blick über die Weite schweifen lässt. Was, wenn etwas dran ist an den Erzählungen der Erwachsenen? Von den Städten, die, verglichen mit dem Dorf Törzskereszt, in dem er lebt, um ein so Vielfaches größer, lauter, dichter sind; vom Meer, das weiter ist als alle Felder in dieser Gegend zusammen; von den Bergen, die so hoch in den Himmel ragen, dass sie lange Schatten über das Land werfen.
All das existiert nur in Árpáds Vorstellung, in Bildern, die er sich aus den Erzählungen der anderen formt; aus Geschichten der Dorfbewohner, von denen die meisten selbst noch nie von hier fortgewesen sind, oder aus Berichten von Wanderarbeitern und fahrenden Händlern.
Eines Tages, davon ist er überzeugt, wird er diese Welt entdecken. So schaut er gespannt dem Tag entgegen, an dem er auf dem Rücken eines schnellen Pferdes Törzskereszt hinter sich lassen wird.
Er erreicht eine Weggabelung, von der eine Straße in das Dorf abgeht. Hoch über der Kreuzung wacht ein Kruzifix an einem verknöcherten Baumstamm; einem Mahnmal gleich, das alle Zeiten überdauert. Wie jeden Morgen, wenn er an der vorwurfsvoll auf ihn herabschauenden Jesusfigur vorübergeht, erfasst ihn Unbehagen. Er beschleunigt auch diesmal seinen Schritt.
Linker Hand der Dorfstraße reihen sich die Gesindeunterkünfte. Gekalkte, reetgedeckte Baracken, in denen die Wanderarbeiter, ganze Hundertschaften von Männern und Frauen mit ihren Kindern, während der Erntezeit eine Bleibe finden. Auf der gegenüberliegenden Seite reihen sich die einfachen Katen der Häusler, eingefasst von kleinen Höfen und Gemüsegärten.
Árpád lässt die Kapelle mit dem Zwiebeltürmchen hinter sich und folgt der von Pferdefuhrwerken ausgefahrenen Piste. Freundlich grüßt er jeden Dorfbewohner, dessen Weg den seinen kreuzt.
Zwischen zwei Katen stehen Ilona und Margit am Ziehbrunnen und bearbeiten schmutzige Wäsche in einem Bottich.
„Da bist du ja“, ruft ihm Ilona zu. „Wasch dich und dann nichts wie in die Schule.“
Árpád zieht frisches Wasser aus dem Brunnen, beugt sich über den Eimer und schrubbt sich die Hände, das Gesicht und den Hals. Margit reicht ihm ein Tuch zum Abtrocknen. Dann eilt Ilona mit ihm ins Haus und gibt ihm ein sauberes, aber abgetragenes Leinenhemd.
„Zieh das an, mein Herz“, sagt sie und holt einen Kamm aus einer kleinen Holzkiste. „Halt doch einen Augenblick still. Wie soll ich dich denn kämmen, wenn du so herumzappelst?“
Widerwillig lässt Árpád seine Mutter gewähren.
„So, nun aber los“, sagt sie. „Pass gut auf, was der Lehrer Euch sagt, hörst du? Und sei anständig.“
„Fast hätte ich es vergessen“, sagt Árpád, gerade im Begriff, aus der Tür zu treten. „Der Herr Baron lässt ausrichten, dass er bei Gelegenheit wieder einmal deiner Hilfe bedarf.“
Ilona entgleiten die Gesichtszüge und sie wird kreidebleich.
„Was ist mit dir?“, fragt Árpád.
„Beeil‘ dich“, antwortet sie. „Du kommst zu spät zur Schule.“
*
Die Klinge schnellt herab und reißt ein Scheit entzwei. Magor greift nach einem weiteren Holz, stellt es auf, hebt die Axt in die Höhe und spaltet auch dieses in zwei Hälften. Ein Scheit nach dem anderen arbeitet er sich durch den großen Haufen.
Dann und wann hält er kurz inne, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Árpád sortiert derweil das Holz an der Rückwand der Kate auf einen Stapel. Die schweren Scheite türmt er auf der linken Seite, die schlanken zum Anfeuern auf der rechten.
Die Schatten werden länger. Auf der Dorfstraße kehren die letzten Arbeiter von den Feldern zurück und biegen zu ihren Unterkünften ab. Ein Junge flitzt zwischen zwei Baracken umher. Eine Frau ist ihm dicht auf den Fersen, schwingt dabei einen Kochlöffel und stößt Flüche gegen ihn aus. Am Ziehbrunnen befüllen Feldarbeiterinnen mit Kopftüchern und Schürzen Wassereimer, während ihre Männer in Gruppen vor den Häusern sitzen und sich unterhalten.
„Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich auch so einen riesigen Stall mit eigenen Pferden besitzen“, sagt Árpád zu seinem Vater.
Die Klinge kracht erneut ins Holz. Ein zerstiebendes Stück verfehlt Angyal, die Vizsla-Hündin, nur knapp. Verschreckt springt sie auf und sucht sich einen anderen Platz.
„Schlag dir das aus dem Kopf“, herrscht ihn Magor an. Seine Halsschlagader pocht bedrohlich.
„Merke dir meine Worte“, sagt er und tippt Árpád mit der Fingerspitze auf die Stirn. „Manche Dinge werden sich nie ändern. Es gibt die Bevorteilten, mit denen es das Schicksal gut meint. Und es gibt uns. Wir sind nicht wie die, und wir werden es niemals sein. Je früher du dich damit abfindest, umso besser.“
Eingeschüchtert von der Bestimmtheit, die in den Worten seines Vaters schwingt, versteht Árpád zwar nicht so recht, was er damit meint, doch scheint es ihm angebracht, es dabei zu belassen.
Magor zückt einen Schleifstein aus dem Gürteletui, schärft die Klinge und bringt die Axt in den Schuppen. Árpád sortiert die letzten Scheite auf den Stapel und greift sich einen Reisigbesen, mit dem er die Holzspäne zusammenkehrt.
Ein leeres Fuhrwerk poltert die Dorfstraße entlang. Durch das Tor schaut die Hündin dem Wagen hinterher, stöbert dann ein wenig auf dem Hof herum und gesellt sich schließlich zu Árpád.
„Verstehst du, warum Vater manchmal so komisch ist?“
Angyal schaut mit ihren fuchsbraunen Augen zu ihm auf.
„Vermutlich nicht. Du bewachst ja nur den Hof.“
Árpád schnappt sich den Wassereimer und geht hinüber zum Brunnen, wo er auf den Jungen trifft, der kurz zuvor Reißaus vor der Frau mit dem Kochlöffel nahm.
„Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du neu hier?“, fragt Árpád.
„Ja“, antwortet der andere. „Man hat uns von einem Gut im Süden hierhergeschickt.“
„Wie war es dort?“
„Wo? Auf dem anderen Gut?“
Árpád nickt.
„Wie soll es schon sein? Es ist doch überall gleich. Man kommt schon irgendwie durch, solange man sich zu helfen weiß.“
„Sich zu helfen weiß?“
„Bist wohl noch nicht groß herumgekommen, wie?“, frotzelt der Junge. „Ganz einfach. Es gibt nur ein paar Regeln, die man beachten muss.“ Verschmitzt schaut er Árpád an und fährt mit gesenkter Stimme fort: „Erstens, hüte dich vor den Älteren und gehe Ärger aus dem Weg. Zweitens, geschenkt bekommst du nichts. Und drittens, wenn du etwas haben willst, musst du es dir beschaffen.“
„Zsolt, wo zum Teufel steckst du?“, ruft eine Frauenstimme.
Der Junge schaut in die Richtung, aus der die Stimme kam. „Ist wohl besser, wenn ich gehe. Vielleicht sehen wir uns ja wieder“, sagt er mit einem Lächeln.
„Ganz bestimmt. Ich heiße Árpád.“
Zsolt zwinkert ihm zum Abschied zu und macht sich auf in Richtung der Baracken.
Árpád geht zurück nach Hause und stellt den vollen Wassereimer auf einen Hocker neben der Tür. Aus einem Schober hinter der Kate zupft er eine Handvoll Heu und verteilt es an die Kaninchen im Gehege. Magor kommt aus dem Schuppen und betrachtet ihn einen Moment. Dann tätschelt er ihm im Vorbeigehen die Schulter, geht zum Eimer, krempelt die Ärmel hoch und wäscht sich das Gesicht.
„Komm zum Essen, wenn du fertig bist“, sagt er, trocknet sich das Gesicht mit dem Ärmel ab und geht hinein.
Árpád wirft einen Blick hinüber zu den Baracken und entdeckt Zsolt, der aus einer der Türen zu ihm herüberschaut. Sie winken einander zu.
Die Wohnküche mit den gekalkten Wänden hat keine Fenster. Nur durch die offenstehende Tür dringen die Reste des abnehmenden Tageslichts herein. Wäre Árpád ein wildes Tier, dann wäre dies seine Höhle. Hier lebt er, hier zieht er sich für die Nacht zurück. Sie bietet Schutz bei Regen, Wind und Schnee.
„Hast du dir die Hände gewaschen?“, fragt Ilona, die auf einem Schemel sitzt und mit den letzten Stichen ein Hemd flickt.
„Ja, Mutter“, antwortet Árpád und setzt sich auf die knarrende Bank neben seinen Vater.
Margit rührt ein letztes Mal den Maisbrei um und schiebt den Topf von der Feuerstelle. Solange Árpád denken kann, ist seine Großmutter schwarz gekleidet. Es ist die Farbe der Trauer, hat seine Mutter ihm einmal erklärt.
Ilona legt ihre Arbeit beiseite, nimmt vier Holzteller vom Regalbrett und verteilt sie auf dem Tisch. Sie legt jedem von ihnen einen Löffel hin und schiebt eine Strähne zurück unter das Kopftuch. Seine Mutter ist die schönste Frau, die Árpád je gesehen hat. Daran kann nichts auf dieser Welt etwas ändern, nicht einmal, dass sie etwas zu betrüben scheint.
Magor sitzt gebeugt am Tisch und starrt in die Kerzenflamme. Schweigen, nur ab und zu ein leises Knistern im Ofen und die letzten Handgriffe, bevor das Essen ausgeteilt wird. Unruhig rutscht Árpád auf seinem Platz hin und her.
„Hör auf damit“, weist ihn Magor zurecht.
Árpád versteht das alles nicht. Sonst tauschen sich die Erwachsenen doch auch über den Tag aus. Was hat ihnen denn nur die Sprache verschlagen?
Margit wischt die Hände an der Schürze ab und setzt sich an den Tisch. Ilona stellt den Topf in die Mitte und verteilt den dampfenden Brei. Sie gießt jedem etwas Öl darüber und setzt sich dazu. Magor spricht ein Tischgebet und beendet es mit einem Kreuzzeichen. Die anderen tun es ihm gleich.
Während sie schweigend den Maisbrei löffeln, sucht Árpád nach der passenden Gelegenheit, seinem Unbehagen Gehör zu verschaffen. Vergeblich will er ansetzen, doch jeder seiner Versuche stockt, noch bevor ein Wort seine Lippen verlässt.
Nach dem Essen fettet Magor seine Stiefel und poliert anschließend mit einem Leinentuch das Leder. Ilona hockt neben ihm und bestickt einen Kissenbezug. Über ihre Arbeit gebeugt, nimmt sie immer wieder Maß, prüft die Abstände und Formen des Musters. Margit sitzt in der Ecke neben dem Ofen und murmelt ihre abendlichen Gebete.
Árpád sucht nach Ablenkung. Er betrachtet die hölzerne Pferdefigur, die Magor ihm geschnitzt hat. Er stellt sich vor, wie sie zum Leben erwacht, ihn fortträgt, an einen anderen Ort, in ein fremdes Land, in eine andere Welt.
„Was sollst du vom Baron ausrichten?“, fragt Magor.
Árpád schaut seinen Vater an, nicht sicher, ob die Frage an ihn gerichtet war.
„Na sag schon“, hakt Magor nach.
„Dass er bei Gelegenheit Mutters Dienste bedarf“, antwortet er zögerlich.
Magor pfeffert den Stiefel in die Ecke. Dann springt er auf, geht rastlos umher und bleibt schließlich, den Blick nach draußen gerichtet, an der Tür stehen.
„Vater, ich verstehe nicht …“
„Du gehst jetzt besser schlafen.“
„Aber ...“
„Geh jetzt“, befiehlt er und zeigt in Richtung Schlafkammer.
Margit nimmt Árpád bei der Hand und geht mit ihm in den Nachbarraum. Vom Bett aus kann er die Küchentür sehen, wo seine Eltern regungslos beieinanderstehen und in die Dunkelheit hinausstarren.
„Was ist denn los?“, fragt Árpád.
Margit setzt sich neben ihn auf die Bettkante und richtet die Decke. „Quäle dich nicht“, sagt sie. „Du bist noch so jung.“
Hin und hergerissen zwischen Enttäuschung und Unsicherheit, weiß Árpád sich auf all das keinen Reim zu machen. Was kann bloß so schlimm sein, dass sie ihn nicht daran teilhaben lassen?
Margit stimmt eine vertraute Melodie an, zuerst summt sie, dann beginnt sie zu singen: „Sír az isten báránya …“
Es ist ein uraltes Wiegenlied, das von einem unschuldigen Lamm erzählt; wie es von der Gottesmutter getröstet wird, während es selbst die Sünden dieser Welt beweint; ein Lied, das Margit aus frühen Kindertagen kennt; ein Lied, mit dem sie vor langer Zeit schon Magor in den Schlaf gesungen hat.
Árpád schreckt auf. War das Angyal, die draußen angeschlagen hat?
„Vater?“, fragt er in die Dunkelheit.
Keine Antwort. Er greift neben sich. Doch seine Großmutter, mit der er nachts das Bett teilt, ist nicht da. Er tastet sich vorsichtig zur anderen Seite der Kammer. Auch das Bett seiner Eltern ist leer.
Draußen ertönt ein Knurren, tief und bedrohlich, gefolgt von Bellen. Das kann nur Angyal sein.
Durch die kleine Fensteröffnung neben dem Bett seiner Eltern fällt ein schwacher Lichtschimmer. Er lugt hinaus und sieht seinen Vater, der mit einer Petroleumlampe in der Hand auf dem Hof steht. Hinter ihm drängen sich Ilona und Margit verängstigt aneinander.
Árpád rückt näher an die Scheibe ran und erschrickt. Die schiere Größe der Gestalt, die sich vor seinem Vater aufgebaut hat, lässt keinen Zweifel. Es ist Jancsi.
Der Gutsverwalter redet auf Magor ein, während Angyal sich immer mehr in Rage bellt. Margit packt sie am Nacken, versucht, sie zu bändigen, doch die Hündin fletscht die Zähne, bereit, auf den Hünen loszugehen.
„Bring die Töle endlich zur Vernunft“, brüllt Jancsi.
Doch Angyal ist nicht zu beruhigen. Plötzlich zückt Jancsi einen Revolver. Ein Schuss zerreißt die Nacht. Angyal heult kurz auf, dann verstummt das Bellen. Árpád stürzt hinaus und fällt neben der fiependen Hündin auf die Knie.
„Was hast du getan!“, ruft Árpád weinend.
„Halt’s Maul, sonst verpasse ich dir die nächste Kugel.“
Die Waffe zielt nun direkt auf Árpád. Magor springt dazwischen. Jancsi reißt die Pistole hoch und presst seinem Gegenüber die Mündung an die Stirn.
„Na los doch!“, schreit Magor. „Willst du mich etwa vor meinem Sohn erschießen?“
Der Hüne zieht den Hahn auf und die Trommel springt eins weiter.
„Halt“, sagt Ilona und schiebt den Lauf beiseite.
„Tu das nicht“, fleht Magor sie an.
Sie streicht ihm über die Wange und gibt ihm mit Tränen in den Augen einen Kuss.
„Verzeih‘ mir“, sagt sie.
Dann wechselt sie auf Jancsis Seite.
„Sieh an. Wenigstens eine, die vernünftig ist.“
Der Gutsverwalter entspannt den Hahn und schiebt die Waffe zurück in den Holster. Dann führt er Ilona zum Beifahrersitz des Wagens, schmeißt mit großem Knattern den Motor an und verschwindet kurz darauf mit ihr in der Nacht.
Árpád kauert vor der sterbenden Hündin. Warmes Blut klebt an seinen Händen. Sie begehrt ein letztes Mal auf, holt noch einmal Luft, dann erschlafft ihr Köper. Schluchzend streichelt Árpád ihr den Kopf.
„Morgen werden wir einen Platz suchen, um sie zu begraben“, sagt Magor.
„Das hat sie nicht verdient“, klagt Árpád.
„Nein, hat sie nicht.“
Magor wendet den Blick ab und trocknet sich die Augen.
„Was glotzt ihr so“, brüllt er die Neugierigen an, die sich, aufgeweckt vom nächtlichen Lärm, vor der Baracke auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelt haben. Mit betretenen Mienen schauen sie herüber. Dann löst sich die Gruppe auf.
Magor holt eine Jutedecke aus dem Schuppen und bedeckt Angyals reglosen Körper.
„Lass uns reingehen“, sagt Margit und nimmt Árpád bei der Hand.
„Wo fährt Mutter hin?“, will Árpád wissen.
„Mach‘ dir darüber keine Gedanken. Ehe du dich versiehst, wird sie wieder bei uns sein.“
Der nächste Tag beginnt mit Regen. Árpád und Magor sitzen schweigend am Tisch und schauen zu Ilona auf, als diese die Wohnküche betritt. Stumm geht sie an ihnen vorbei, greift nach einem Tuch und trocknet sich die Haare. Dann nimmt sie, wie gewohnt, die Schürze vom Haken und bindet sie um.
Währenddessen schöpft Margit Haferbrei in eine Schale und stellt sie vor Árpád auf den Tisch. Eine Weile stochert er mit dem Löffel in der klebrigen Masse herum, bis er schließlich fragt: „Wo warst du, Mutter?“
„Lass gut sein“, antwortet Magor. „Iss‘ lieber. Wir wollen Angyal begraben.“
Debrecen - 1979
*
Vor dem Fenster begrüßt eine Amsel singend den heranbrechenden Tag. István liegt bereits seit einer Weile wach neben Dóra und starrt in die Dämmerung. Da ihn nichts auf dieser Welt mehr ärgert als vergeudete Zeit, beschließt er, aufzustehen.
Er vernimmt ein leises Wimmern aus der Ecke. Über das Bettchen gebeugt schaut er in das fragende Gesicht seines Sohnes, der, wie es scheint, nicht so recht weiß, ob er weinen oder lächeln soll. István nimmt den Kleinen auf den Arm, gibt ihm einen Kuss auf die Stirn und schleicht mit ihm ins Wohnzimmer.
Auf dem Esszimmertisch verstreut liegen aufgeklappte Bücher über Kunstgeschichte, daneben handbeschriebene Zettel mit Dóras akkurat sortierten Notizen. Manchmal fragt er sich, was ihn mehr fasziniert: die Tatsache, dass jemand so viel Zeit mit der Vergangenheit verschwenden kann, oder die Inbrunst, mit der sich seine Frau damit beschäftigt. Ein Lächeln huscht über seine Lippen, während er die Notizen betrachtet. Das ist ihre Welt, denkt er.
Den Kopf an Istváns drahtige Schulter geschmiegt, hängt sein Sohn friedlich in seinen Armen und ist wieder eingeschlafen. Die Wärme, die von dem kleinen Körper ausgeht, erfüllt ihn mit Liebe und mit unendlichem Stolz.
Béla soll es einmal besser haben als er. Dafür würde István alles geben, so, wie auch sein Vater alles für ihn gegeben hat. Denn es ist die Loyalität, die die Cseléd-Familie ausmacht. Sie halten zusammen, komme was wolle. Es ist Geschenk und Verpflichtung zugleich, erklärte ihm schon sein Vater Árpád.
István schielt zu Béla runter.
„Du bist noch so jung“, flüstert er ihm zu. „Eines Tages, wenn auch du dein Kind auf dem Arm trägst, wirst du verstehen, was ich meine.“
Er legt Béla wieder in sein Bettchen, wirft einen Blick zu Dóra, die noch immer tief und fest schläft, und geht ins Bad.
Wenig später steht er in der Küche und belegt Pausenbrote für die Arbeit, zwei mit Paprikasalami, eines mit geräuchertem Käse. Neben ihm blubbert der Espressokocher auf dem Gasherd. Er dreht die Flamme aus.
An die Arbeitsfläche der Küchenzeile gelehnt, befüllt er ein Tässchen, schlürft das noch viel zu heiße Getränk und isst eines der Brote mit großen Bissen. Nachdem er auch eine zweite Tasse geleert hat, steckt er die Brote in die abgegriffene Ledertasche, nimmt den Haustürschlüssel und streift sich die mausgraue Blousonjacke über.
Er holt das Fahrrad aus dem Verschlag und schiebt es auf die mit Pfützen bedeckte Straße. Nach zwei Tagen ergiebiger Regenfälle begrüßt ihn der süße Duft eines grauen, aber milden Frühlingsmorgens.
Pünktlich um halb acht sitzt er am großen Besprechungstisch im Leitungsbüro des städtischen Baubetriebs von Debrecen. Von hier aus kann er das weitläufige Betriebsgelände überblicken, in dessen Mitte sich eine Sheddachhalle befindet, mit der Werkstatt, dem Magazin und dem Baustofflager, umrahmt von Garagen und Schuppen. Im rückwärtigen Bereich hinter der Werkhalle steht das Großgerät: zerlegte Turmdrehkräne, Bagger mit Rad- und Kettenantrieb, Walzen für den Straßen- und Erdbau, Lastkraftwagen.
Székelyi József, der von allen Kollegen freundschaftlich nur Józsi bácsi genannt wird, sitzt ihm gegenüber. Hinter ihm hängt eine Karte, die den Zuständigkeitsbereich der Verwaltungseinheit zeigt. Jede Baustelle ist durch eine Nadel mit rotem Kopf gekennzeichnet.
István beobachtet seinen Vorgesetzten, der vornübergebeugt die vor ihm auf dem Tisch liegenden Dokumente studiert. Nach einer Weile fingert Józsi bácsi ein Stofftuch aus der Hosentasche und beginnt gedankenversunken und unter gleichmäßig kreisenden Bewegungen, die Gläser seiner schwarzen Hornbrille zu polieren.
Die streng zurückgekämmten weißen Haare des Alten und der in die Jahre gekommene Glencheck-Anzug erinnern István an seinen früheren Professor für Statik. Wenngleich Józsi bácsi viel weniger streng ist. Leider. Denn ginge es nach István, würde hier ein ganz anderer Wind wehen.
Józsi bácsi blättert eine Weile stumm durch die einzelnen Bautenstandsberichte, die Aufstellung der Lagerbestände und die Personaldisposition für die kommenden drei Monate.
„Hast du denn nichts dazu zu sagen?“, fragt István.
Der Alte schaut wortlos auf. Aus seinen Augen dringt der müde gewordene Schimmer eines einst an Ideale glaubenden Mannes.
„Wie soll man mit so einem lahmen Haufen wirtschaftlich arbeiten, vom Erreichen der Planvorgaben ganz zu schweigen? Die Hälfte der Belegschaft würde ich am liebsten gleich heute vor die Tür setzen. Sie kommen zu spät, sie gehen zu früh, und um Ausreden sind sie nie verlegen. Immer tragen die anderen die Schuld, immer wurde dieses oder jenes nicht geliefert. Die meisten trinken während des Dienstes, manche kommen bereits sturzbesoffen zur Arbeit. Ein Drittel der Baugeräte ist nicht funktionsfähig, es fehlt an allen Ecken und Enden, allem voran an Ersatzteilen. Es ist zum Haare raufen.“
Während István seinem Ärger Luft macht, sitzt ihm Józsi bácsi teilnahmslos gegenüber und scheint in Gedanken ganz woanders zu sein.
„Schau‘ her“, fährt István fort und greift zu einem der Bautenstandsberichte. „Die Baustelle hätte planmäßig zum vierzehnten September vergangenen Jahres fertiggestellt und übergeben werden sollen. Wir haben Ende März!“
Vergebens hofft István auf eine Reaktion seines Vorgesetzten und fragt sich, was er noch alles tun muss, um ihn endlich wachzurütteln.
„Als wäre das nicht genug. Ständig verschwindet Baumaterial. Zement, Ziegel, Fliesen, Armaturen, Beschläge, diese Mistkerle klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist!“
Noch immer keine Reaktion seines Gegenübers.
„Hörst du mir eigentlich zu?“
Der Alte antwortet mit einem Nicken, während er das Fenster betrachtet, an dem der wieder einsetzende Regen in Perlen herabläuft.
In Anbetracht der Lethargie seines Vorgesetzten fällt es István zunehmend schwer, nicht vollends die Fassung zu verlieren. Der alte Trottel ist müde geworden und blind für die Welt.
„Bricht man die Gesamtleistung der einzelnen Bereiche auf die jeweiligen Mitarbeiter herunter, so hat die Belegschaft in den vergangenen Quartalen gerade einmal zwei Drittel der eigentlichen Soll-Leistung erbracht“, führt István seine Erläuterungen fort.
„Das stimmt nachdenklich“, antwortet Józsi bácsi.
„Nachdenklich? Das ist schlichtweg inakzeptabel!“
István springt von seinem Platz auf. Polternd knallt die Stuhllehne hinter ihm gegen die Wand. Genervt geht er vor dem Fenster auf und ab und fährt sich durch das nussbraune Haar.
„Das ist nicht das erste Jahr, in dem die Budgetvorgaben nicht erreichen werden. Du weißt, was das bedeutet“, versucht István den Ernst der Lage zu verdeutlichen. „Verfehlung der Planvorgaben! Du wirst dir ein paar ziemlich unangenehme Fragen vom Ausschuss gefallen lassen müssen.“
Józsi bácsi winkt ab.
„Weißt du, mein Junge, diese Bürokraten bereiten mir keine Sorgen. Es ist doch stets das Gleiche. Sie werden den Bericht zum Anlass nehmen, einen Krisenstab einzurichten. Jeder von ihnen wird ganz genau wissen, was zu tun ist, einer besser als der andere. Sie werden Konsequenzen fordern und schon bald merken, dass es dabei an ihren eigenen Kragen geht. Glaube mir, das wird keiner von denen zulassen. Am Ende werden sie zu dem Schluss kommen, dass die Lage doch gar nicht so dramatisch ist. Sie werden manche der Zahlen beschönigen und manche wohlwollend unter den Tisch fallen lassen. Für das Folgejahr werden sie dann in trautem Einvernehmen ein angepasstes Planbudget aufgeben. Achtzehn lange Jahre leite ich nun schon diesen Betrieb, und es war stets das gleiche Spiel.“
István schaut den Alten verdutzt an.
„Du weißt darüber Bescheid, dass manche sich in diesem Betrieb bereichern?“
„Sag mir lieber, wer nicht?“, entgegnet Józsi bácsi. „Glaub mir, es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mich nicht frage, was nur aus diesem Land geworden ist? Wo sind sie geblieben, die großen Ideale wie das Streben nach Gleichheit, nach Gerechtigkeit, nach Solidarität? Nichts davon ist geblieben. Stattdessen herrscht ein System der Vetternwirtschaft, das sich von innen heraus selbst korrumpiert; ein System, das den Leistungswillen des Einzelnen hemmt, weil es sich ohnehin nicht lohnt, für etwas zu streben. Es wird endlich Zeit ...“
Nichts als Reden, immer nur Reden, denkt István. Leere Worthülsen, zu Luftschlössern aneinandergereiht, die schon beim kleinsten Windhauch zerstieben. István hat es satt. Er will, verdammt noch mal, nicht mehr als seine Arbeit erledigen, ohne ständig ausgebremst zu werden.
„Ja, bitte?“, unterbricht der Alte seinen Monolog.
Gönczy Pál, ein untersetzter Mittdreißiger mit schwammigem Gesicht, der als Bauleiter bei der städtischen Gesellschaft arbeitet, steht in der Tür. Noch bevor Józsi bácsi zum Eintritt hätte auffordern können, war dieser offensichtlich so frei, sich selbst hereinzulassen. István, der noch immer am Fenster steht, schaut überrascht zur Tür.
„Kann ich Ihnen helfen?“, fragt der Alte.
„Ich habe hier ein paar Freigaben, die unterzeichnet werden müssten.“
„Legen Sie mir die Papiere hin, ich unterschreibe sie dann später.“
Der Bauleiter tritt an den Schreibtisch und legt die Unterschriftenmappe auf den Stapel zu den anderen. Dabei lässt er seinen Blick nach Istváns Geschmack etwas zu lange über die herumliegenden Unterlagen wandern. Schnüffelt Gönczy Pál etwa herum?
„Das wäre dann alles“, sagt Józsi bácsi und deutet zur Tür.
„Ich mag ihn nicht“, flüstert István, als er wieder mit seinem Vorgesetzten allein ist.
„Ich auch nicht. Doch persönliche Befindlichkeiten einmal außen vor gelassen, von den Bauleitern liefert er zumindest noch die besten Ergebnisse.“
„Ein schwacher Trost, da wirst du mir sicherlich zustimmen. Er ist wie alle anderen, keinen Deut besser! Der Mistkerl hat Materialien für die Baustelle am Bahnhof abgezweigt, um sich diese nach Hause liefern zu lassen. Einer der Fahrer hat es mir im Vertrauen erzählt. Anzeigen müsste man ihn!“
„Schlag dir das aus dem Kopf. Mit solchen Leuten fängt man keinen Ärger an.“
István schaut zur Tür, um sich zu vergewissern, dass sie geschlossen ist.
„Ach, was soll‘s“, sagt er schließlich und winkt ab.
Ernüchtert schaut er aus dem Fenster und beobachtet einen der Magazinarbeiter. Unter dem Vordach an die Wand gelehnt, dreht dieser sich gemächlich eine Zigarette, als könnte ihn nichts auf dieser Welt aus der Ruhe bringen.
„Gräm dich nicht“, sagt Józsi bácsi. „Lass uns lieber wieder an die Arbeit gehen.“
István verlässt das Büro und geht zurück an seinen Arbeitsplatz. Als Józsi bácsis persönlicher Assistent steht sein Schreibtisch am Kopfende des Großraumbüros, unmittelbar vor der Eingangstür zum Direktionsbüro. Von hier aus kann er den Raum überblicken, die großflächigen Zeichentische der Ingenieure und die mit Unterlagen, Heftern und Aktenordnern gefüllten Schreibtische der Bauleiter. Eine stickige Note aus Zigarettenrauch und Kaffee, durchmischt vom synthetischen Aroma des PVC-Bodens, hängt im Raum. István braucht dringend frische Luft. Er versucht, das Fenster zu öffnen, doch der Hebel klemmt noch immer. Genervt bittet er den Kollegen am Nachbartisch, sein Fenster zu öffnen. Feuchte Luft zieht herein.
Geschäftiges Gemurmel, wohin István im Arbeitssaal auch schaut. Die Angestellten sitzen an den Schreibtischen und telefonieren oder stehen an Zeichentischen und diskutieren technische Sachverhalte. Wie kommt es nur, dass bei so viel Betriebsamkeit so wenig erreicht wird?
Gönczy Pál sitzt ein paar Reihen weiter an seinem Platz und ist in ein Dokument vertieft. Läge es in seiner Macht, István würde ihn hochkant rausschmeißen. Er mag nichts Handfestes gegen ihn in der Hand haben, aber István ist sich sicher, dass dieser schmierige Typ vom Scheitel bis zur Sohle falsch ist. Gönczy Pál legt das Dokument beiseite und verlässt den Raum.
Irgendwann wird István den Mistkerl auf frischer Tat ertappen. Dann, so schwört er, werden selbst dessen Beziehungen ihm nicht mehr helfen.
Lustlos klappt István die vor ihm liegende Mappe auf: Genehmigungsbescheide, Schriftverkehr mit anderen städtischen Verwaltungseinheiten, Mengenabrechnungen einzelner Baustellen. Zwischendurch nippt er an seinem Kaffee, der genauso abscheulich ist wie die Welt draußen vor dem Fenster – verwässert.
Er prüft einen mit der Bemerkung DRINGLICH versehenen Stapel nach Baustellen sortierter Bestell- und Lieferscheine. Einige von ihnen betreffen die Baustelle am städtischen Busbahnhof, die Gönczy Pál betreut. István bleibt an der fortlaufenden Nummer des Auftrags 78-13/A14 hängen und blättert zurück. Laufende Nummer 78-13/A12. Das Freigabedokument für 78-13/A13 fehlt. Kann dieser Idiot seinen Krempel nicht einmal geordnet beisammenhalten? Wie soll István diese Zahlung freigeben? Am liebsten würde er ihm die Papiere auf den Tisch knallen und die Meinung geigen.
István erkundigt sich bei Gönczy Páls Tischnachbarn, ob dieser wisse, wann der Bauleiter wieder zurückkommt. Der Kollege zuckt nur mit den Schultern und wendet sich wieder seiner Arbeit zu.
István geht in die Buchhaltung, um sich die Akte mit den Bestell- und Lieferscheinen herausgeben zu lassen. Er geht die einzelnen Papiere durch. Bis auf den Auftrag mit der Nummer 78-13/A13 liegen die vorhergehenden Bestellscheine und die zugehörigen Lieferscheine vollständig vor.
„Vorgang 13 fehlt“, sagt István zur Buchhalterin.
Verwundert prüft sie noch einmal das Eingangsfach und ihre Ablage. „Hier ist auch nichts“, erklärt sie.
Genervt geht István zurück an seinen Arbeitsplatz.
„Hören Sie“, fährt István den Bauleiter an, als dieser am späten Vormittag zurückkehrt und sich geschafft auf seinen Stuhl fallen lässt. „So geht das verdammt noch mal nicht. Wie oft soll ich Ihnen eigentlich noch…“
„Ich weiß“, unterbricht ihn Gönczy Pál.
Er greift in die Aktentasche, die neben ihm auf dem Boden steht, kramt einen Moment darin herum und hält István schließlich ein zerknittertes Bündel Papiere hin.
„Das habe ich vergessen. Der Polier musste noch freizeichnen.“
„Machen Sie das eigentlich mit Absicht?“, fragt István und reißt ihm die Zettel aus der Hand.
„Was denn?“
„Mich mit Ihrer Unordnung in den Wahnsinn zu treiben!“
„Warum regen Sie sich so auf? Das kann doch mal passieren.“
Die Arroganz dieses selbstherrlichen Affen, der nichts und niemanden zu respektieren scheint, schon gar nicht seine beiden Vorgesetzten, kann István nicht länger ertragen.
„Ich habe ein Auge auf Sie“, herrscht er den Bauleiter an.
„Tun Sie, was Sie nicht lassen können“, entgegnet dieser und lehnt sich in seinem Stuhl zurück.
„Irgendwann kriege ich Sie dran.“
„Wovon sprechen Sie?“
„Sie wissen genau, wovon ich spreche.“
„Keine Ahnung, sagen Sie es mir.“
„Hören Sie auf, mich für dumm zu verkaufen, sonst …“
„Sonst was? Wollen Sie mir etwa drohen?“, fragt der Bauleiter mit überlegener Gelassenheit.
Ganz recht. István will ihm drohen.
„Genossen, hört ihr das?“, ruft Gönczy Pál in den Arbeitssaal. „Der Herr Direktionsassistent will mir drohen!“
„Ich will verdammt noch mal, dass Sie Ihre Arbeit anständig machen! Mehr nicht“, sagt er, und geht wieder an seinen Arbeitsplatz.
So viel steht fest - ein offener Kampf gegen Gönczy Pál ist aussichtslos, solange István ihm keine belastbaren Verfehlungen nachweisen kann. Für ein Disziplinarverfahren wegen Veruntreuung reichen simple Schludrigkeiten nicht aus. Dafür braucht es mehr. So sehr es auch an István nagt, einmal mehr wird Gönczy Pál ungeschoren davonkommen.
Dass dieser Fettsack ihn zudem vor allen anderen derart bloßgestellt hat, macht ihn innerlich rasend. Gönczy Pál will den Kampf haben? Er soll ihn bekommen.
Am darauffolgenden Tag sucht István erneut die Buchhaltung auf. Neben den Bestell- und Lieferscheinen lässt er sich nun jedoch auch die Fahrtenbücher und die Materialausgabelisten des Magazins aushändigen. Er quittiert die Herausgabe der Unterlagen und schleppt die prall gefüllten Aktenmappen an seinen Arbeitsplatz.
Für ihn besteht kein Zweifel, irgendwo da drin wird er die notwendigen Hinweise finden, um Gönczy Pál den Garaus zu machen.
Es ist bereits am späten Nachmittag, als István den zweiten Ordner zur Seite legt, ohne fündig geworden zu sein. Was, wenn er sich die Mühe vergeblich macht? Das kann nicht sein. Gönczy Pál unterschlägt Betriebsmittel, und István wird es beweisen. Jedem unterlaufen früher oder später Fehler. Er klappt den Deckel des nächsten Aktenordners auf. Die ersten Mitarbeiter packen derweil ihre Sachen und machen sich auf den Heimweg.
„Du musst wohl nachsitzen“, scherzt einer der technischen Zeichner im Vorbeigehen.
„Muss noch ein paar Zahlen fertigmachen“, antwortet István.
Ein Angestellter nach dem anderen verlässt den Raum, bis nur noch István und Gönczy Pál zurückbleiben. Er fragt sich, was es denn so Wichtiges zu erledigen gibt, dass Gönczy Pál ausgerechnet heute länger bleibt. Instinktiv spürt er, wie jede seiner Handlungen beobachtet wird. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der andere sich beschäftigt gibt.
Eine weitere halbe Stunde vergeht, bis auch Gönczy Pál endlich seine Tasche nimmt und den Raum verlässt. Kein Blick, kein Gruß. Die Auseinandersetzung nimmt also eine neue, subtilere und ungleich bedrohlichere Form an.
Ruhe kehrt auf dem Gelände ein. Längst haben auch die letzten Arbeiter den Bauhof verlassen. Geblieben ist nur noch das Pförtnerpersonal am Haupteingang, das sich auf eine, wie üblich, ereignislose Nacht einstellt.
István prüft nacheinander jeden einzelnen der in der Akte dokumentierten Liefervorgänge und hofft, endlich den passenden Hinweis zu finden. Die Mengen auf den Bestell- und Lieferscheinen stimmen exakt überein. An denen ist nichts auszusetzen. Er nimmt sich die Materialausgabelisten des Magazins vor und beginnt mit dem 19.05.1978, dem Tag, an dem die Bauarbeiten am städtischen Busbahnhof begonnen haben. Nacheinander gleicht er die Bestell- und Lieferscheine mit den zugehörigen Materialausgabelisten ab. Zunächst liefern auch diese kein verwertbares Ergebnis, bis er zum Eintrag vom 30.07.1978 gelangt. Die auf dem quittierten Lieferschein der Baustelle ausgewiesene Menge passt nicht zu der dokumentierten Menge der Materialausgabe. Letzterem zufolge haben dreißig Kubikmeter Sand mehr den Bauhof verlassen, als auf der Baustelle ankamen.
Sollte es etwa reiner Zufall sein, dass die Differenz zwischen Ausgabe- und Liefermenge genau in jenen Zeitraum fällt, in dem Gönczy Pál sein Haus baute? Für István besteht nicht der geringste Zweifel. Ein Gedanke folgt dem nächsten. Sollte der zusätzliche Sand also tatsächlich nicht auf der Baustelle angekommen sein, müsste demnach mindestens eines der Fahrtenbücher der Lastkraftwagen an diesem Tag Kilometerabweichungen aufweisen.
Und tatsächlich, die Fahrtenbücher zweier Fahrzeuge weichen ab. Multipliziert István die Gesamtanzahl der dokumentierten Hin- und Rückfahrten zwischen dem Warendepot und der etwa sechs Kilometer entfernten Baustelle, weisen die Einträge eine Gesamtstreckendifferenz auf, die etwa jeweils einer Hin- und Rückfahrt nach Hajdúböszörmény, dem Ort, in dem Göncy Pál heute wohnt, entspricht. Das ist es. Dieser Schweinehund hat sich tatsächlich Material auf seine eigene Baustelle liefern lassen.
Angespornt von diesem ersten Teilerfolg ist István überzeugt, weitere Ungereimtheiten zu finden. Seine Vermutung stellt sich als begründet heraus. Im Laufe der Wochen folgten weitere Lieferungen mit den gleichen Ungereimtheiten; Zement, Ziegel, Bauholz und Betonfertigteile.
István notiert auf einem Zettel diejenigen Dokumente, die er vervielfältigen lassen will, knipst das Licht aus und verlässt mit einem Gefühl der Genugtuung das Büro.
„Wenn es wirklich stimmt, was du herausgefunden hast, dann wäre das unerhört“, sagt Józsi bácsi, als er am nächsten Morgen Istváns Notizen betrachtet.
„Wenn es stimmt? Sind die Notizen etwa nicht Beweis genug?“, antwortet István angriffslustig. „Ich muss mir nur noch überlegen, wie und wann ich die Bombe platzen lasse.“
Józsi bácsi reibt sich nachdenklich die Stirn.
„Mein Junge, das halte ich für keine gute Idee.“
Verdutzt schaut István seinen Vorgesetzten an.
„Die Abweichungen sprechen für sich. Doch einen echten Beweis haben wir nicht. Die Baustoffe könnten auch an einen anderen Ort geliefert worden sein. Hast du diese Möglichkeit in Betracht gezogen?“
„Wir beide wissen ganz genau, wohin die Lieferungen gegangen sind!“
Der Alte holt tief Luft, als wolle er die Zeit nutzen, sich auf der Suche nach den richtigen Worten zu sammeln.





























