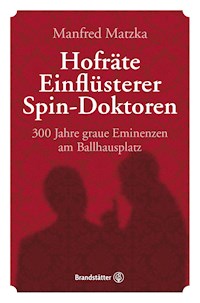Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wo Macht und Menschen zusammenkommen, sind kuriose Persönlichkeiten ebenso nah wie große Skandale, absurde Intrigen, revolutionärer Elan und schicksalhafte Begegnungen. Hier, in den Wiener Machtzentralen, den Ministerien und den Parteisitzen, wurde und wird Geschichte geschrieben – vieles davon spielt sich für gewöhnlich aber im Verborgenen ab. Mit Manfred Matzka, der Österreichs politischen Betrieb von innen kennt wie wenig andere, schauen wir nun hinter die Türen und verhängten Fenster der Macht – und begegnen jenen oft speziellen Charakteren, die von dort aus mal besser und mal schlechter gewaltet und geschaltet haben: fundiert recherchierte, spannende und erhellende Einblicke hinter die Fassaden der Macht in Österreich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Matzka
Schauplätze der Macht
Geheimnisse Menschen Machenschaften
Vorwort:MINISTER, MACHT UND MARMOR
Bundeskanzleramt 1918–1938
DEMOKRATIE UND DIKTATUR
Bundeskanzleramt seit 1945
REGIERUNG UND REFORM
Außenministerium
AUSSEN UND INNEN
Präsidentschaftskanzlei
GLANZ UND HILFLOSIGKEIT
Finanzministerium
GELD UND GOLD
Justizministerium
RECHT UND UNRECHT
Innenministerium
ORDNUNG UND MISSBRAUCH
Verteidigungsministerium
GEWALT UND GESCHÄFT
Bildungsministerium
KULTURKAMPF UND SCHULKRAMPF
Handels- und Landwirtschaftsministerium
HANDEL UND WANDEL
Sozialministerium
OBRIGKEIT UND OBSORGE
Verkehrs- und Verstaatlichtenministerium
KRISEN UND KORRUPTION
SPÖ
ROT UND REALISTISCH
ÖVP
SCHWARZ UND STARK
Nachwort:POLITIK UND ARCHITEKTUR
VORWORT
Minister, Macht und Marmor
MAN KENNT DIE FASSADEN der Wiener Palais, in denen Bundeskanzler, Bundespräsident, Finanz-, Justiz-, Innen-, Bildungsminister, Parteien arbeiten. Man kennt sie von außen, allenfalls noch ein paar Räume von Fernsehbildern. Was aber hinter den Fassaden abläuft, welche Strukturen, Machtspiele, Intrigen, Usancen dort bestimmen, was im Land geschieht, das bleibt weitgehend im Verborgenen.
Wie ist das mit der Macht, die von dort ausgeübt wird? Was geschieht hinter den abends mitunter hell erleuchteten Fenstern? Können sie dort tun, was sie wollen, tun sie, was sie wollen, was wollen sie eigentlich, wie funktionieren sie? Wir lesen, was darüber in den Zeitungen steht, hören, was sie selber sagen, sehr viel mehr können wir aber nicht wahrnehmen. Immerhin waren es bisher annähernd 600 Männer und Frauen, die von ihren oftmals feudalen Amtssitzen als Minister das Land regiert haben. Einige wenige länger als ein Jahrzehnt, etliche nur wenige Tage, manche mehrmals und in unterschiedlichen Funktionen, Einzelne sogar in zwei Republiken.
Dieser Machtausübung im Detail nachzugehen ist spannend, weil die Türen für die Bürger ebenso verschlossen sind wie die Auskunftsfreudigkeit der Entscheidungsträger darüber, was wirklich läuft – von zufällig aufgeflogenen Handy-Nachrichten einmal abgesehen. Das Amtsgeheimnis lastet noch immer als Schleier über allem, und die Messages, die die Medien in den vergangenen Jahren so intensiv beschäftigten, sind nur einzelne Blitzlichtaufnahmen. Sie sind aufschlussreich, aber das wirkliche, ganze, große Bild erschließt sich erst, wenn man hineingeht in die Gebäude, in ihre Geschichte und ihre Arbeitsbedingungen; wenn man sich im Detail anschaut, wer dort arbeitete, wie und mit wem; nachspürt, wie sich Macht und Einfluss dort verfestigten und von dort ausstrahlten.
Wir werden sehen, dass Bundespräsidenten viele Jahre kein eigenes Büro hatten, die Justiz in der Ersten Republik eine Erbpacht Deutschnationaler war, dass Unterrichtsminister die Polizei führten, dass es jahrelang so etwas wie ein „Korruptionsministerium“ gab, dass Republikspitzen von zu Hause aus amtierten, dass Mord in Amtssitzen verübt wurde, wie Seilschaften funktionieren, dass einige Ministerinnen und Minister den eigenen Rücktritt aus der Zeitung erfuhren und ein paar vom Strafrichter eingesperrt wurden.
In drei der prominentesten Palais habe ich selbst viele Jahre verbracht, nahe den Chefs oder in größerer Distanz als Zuarbeiter. Der Ballhausplatz, die Hofburg und das Modena waren meine Arbeitsplätze. In einem Dutzend weiterer Feudalsitze ging ich so oft ein und aus, dass ich heute noch mit verbundenen Augen vom Portier bis zum Chef/zur Chefin finde. Zu allen Tageszeiten war ich dort, habe verhandelt, interveniert, Expertise geliefert, ging erhobenen Hauptes mit einem erfolgreichen Projekt oder geschlagen und voller Selbstzweifel nach einer Niederlage hinaus. Und dafür, warum etwas gut oder schlecht ausgegangen ist, war neben den handelnden Personen und dem Zeitpunkt oft auch das Ambiente entscheidend.
Eines ist mir dabei klar geworden und wird wohl auch in der Lektüre der folgenden Kapitel erkennbar werden: Die Macht derer, die die Schaltstellen der Republik besetzen, ist sehr groß, die Dimension wächst und schrumpft mit den handelnden Personen, unbegrenzt ist sie aber nicht. Und das ist gut so, das ist das Essenzielle einer funktionierenden Demokratie. „Das Wort Macht täuscht ja“, sagte einmal ein Kanzler, „es ist nur eine Position der Verantwortung“. Die Minister bewegen sich in einem Korsett von verfassungsrechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und medialen Zwängen, die ganz schön einengen können; und sie bewegen sich in einer Außenwelt, die sie nicht sehr stark beeinflussen können: Naturgesetze und Pandemien, Kapitalmacht und Globalisierung, Konjunktur und Krise. Diese Faktoren können sie nicht beseitigen und dürfen sie nicht ignorieren; sie können sie bestenfalls rechtzeitig erkennen, den Auswirkungen gegensteuern, die Interessen ihrer Wählerschaft einigermaßen wahren, Linie halten und sich fürs nächste Mal besser vorbereiten.
1960 schämte sich die Republik für große Dienstwagen noch nicht.
WAS MACHT EIGENTLICH so ein Minister, eine Ministerin den ganzen Tag? Wie sieht das „Regieren“ hinter den Fassaden im realen Alltag aus?
Es beginnt wohl regelmäßig damit, dass ein Fahrer mit der Limousine vorfährt. Nur ganz selten kommt es vor, dass ein Minister, der in der Innenstadt wohnt, auf einen Dienstwagen verzichtet – dann muss er auch nicht so wie die anderen dafür 600 Euro im Monat zahlen. Die Bürofahrt gehört der Zeitungslektüre, man ärgert sich fast immer über irgendeine Meldung und ruft den Mediensprecher oder einen politischen Leidensgenossen der heutigen Berichterstattung an. Im Büro angekommen, warten schon Kabinettschef und Terminsekretärin, beide beladen mit Wünschen, Briefen, Akten – der Eindruck ist, alle wollen den Minister nur zuschütten, damit er möglichst nicht auf eigene Gedanken kommt. Zwei, drei dringende Anordnungen gegeben für den Tag, und dann beginnt der schreckliche Reigen der „Audienzen“.
Alle Welt will zum Minister, ihm direkt etwas vortragen, eine konkrete Zusage erhalten, sich wichtigmachen, ihn zu etwas motivieren oder vor etwas bewahren, eine ganz dringende und entscheidende Sache regeln. Die Wünsche nach Vorsprachen sind Legion, nur mit großem Geschick und eiserner Strenge schafft es die Termindame, sie auf ein Viertel einzuschränken. Aber auch damit sind täglich vier Stunden weg, und wenn es Auswärtstermine in der Partei, im Wahlkreis, in Brüssel gibt, ein ganzer Tag. Entschieden wird bei diesen Audienzen wenig, meist ist ein Sekretär dabei, dem die Sache in die Hand gegeben wird. Er wird sie – vielleicht sogar mit den zuständigen Beamten gemeinsam, was sinnvoll wäre – irgendwie erledigen.
Zu einer eingehenden Reflexion kommen Minister in ihren Salons nicht. Die meisten Aktivitäten sind außengesteuert, medienbedingt – die Pressesprecherin kommt mehrmals am Tag vorbei und hat jedes Mal schon Texte für Äußerungen oder Nummern von Interviewpartnern dabei. Rasch inhaltlich einlesen, dann geschickt Rede und Antwort stehen, den Spin nicht vergessen. Und bei wichtigen Fragen unbedingt den Kanzler vorinformieren.
Mittagessen ist meist nicht. Ein Weckerl, lieblos beigeschafftes Fast Food. Organisierte Diners im Restaurant sind ohnehin stressige Arbeitstermine und zudem noch ein Spießrutenlauf durch Bittsteller auf dem Hin- und Rückweg (Wirt inklusive, der unbedingt Kommerzialrat werden will). Vielleicht findet man ein wenig Zeit, mit dem Kabinett rasch ein paar Projekte durchzugehen, Aufträge zu geben, allzu Wichtigtuerisches zu erkennen und abzuwehren, ein Detail einer strategischen Linie zu entwickeln. Nützlich wäre es, mit den Sektionschefs wirklich eingehend etwas durchzuarbeiten, große Vorhaben und Linien anzureißen – aber das geht sich nicht aus und die Sekretäre halten das ohnedies für unnötig.
Eigentlich viel zu wenig Zeit und fast gar kein Gedankenaufwand für die Dinge des Ressorts, für die Alltagsarbeit des Verwaltens, des Regierens. Stattdessen nur immer wieder Akten und Unterschriften. Dutzende täglich. Vieles davon unnützer Kleinkram, der nur zeigt, dass vife Bürokraten Meister darin sind, Dinge nach oben zu delegieren. Wichtiges, wirklich Wichtiges kommt kaum per Akt – da muss man nachfragen, lästig sein, anweisen. „Erst im Nachhinein“, sagte mir ein Minister, „kommt man drauf, wie viel Zeit man mit Dingen verbringt, die aktuell unumgänglich scheinen, aber sinnlos waren. Es gibt zu viele Anlässe, wo eigentlich nur ihre physische Präsenz notwendig ist und sie nichts zu tun haben, außer anwesend zu sein. Gleichzeitig gibt es aber viele Dinge, bei denen die Zeit davonrennt.“
Und dann sind noch die besonderen Ereignisse: Ministerrat am Mittwoch – in der Sache alles schon vorentschieden und vorgegeben; es kann aber in der fraktionellen Vorberatung lästig werden, sollte der Kanzler wieder einmal grantig sein und ein Opfer im Ministerkreis brauchen. Es kann sogar unangenehm werden, wenn eine Fehlentscheidung im Ressort mediale Wellen schlägt und man vor die Presse geschickt wird. Besonders ist auch ein Parlamentstag – endloses Sitzen auf der Regierungsbank, langweilig bis zum Abwinken, aber man muss freundlich Interesse heucheln und hellwach sein, falls ein untergriffiges Detail auftaucht. Ministerrat in Brüssel – das Schrecklichste von allem; hier ist wirklich alles bereits vorentschieden, aber dennoch muss man den ganzen Tag in der klimatisierten Bürokratenburg ausharren. Man hört nicht zu, kann aber wenig anderes machen; und in den seltenen Fällen, wo wirklich noch ein Punkt zu entscheiden ist, nerven die end- und sinnlosen Schleifen um die Kompromissmöglichkeiten bis tief in die Nacht, ja bis zum Morgengrauen, wo man endlich völlig zermahlen in den Charterflieger retour nach Wien steigt.
Letzte Ministerratssitzung Kreisky, 1983
Habe ich als Minister heute tatsächlich regiert, Macht ausgeübt, über die Zukunft des Landes entschieden? Die Frau oder der Mann hat dieses Gefühl zumeist nicht – auch wenn die eine oder andere Personalentscheidung ein Schicksal bestimmt hat, eine Verordnungsunterschrift Millionen bewegt, ein Projektauftrag in einem Jahr die Realität verändert, eine politische Weichenstellung langsam eine Lawine ins Rollen bringt, ein Medienauftritt einen Stein ins Wasser wirft. Merkbar ist der Effekt nicht sofort, vielleicht nach einem längeren Zeitraum – und wenn man erkennt, dass die Bilanz negativ ist, ist es auch schon zu spät. Minister zu sein ist mühsam, stressig, frustrierend, langweilig, fantasietötend, zeitfressend, zerstörend – aber natürlich auch wohltuend für das Ego, berauschend in den Momenten des Machtworts, angenehm, weil einen das Ambiente, die Arbeitsumgebung, das Palais erhöht und zu jemand Besonderem macht. Alle wissen, dass es diese Macht gibt, alle unterwerfen sich ihr, nur wirkt sie so im Hintergrund, zwischen den sichtbaren Aktionen, strukturell, heimlich, verborgen, dass man sie konkret meist kaum festmachen kann.
Hertha Firnberg hat einmal ihre ambivalente Position als Ministerin im Palais angesprochen: „Sie dürfen nicht vergessen, wie schwer es für einen Politiker ist, kein Privatleben und auch für seine Freunde keine Zeit zu haben.“ Aber „ich bin an sich dagegen, dass Politiker plötzlich aufsteigen in eine andere, begüterte Klasse, und sich auch danach verhalten. Ich halte das für einen grundsätzlichen Fehler. Man soll mit den Leuten so leben, wie die Leute selber leben.“ Ob das wirklich so einfach möglich ist, ließ sie offen.
EIN MINISTERIUM ist eine komplexe Organisation. 300 bis 1000 Mitarbeitende sind auf ein halbes Dutzend Sektionen aufgeteilt, diese gliedern sich wieder in Abteilungen; manchmal hat man eine Zwischenebene, Gruppen, eingezogen, und oftmals gibt es noch eine unterste Organisationsebene, die Referate. Die klassische Linienorganisation ist allerdings in den letzten Jahrzehnten fantasievoll mit allerlei Sondergebilden garniert worden: Ministerbüros, Thinktanks, Stabsstellen, Projektgruppen … Deren Sinn besteht darin, an den Verwaltungsexperten dort politisch vorbeizuregieren, wo man ihnen nicht traut. Und dieses Misstrauen, wenngleich in der österreichischen Verwaltungstradition unbegründet, hat zugenommen, wie das explosionsartige Wachstum der Ministerbüros zeigt: Mittlerweile halten wir hier bei rund 280 Köpfen, ein Vielfaches dessen pro Minister, was etwa EU-Kommissare brauchen und was noch Klaus und Kreisky in ihrem unmittelbaren Umfeld befehligten.
Der Schauplatz der Vorzimmer der Macht hat sich allerdings – außer der Größe des Sekretärstabes – nicht sehr geändert; noch immer ist treffend, was der alte Beamte Kleinwaechter über sein Avancement zum „Vorzimmerpinsch“ schrieb: „Schon der Wechsel des Büros befriedigte mich über alle Maßen. Aus meinem elenden Glasverschlag war ich mit einemmal in einen prächtigen Salon versetzt. Großer Diplomatenschreibtisch mit einem breiten, bequemen Fauteuil davor. In der Ecke eine Salongarnitur, bestehend aus mit grünem Samt überzogenen Fauteuils und ebensolchem Sofa und einem Mahagonitisch. Bücherschrank. Teppich über den ganzen Raum. Prachtvoller Luster. Bilder an den Wänden. Schwere Seidenportieren. Amtsdiener nur für den Chef und seinen Vorzimmerpinsch. Was mich aber besonders entzückte, war das Tischtelephon.“ So ähnlich habe ich 100 Jahre später meinen ersten Arbeitstag im Kabinett des Innenministers und meinen ersten Arbeitstag als Präsidialchef im Bundeskanzleramt erlebt. Nur hatte das Telefon mehr Knöpfe.
Neben der formalen Organisation von Ministerien existiert noch eine informelle: Seilschaften aus politisch miteinander verbundenen Parteifreunden, verschworene Klubs aus CV-Bundesbrüdern oder aus Freimaurern, lose Klubs und Netze zur gegenseitigen Karrierehilfe, Gewerkschaftsgremien, Bundesländer-Kreise oder einfach nur gute kollegiale Freunde, die gerne, effektiv und intensiv in einer langjährig bewährten Gruppe zusammenarbeiten. Um diese informelle Struktur klar zu durchschauen, braucht ein Minister Jahre; um sie zu nutzen und optimal einzusetzen, benötigt er besonderes Geschick, großes Wissen und intensivste Organisationserfahrung. Die meisten der aktuellen Ministerinnen und Minister haben das nicht, weil sie „Verwaltung“ nicht gelernt haben. Daher versuchen sie krampfhaft, diese Lücke durch übertriebene Kontrolle und Intervention in das operative Geschäft zu kompensieren. Genau das geht aber schief, denn Minister sind dazu da, zu planen und Strategien zu verfolgen, nicht zu administrieren. Sie sind es, die steuern, der Verwaltungsapparat sind die Ruderer. Da soll keiner dem anderen hineingreifen.
Mitunter suchen Ministerinnen und Minister beim Regieren auch das Heil in dreisten Personalbesetzungen. Das geht aber besonders schief, weil die vertrauensvolle Nähe zum Chef nichts mit der Qualifikation zu tun hat und nur in seltenen Fällen korreliert. So werden diese „Implantate“ in ein Scheitern an ihren Aufgaben hineinmanövriert, vom Gesamtkörper der Bürokratie abgestoßen, sie produzieren die Fehler, deretwegen in den letzten Jahren das allgemeine Vertrauen in den Staat so sehr abgenommen hat. Und dass die Reaktion der Entscheidungsträger, als sie das Scheitern feststellten, immer nur war, noch mehr jener Leute hineinzupressen, hat das Ganze nur noch verstärkt.
Eines wird klar, beschäftigt man sich mit der Geschichte der Ministerien: Die politischen Parteien haben diese Institutionen immer auch dazu benutzt, ihre personelle Basis auszubauen. Bei der Aufnahme von neuem Personal, bei der Besetzung von Führungsfunktionen hat man immer auf die eigenen Leute geschaut und damit eine Bindung einer wachsenden Klientel begründet. Und da ging es nicht nur um die paar tausend Stellen in den Ministerien selbst, sondern auch um den riesigen Bereich der Verwaltung und der staatsnahen Wirtschaft, der von diesen geführt und beherrscht wird. Das sind bei Bund, Ländern und Gemeinden etwa 300.000 Arbeitsplätze und in der öffentlichen Wirtschaft noch einmal so viel – also schon relevante Größenordnungen für die Stärke einer Partei, die es lohnend erscheinen lassen, der „Einfärbung“ besonderes Augenmerk zu widmen.
Diese Praxis haben die beiden alten und früher großen Parteien perfektioniert. Es ist aber erstaunlich, wie rasch auch die kleinen und neuen Parteien, insbesondere die FPÖ und die Grünen, hier die Methoden gelernt haben. Zwar sind in den letzten Jahrzehnten die dafür geschaffenen Vorfeldorganisationen – allen voran der CV – schwächer geworden und eine höhere Transparenz der internen Vorgänge hat ebenfalls dämpfend gewirkt. Umgekehrt aber wurden persönliche Klüngel und Seilschaften, geheime und intransparente Strukturen, die direkt von Ministerbüros aus gesteuert wurden, deutlich stärker und in ihren Methoden brutaler und unverschämter. Der Trend ist jedenfalls insgesamt noch nicht gebrochen.
So viel zum Strukturellen und Politischen, das ich an den Schauplätzen der Macht als Beamter, als Kabinetts- und Sektionschef, als Berater gesehen und gelernt habe.
ABER AUCH MANCH ANEKDOTISCHES zum Verhalten der Mächtigen in ihren Arbeitsstätten taucht auf. Ich erinnere mich an den warmen Frühlingstag 1974, als mich die von mir hoch geschätzte Ministerin Firnberg vom SPÖ-Parteirat im Volksheim Floridsdorf, der eben Kirchschläger zum Präsidentschaftskandidaten gekürt hatte, im Dienstwagen in die Stadt herein mitnahm. Sie hätte wohl selber gerne kandidiert, merkte ich an ihrer gedrückten Stimmung. Aber als ich ihr in der pompösen Einfahrt des Minoritenplatzpalais den Wagenschlag öffnete, seufzte sie nur mit versonnenem Blick zur Stuckdecke: „Weißt du, die Einfahrt in die Hofburg ist schöner.“ Ich denke an die Anweisung eines Kanzlers, die Luster im Kongresssaal des Bundeskanzleramts am Abend immer bis 21 Uhr erleuchtet zu lassen, damit die Leute draußen glauben, es werde täglich bis in die Nacht hinein gearbeitet. Oder an den Landwirtschaftsminister, der mich nach einem Vieraugengespräch über Verfassungsfragen zum großen Fenster seines Arbeitszimmers im ersten Stock des Regierungsgebäudes am Stubenring zerrte. Da schob er den Vorhang zur Seite, zeigte auf die riesige Bronzestatue des alten Radetzky zu Pferde und meinte resignierend: „Ich weiß nicht, was ich angestellt hab’, dass ich den ganzen Tag dem Ross in den Arsch schauen muss.“ Im Reichskanzleitrakt des Kanzleramts hatten wir damals unser Sitzungszimmer just über dem Thronsaal; und weil dessen Decke durchhing, war unser Fußboden leicht abschüssig, sodass eine Seite des runden Sitzungstisches vier Zentimeter tiefer lag. Dorthin platzierten wir immer die Verhandlungspartner, und sie konnten sich einfach nicht erklären, warum sie sich uns immer so sehr unterlegen fühlten. Und unvergessen der wichtige Rat, den mir mein Minister-Chef zuraunte, als wir zu zweit am 2. Feber 1989 in der prachtvollen Beletage des Innenministeriums eintrafen und er dort von einer großen Schar beflissener Ministerialer als neuer Minister ehrerbietig begrüßt wurde: „Wennst was wirst, vergiss ja deine alten Freunde nicht, denn es kann jeden Tag vorbei sein mit der Wichtigkeit“. Schließlich fällt mir noch der 21. Juni 2006 ein, an dem ich den ganzen Tag in der Hofburg nicht von der Seite des US-Präsidenten Bush wich, weil ich mich selber als seinen liaison-officer eingeteilt hatte, um zu sehen, wie der Mann tickt. Zwischen einem fast gemeinsamen Gang aufs Örtchen und einem brutalen Rempler der eiskalten Condoleezza Rice konnte ich in 13 Stunden feststellen, dass er wahrlich nicht so schlicht im Geiste war, wie man ihm medial nachsagte.
Wie das ist mit der Wichtigkeit, wie alles in den Häusern der Macht zusammenwirkt, wie es aufwärts und bergab ging mit den Mächtigen in der österreichischen Republik? Dem will ich in den folgenden Kapiteln nachgehen. Macht, Geld, Souveränität, Recht, Krieg und Frieden, Gewalt, Ordnung, Wissen, Parteipolitik sind dabei die Schlagworte, die imposanten Häuser sind die wichtige Bühne, auf ihr geht es um Bemühungen und Fehler, aber auch um die verantwortungsvolle Aufopferung oder den verachtenden Zynismus der Menschen darauf und dahinter.
Wozu das alles? Vielleicht hat es Sinn, Argumente dafür zu finden, wer tatsächlich mit seinem oder ihrem Ministeramt einen Anspruch verwirklichte, für die Gemeinschaft, für das Land, für die Zukunft etwas besser zu machen, als es bisher war, oder zumindest eine Verschlechterung nachhaltig zu verhindern. Und wer – das wäre der gegensätzliche Fall – nur Minister war, um Minister zu sein und davon persönlich maximal zu profitieren. Vielleicht ist es sinnvoll, dahinterzukommen, wer es konnte und wer nicht, wer Substanz hatte und wer bluffte. Damit man Übles, wenn es schon in der Vergangenheit unabwendbar war, zumindest in der Zukunft verhindern und Besseres ermöglichen kann.
Den Versuch war es wert. Herausgekommen ist ein besonderes und durchaus subjektiv gefärbtes Buch. Es ist ganz sicher kein Architekturführer – obwohl es einer Reihe von bemerkenswerten Bauten, deren Geschichte, Ausstattung und Wirkung auf das, was drinnen passierte, viel Raum widmet. Es ist kein Geschichtsbuch – obwohl es manchmal auch detailliert das Handeln und Scheitern mächtiger Minister in den letzten 100 Jahren nachzeichnet, soweit es typisch war und man daraus lernen kann. Es ist keine Sammelbiografie, obwohl es mir gelungen ist, eine Reihe von betagten Zeitzeugen dazu zu bewegen, noch ein letztes Mal im Gespräch ihre Ministerzeit Revue passieren zu lassen und Informationen zu geben, die man so authentisch nie mehr wieder erhalten wird. Es ist kein politikwissenschaftliches Werk – obwohl österreichische Regierungspolitik das Objekt der Beschreibung und kritischen Auseinandersetzung ist. Es ist mit Absicht ein Mosaik aus all dem, denn erst die ausgewogene Mischung all jener Elemente zusammen ergibt das komplette Bild der staatlichen Macht in diesem Land.
BUNDESKANZLERAMT 1918–1938
Demokratie und Diktatur
„Die Fenster des schönen alten Palais am Ballhausplatz […] warfen oft noch spät abends Licht in die kahlen Bäume des gegenüberliegenden Gartens, und gebildete Bummler, wenn sie nachts vorbeikamen, fasste Schauer an. Denn so wie der heilige Josef den gewöhnlichen Zimmermann Josef durchdringt, durchdrang der Name ‚der Ballhausplatz‘ den dort stehenden Palast mit dem Geheimnis, eine des halben Dutzends mysteriöser Küchen zu sein, wo hinter verhängten Fenstern das Geschick der Menschheit bereitet wurde.“
(ROBERT MUSIL, „DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN“)
IN DER MONARCHIE war der Ballhausplatz mehrmals Entscheidungszentrum für halb Europa. Heute ist er nur mehr politisches Zentrum der Republik. Aber weder das Bundeskanzleramt noch die Präsidentschaftskanzlei waren zu Beginn dieser Republik an dem Platz, an dem sie aktuell residieren. Im alten Palais Kaunitz, dem heutigen Bundeskanzleramt, tagte nach 1918 zunächst nur der Ministerrat und gab sich jene Geschäftsordnung, die die reale Ausübung der Staatsmacht in den folgenden 100 Jahren prägte. Darüber hinaus saß der Staatssekretär für Äußeres am Ballhausplatz. Der Bundeskanzler hingegen hatte sein Büro in der Herrengasse, im heutigen Innenministerium. Zudem hatte am Ballhausplatz auch der 1919 zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählte Karl Seitz seine Dienstwohnung. Doch erst im Dezember 1920 fand der neu gewählte Bundespräsident Michael Hainisch in den an der Löwelstraße gelegenen Zimmern sein neues Büro; die junge Republik wollte sich in ihren Symbolen nicht an die überwundene Monarchie anlehnen, daher sollte das Staatsoberhaupt hier und nicht in der kaiserlichen Hofburg sitzen.
Die Staatskanzlei, jahrhundertelang Schauplatz der habsburgischen und internationalen Diplomatie, wurde 1717 im Auftrag des Obersthofmeisters Sinzendorf durch Johann Lucas von Hildebrandt gebaut, um für den erstmals entstehenden professionellen Apparat der Außenbeziehungen eine Infrastruktur zu schaffen. Entsprechend den damaligen Gepflogenheiten musste das Gebäude sowohl das Amt als auch die Residenz des Ministers beherbergen. Da der Bauplatz recht beengt war, entschied sich Hildebrandt für einen fünfeckigen Bau, der die kurze Platzfassade eindrucksvoll erweiterte. Über dem großen Einfahrtstor signalisierte ein Balkon die Wichtigkeit des Hauses, die Beletage wurde betont, sonst war nicht viel Schmuck angebracht.
Man fuhr in die stuckverzierte Einfahrt, stieg beim rechten Wagenschlag aus und schritt die Prunkstiege direkt hinauf in die Beletage. Diese war zweigeteilt: rechts die private Repräsentationswohnung, links der Amtsflügel und dazwischen vier Räume für eine beiderseitige Nutzung. Von der Treppe kam man zunächst in einen schlichten Vorsaal, von diesem in den über sieben Meter hohen Festsaal mit vergoldeten Stuckaturen, Friesen und Simsen und einem Plafond, in dem sich vier Lüftungsgitter in den darüber liegenden Raum öffnen. Sie hatten zur Zeit des Wiener Kongresses große Berühmtheit erlangt, weil Metternichs Schreiber durch sie mithörten und mitschrieben. Fünf schwere Luster funkeln mit ihren Kristallen und erleuchten den Saal für nächtliche Festlichkeiten. Hier konnte man schon Hof halten – auch wenn sich das gesamte Gebäude im Vergleich zu den Palais der wirklich reichen Potentaten bescheiden ausnahm.
Vom großen Saal gelangt man durch einen fünfeckigen Salon in den heutigen Ministerratssaal mit einer strengen, aus dem frühen 19. Jh. stammenden Ausstattung. Ihn dominieren Stucco-lustro-Wände, zwei große vergoldete Spiegel und noch immer ein Bild des 18-jährigen Kaisers Franz Joseph. Der Raum ist heute die Schaltstelle der österreichischen Politik. Nach einem weiteren kleinen Salon erreichte man ursprünglich das Ministerzimmer, dessen kleiner Balkon damals auf die Bastei hinausblickte. Von diesen Räumen aus konnte man über eine kleine eiserne Brücke direkt auf die Krone der Stadtmauer und in das hübsche Paradeisgartl gelangen. Nach dem Ministerzimmer lag die Kapelle, die Metternich später zugunsten einer Bibliothek in den Halbstock verlegte. Heute befindet sich das Kanzlerzimmer nicht mehr hier, sondern im rechten Flügel.
Die Wohnung in dieser Flucht – wo aktuell der Bundeskanzler amtiert – war fast gemütlich angelegt. Durch einen schmalen Spiegelgang erreichte man ein Vorzimmer und von dort das große Boudoir der Dame des Hauses, südseitig im ruhigen Innenhof, sowie das Schlafzimmer und den Speisesaal – früher Säulensaal, heute holzgetäfeltes Kanzlerbüro. Ein paar Nebenräume sowie ein Herrenzimmer hinter dem Säulensaal schlossen das Ganze gegen das Minoritenkloster ab. Eine Hintertreppe führte in das Obergeschoß und in den Hof hinunter. Heute liegen hinter dem Kanzlerzimmer noch weitere Räume, üblicherweise auch das Büro des Kabinettschefs, da der Flügel 1902 in Richtung Staatsarchiv verlängert wurde.
Im darüberliegenden zweiten Stock befanden sich zur Zeit der Monarchie die privaten Wohnräume der Ministerfamilie, die Kinderzimmer, die Privatkanzlei sowie Wohnräume führender Hausangestellter. Im Hochparterre unter der Beletage lagen die Dienstzimmer der Beamten der Staatskanzlei und nochmals darunter im linken Flügel die Stallungen und im rechten die Küche, von wo zwei Spindeltreppen das Service nach oben ermöglichten.
Staatskanzler Renner nutzte 1918–20 das Gebäude nur wenig und nur in seiner Rolle als Leiter des Außenamts; Gleiches gilt für seine Nachfolger Michael Mayr und Johann Schober. Erst am 18. Juni 1923, nachdem der Völkerbund dem österreichischen Kanzler Seipel aufgenötigt hatte, einige Ressorts einzusparen, beschloss die Bundesregierung die Zusammenlegung von Kanzler- und Außenamt im Palais. Der ehemalige Privatflügel wurde dem Bundeskanzler zugeordnet – Marmorecksalon als Vorzimmer, das daran anschließende Zimmer als Arbeitszimmer, dahinter den Säulensaal als Besprechungsraum und danach vier Räume an der Außenfront und vier innenliegende Zimmer. Im rückwärtigen Teil der Beletage wurden die Räume ebenfalls vom Kanzleramt genutzt. Das Außenamt, insgesamt nur zwei Sektionen, war im Hochparterre und in Teilen des Obergeschosses konzentriert, zum Teil musste es in benachbarte Palais auswandern. Jetzt wurde der Ballhausplatz wieder Zentrum der österreichischen Politik, denn hier amtierten nun Bundespräsident, Bundesregierung und Bundeskanzler – der mehrmals auch die Ressorts Äußeres, Inneres und Justiz führte. Aufgrund dieser Kompetenzfülle gab es in den Folgejahren auch zusätzlich zahlreiche Kanzleramtsminister.
Säulensaal, Besprechungszimmer des Kanzlers bis 1938
1924 BEGANNEN – vor allem wegen des Sparkurses Seipels – innerparteilich die Länder zu rebellieren und legten ihm den Rücktritt nahe. Der Prälat war seit einem Schussattentat ohnedies psychisch und körperlich geschwächt und demissionierte am 8. November. Jetzt wurde der Salzburger Rudolf Ramek neuer Chef eines Kabinetts, in dem Vertreter der Länder starke Positionen innehatten. Der erfahrene Pragmatiker schaffte es am Ballhausplatz tatsächlich, bis Oktober 1926 seine Regierung zu halten. In seine Amtszeit fiel die Einführung des Schillings, die die ökonomische Stabilisierung der Republik symbolisierte. Letztlich stolperte er aber über Bankenzusammenbrüche, die er nicht verhindern konnte.
Daher übernahm im Oktober 1926 nochmals Seipel die Regierung, doch in der Folge verschärften sich die innenpolitischen Spannungen zusehends. Am Ballhausplatz war das daran zu merken, dass immer mehr Demonstrationen ihren Weg zum Bundeskanzleramt nahmen. Einen blutigen Ausbruch fanden die Konflikte am 30. Jänner 1927 im burgenländischen Schattendorf, als rechte Frontkämpfer das Feuer auf eine Demonstration des Republikanischen Schutzbundes eröffneten und zwei Menschen töteten. Die Verantwortung war klar, aber Kanzler Seipel beschwor vom Ballhausplatz aus nur die Gefahr der roten Volksfront. Es war erkennbar, dass er darauf abzielte, die Sozialdemokratie auszuschalten.
Die Allgemeinheit glaubte Seipel sein Bedrohungsszenario allerdings offenbar nicht, denn bei der Wahl im April 1927 erreichten die Sozialdemokraten mit über 42 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis. Seipel musste daher eine Koalition aus drei Parteien zusammenbasteln. Als am 14. Juli die Mörder von Schattendorf in Wien freigesprochen wurden, brach tags darauf der Aufstand los: Eine empörte Menge stürmte den Justizpalast und setzte ihn in Brand, Regierung und Bundeskanzler sahen sich einer kaum mehr lösbaren Krise gegenüber. In dieser suchte Seipel sein Heil in der Verfolgung sozialdemokratischer Institutionen, übersah dabei aber die wachsenden Konflikte innerhalb seines Bürgerblocks. Als jene offen aufbrachen, trat er im April 1929 zurück – er war abermals gescheitert.
Noch einmal eröffnete sich am Ballhausplatz eine Chance auf konstruktive Zusammenarbeit der großen gesellschaftlichen Kräfte im Land, als 1929 Ernst Streeruwitz für viereinhalb Monate das Kanzleramt übernahm und von dort die Sozialdemokraten für eine umfassende Verfassungsnovelle gewinnen konnte. Doch wurde er über Nacht von der eigenen Partei gestürzt, die einen radikaleren Kurs sehen wollte. Polizeipräsident Schober übernahm (zum dritten Mal) am 26. September das Kanzleramt für ein Jahr – er war aber das absolute Feindbild der Arbeiterbewegung und wieder war an eine formelle Zusammenarbeit nicht zu denken. Im Mai 1930 erklärte die Heimwehr mit dem „Korneuburger Eid“ offen, die parlamentarische Demokratie beenden und die Verfassung beseitigen zu wollen. Im September wurden zwei Vertreter dieser politischen Haltung Mitglieder einer neuen Regierung des 57-jährigen christlichsozialen Parteiobmanns Carl Vaugoin, der einen findigen Juristen mit Namen Dr. Hecht ins Haus mitbrachte. Bundespräsident Wilhelm Miklas hatte diese Regierung ermöglicht, verwehrte sich aber gegen deren Putschplan.
Die Verschärfung, Militarisierung und Faschisierung der Innenpolitik gingen weiter. Als die Christlichsozialen und der Heimatblock bei der Wahl im November 1930 wieder schlecht abschnitten – die Sozialdemokraten wurden abermals stärkste Partei –, verfestigte sich bei den Entscheidungsträgern am Ballhausplatz der Gedanke, dass es für sie notwendig ist, weitere Wahlen zu vermeiden und das Land autoritär zu regieren. Noch einmal wurde eine Bürgerblock-Regierung gebildet und der Vorarlberger Landeshauptmann Otto Ender Bundeskanzler, der junge radikale Bauernfunktionär Engelbert Dollfuß rückte als Minister an seine Seite. Ender verlangte vom Parlament Sondervollmachten, die ihm zunächst noch verweigert wurden. Er entwickelte diese Idee später weiter, als er 1933 als Minister ohne Portefeuille wieder ins Kanzleramt kam, um eine ständestaatliche Verfassung auszuarbeiten.
Im April 1932 brachten Landtagswahlen weitere schlechte Ergebnisse für die Regierung und erstmals eine starke Unterstützung der Nationalsozialisten. Jetzt erfasste Panik die Christlichsozialen, und in den geschichtsträchtigen Räumen am Ballhausplatz wurde der Weg in ein autoritäres Regime vorbereitet. Seinen Ausdruck fand er im Mai 1932 mit der Übernahme der Kanzlerschaft durch Dollfuß. Der 40-Jährige stammte aus kleinsten Verhältnissen und hatte sich nach Jusstudium und Bauernbund bis zum Bundesbahn-Chef und Landwirtschaftsminister hochgearbeitet. Sein ganzes Engagement galt dem Deutschtum, einem radikalkonservativen Katholizismus und dem Kampf gegen „die Roten“. Er zeigte dies so entschlossen, dass die Sozialdemokraten ihn postwendend und in Anspielung auf Metternich wegen seiner Kleinwüchsigkeit als „Millimetternich“ karikieren.
Sofort nach seinem Amtsantritt versuchte er, die verfassungsmäßigen Institutionen systematisch für sein Ziel umzukrempeln. Im Parlament blieben ihm entscheidende Erfolge verwehrt, so setzte er zunehmend auf die Macht der Straße. Die Institutionen der Demokratie wurden propagandistisch desavouiert, paramilitärische Verbände aufgerüstet und Machtpositionen der Sozialdemokratie zurückgedrängt. Die Sicherheitsverwaltung wurde unter eigenen Bundesministern zu diesem Zweck eng an das Bundeskanzleramt gebunden. In dem von Sektionschef Hecht geleiteten Rechtsdienst bastelte man an juristischen Modellen, mithilfe des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes aus 1917 das Parlament gänzlich auszuhebeln und den Staat diktatorisch zu führen. Am 1. Oktober 1932 wendete Dollfuß dieses Produkt seines Rechtsberaters zum ersten Mal „probeweise“ an.
Der Bundeskanzler war jetzt endgültig zum Putsch entschlossen. Als am 4. März 1933 die Nationalratspräsidenten der Reihe nach zurücktraten, nutzte Dollfuß den Moment und schaltete gewaltsam das Parlament aus. Danach wandte er sich sofort an die Bevölkerung, in dieser Staatskrise müsse die Regierung entschlossen handeln. Als nächsten Schritt erließ er ein Versammlungsverbot. Als der Nationalrat wieder zusammentreten wollte, verhinderte er das mit Polizeigewalt. Am 31. März wurde der Schutzbund aufgelöst, am 20. Mai die Vaterländische Front als Zwangsorganisation gegründet, am 27. Mai die KPÖ verboten, am 19. Juni die NSDAP, am 11. September verkündete Dollfuß das Programm des autoritären Ständestaats.
Dem Amt am Ballhausplatz war jetzt eine absolute Machtfülle zugewachsen: Dollfuß führte den Staat mit Regierungsverordnungen – das Palais wurde damit de facto auch Sitz der Gesetzgebung. Zudem gehörten die Sicherheitsminister zum Ressort, und der Kanzler führte zusätzlich das Militär. So lag die ganze Staatsmacht am Ballhausplatz. Hier wurden nun im Stakkato die Maßnahmen gegen die demokratische Republik entworfen, in Rechtsformen gegossen und umgesetzt. Der stetige, aber kurzfristig unmerkbare Wandel vom demokratischen Parteiensystem zur Diktatur eines Einheitsbündnisses, das Korrodieren der Macht des Parlaments als Volksvertretung und Souverän – all das wurde vom Ballhausplatz aus mitgestaltet, legitimiert und als ganz normale Entwicklung präsentiert. Bedrückend ist für den Beobachter, dass das auf so leisen Pfoten und in so wohlgeordneten bürokratischen Bahnen kommen konnte. Zur Vorsicht mahnt auch der Umstand, dass es so einfach war, sich in diesem Prozess der verfassungsrechtlichen Werkzeuge zu bedienen.
Vom Ballhausplatz aus ging man in gezielten Aktionen rechtlich und mit den Mitteln der Finanzpolitik auch gegen das „Rote Wien“ vor. Im September 1933 drückte Dollfuß eine Verordnung über die „Verhaltung sicherheitsgefährlicher Personen zum Aufenthalte in einem bestimmten Orte oder Gebiete“ durch. Die daraufhin errichteten Anhaltelager, darunter Wöllersdorf, unterstanden dem Bundeskanzleramt. Als am 12. Februar 1934 in Linz eine provokante Hausdurchsuchung der Polizei bei sozialdemokratischen Einrichtungen auf Widerstand stieß, setzte Dollfuß offen die Staatsmacht ein. Militär und Polizei brachen die organisatorische und militärische Kraft der Sozialdemokratie, die Partei wurde verboten, ihre Exponenten inhaftiert, vor Gericht gestellt, umgebracht oder eingesperrt. Die Mitglieder und Sympathisanten der Partei sowie der Gewerkschaft verloren Arbeit, Lohn und Brot.
Am 1. Mai 1934 wurde durch Regierungsverordnung eine neue ständestaatliche Verfassung erlassen, die in den Wochen davor am Ballhausplatz ausgearbeitet worden war und eine Kanzlerdiktatur etablierte. Gesetze kamen jetzt ausschließlich von der Bundesregierung. Politisch stützte sich das Regime auf die Organisation der Vaterländischen Front, für die folgerichtig gegenüber dem Bundeskanzleramt die Zentrale errichtet werden sollte.
Aufgrund der Machtfülle des Kanzlers und seines Amtes wurde der Ballhausplatz in steigendem Maß aber zum zentralen Angriffsziel aller Gegner des Regimes, und das waren vor allem die illegalen Nazis. Ihre terroristischen Aktivitäten machten nicht vor dem Ballhausplatz halt, der im Fokus von Überlegungen zu einer gewaltsamen Machtergreifung stand, sah man darin doch die Gelegenheit, den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Bundesregierung mit einem Streich festzusetzen. Sprengstoffanschläge auf Infrastruktureinrichtungen, Attentate und gewaltsame Propagandaaktionen standen auf der Tagesordnung. Sie erreichten schließlich mit einem militärisch organisierten Angriff auf den Ballhausplatz ihren tragischen Höhepunkt.
Einsatzskizze der Nazi-Putschisten des Jahres 1934
Am 25. Juli 1934 mittags fuhren 154 Angehörige der illegalen SS-Standarte 89 in Bundesheeruniformen und schwer bewaffnet am Ballhausplatz vor. Um 12.50 Uhr, genau zur Ablöse der Torwache, drangen sie ohne Widerstand ein, setzten die Exekutive im Parterre fest und verteilten sich blitzschnell im Gebäude. Die Putschisten hatten Verbündete im Haus, wahrscheinlich den Leiter des Archivs, Ludwig Bittner.
Der Kanzler war vorgewarnt und hatte daher kurzfristig die Regierungssitzung abgesagt, wurde aber dann doch vom Lärm der Soldateska in seinem Arbeitszimmer überrascht. Erschreckt versuchte er, in Richtung Archiv zu entkommen, aber das war nicht mehr möglich, denn schon schlugen die Aufständischen an die Verbindungstür. Da zog der Amtsdiener Hedvicek Dollfuß wieder zurück in sein Amtszimmer und wies eine andere Fluchtrichtung zur Wendeltreppe beim Kongresssaal. Beide liefen in das Eckzimmer. Schon hatten sie die Tür zum Saal erreicht, als mehrere Uniformierte mit schussbereiter Pistole aus dem Stiegenhaus ins Zimmer stürzten, Otto Planetta an der Spitze. In rascher Reihenfolge fielen zwei Schüsse. Dollfuß hob die Hände wie schützend gegen den Kopf und schlug zu Boden. Die Schüsse trafen ihn aus nächster Nähe in den Hals. Sie kamen aus zwei Waffen mit unterschiedlichen Kalibern. Es haben also zwei Personen geschossen, doch eine zweite Person wurde niemals angeklagt. Erst spät tauchte der zweite Name auf: Rudolf Prochaska, illegaler SA-Aktivist.
Dollfuß starb um 15.45 Uhr, weil ihm ärztlicher Beistand verweigert wurde.
Nach den tragischen Ereignissen vom Juli 1934 übernahm der bisherige, erst 36-jährige Justizminister Kurt Schuschnigg das Amt des Bundeskanzlers. Er setzte die Politik seines Vorgängers fort, die er bisher schon radikal unterstützt hatte: autoritärer Ständestaat und brutale polizeiliche Kontrolle. Für ein paar Monate gab es noch den früheren Bundeskanzler Buresch als Berater im Bundeskanzleramt, dann holte sich der Kanzler Odo Neustädter-Stürmer als Minister, der Gesetze zur berufsständischen Neuordnung mithilfe des Verfassungsdienstes vorbereiten sollte. Schuschnigg selbst war noch stärker katholisch orientiert als sein Vorgänger und monarchiefreundlich, gehörte zu seinen ersten Akten doch die Aufhebung des Habsburgergesetzes, womit er sich auch wieder „von“ Schuschnigg nennen konnte.
IM NOVEMBER 1937 schienen sich Hitler und seine Berater für eine Okkupation Österreichs zu entscheiden. Im Jänner 1938 fand die Staatspolizei belastendes Material für einen Putsch der NSDAP. So traf am 12. Februar Schuschnigg auf dem Berghof mit Hitler zusammen, das Treffen verlief aber sehr einseitig, und am Ende beugte sich der Kanzler einem Diktat: Er verpflichtete sich, den Nazi Seyß-Inquart als Innenminister zu bestellen, den Generalstabschef zu entlassen und die Vaterländische Front für Nazis zu öffnen. Mit 16. Februar wurde die Regierung umgebildet, am 24. rief der Kanzler auf, „bis in den Tod: Rot-Weiß-Rot“ zu bleiben, und am 3. März suchte er sogar den Kontakt zu den vom Regime verbotenen freien Gewerkschaften, die er hier im Bundeskanzleramt empfing. Am 9. März beraumte er eine Volksbefragung über die Selbstständigkeit Österreichs für den 13. an.
Doch am Freitag, 11. März 1938 verlor der Ballhausplatz trotz all dem unter dramatischen Begleitumständen seine Funktion als Zentrale der politischen Gestaltung des Landes. Hitler hatte bereits am Vortag den Befehl zur Intervention in Österreich erteilt, die Vorbereitung des Einmarsches lief auf vollen Touren, aber Schuschnigg erfuhr davon erst am frühen Morgen. Daraufhin mobilisierte er das Bundesheer. Um neun Uhr brachte Minister Glaise-Horstenau per Flugzeug aus Berlin das Ultimatum Hitlers, der die Verschiebung der Volksbefragung verlangte. Ein Ministerrat wurde im Kanzleramt anberaumt, aber wieder abgesetzt. Der völlig uninformierte Bundespräsident wurde vom Mittagessen nochmals ins Haus geholt. Letztlich fügte sich Schuschnigg und sagte um 14.30 Uhr die Volksbefragung ab. Doch da teilte ihm Göring persönlich aus Berlin mit, dass jetzt auch er zurücktreten müsse. Der Kanzler telefonierte zunächst noch aus seinem Arbeitszimmer um internationale Hilfe. Als er aber erkannte, dass Österreich keine Verbündeten mehr hatte, demissionierte er um 16 Uhr.
In den Abendstunden versammelten sich auf dem Ballhausplatz Tausende Demonstranten, während sich im Gebäude noch immer Schuschnigg und Miklas aufhielten und zusätzliche Sicherheitskräfte mit Maschinengewehren und aufgepflanzten Bajonetten zusammenzogen. Aus dem Tumult am Platz kamen immer mehr nationalsozialistische Funktionäre ins Haus. Sie sammelten sich im heutigen Kanzler-Zimmer, von wo aus sie die 6000 SA- und SS-Männer auf dem Platz dirigierten, während wenige Schritte über den Gang im späteren Kleinen Ministerratssaal weiterhin die Führung der Austrofaschisten zur Lage konferierte.
Gegen 23 Uhr resignierte auch der Bundespräsident und betraute auf Schuschniggs Drängen Seyß-Inquart mit der Regierung, ernannte ihn zum Bundeskanzler und genehmigte die bereits vorbereitete nationalsozialistische Ministerliste. Kurz nach Mitternacht traten der neue Kanzler und einige Regierungsmitglieder auf den Balkon und ließen sich von der organisierten Menge bejubeln. Um zwei Uhr früh verließen Schuschnigg und Miklas das Haus und gelangten erstaunlicherweise unbehelligt heim – Schuschnigg in seine Dienstwohnung im Oberen Belvedere. Ab 5.30 Uhr marschierten deutsche Verbände in Österreich ein – und Bundespräsident Miklas erschien am Vormittag zum Dienst, als wäre nichts geschehen und gelobte die neue Regierung mit dem naiven Appell an, dass sie österreichische Minister seien und die österreichische Verfassung zu beachten hätten. Seyß-Inquart erklärte aber dem um 15 Uhr zusammentretenden Kabinett, dass es nur mehr das Wiedervereinigungsgesetz mit dem Deutschen Reich zu beschließen hätte. Der Text wurde gar nicht verteilt, sondern dem Befehl nach kurzer Erörterung Folge geleistet.
Als Hitler am 15. März in Wien eintraf, ernannte er Seyß-Inquart zum „Reichsstatthalter in Österreich“; sein Behördensitz war bis zum 1. Mai 1939 der Ballhausplatz. Die politische Schaltzentrale, die von Josef Bürckel geführte Gauleitung, nahm das Parlamentsgebäude in Besitz. Als dieser ab April auch „Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“ wurde, griff er immer häufiger und in wachsender Intensität in die Kompetenzbereiche des Ballhausplatzes ein, der eigentlich das Zentrum der Verwaltung der österreichischen Gebiete war. Im Mai 1939 resignierte Seyß-Inquart und wurde als Minister ohne Portefeuille in die Reichsregierung befördert, was er bis Kriegsende blieb.
Im Herbst 1939 wurden einige NS-Spitzenbeamte des Ballhausplatzes Teil der Besatzungs- und Vernichtungspolitik. Otto Wächter etwa wurde Gouverneur des Distrikts Krakau und damit für die Ausweisung von 68.000 Juden und die Errichtung eines jüdischen Ghettos verantwortlich. Sein Mitarbeiter Rudolf Pavlu wirkte aktiv an der Deportation der polnischen Juden mit, Seyß-Inquart leitete ab 1940 die Deportationen in den Niederlanden. Im Nürnberger Prozess wurde er dafür 1946 zum Tod verurteilt und hingerichtet.
Mit 7. August 1940 war der Hitler von Kindheit an glühend ergebene Reichsjugendführer Baldur von Schirach Reichsstatthalter, Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar von Wien geworden. Er entschied sich dafür, wieder vom Ballhausplatz aus zu regieren – er hatte als Aristokrat ein Gespür für Symbole und Traditionen. Im Haus ließ er seine Büroumgebung nach seinem Verständnis von Autorität und Gepränge gestalten. Das düstere Chefbüro wurde aufgegeben und Schirach übersiedelte mehrmals, um den „Anmarschweg“ zu seinem Büro zu verlängern und eindrucksvoller zu machen, schließlich sogar in den prachtvollen Kongresssaal, da ihm nur dieser seiner Position angemessen schien.
Baldur von Schirach 1944 in seinem Amtszimmer, dem Kongresssaal