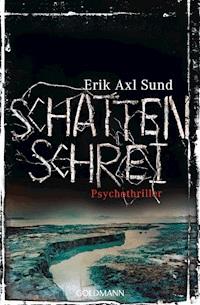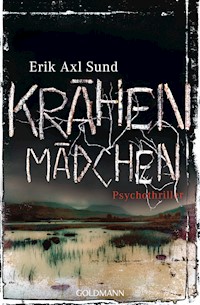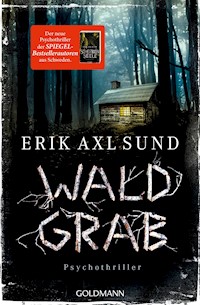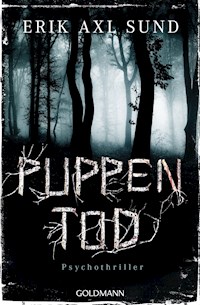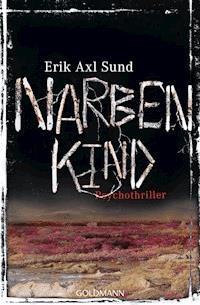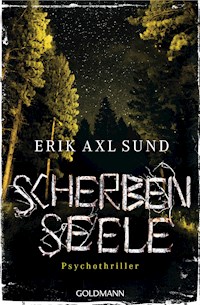
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kronoberg-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der erste, in sich abgeschlossene Band der neuen Kronoberg-Reihe.
Eine Welle bizarrer Selbstmorde erschüttert Schweden. An den unterschiedlichsten Orten im Land nehmen sich Jugendliche auf ungewöhnliche, grausame Weise das Leben, und sie alle haben eines gemeinsam: Sie hören die düstere Musik eines Interpreten namens "Hunger" auf alten Musikkassetten, während sie sich umbringen. Zur gleichen Zeit wird in Stockholm der erste von mehreren einflussreichen Männern ermordet. Als Kommissar Jens Hurtig ihn mit den Selbstmorden in Verbindung bringt, zeigt sich das ganze schreckliche Ausmaß des Falls ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Als Kriminalkommissar Jens Hurtig aus einem Kurzurlaub nach Stockholm zurückkehrt, legt ihm Polizeichef Billing eine neue Fallakte auf den Tisch: Mehrere Jugendliche haben sich auf ungewöhnliche, spektakulär inszenierte Weise das Leben genommen. Allen Suizidfällen scheint gemeinsam zu sein, dass die jugendlichen Selbstmörder eine alte analoge Musikkassette in ihrem Besitz hatten und die darauf gespeicherte Musik hörten, während sie sich das Leben nahmen. Der Interpret nennt sich »Hunger«. Während Hurtig nach »Hunger« sucht, wird an einem nahe gelegenen Strand ein alter Major a.D. erschossen. Eigentlich nicht Hurtigs Zuständigkeitsbereich – doch als Gegenstände aus dem Besitz des Majors an die Stockholmer Polizei geschickt werden, ist klar: Der Mord hängt mit den Suiziden zusammen …
Weitere Informationen zu Erik Axl Sund sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
ERIK AXL SUND
Scherbenseele
Psychothriller
Aus dem Schwedischen von Nike Karen Müller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Glaskroppar« im Ordfront Förlag, Stockholm.
Deutsche Erstausgabe Oktober 2015 Copyright © der Originalausgabe 2014 by Erik Axl Sund Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Published by agreement with Salomonsson Agency Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München Umschlagmotiv: Getty Images/Daniel Cummins; FinePic®, München Redaktion: Leena Flegler AG · Herstellung: Str. Satz: DTP Service Apel, Hannover ISBN 978-3-641-16662-5V003www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
PHASE I: Schock
Life is meant to be more than this and this is a bum trip.
Fahr zur Hölle
Salem
Sie heißt wie Jesu Mutter und wohnt im Süden Stockholms in Salem – das sind zwei Silben aus Jerusalem.
Das Haus, das Gott vergessen hat, denkt sie, während sie den Radweg entlangschlendert und auf das graue Mietshaus zusteuert. Das gesamte Viertel liegt wegen eines Stromausfalls im Dunkeln. Es ist schon der dritte in dieser Woche. Der Türcode funktioniert auch nicht, also nimmt sie den Schlüssel.
Ihre Hände zittern. Sie weiß nicht, ob es Angst ist oder Vorfreude.
Sie hat eine Plastiktüte dabei. Darin liegen ein Dreiviertelliter geschmuggelter russischer Schnaps und ein Liter Chlorreiniger.
Maria schließt die Wohnungstür auf und betritt die dunkle Diele, holt ein paar Stearinkerzen, stellt sie auf den Wohnzimmertisch und zündet sie an.
Dann greift sie zum Telefon. Der letzte Mensch, mit dem sie redet, muss einer sein, dem sie vertraut, und Vanja ist die Einzige, die sie vielleicht verstehen kann. Sie war auch ganz unten.
Ganz unten ankommen – die Formulierung trifft es nicht annähernd. Ganz unten ist nur noch Dreck, ein Morast aus Sinnlosigkeit, und je mehr man versucht, sich wieder nach oben zu kämpfen, desto tiefer sinkt man darin ein.
Maria lässt es lange klingeln, aber Vanja nimmt nicht ab.
Sie wartet. Wählt noch ein paarmal Vanjas Nummer – ohne Erfolg.
Aber sie braucht jetzt jemanden zum Reden, und mangels Alternativen entscheidet sie sich für Isaak. Sie haben sich seit dem letzten Workshop in der Lilja nicht mehr gesehen und kennen einander nicht besonders gut, aber sie mag ihn.
Er hebt kurz vor dem vierten Freizeichen ab.
»Hej, Maria«, sagt er, und sie hört sofort, dass er draußen an der frischen Luft ist. Der Wind pfeift ins Mikrofon seines Handys. »Wie läuft’s?«
Seine Stimme vertreibt die Kälte in ihrem Körper ein wenig, und sie sieht kurz zu der Plastiktüte hinüber.
»Alles gut«, antwortet sie. Eine Lüge. »Ich bin gerade mit dem Selbstporträt fertig geworden, du weißt schon …«
Im Hintergrund Wellenrauschen und kreischende Möwen.
Ganz anders als ihr eigener Soundtrack.
»Ist ja klasse! Ist die Nase was geworden?«, fragt er und lacht. Maria muss daran denken, wie sie sich stundenlang damit abgeplagt haben, ihre schiefe Nase im richtigen Winkel zu treffen. »Ja, ich glaub schon«, sagt sie und kämpft gegen den Wunsch an, ehrlich zu sein und zu erzählen, wie es ihr wirklich geht. Von der Müdigkeit und der Dunkelheit. Zu erzählen, was sie vorhat.
Aber das geht nicht. Die Worte sind wie eine Mauer zwischen ihr und der Welt, und er würde sie für eine schrecklich banale Person halten.
Ihre Wirklichkeit ist eben nicht seine Wirklichkeit. Ihr Mount Everest ist für ihn nur eine kleine Anhöhe.
»Es ist echt gut geworden«, sagt sie, zwingt sich zu unterdrücken, was aus ihren Tränenkanälen dringen will, und nimmt das Telefon vom Mund, damit er ihre Verzweiflung nicht hört.
Dabei will sie, dass er ihren stummen Hilferuf wahrnimmt, und weil er das nicht tut, kommt die Kälte langsam, aber sicher wieder zurück. Sie hat überhaupt nichts gemalt. Keinen Pinselstrich. Hat keine Lust gehabt. Sein Kurs hat sie nicht inspiriert, so gut er auch gewesen sein mag.
Sie hat zu gar nichts Lust gehabt.
Trotzdem erzählt sie, dass sie große Pläne hat und dass sie endlich einen Weg sieht, der auf ein Ziel zuführt.
Alles Lügen.
Sie beenden das Gespräch, und sie fühlt sich ebenso leer wie kalt.
Eine Motte verirrt sich in eine Kerzenflamme. Es zischt, und das Tier fällt auf die Tischplatte. Angesengt, aber noch nicht tot. Sie lässt es liegen.
Sie nimmt eine der Kerzen mit hinüber in ihr Zimmer und holt ihr Tagebuch.
Keiner darf lesen, was sie geschrieben hat, und als sie wieder auf dem Sofa sitzt, reißt sie die Blätter raus, eins nach dem anderen, und knüllt sie zu kleinen Kügelchen zusammen.
Plötzlich scheint die Luft dicker zu werden. Es knackst in der Küche, dann surrt es. Das muss der Kühlschrank sein. Der Strom ist wieder da.
Sie pustet die Kerzen aus, macht die Stehlampe an und geht zurück in die Diele, um den Walkman aus ihrer Jackentasche zu holen. Als sie das Gerät und die Papierkugeln auf den Tisch legt, geht die Stehlampe wieder aus. Der Strom ist wieder weg.
Es wird das letzte Mal sein, dass sie sich wehtut.
In dem Haus, das Gott vergessen hat, obwohl es nur zwei Silben von Jerusalem entfernt liegt, mischt Maria Alvengren sich im Dunkeln einen Cocktail, ohne dass etwas danebengeht.
Ein Deziliter Wodka, ein Deziliter Chlorreiniger.
Als sie den tödlichen Drink hinunterkippt, muss sie nicht einmal würgen. Auch nicht beim nächsten Glas. Oder beim nächsten.
Sie kommt sich vor wie ein Kind in den Tagen vor Weihnachten. Ein Kind, das die Hände nicht stillhalten kann und jedes verheißungsvoll bunt verpackte Geschenk befühlt und befingert.
Ein kalter Windstoß strömt ihr um die Knöchel, als sie die Balkontür aufmacht.
In ihrem Kopf ist Hunger.
Die hinteren Oberschenkelmuskeln spannen sich an. Das liegt an der Höhenangst. Sie weiß, das ist ihr Fluchtreflex.
Sie ist ein Tier, das gejagt wird.
Hurtig
Runmarö
Das letzte Tageslicht färbt die Klippen und Baumkronen rosa. Das Wasser jenseits der Bäume sieht in der Dämmerung graublau aus, nur die Vogelbeeren leuchten noch rot.
Zwei Rinderfilets, je eine Ofenkartoffel, ein halbes Baguette – das alles mit einem Liter Bier runtergespült – lassen sieben Grad plus an der herbstklammen Ostsee fast angenehm erscheinen. Der stellvertretende Teamleiter, Kriminalkommissar Jens Hurtig, sitzt gut, wo er sitzt: Zurückgelehnt in einem überwinternden Sonnenstuhl auf dem Bootssteg, einen Steinwurf von dem Haus entfernt, das sie gemietet haben, fühlt er sich genauso behäbig wie einer der riesigen Findlinge auf der Insel.
Hurtig lässt seinen Blick über die Klippen schweifen. Der Geschichte nach hat der rote Stein dieser Insel den Namen gegeben. Rudhme, das altschwedische Wort für Rötung. Es trifft exakt, was er vor sich sieht.
Er hört, wie Isaak sich besorgt verabschiedet, dann Schritte auf dem Steg. Hurtig hat versucht, nichts von dem Telefonat mitzubekommen, und trotzdem nicht umhingekonnt, das eine oder andere aufzuschnappen.
»Eins der Mädchen. Sie wollte bloß reden«, sagt Isaak und setzt sich in den Stuhl neben Hurtig.
Hurtig nickt nur und nimmt zwei weitere Dosen Bier aus dem Wassereimer auf dem Steg.
»Wenn sie sagen, dass es ihnen gut geht, muss man besonders aufpassen.« Isaak macht seine Bierdose auf. Es zischt leise. »Andererseits … Vielleicht mache ich mir auch nur unnötig Sorgen.«
»Wer war denn überhaupt dran?«
»Maria.«
»Kennst du sie gut?«
Isaak fährt sich mit der Hand durchs Haar und nimmt ein paar Schlucke Bier, bevor er antwortet: »Nicht besonders. Sie wohnt in Salem und hat bei ein paar Workshops mitgemacht, die ich in der Lilja gegeben habe. Sie ist nicht sonderlich gesprächig. Ich glaube, wir haben noch nie so lange geredet wie jetzt, und gerade das beunruhigt mich.«
»Mit meiner Schwester war es genau umgekehrt«, sagt Hurtig, und eine fünfzehn Jahre alte Erinnerung taucht wieder auf. »Sie hat eigentlich immer gern geredet. Aber unser letztes Gespräch war sehr kurz.« Hurtig ist das Mitgefühl in Isaaks Blick unangenehm. Er dreht sich weg und blickt übers Meer, bevor er fortfährt: »›Ich liebe dich, Bruderherz‹, hat sie gesagt. Das war alles.«
Dann hat sie aufgelegt und sich erhängt.
Er kann Isaaks Atemzüge hören, langsam und regelmäßig – im Gegensatz zu den rauschenden Windböen in den Bäumen. Ein Ast schlägt gegen das Blechdach des Hauses. Der Wind frischt auf.
»Das ist schön«, sagt Isaak nach einer Weile. »Ein schöner Abschied.«
»Ja, vielleicht.«
»Glaubst du, ich muss mir Sorgen um sie machen?«
»Keine Ahnung«, gibt Hurtig zurück und denkt nach. »Du machst dir doch ohnehin Sorgen, und Mitgefühl zu empfinden ist doch nur menschlich.«
»Was ist das eigentlich, Mitgefühl?«
Hurtig mag seine Art, die Dinge zu hinterfragen, und lässt sich gerne auf Isaaks Gedankenspiel ein. »Mitgefühl bedeutet, man möchte nicht, dass einem anderen geschadet oder wehgetan wird.« Er überlegt einen Augenblick. »Es bedeutet, sich in die Empfindungen anderer Menschen hineinzudenken.«
»Zu vermeiden, seine Mitmenschen negativ zu beeinflussen«, kontert Isaak. »Und deshalb kann ein Politiker nie völlig menschlich sein – und vielleicht auch kein Künstler. Für diese Berufe muss man ein Soziopath sein – vielleicht sogar ein Psychopath.«
Hurtig lacht. »Du meinst, du bist ein Psychopath, nur weil du Künstler bist? Oder macht es dir einfach nur Spaß, dich um Kopf und Kragen zu reden?«
»Na ja, als Künstler übe ich nun mal auf alle möglichen Leute Einfluss aus. Da muss ich doch die Verantwortung für die Konsequenzen meiner Arbeit von mir weisen, oder nicht?«
»Und ich dachte, in der Kunst geht es um Kommunikation.«
»Das sagst du, ja. Aber wie viele sprechen diese Sprache? Nein, Kommunikation wäre das, was ich gern mit Maria gehabt hätte. Ich fühle zwar mit ihr, aber ich weiß nicht genau, was ich mit diesem Mitgefühl anfangen soll. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber ich finde einfach keinen Draht zu ihr – und deshalb ist Mitgefühl in diesem Zusammenhang sinnlos. Außerdem ist Maria destruktiv. Empathie ist schwierig, wenn jemand sich selbst hasst, finde ich.«
Isaak mustert ihn mit einer Selbstverständlichkeit, die Hurtig gleichermaßen beneidet wie bewundert. Vielleicht liegt das am Alter. Isaak ist noch keine dreißig. Hurtig selbst ist fast vierzig.
»Als meine Schwester starb, hab ich mich auch gehasst«, sagt er nach einer Weile. »Für mich hat sich damals alles nur noch um meine Eltern gedreht. Empathie kann ein sehr selektives Gefühl sein. Ist das nicht beängstigend?«
»Es war ja auch eine außergewöhnliche Situation für dich.«
»Möglich. Aber gibt es dieses Selektive nicht überall um uns herum? Die Menschen bezeichnen sich als empathisch, dabei bestimmen sie selbst, wo die Grenze verläuft. Sie haben Mitgefühl für diejenigen, die ihnen nahestehen, aber um alle anderen scheren sie sich einen feuchten Dreck.«
Unter dem Steg gluckst das Meer, und der Geruch der brackigen Ostsee wird plötzlich salziger. Der Wind hat zugenommen, ebenso wie die Heftigkeit, in der die Äste auf das Blechdach schlagen. Hurtig tippt auf Sturm.
»Ich mag dich, Jens«, sagt Isaak und lächelt schief.
»Gleichfalls«, entgegnet Hurtig.
Das restliche Bier wird schweigend getrunken, und der Abend schlummert ein, während das Meer erwacht. Schaum auf den Wellenkämmen und rosafarbener Dunst über den felsigen kleinen Inseln vor Nore.
Isaak erzählt, dass Strindberg seinen Roman Am offenen Meer in einem Sommerhaus auf der Insel zu schreiben begann. Hurtig meint zu verstehen, warum, und schlägt vor, dass sie sich morgen das Haus ansehen sollten. »Was auch immer davon noch übrig ist.«
»Ich muss zurück in die Stadt«, sagt Isaak und stellt sein Bier zur Seite. »Ich will noch ein bisschen arbeiten, bevor ich nach Berlin fahre.«
Hurtig denkt an Isaaks vergangene Besuche in der deutschen Hauptstadt. Jedes Mal ist er mit neuen Ideen wiedergekommen: Bilder, die er malen, und Ausstellungen, die er auf die Beine stellen wollte. Aus Schweden und der beschränkten, inzestuösen Kunstwelt auf Östermalm rauszukommen war für ihn jedes Mal wie eine Vitaminspritze.
»Willst du, dass ich mit zurückfahre?«
»Nein, das musst du nicht. Außerdem sehen wir uns ja noch, bevor ich am Freitag abreise. Genieß es doch einfach, dass du mal freihast. Du kommst schließlich nicht allzu oft raus aus der Stadt.«
»Die erste freie Woche seit den zwei Urlaubstagen an Mittsommer«, stellt Hurtig fest und zuckt mit den Schultern. »Eigentlich gar nicht so schlecht im Hinblick auf unsere dezimierte Mannschaft.«
»Urlaub in den Schären Ende Oktober. Man nimmt, was man kriegen kann.«
»Oder eher das, was man zugeteilt bekommt. Trotzdem hab ich ein schlechtes Gewissen, weil ich hier jeden Abend mit einem Bier in der Hand dasitze.«
Isaak lässt den Blick übers Meer schweifen. »Da brauchst du wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben«, sagt er und legt Hurtig die Hand auf die Schulter.
Der Ast schlägt erneut aufs Dach.
»Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!«
Kriminalkommissar Jens Hurtig lacht. »Was war denn das?«
»Bloß eine Liebeserklärung«, sagt Isaak. »Aus Goethes Faust.«
Vanja
Södermalm
Im Westen von Södermalm ist die Journalistendichte schwedenweit am höchsten. Fast drei Prozent der Anwohner gehören hier mehr oder weniger der schreibenden Zunft an.
So wie das Viertel östlich der Götgatan historisch bedingt Knogsöder – »Plackerei-Söder« – genannt wird, heißt der westliche Teil aufgrund all der zwielichtigen Machenschaften Knivsöder – »Messer-Söder« –, selbst wenn in letzter Zeit im Zuge der zunehmenden Gentrifizierung und rasant steigender Immobilienpreise immer öfter auch der Name »Hummerzangen-Söder« fällt.
Vanja Hjorth ist fast sechzehn und wohnt mit ihren Adoptiveltern Edith und Paul in Knivsöder.
Für ihren Heimweg hat sie Stunden gebraucht.
Drei misslungene Versuche, in ebenso vielen Kneipen Starkbier zu bestellen, hat sie mit zwei Pils auf dem Basketballfeld des Åsö-Gymnasiums kompensiert. Inzwischen ist sie auf dem Weg zum Geldautomaten an der Katarina Bangata und stellt fest, dass sie ihre Karte verloren hat.
Sie will gerade umkehren, als sie den alten Mann bemerkt. Er steht allein mit seinem Rollator vor dem Geldautomaten.
Sie sieht, wie er mehrere Fünfhunderter zusammenfaltet und in seine Brieftasche steckt und diese dann in die Henkeltasche legt, die vorn an seinem Rollator in einem Korb steht. Dann schlurft er langsam um die Ecke und biegt in die Bondegatan ein.
Sie geht ihm nach. Als sie direkt hinter ihm ist, klingelt ihr Handy, und der Klingelton schrillt von den Backsteinhäusern zu beiden Seiten der fast menschenleeren Straße wider.
Verdammt, denkt sie, als der Mann innehält, sich umdreht und sie taxiert. Sie lässt es klingeln.
Sieht die Gelegenheit. Packt sie am Schopf.
Während das Handy weiterklingelt, reißt sie die Tasche an sich und rennt los.
Das irritierende Klingeln übertönt das Gejammer des Alten und verstummt erst, als sie um die nächste Straßenecke biegt.
Sie sprintet auf die Östgötagatan – und sieht den Streifenwagen. Zehn Meter weit entfernt. Die Umrisse zweier Köpfe auf den Vordersitzen. Zurück kann sie nicht mehr, aber einfach so vorbeirennen kann sie auch nicht. Sie hofft, dass keiner gesehen hat, wie sie um die Ecke geschossen ist.
Sie wird langsamer und geht so unbeteiligt wie nur möglich auf die Streife zu.
Die Rufe des alten Mannes sind verhallt. Vielleicht schafft sie es bis zur nächsten Querstraße, bevor er hinter ihr die Straßenecke erreicht.
Da klingelt das Handy erneut. Sie reißt es aus der Tasche und stellt es stumm.
Sie geht weiter.
Noch ein paar Meter. Links in die nächste Straße – und jetzt rennt sie wieder. Die Åsögatan entlang zurück zur Götgatan.
Erst als sie sich der U-Bahn am Medborgarplatsen nähert, hört sie auf zu laufen.
Es ist, als würde ihr Herz den Brustkorb sprengen. Sie spürt, dass sie lebt.
Als Maria zum dritten Mal anruft, sitzt Vanja in der U-Bahn, die Tasche des Alten auf dem Schoß. Sie nimmt das Handy in die Hand und will schon rangehen, überlegt es sich dann aber anders.
Sie schafft es einfach nicht. Maria kann manchmal richtig nerven.
Bevor sie an der U-Bahn Slussen umsteigt, hat Vanja festgestellt, dass die Tasche außer einer Brieftasche mit sieben Fünfhundertern noch eine Schachtel Kopfschmerztabletten und einen abgewetzten Kalender enthält.
Sie beginnt, darin zu blättern.
Zu jedem Tag gibt es Notizen: genaue Wetterbeschreibungen, und aus irgendeinem Grund hat der alte Mann aufgeschrieben, welche Lkws unter seinem Fenster vorbeifahren.
Sie spürt, wie ihr die Tränen in die Augen steigen, doch obwohl das Abteil so gut wie leer ist, hält sie sie zurück. Tränen sind Privatsache.
An der Glaswand vor ihr klebt ein Reklameposter von einem großen Kosmetikkonzern. Eine schöne Frau lächelt sie mit gebleichten Zähnen an, und Vanja sieht ihr eigenes Spiegelbild daneben in der Glasscheibe. Strohiges rabenschwarzes Haar und dunkle Schatten unter den Augen. Manche behaupten, sie sähe süß aus, doch Vanja weiß genau, dass das nicht stimmt. Sie zieht einen Stift aus der Tasche und erinnert sich an einen Blogeintrag, den sie vor Kurzem gelesen hat.
Schmink dich, bis du nicht länger zu erkennen bist! Vergiss die Schamlippen nicht!, schreibt sie über das Frauengesicht und fügt dann hinzu: Wenn du Cellulitis hast, lass es bleiben!
Am Zinkensdamm steigt ein ziemlich düsterer Typ ein. Er hat einen Stapel Flyer in der Hand und legt einen davon auf den Sitz neben sie, bevor er zu den restlichen Fahrgästen im Abteil weitergeht.
Ein kleines Kind ist darauf abgebildet, daneben ein paar Worte über Krebs und Armut.
Sie legt sechs der sieben Fünfhunderter auf den Sitz, steht auf und stellt sich an die Tür.
Sie schafft es auszusteigen, ehe er ihr Geschenk bemerkt.
Vor den Ausgängen der U-Bahn-Station Hornstull herrscht wegen der Umbauarbeiten des heruntergekommenen Taxiplatzes das reinste Chaos. Irgendwelche Politiker haben beschlossen, dass Hornstull ein Facelift braucht, aller Proteste der Anwohner zum Trotz. Vanjas Adoptiveltern Edith und Paul waren unter den Lautesten, die versuchten, die Baupläne zu stoppen – vergebens. Jetzt ragt ein neues Einkaufszentrum aus Glas und Beton auf dem alten Platz in die Höhe.
Das hier ist ihr Stadtviertel. Hier hat sie gelebt. Und hier wird sie sterben.
Bald. Sobald das Paket ankommt.
Sie wirft die Tasche des Alten mit der leeren Brieftasche und den Kopfschmerztabletten in einen der Säcke mit Bauschutt. Den Kalender behält sie. Sie will ihn mit in die Lilja nehmen und Aiman bitten, ihr dabei zu helfen, ihn neu einzubinden.
Aiman ist ihre Betreuerin, wie es vormundschaftsmäßig so schön heißt, und eine der wenigen Personen, denen Vanja vertraut. Aiman weiß, wie es ist, nicht dazuzugehören, und sie hat etwas Geheimnisvolles an sich. Das gefällt Vanja.
Sie steckt die Hand in die Tasche. Der Stift, der Fünfhunderter – aber nur noch eine einzige Zigarette.
Sie biegt links ab, betritt den Ica-Supermarkt am Bergsundsstrand, schnappt sich einen Einkaufskorb und geht die Regalreihen entlang. Als der Korb voll ist, schlendert sie zur Kasse und stellt sich hinter einen Mann mit dicken Brillengläsern und einem mürrischen Gesichtsausdruck. Sie legt den Warentrenner aufs Band und beginnt, ihre Einkäufe daraufzulegen, streckt sich nach den Zigaretten und nimmt drei Päckchen, die sie ebenfalls aufs Band legt. Dann greift sie sich an die Stirn. »Ach ja, genau …«, murmelt sie leise, legt die Waren wieder in den Korb und geht noch mal zurück, holt noch ein Päckchen Kaffee, schiebt die Zigaretten in ihren Jackenärmel und geht wieder zur Kasse.
»Kaffee vergessen?«, stellt der Kassierer fest.
Vanja macht das nicht zum ersten Mal, und sie weiß, dass sie jetzt nicht unfreundlich rüberkommen darf, wenn es klappen soll.
Die Rippen drücken auf die Lunge, und jeder Atemzug strengt an. Schweiß dringt durch den Pullover. Sie klaut die Zigaretten nicht, weil sie kein Geld hätte oder zu jung wäre, um sie zu kaufen.
Sie will nur noch ein kleines bisschen länger leben.
Während der Kassierer die Waren scannt, packt Vanja sie in eine Plastiktüte, und als sie damit fertig ist, durchsucht sie ihre Taschen.
»Mist, zu blöd«, sagt sie, seufzt und befühlt den Fünfhunderter in ihrer Tasche. »Ich hab mein Geld zu Hause vergessen … Kann ich die Tüte kurz hier abstellen?« Sie deutet auf den Platz neben dem Kassierer. »Ich bin in fünf Minuten wieder da.«
Der Kassierer lächelt verständnisvoll. »Gib sie rüber.«
»Danke, das ist sehr nett«, sagt sie und geht.
Vor dem Supermarkt kommt ihr ein Junge entgegen, den sie kennt, aber sein Name fällt ihr nicht mehr ein. Er tut so, als würde er sie nicht bemerken. Sie weiß genau, dass er sie gesehen hat. Seine Art wegzugucken täuscht sie nicht darüber hinweg. Hau ab, oder du stirbst, denkt sie.
In der Neunten war er in ihrer Parallelklasse, und sie ist mit ihm im Bett gewesen, weil er ihr damals leidgetan hat. Keiner sollte fünfzehn Jahre alt werden müssen und immer noch Jungfrau sein. Sie hat ihn sogar dazu überreden müssen, so nervös war er. Später an jenem Abend schrieb er auf seiner Facebook-Seite, sie wäre eine Hure.
Vanja bleibt stehen, beobachtet seinen selbstsicheren Schritt die Straße hinauf, bis er in einen Hauseingang verschwindet.
Sie wohnen in einer Vierzimmerwohnung ganz oben. In einer renovierten Eigentumswohnung. Vanja fragt sich, was Edith und Paul für das verdienen, was sie schreiben. Edith, die in ihren Büchern Nabelschau betreibt, und Paul mit seinen sogenannten investigativen Reportagen. Engagement für die Gesellschaft, heißt es gern, dabei findet Vanja, dass sich alles nur um die beiden dreht. Zwei egozentrische Menschen, die sich als links bezeichnen, aber Kronleuchter für fünfundzwanzigtausend Kronen auf Firmenkosten zu Hause hängen haben. Alles nur Geschwätz und Theorie, keine Taten.
Alles Lüge.
Als sie die Diele betritt, hört sie Stimmen aus der Küche. Holger Sandström ist zu Besuch. Vanja ahnt, dass er mal wieder Geld vorbeigebracht hat. Das tut er manchmal. Verleiht mal eben ein paar Tausender, wenn es nicht so recht vorwärtsgeht mit dem Schreiben und die Kasse leer ist. Er ist fast siebzig, aber arbeitet immer noch und verdient offenbar gut.
Im Sommer vor vier Jahren hat sie zwei Wochen lang bei Holger gewohnt, als Edith und Paul im Urlaub waren. Er war nett, hat sie ins Skansen und nach Gröna Lund mitgenommen. Es waren zwei gute Wochen.
»Wie geht’s Vanja?«, fragt er. Sie haben nicht gehört, dass sie hereingekommen ist. »Wird es denn besser? Kommt ihr jetzt besser miteinander aus?«
»Sie geht in die Lilja, zusammen mit Maria, ihrer besten Freundin.« Das ist Ediths Stimme. »Sie sagt nicht viel, aber ich denke mal, dass in der Schule alles in Ordnung ist, und …«
»Blödsinn«, fällt Paul ihr ins Wort. »Das Mädchen ist faul. Punkt, aus. Sie ist wirklich nicht dumm, aber viel zu bequem. Das Einzige, das sie am Leben hält, sind ihre Musik und Nudeln.«
Holger lacht. »Ja, ja. Und jetzt könnt ihr euch das ja auch wieder leisten.« Er macht eine kurze Pause. »Zumindest die Nudeln, meine ich.«
»Du kriegst jede Öre wieder, sowie das Buch erscheint«, erwidert Edith säuerlich, und Vanja wird das Lauschen unbehaglich. Vorsichtig macht sie die Wohnungstür noch mal auf und schlägt sie laut hinter sich zu.
»Das ist sie bestimmt«, sagt Paul, und Vanja hört, wie Besteck auf den Teller gelegt wird.
Sie sitzen am Küchentisch. Edith raucht einen Zigarillo, und Paul steckt sich gerade eine Mentholzigarette an.
Nur Oberschicht und Unterschicht rauchen drinnen, denkt sich Vanja. Sie wollen damit doch nur zum Ausdruck bringen, dass sie auf keinen Fall zur schnöden Mittelschicht gehören.
»Das Essen ist kalt geworden«, sagt Paul. Sie sieht ihm an, dass er verärgert ist. Die Ader an seinem kahlen Kopf ist dick wie ein Regenwurm.
»Ich wollte noch einkaufen, konnte aber meine Bankkarte nicht finden, und ich hatte kein Geld dabei.«
Edith drückt den Zigarillo aus. »Ich gehe schon … muss mir sowieso die Beine vertreten.«
»Nein«, widerspricht Paul. »Ich gehe, aber das ist jetzt wirklich das allerletzte Mal.« Er steht auf, wirft Holger einen resignierten Blick zu und geht hinaus in die Diele. Edith ringt sich ein Lächeln ab. Durch ihre spitzen Gesichtszüge und die dunklen Augen sieht sie irgendwie gemein aus, obwohl sie das gar nicht ist.
Maria sagt immer, Edith wäre schön, aber Vanja findet, sie sieht aus wie eine Hexe. Das aschgraue schnittlauchglatte Haar reicht ihr bis zur Hüfte.
»Wieso bist du so spät dran?«
»War spazieren«, gibt Vanja zurück, zuckt mit den Schultern, kehrt Edith und Holger den Rücken und geht in ihr Zimmer.
Sicherheitshalber schließt sie die Tür ab.
Vom Fenster aus kann sie die Lilja, das Haus der Projekte, und auf der anderen Seite das Wasser sehen. Wie klein die Welt doch ist.
Sie zieht die Kiste unter dem Bett hervor, nimmt den Deckel ab und räumt Glückwunschkarten, Briefe von Freunden und Feriensouvenirs aus Kindertagen beiseite, die obenauf liegen. Zwei Uhren, Silberschmuck, eine Brosche aus echtem Gold, drei Handys und allen möglichen anderen Krimskrams, von dem sie gar nicht mehr weiß, warum sie ihn überhaupt geklaut hat. Außerdem liegen dort rund zweitausend Kronen, von einer Büroklammer zusammengehalten, und sie klemmt den Fünfhunderter des Alten dazu, bevor sie den Deckel wieder schließt und die Kiste zurück unters Bett schiebt.
Sie tritt vor ihr Bücherregal und greift nach dem Tagebuch, das zwischen zwei Harry-Potter-Bänden steht, die sie von Holger bekommen hat, als sie dreizehn beziehungsweise vierzehn wurde. Die Buchstaben sind zwar vor ihren Augen hin- und hergehüpft, aber sie hat die Bücher trotzdem gelesen.
Inzwischen weiß sie, dass sie Legasthenikerin ist. Damals dachte sie, sie wäre einfach nur bescheuert.
Aiman hat ihr erklärt, dass sowohl Agatha Christie als auch Ernest Hemingway Legastheniker waren und dass es beim Schreiben darum geht, etwas zu erzählen.
Vanja setzt sich auf den Boden, steckt das Kopfhörerkabel in den PC und lehnt sich mit dem Rücken gegen das Bettgestell. Ein pulsierender Bass, der knarzt, als würden die Saiten unter Strom stehen.
Sie schlägt ihr Tagebuch auf und fängt an zu schreiben. Nicht, weil Aiman sie dazu aufgefordert hätte, sondern einfach, weil der Impuls da ist.
Und weil sie Maria versprochen hat zu schreiben.
Was macht man, wenn man keine Träume hat?
Hunger hilft ihr dabei, sich auszudrücken, und sie hofft, dass das Paket mit der Kassette bald kommt. Dann wird sie endlich vor die konkrete Wahl gestellt.
Leben oder sterben.
Gefallener Engel
Liljeholmsbron
In den frühen Morgenstunden ist auf den Straßen nicht viel los, und der Lieferwagen, der aus östlicher Richtung auf die Liljeholmsbron zusteuert, fährt viel zu schnell. Der Körper, der gegen die Windschutzscheibe prallt, fliegt fast fünfzig Meter weit durch die Luft und landet auf der Gegenfahrbahn ein Stück weiter die Brücke hinauf. Die Bremsspur des Lasters ist fast genauso lang. Als der Fahrer aussteigt, steht er unter Schock. Sein Puls rast, sein Atem geht stoßweise, und ihm bricht eiskalter Schweiß aus.
Als der erste Wagen am Unfallort anhält, sitzt der Fahrer auf der Leitplanke und raucht.
Ein weiterer Wagen hält, und jemand ruft die Polizei und den Notarzt.
Der Mann auf der Leitplanke zündet sich die nächste Zigarette an. Jemand packt ihn an der Schulter. Er will etwas sagen, schafft es aber nicht. Es ist, als würde ihm die Luft abgeschnürt.
Nichts ist passiert, denkt er. Überhaupt nichts.
Schwarze Melancholie
Saltsjö-Bahn
Eigentlich wollte ich mit Fabian Modin noch warten, aber als ich ihn unten in der U-Bahn Slussen sehe, nutze ich die Gunst der Stunde. Konsequenzen abzuschätzen war noch nie meine Stärke.
Der Entschluss, mein Schicksal anzunehmen, ist richtig gewesen. Es gibt eine höhere Gerechtigkeit als die der Gesetze. Ich werde einer Sache dienen, die größer ist als das Leben, größer als alle menschlichen Gefühle. Größer als die Liebe.
Aber zu töten ist nun mal nicht einfach. Auch nicht, wenn eine hehre Absicht dahintersteckt.
Der Risikokapitalist Fabian Modin steht mit dem Rücken zum Gleis am Ende des Bahnsteigs, wahrscheinlich will er sich in den letzten Waggon setzen. Was mir sehr entgegenkommt.
Ich sehe auf die Uhr. Der nächste Zug nach Saltsjöbaden ist einer der letzten an diesem Abend, und ich weiß, dass das, was ich vorhabe, davon abhängt, dass in dem Zug alles in etwa so ist wie an den drei Tagen, an denen ich die Abfahrten kontrolliert habe.
Ich taste über meine Innentasche. Das Messer ist da. Das Probenröhrchen ebenso.
Als der Zug hält und die Türen sich öffnen, betrete ich denselben Waggon und nehme ein paar Reihen von ihm entfernt Platz. Er ist betrunken, und ich bin überrascht, dass er keinen Tag älter geworden zu sein scheint als bei unserer letzten Begegnung.
Ich war sechs Jahre alt, als Fabians Frau in der Garage gefunden wurde und Papa mir erklärte, dass Selbstmörder zusammen mit anderen Mördern im siebten Kreis der Hölle landen. Während Mörder in Blut vor sich hinschmoren, wachsen Selbstmörder an Bäumen fest, damit sie sich nichts mehr antun können.
Als ich gefragt habe, was mit den Mordopfern passiert, antwortete er, dass sie in den Himmel kommen, vorausgesetzt, sie sind selbst keine Sünder. Ein Selbstmörder begeht eine zweifache Sünde.
Ich saß auf dem Perserteppich in Papas Bibliothek und blätterte in den Büchern, die vor mir lagen. Aus dem Nebenzimmer waren die Stimmen der Alten zu hören. Papa redete am meisten, aber von Zeit zu Zeit sagte auch Fabian irgendwas. Sie stritten zwar nicht, waren sich aber offenbar auch nicht einig.
Fabian war dafür, zu expandieren und sich einen Standort in der Innenstadt zu suchen, während Papa der Meinung war, sie sollten noch ein wenig abwarten und die Gemeinde langsam wachsen lassen. Vergiss nicht, dass Jesus das Himmelreich mit einem Senfkorn vergleicht, sagte Papa, und Fabian brummelte nur. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum.
Papa sagt, Fabian ist ein Spaßvogel, und das weiß ich auch, denn er und Mama lachen immer, wenn Papa den Müll runterbringt. Fabian ist voller Einfälle, und er nimmt uns Kinder mit in den Grimstawald, wo wir nach Insekten suchen und uns vor den Trollen verstecken.
Ich spüre sein unrasiertes Kinn auf meinem Bauch. Es kitzelt nicht annähernd so, wie er denkt, dass es kitzelt. Es kratzt und tut weh und riecht nach Käse, Staub und Leder.
Als der Zug losfährt und den Bahnhof verlässt, ist das Abteil halb voll. Die meisten Fahrgäste sind Teenager auf dem Heimweg nach einem Kneipenabend, aber es sind auch ein paar Rentner darunter. Wir fahren über die Zugbrücke am Danvikstull, und die Lichter von Sjöstad spiegeln sich in der dunklen Wasseroberfläche des Hammarby sjö. Das Fenster wirft sein Spiegelbild zurück, und es sieht aus, als nicke er allmählich ein. Das Kinn sackt auf die Brust, und er atmet schwer. Neben mir hängt die Karte mit dem Streckenplan der Saltsjö-Bahn, und ich kann sehen, dass ihm noch vierzehn Haltestellen im Leben bleiben.
In Nacka steigt die Hälfte aus, und niemand steigt zu. Auf dem Bahnsteig sitzen ein paar Halbstarke und rauchen. Im Zug sitzen jetzt nicht mal mehr zehn Personen.
Der Schaffner kommt, um die Fahrscheine zu kontrollieren, während eine blecherne Stimme kaum hörbar durchsagt, dass wir in Kürze in Saltsjö-Järla halten.
Ich drehe den Kopf weg, als der Schaffner meine Magnetstreifenkarte kontrolliert.
Wir halten in Lillängen und Storängen. In der Nähe von Östervik sehe ich ein paar Rehe, die unter einem großen, gespenstischen Baum mit merkwürdig abstehenden Ästen äsen.
Beim Halt in Fisksätra zuckt Fabian Modin zusammen und blickt auf.
Ich nahm die dicke Familienbibel mit dem braunen Ledereinband aus dem Regal, legte sie auf den weichen Teppich und las das Deckblatt. »Biblia, die Heilige Schrift auf Schwedisch, auf Befehl von König Carl dem Zwölften«, stand da auf Altschwedisch.
Ich blätterte gern darin und sah mir die Bilder an. Am besten gefiel mir das Bild der Steinigung des Heiligen Stefan, des ersten christlichen Märtyrers.
Einer derjenigen, der an der Steinigung teilnimmt, ist Paulus. Er zeigte später Reue und wurde bekehrt.
Ich war sechs Jahre alt und machte mir Gedanken über Jesus. Er ging tolerant und liebevoll mit allen um. Sollte man deswegen intolerant und gehässig sein gegen all jene, die nicht an ihn glaubten?
Mama kam rein und fragte mich, ob ich ein Brot wollte. Sie war dick; ich sollte bald ein Geschwisterchen bekommen. Ich hätte keinen Hunger, sagte ich und sah mir wieder die Bilder an.
Ich stecke die Hand in die Innentasche und spüre den kalten Stahl. Die scharfe Klinge.
Der Druck im Kopf nimmt zu, und ich merke, wie sich die Kiefermuskeln verkrampfen – wie das, was sich in meinem Hirn festgesetzt hat, wächst und um die Macht über meinen Körper kämpft. Anfangs war es nur eine fixe Idee, dann wurde ebenjener Albtraum daraus, vor dem ich am meisten Angst gehabt hatte. Nicht mehr Herr über meine Gedanken zu sein.
Meinen eigenen Körper nicht mehr steuern zu können.
»Igelboda. Reisende nach Solsidan bitte hier umsteigen.«
Wir sehen einander an. Fabian Modin erkennt mich nicht wieder. Er rülpst leise und kramt in seiner Jackentasche.
In Neglinge steigen erneut ein paar Fahrgäste aus, und am Ringvägen sind wir die Letzten, die jetzt noch im Zug sitzen.
In Saltsjöbaden zücke ich das Messer.
Sich schuldig zu fühlen sei die Aufgabe und schwere Bürde der Unschuldigen, antwortete Fabian Modin, als ich ihn nach Paulus fragte.
Simon
Vägaren-Viertel
Er hört, wie jemand im Wohnzimmer gähnt. Eine Decke wird zurückgeschlagen, dann behäbige Schritte, die das Zimmer durchqueren und ins Bad verschwinden, wo sich prustend Wasser ins Gesicht geklatscht wird.
Er schiebt die Decke weg und steigt aus dem Bett. Sein Haar riecht säuerlich von dem Bier, mit dem sie einander angespuckt haben. Er weiß noch, dass ein paar verwirrte Gestalten mit zu ihm nach Hause gekommen sind, Jungs mit sorgfältig zusammengestellten Outfits, und als er zu ihnen sagte, dass sie nicht echt seien, flippten sie aus. Er hofft, dass sie mittlerweile verschwunden sind.
Er reckt sich nach dem Buch. Anleitung für einen Vater von Peter Kihlgård. Er erinnert sich an die Leere, die der Sohn empfindet, der behauptet, er sehe zu seinem Vater auf, dessen Vollkommenheit er insgeheim jedoch verabscheut. Alles, was der Vater ihm mitgegeben hat, sind ein Gefühl von Schuld und ein schlechtes Gewissen, weil er den Ansprüchen nicht genügt. Man verfehlt beim Weitsprung den Balken, traut sich nicht, vom Fünfmeterbrett zu springen, oder versteht nicht, warum eins hoch null gleich eins ist, so was Krankes wie ein leeres Produkt.
Man taugt einfach zu nichts.
Er hört, wie die Badezimmertür ins Schloss fällt, und legt das Buch wieder aus der Hand.
»Simon, ich gehe jetzt.« Øystein steckt den Kopf durch die Tür: die Augen blutunterlaufen und immer noch schwarz von all der Schminke, und Simon bemerkt die frischen Verletzungen an Øysteins Armen. Ein paar Schnitte scheinen richtig tief zu sein. Vielleicht war es ja trotz allem ein guter Abend.
Der Auftritt in Uppsala war so lala. Halbherzig. Hunger nicht würdig.
Simon schlüpft in seine Jeans, bleibt mit den Zehen in einem Loch über dem Knie hängen, und der Stoff reißt ein. »Ich brauch was für heute Abend. Kannst du was organisieren?« Er stellt sich an die Kommode. »Wenn du das hinkriegst, ist der Rest für dich. Okay?«
Øystein nickt, und Simon weiß genau, dass er ihn bescheißen wird. Er wird genau so viel oder so wenig kaufen, wie er meint, dass Simon haben will, und sich den Rest in die eigene Tasche stecken. Der Stärkste überlebt. Kein Löwe würde zu einem schwachen, kränkelnden Wasserbüffel Nein sagen. Wer schwach ist, hat keine Existenzberechtigung mehr und muss sterben. Dazu muss man Stellung beziehen, ob man will oder nicht.
»Aber sieh zu, dass du vernünftiges Zeug kriegst«, fügt er hinzu.
Die Suboxone- und Methadonprogramme haben dazu geführt, dass manche Dealer ihren Stoff fast schon verschenken, um an neue Kunden zu kommen, und um die Kosten niedrig zu halten, verlängern sie ihn mit fast allem: von Zucker über Chinin bis zu lebensgefährlichen Herzmedikamenten.
Simon schließt die oberste Kommodenschublade auf. Vor ihm liegen vier Etuis. Er klappt eins davon auf und reicht Øystein zwei Fünfhunderter.
»Krass, wie viel Kohle du hast.«
Simons Vater zahlt ihm für seine Abwesenheit zehntausend im Monat, was die Kosten für Miete und Lebenshaltung decken soll. Simon muss sich als Gegenleistung lediglich fernhalten, aber das ist kein allzu großes Problem. Eher eine Befreiung.
Øystein nimmt das Geld, und sie verabreden sich für später.
Als Øystein weg ist, geht Simon in die Küche. Drei Jungs liegen dort in unterschiedlichen Zersetzungsstadien auf dem Boden, und er gibt einem von ihnen einen Tritt in den Rücken. »Aufstehen, verdammt.« Wenn Øystein nicht da ist, ist er hier das Alphamännchen, auch wenn er bloß ein Strich in der Landschaft ist.
Der junge Typ rollt sich auf den Rücken und streckt sich. »Sorry …« Dann grinst er. »Mann, war das gut gestern! Hunger war echt cool.«
Simon schnaubt. »Er hatte schon bessere Auftritte.«
Der Typ setzt sich auf und reibt sich die Augen. »Er? Das könnte genauso gut eine Frau sein. Bis jetzt weiß ja wohl keiner, wer es ist, oder?«
»Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Weck deine Kumpels und haut endlich ab.«
Der Typ gähnt und streckt dabei seine trockene gelbbraune Zunge raus. »Lebst du hier?«
Simon sieht verächtlich und mitleidig auf ihn hinab. »Nein«, gibt er dann zurück. »Derjenige, der hier wohnt, ist so gut wie tot.«
Hurtig
Sibirien
Vor rund hundert Jahren kam ein Umzug in den Nordosten von Vasastan der Deportation in ein fernes Arbeitslager gleich. Bis heute trägt das Viertel den Spitznamen »Sibirien«.
Jens Hurtig wohnt in einer Zweizimmerwohnung mit siebenundfünfzig Quadratmetern, die ihm klein und verlassen vorkommen.
Er wacht noch vor dem Radiowecker auf, aber er ist unausgeschlafen. Das ist bei ihm immer so am ersten Tag nach dem Urlaub, und er bleibt noch eine Weile im Bett liegen, bevor er sich etwas überzieht und ins Wohnzimmer geht. Den gestrigen Spaziergang auf Runmarö spürt er immer noch in den Beinen.
Isaak liegt auf dem Sofa unter zwei Decken. Er scheint die Kälte aus dem Sommerhaus in den Schären mitgenommen zu haben in die Stadt. Vier Grad waren es, als sie dort ankamen, und das Thermometer ist kein einziges Mal über siebzehn Grad hinausgeklettert.
Er muss an seine Eltern in Kvikkjokk denken.
Siebzehn Grad Innentemperatur im November sind für sie der reinste Luxus. Wenn sie frieren, hat das andere Gründe. Eine Tochter, die Selbstmord begangen hat, macht das Leben kalt, und es spielt keine Rolle, dass seitdem fünfzehn Jahre vergangen sind.
Er geht in die Küche, stellt die Kaffeemaschine an, und als der Kaffee anfängt durchzulaufen, hört er Isaak gähnen. Kurz darauf kommt er mit der Morgenzeitung unterm Arm in die Küche.
Isaak musste aus seiner alten Wohnung ausziehen, und solange er auf der Suche nach einer neuen ist, übernachtet er gelegentlich auf Hurtigs Sofa. Bei der Wohnungsmisere in Stockholm ist man auf gute Freunde angewiesen.
Er findet, Isaak sieht blass aus und irgendwie krank. Da hilft es auch nichts, dass er wie gewohnt seine Gesichtscreme aufgetragen und sein langes Haar glatt gekämmt hat. Auf seinem Oberarm prangt ein Nikotinpflaster. Vielleicht ist er so schlapp, weil er versucht, mit dem Rauchen aufzuhören.
»Ich fühle mich, als hätte ich verschlafen«, sagt er. »Wie viel Uhr ist es?«
»Erst Viertel nach sechs. Nur keine Eile, du kriegst deinen Zug. Du hast doch nur deshalb bei mir übernachtet, damit du nicht von deinem Atelier in Västberga zum Bahnhof hetzen musst.«
»Doch nicht deswegen …«
Isaak setzt sich an den Tisch und macht das Radio an. So ist er nun mal. Er braucht eine Geräuschkulisse. Bei Hurtig ist das anders. Er kann besser denken, wenn es still ist.
Im Radio wird von einem Mord in einem Nahverkehrszug berichtet, draußen in Saltsjöbaden.
Hurtig dreht das Gerät lauter und fragt sich, wer von seinen Kollegen das zweifelhafte Vergnügen gehabt haben mag, hinter einem Dutzend Messerstichen herzuräumen. Er tippt auf Schwarz oder Åhlund.
Isaak ist beunruhigt.
»Was ist los?«
Er druckst herum. »Ich bin mir nicht sicher, ob Berlin jetzt das Richtige ist. Ich hab schon seit Ewigkeiten nichts Brauchbares mehr zustande gebracht. Es kommt mir vor, als würde ich mich allmählich meinem Verfallsdatum nähern.«
Hurtig findet es schade, dass Isaak es so wichtig nimmt, was andere Künstler machen.
»Fahr nach Berlin. Das wird bestimmt gut. Vielleicht hast du ja wieder so viel Glück wie beim letzten Mal.«
Vor vier Jahren hat Isaak ein paar Geschäftsleute getroffen und sie mit ein wenig Überredungskunst dazu gebracht, ihn und seine Arbeit zu unterstützen. Sie ließen ihm ein anständiges Sponsoring zukommen.
»So ein Glück hat man nur einmal«, entgegnet Isaak. »Ich hab noch gar nicht richtig angefangen, an dem Werk zu arbeiten. Sie hatten wirklich keine Ahnung, wofür sie bezahlt haben. Aber jetzt ist sowieso alles anders. Meine Freunde sind nicht mehr da – nicht mal Ingo, und ich dachte, der würde für den Rest seines Lebens in Berlin bleiben. Ich werde mich dort ganz schön einsam fühlen.« Isaak sieht ihn ernst an. »Könntest du nicht mitkommen? Es wäre schön, jemanden dabeizuhaben, den man gut kennt. Nimm einfach noch ein paar Tage frei oder lass dich krankschreiben. Scheiß auf die Pflichten.«
»Du weißt, dass ich nicht mitkommen kann«, erwidert Hurtig, auch wenn er sich wünschte, dass er könnte.
Isaak seufzt, fängt an, in der Zeitung zu blättern, und Hurtig beobachtet ihn.
Eine von Isaaks besten Eigenschaften ist, dass es ihm leichtfällt, Menschen nahe zu kommen; sie fassen zu ihm Vertrauen. Jens schätzt Isaaks soziale Ader. Er selbst schafft es einfach nicht, ein Feuer am Brennen zu halten, wenn er kein wirklich gutes Holz zur Verfügung hat.
Hurtig meint, erste Bitternisfältchen um Isaaks Mundwinkel zu entdecken, aber sie verschwinden wieder, als er den Blick hebt und aufsieht. Er ist von Natur aus ein wenig launisch. Jetzt wirkt er neugierig und belustigt. »Ach«, sagt er, legt die Zeitung aus der Hand und wedelt mit einem Abholschein von der Post. »Was ist denn das?«
»Computerkram«, flunkert Hurtig. Er weiß genau, dass es sich dabei um eine der beiden Spielkonsolen handelt, auf die er sehnsüchtig wartet. Isaak würde ihn auslachen, wenn er wüsste, welche Summe er für schlichte Nostalgie zu zahlen bereit ist. Ein Atari Home Pong aus dem Jahr 1975 für hundert Dollar, eine Coleco Telstar von 1977 für siebzig Dollar. Beide hat er bei Online-Auktionen erworben.
»Du bist fast vierzig, zehn Jahre älter als ich«, lacht Isaak. »Trotzdem bist du derjenige, der auf Einser und Nuller steht. Es ist ein Videospiel, gib’s zu!«
Hurtig will schon mit einem Kommentar über Computerspiele als legitime, aber leider unterbewertete kulturelle Errungenschaft kontern, als die Nachrichten im Radio einen Unfall auf der Liljeholmsbron am Hornstull melden.
Ein Mann ist von einem Lkw überfahren worden, konnte aber bislang nicht identifiziert werden.
Aiman
Vägaren-Viertel
Ihre Reise begann in Almaty, damals noch Alma-Ata, und führte über Teheran, Minsk und Gävle in eine Wohnung an der Folkungagatan in Stockholm.
Sie schuf sich ein geregeltes Leben als Bibliothekarin, widmete sich der Buchbinderei und erlaubte es sich, ihrer Neigung nachzugeben, sich an Kleinigkeiten aufzuarbeiten. Mit der Zeit schwand der Wunsch nach den ganz großen Plänen, und schließlich vergaß sie ihre Träume vollends. Die Zeit raste, und mit einem Mal schienen mit einem Wimpernschlag zwanzig Jahre vergangen zu sein.
Das Haus, in dem Aiman Chernikova wohnt, seit sie in Stockholm ist, ist ein gigantischer orangefarbener Plattenbau mit winzigen Fenstern direkt gegenüber vom U-Bahn-Aufgang Medborgarplatsen. Es zählt zu den hässlichsten Gebäuden der Hauptstadt und dient der Hochschule für Architektur auf Östermalm regelrecht als Mahnmal.
Obwohl sie findet, dass das Haus an einen Aufbewahrungskarton aus den Siebzigern erinnert, mag sie es. Ihre Wohnung ist großzügig geschnitten, der Innenhof wirklich schön, und auch wenn die Fassade fast schon als grotesk bezeichnet werden kann, sieht man sie von drinnen schließlich nicht.
Bevor sie die Straße überquert, schaut sie zu ihren drei Fenstern hoch. Hinter der Wohnzimmerjalousie steht ihr Fernglas. Von der Straße aus sieht man nur einen schwarzen Schatten, der auch als Lampe durchgehen könnte.
Sie mag es, die Welt durch den einäugigen runden Zylinder zu betrachten. Ihr verletztes Auge kann sich dann ausruhen, und sie fühlt sich geborgen. Sie spioniert und observiert schließlich nicht, sie richtet das Fernglas nie auf die Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Was dahinter passiert, geht sie nichts an. In seinen eigenen vier Wänden soll man seine Ruhe haben dürfen, während man unten auf der Straße damit leben muss, gesehen zu werden.
Sie gibt den Türcode ein und nimmt die Treppe anstelle des Fahrstuhls.
Seit sich das Kind in ihrem Bauch in Form von ein paar zusätzlichen Kilos an Oberschenkeln und Hüften zu erkennen gibt, achtet sie penibel darauf, sich so viel wie möglich zu bewegen.
Als sie den Laubengang erreicht und sich ihrer Wohnungstür nähert, kramt sie in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln und wirft einen Blick in Richtung Küchenfenster. Hinter dem Fensterglas erahnt sie einen schwarzen Schatten und ein gelbes Augenpaar. Sie hört den Kater maunzen, als er zwischen den Blumentöpfen über die Fensterbank balanciert.
Als sie die Schlüssel gefunden hat – eingekeilt zwischen Puderdose und Kalender –, geht die Tür zur Nachbarwohnung auf.
»Hej«, sagt sie.
Ein junger Mann tritt auf den Gang. Er dreht sich zu ihr um, nickt stumm hinter seinem schwarzen Haar und senkt dann den Blick. Sie fragt sich kurz, ob er wohl vorhat, sich für das Fest in der vergangenen Nacht zu entschuldigen – ein Heidenlärm, der sie bis in die frühen Morgenstunden wach gehalten hat.
Schließmechanismen und Schlüsselbunde rasseln synchron, und sie hört, wie der Kater drinnen am Türstock die Krallen wetzt.
Sein Gesicht ist bleich, sein Blick leer. »Deine Katze heißt Behemoth, oder?«
Dies ist das allererste Mal, schießt es ihr durch den Kopf, dass sie miteinander reden. »Ja … meistens aber nur Motte.«
»Nicht, wenn sie dir auf die Nerven geht.«
Er schiebt die verschlissene Lederjacke zur Seite und zeigt ihr sein T-Shirt. BEHEMOTH, steht da in gotischer Schrift über einem Symbol aus Kreuzen und Raubvogelflügeln.
Dann wendet er sich ab und geht. Als seine hochgewachsene Silhouette mit den dünnen Beinen um die Ecke biegt, schiebt sie die Tür auf. Motte sitzt auf dem Flurteppich und miaut.
Sie legt den Hidschab ab und hängt ihn an die Garderobe, löst die Haarspange und stellt sich vor den Spiegel, um ihr Haar zu ordnen.
Man sieht ihr die Schwangerschaft nicht an, und das liegt nicht allein an den bauschigen Kleidern. Das ist immer schon so gewesen in ihrer Familie. Generationen von späten Erstgebärenden mit kleinen Bäuchen, und jetzt ist eben sie an der Reihe, mit dreiundvierzig Jahren und einem kaum erkennbaren Bäuchlein, obwohl sie schon im sechsten Monat ist.
Sie betrachtet ihr Gesicht in dem kalten elektrischen Licht der Deckenlampe. Aiman bedeutet »schön wie der Mond«, aber sie findet, das ist wohl Ansichtssache. Natürlich ist der Mond schön, wenn man in der richtigen Stimmung ist, aber wenn nicht, sieht man nur schroffe Krater und eine blassgelbe kranke Farbe. Aknenarben und den gelblichen Teint ihres südkasachischen Gesichts, das viele Schweden irrtümlich für ein persisches oder pakistanisches halten. Ihre Hautfarbe kommt stärker zur Geltung, wenn sie einen weißen Hidschab trägt, deshalb entscheidet sie sich meist für einen schwarzen. Damit wirkt ihr Gesicht heller, schwedischer.
Die Pupille ihres verletzten Auges sieht ganz klein aus, wenn das Licht senkrecht von oben fällt, aber eigentlich ist sie vergrößert.
Behemoth schnurrt und streicht ihr um die Beine. Sie bückt sich, und seine Nase berührt ihre Hand.
In Der Meister und Margarita ist Behemoth eine Katze, die spricht und auf den Hinterbeinen geht und in Begleitung des Teufels nach Moskau kommt. Ferner heißt so eine Bestie aus der Bibel – geboren in den feuchten Winkeln der Unterwelt. Ein Dämon mit Röhrenknochen wie Kupferrohre und Gliedmaßen stark wie Eisenstangen.
Das Handy surrt und reißt sie aus ihren Gedanken.
Es ist ein Kollege aus der Lilja, und während sie sich unterhalten, räumt sie nebenbei ein bisschen auf, klaubt ein paar Kleider in der Diele auf und hängt ihren Hidschab zu den anderen in den Schlafzimmerschrank.
Der Kollege erwähnt, dass er sich Sorgen um Maria macht. »Hast du was von ihr gehört?«
»Nein«, antwortet sie. »Wir kennen uns nicht besonders gut, ich arbeite ja hauptsächlich mit Vanja. Aber vielleicht weiß Isaak was. Hast du mit ihm geredet?«
»Ja, er hat auch schon versucht, sie zu erreichen, aber ohne Erfolg. Und jetzt ist er unterwegs nach Berlin.«
Berlin?, denkt sie und muss daran denken, wie sie Isaak vor ziemlich genau vier Jahren kennengelernt hat. Kurz darauf hat er sie Ingo, einem Künstler, einer Autorin namens Edith und dem Journalisten Paul vorgestellt – die sich später als Vanjas Adoptiveltern entpuppten: eine schwedische Clique, die in Berlin eine kleine kreative Enklave gebildet hatte.
Jetzt ist die Lilja ihr gemeinsamer Nenner, auch wenn Ingo dort nicht mehr unterrichtet, seit er krank wurde. Seit er an seinem fünfundsechzigsten Geburtstag eine Hirnblutung erlitt, wohnt er in einem Pflegeheim in Strängnäs, und sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn dort schon lange nicht mehr besucht hat. Vielleicht sollte sie Isaak vorschlagen, mal zu ihm rauszufahren.
Der Kontakt zu Edith und Paul ist ebenfalls sporadischer geworden und beschränkt sich mittlerweile auf gelegentliche Telefonate, in denen es meist um Vanja geht.
»Ich bin heute mit Vanja in der Lilja verabredet«, sagt Aiman zu ihrem Kollegen. »Sie hat mit dem Buchbinden angefangen. Ich kann sie ja mal fragen, ob sie weiß, wo Maria steckt.«
Als sie das Gespräch beendet haben, fällt ihr aus irgendeinem Grund Isaaks einstige Gesprächseröffnung ein. Sie hatten sich in einer Hotelbar im alten Ostberlin kennengelernt. »Ich liebe dich«, hatte er gesagt, und als sie ihn fragte, wie er denn darauf komme, antwortete er nur, dass er den Satz lediglich einübe.
In jener Zeit fühlte sie sich unbeschreiblich verwundbar. Als würde sie auf einem Glasdach balancieren und Todesangst davor haben, es könnte einbrechen. Vielleicht lag es an diesen drei Worten, dass sie sich Isaak gegenüber öffnete? Ich liebe dich. Sie ist sich nicht sicher. Aber zumindest hat sie Isaak erzählt, dass sie sich in Berlin aufhielte, weil sie vor ihrem Bruder geflüchtet wäre.
Nachdem sie Behemoth ein bisschen Trockenfutter hingestellt hat, greift sie nach dem Fernglas und nimmt die Linsenklappe ab.
Manchmal kommt es ihr so vor, als würden die Fremden auf der Straße ein Ersatz für richtige Freunde sein.
Sie sieht den Briefträger in einen der Hauseingänge gegenüber treten – ein junger Mann, der sich oft ungewöhnlich lang in diesem Haus aufhält, und Aiman hat allmählich den Verdacht, dass das an einer Frau liegt, die dort wohnt. Er ist sicher noch keine zwanzig, während die Frau schon sichtlich in die Jahre gekommen ist.
So gut wie jeden Tag kommt es zu einer fruchtbaren Begegnung zwischen dem, was spät, und dem, was früh erblüht, und all das weiß Aiman, ohne je das Fernglas auf die Wohnung der Frau gerichtet zu haben.
Sie ist schließlich keine Voyeurin.
Irgendwann kommt der Briefträger mit einem Lächeln auf den Lippen wieder heraus, es beginnt zu regnen, und die Passanten suchen Schutz oder eilen die Bürgersteige entlang. Ein Mann mit einem angeleinten Zwergpudel ist vom Regen überrascht worden, hält sich die Lederjacke über den Kopf, sein Hund läuft neben ihm her, und an der Bushaltestelle steht eine Frau unter einem Schirm, während ein kleines Mädchen unbekümmert in eine Pfütze auf dem Fußweg hüpft. Kinder und Tiere finden Regen toll.