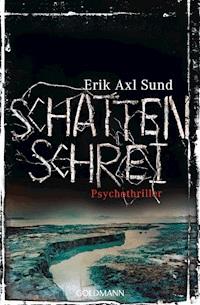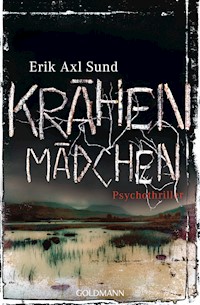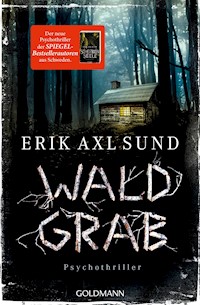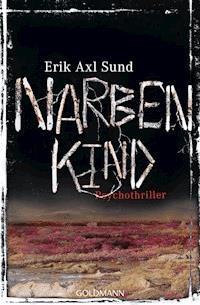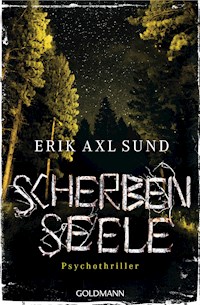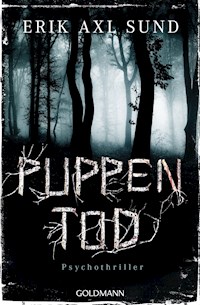
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kronoberg-Reihe
- Sprache: Deutsch
In Stockholm stürzt ein junges Mädchen von ihrem Balkon in den Tod. Zunächst sieht es nach Selbstmord aus, doch dann stellt sich heraus, dass sie in der gleichen Nacht mit einem unbekannten Mann verabredet war, mit dem sie gegen Geld Sex haben sollte. Spuren im Internet deuten darauf hin, dass sie Kontakt zu einem User namens »Der Puppenspieler« hatte, der mit illegalen Aufnahmen von Teenagern in Verbindung steht. Der Polizeibeamte Kevin Jonsson beginnt fieberhaft zu ermitteln. Gleichzeitig verschwinden zwei Jugendliche aus einem Heim bei Uppsala. Und auch sie drohen in die Hände des Unbekannten zu fallen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
In Stockholm stürzt ein junges Mädchen von ihrem Balkon in den Tod. Zunächst sieht es nach Selbstmord aus, doch dann stellt sich heraus, dass sie in der gleichen Nacht mit einem unbekannten Mann verabredet war, mit dem sie gegen Geld Sex haben sollte. Spuren im Internet deuten darauf hin, dass sie Kontakt zu einem User namens »Der Puppenspieler« hatte, der mit illegalen Aufnahmen von Teenagern in Verbindung steht. Der Polizeibeamte Kevin Jonsson beginnt fieberhaft zu ermitteln. Gleichzeitig verschwinden zwei Jugendliche aus einem Heim bei Uppsala. Und auch sie drohen in die Hände des Unbekannten zu fallen …
Weitere Informationen
zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
Erik Axl Sund
Puppentod
Band 2
der Kronoberg-Reihe
Psychothriller
Aus dem Schwedischen
von Nike Karen Müller
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Grå Melankoli«
im Ordfront Förlag, Stockholm.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe April 2020
Copyright © der Originalausgabe 2019
by Erik Axl Sund
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Leena Flegler
CN · Herstellung: ik
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-16739-4V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Alle unschuldig, keiner ohne Schuld.
Mitten in der Zirkusmanege wird die Bärin gequält.
Nadja Uschakowa
Der Himmel hier
Nordwärts
Zuerst fährt der Zug durch einen Tunnel und dann über die längste Brücke, die sie je gesehen hat. Im Bahnhof in Malmö riecht es nach Kaffee, fast jeder hält einen dampfenden Pappbecher in der Hand. In ganz Schweden riecht es nach Kaffee, im Amt für Migration und Flüchtlinge und im Bus, der sie weiter hinauf in den Norden bringt.
Zuerst sieht es aus wie in Deutschland, alles ist braun, Äcker und Hügel und Wäldchen mit kahlen Bäumen, aber dann wird der Wald dichter, es wird felsiger und weißer und grüner.
Der Busfahrer spricht die ganze Zeit ins Telefon und gibt neue Anweisungen über Lautsprecher durch, ehe der Bus in einem Ort namens Lidköping hält. Laut Wörterbuch heißt die Stadt in etwa Leidestadt, und der Busfahrer sagt, sie liege an Schwedens größtem See, doch der See sieht eher aus wie ein Meer, man kann nicht mal bis zum anderen Ufer sehen. Auf der Wasseroberfläche ist Eis, und es ist Nacht, obwohl es erst Nachmittag ist. Das Mondlicht fällt auf die Schneedecke, und die Dunkelheit ist irreal wie in einem Traum, vielleicht ist es ja einer.
Sie schläft ein, bevor sie Stockholm erreichen, die Stadt, die sie so gerne sehen will, und erst als sie durch die Stadt hindurchgefahren sind, wacht sie wieder auf. Als sie aus dem Fenster blickt, glaubt sie noch immer zu träumen, denn die Bäume entlang der matschigen Autobahn sehen aus wie Brokkoli.
Als sie in Borlänge ankommen, muss sie sitzen bleiben, sie ist nur ein Name auf einer Liste, und es ist nicht einmal klar, in welche Kategorie sie aufgenommen wird, sie ist momentan alleinreisend, aber vielleicht ist ihr Vater schon da, auch wenn sie seinen Namen nirgends finden können.
Der Bus fährt weiter in nördlicher Richtung, und draußen wird es kälter und immer kälter und die Straßen schlechter und immer schlechter, aber die Natur wird schöner und die Dunkelheit noch schwärzer, und sie denkt, schon komisch, dass der Himmel hier derselbe ist wie zu Hause. Und es ist dasselbe Wasser, denn alles Wasser auf der Erde ist miteinander verbunden, ein einziges Wasser, um darin zu ertrinken, und ein einziger Himmel, um darin zu fliegen, wenn man tot ist.
Die Nacht über den dunkelblauen Bergen strahlt plötzlich in gespenstischem Grün, und der Bus hält, der Busfahrer sagt, das da heiße Nordlicht und komme hier öfter vor. Und es ist nicht nur grün, es ist auch gelb, blau und violett und gleitet über den Himmel, verändert die Form wie eine Feuerqualle, die sich unter Wasser zusammenzieht und entspannt, wie schwere Atemzüge eines vergifteten Gottes. Wie kann etwas so Schönes öfter vorkommen? Wird es irgendwann nur mehr nichtssagender Hintergrund, wenn man es jede zweite Nacht sieht?
Die sieben Baubaracken vor Bräcke gehören einem Alten im Jogginganzug, der Geld anhäuft und alleinreisende Flüchtlingskinder, dreißig sind es inzwischen, alle zwischen zwölf und siebzehn, davon achtundzwanzig Jungs. Es sind nicht alle dumm, aber fünf oder sechs schon, so ist es immer. Zwischen zehn und zwanzig Prozent aller Menschen haben nicht einfach nur Pech, wenn sie denken, sie sind auch noch stolz darauf. Nachts schleichen sie sich rein zu ihr, und wenn ein Typ versucht, ihr die Hose runterzuziehen, verpasst sie ihm einen Tritt ins Gesicht. Dann sagt er, er zeigt sie bei der Polizei an, aber die Polizei kommt nie, denn hier gibt es nur drei Polizisten für ein Gebiet, das so groß ist wie Belgien.
Wenn ihr Asylantrag bewilligt wird, kommt sie in ein Pflegeheim, bis sie volljährig ist. Aber das mit den Dokumenten braucht Zeit, ein halbes Jahr lang passiert gar nichts, die Sonne schleckt den Schnee von den Bergen, und es wird Sommer in Jämtland. Dass die Sonne mitten in der Nacht aufgeht und ihre Haut schon ganz knotig ist von Milliarden Mückenstichen, kann sie aushalten; mit der Einsamkeit ist es schwieriger. Die treibt sie in den Wahnsinn.
Mach dich klein in deinem frostigen Fichtenreisigbett, kleines schwarzes Mädchen, so dunkel von außen und von innen und so kalt und eisig, dass die Finsternis dich verschlingt. Du bist eine Hure und eine Mörderin.
Es ist immer ein Er
Straße 222
Der Tod ist weder schwarz wie die ewige Nacht noch weiß wie das Licht im Tunnel, er ist graumetallic, hergestellt in Deutschland und nicht für Tempolimits gemacht.
Der Schnee hängt wie ein Nebelschleier über dem Värmdöleden, der Straße, die in Richtung Osten nach Värmdö führt – als wären die Schneeflocken in der Luft angefroren. Das Auto pflügt durch die weiße Masse, und als sie am Einkaufszentrum Nacka Forum vorbeifahren, sind sie mit einhundertfünfzig Sachen unterwegs.
Rund dreißig Meter hinter ihnen fährt noch jemand, ebenfalls mit hundertfünfzig. Es ist ein roter Toyota Prius, ein Hybridmodell, das einige Jahre später aufgrund eines Fehlers im Bremssystem, der mehrere tödliche Unfälle verursacht, Gegenstand einer Rückrufaktion wird. In der Kurve an der Svindersviken verliert der Toyota den Grip und schlittert mit sprühenden Funken an der Leitplanke entlang.
Der Wagen in Graumetallic beschleunigt wieder. Einhundertsechzig Stundenkilometer, die beiden jungen Frauen grinsen sich an.
Mercy hält das Lenkrad fest umklammert.
Nova streicht sich die Haare aus der Stirn und zündet sich eine Zigarette an.
Der Wind heult, als sie das Fenster runterlässt. »Hast du gesehen? Wir haben ihn abgehängt.«
»Ihn? Woher weißt du, dass es ein Er war?«
»Es ist immer ein Er.«
An der Anschlussstelle, wo der Värmdöleden in den Värmdövägen übergeht, zittert die Nadel bei einhundertachtzig. Sie wissen nichts von den beiden Verkehrspolizisten, die in ihren Dienstfahrzeugen am S-Bahnhof Henriksdals station schon auf sie warten, um sie mit Nagelketten anzuhalten.
»Neunzig Prozent aller Morde und neunundneunzig Prozent aller Vergewaltigungen werden von Männern verübt«, sagt Nova. »Und von hundert Pädophilen sind nur zwei Frauen.«
»Und sie quälen gern Tiere«, ergänzt Mercy.
»Von tausend Leuten, die es mit Tieren treiben« – Nova lacht –, »zum Beispiel mit Kühen, Ziegen, Hundewelpen und kleinen hilflosen Hühnern …«
»… sind neunhundertneunundneunzig Männer, und die einzige Frau, die sich einen Hengstschwanz reinschieben lässt, wird von einem Mann dazu gezwungen.«
»Männer haben die Gruppenvergewaltigung, die Atombombe und den elektrischen Stuhl erfunden.«
»Ja, was haben sie sich dabei gedacht?«
»Die haben einfach zu viel Selbstbewusstsein. Wissen alles und können alles. In Wahrheit sind die ein einziger großer Fehler, ein Irrtum der Evolution.«
»Ja, das einzig Positive an ihnen ist, dass sie sich ungefähr eine Milliarde Mal am Tag entweder gegenseitig misshandeln oder zusammenschlagen. Warum haben die überhaupt das Wahlrecht?«
»Jedes Mal, wenn ein Mann geboren wird, wird ein potenzieller Kannibale oder Pädophiler geboren. Von Geburt an dürften die gar keine Rechte haben …«
Nova und Mercy kennen sich noch nicht besonders lange, aber ihre Freundschaft ist so eng, dass sie manchmal ein und dieselbe Person zu sein scheinen.
»Um überhaupt reden zu dürfen, müssten sämtliche Typen erst mal einen Test machen, mit dem sie beweisen, dass das, was sie sagen, interessanter ist als das, was alle Frauen auf der ganzen Welt zusammengenommen jemals gesagt haben.«
Die blinkenden Lichter vor der Brücke über die Danviken sehen sie nicht.
Die Nagelkette sehen sie auch nicht.
Mit einem Mal erstirbt Mercys Lachen. »Zehn per Zufall ausgewählte Männer zu ermorden hieße, achtundvierzig Gewaltverbrechen zu verhindern. Inklusive Mord und sexueller Missbrauch von Kindern. Männer sollten von Geburt an dazu ermuntert werden, sich umzubringen.«
»Mein leiblicher Vater hat Selbstmord begangen«, sagt Nova.
»Alle außer deinem leiblichen Vater und meinem Vater sollten sich umbringen.«
»Ja … Alle außer den beiden.«
Zweihundert Stundenkilometer durch den erstarrten Schnee, zweihundert bis zur Zugbrücke am Danvikstull. Sie wissen nicht, dass jemand bereits die Brückenwärterin informiert und angeordnet hat, die Brücke aufzumachen, um diese Wahnsinnsfahrt zu beenden.
»Ich find’s schön mit dir«, sagt Mercy. »Ich fühl mich wild, wenn wir zusammen sind.«
Das sind Nova und Mercy.
Nova sieht ein Zimmer in einer kalten Wohnung in Fisksätra vor sich, wo es dauerhaft nach Alkohol stinkt, und Mercy sieht ein kleines gemütliches Haus mit Mutter und Vater und zwei pummeligen kleinen Brüdern.
Sie sehen all die Wege, die sie von dort fortgeführt haben.
Die sie hierhergeführt haben. Auf ihren allerletzten Weg.
Zum Ende.
Sie fahren.
Der Wagen in Deutschgraumetallic gehört Sven-Olof Pontén, einem fünfundvierzigjährigen Mann aus Stocksund, CEO eines Unternehmens mit achtzig Millionen Jahresumsatz. Vier Tage zuvor hat er an einer Tankstelle in Knivsta gehalten und einem schwarzen Mädchen die Tür aufgemacht. Sie heißt Mercy und ist sechzehn Jahre alt. Er hat ihr einen Fünfhunderter gegeben, sich die Hose aufgeknöpft, während er sie Negerhure schimpfte und ihr befahl, sich auszuziehen. Zwanzig Meter entfernt eine Kassiererin, bei der ein Kunde seine Tankfüllung zahlte.
Als Sven-Olof Pontén mit ihr fertig war, übergab sie sich. Kaba und zerkautes Käsebrot. Sven-Olof ohrfeigte sie, brüllte, sie sei eine Fotze, die sein Auto einsaue, eine verdammte beschissene Schlampe.
Dann klingelte sein Telefon. Es war seine Frau.
Er knöpfte die Hose wieder zu, stieg aus, als die Kassiererin gerade den Beleg für einen Hotdog und eine Cola abriss, und nahm den Anruf entgegen. Seine Stimme klang sanft, als er erzählte, er sei schon auf dem Heimweg und müsse nur noch ganz kurz was erledigen – ein Besuch bei einem wichtigen Kunden. Mercy hörte, wie er zu seiner Frau sagte, dass er sie liebe und sie vermisse.
Dann Küsschen, Küsschen, und als er sich umdrehte, um zu seinem Auto zurückzugehen, fuhr sie auch schon davon.
Küsschen, Küsschen. Zur Hölle mit dir, du verfluchtes Aas.
Es gibt Männer
Graue Melancholie
Der Herbst war mild gewesen in Stockholm, regnerisch und stürmisch, aber an ein paar Tagen war das Wetter umgeschlagen und hatte sich zu einem Indian Summer hinreißen lassen. Meistens jedoch war es trist und ungemütlich. Schlauchte Körper und Seele.
Sven-Olof Pontén saß zu Hause in seinem Reihenhaus in Stocksund an seinem Rechner. Er hatte sich gerade ausgeloggt, Reißverschluss und Knopf seiner Hose zugemacht.
Draußen vor dem Fenster fuhr der Wind durch die dürren biegsamen Kirschbäume, die er fünf Jahre zuvor gepflanzt hatte. Der Herbst riss und zerrte an den kahlen Zweigen, die die Rehe verschmäht hatten.
Das Mädchen, mit dem er eben gechattet hatte – nach monatelanger harter Arbeit seinerseits –, war endlich bereit, sich mit ihm zu treffen. Heute Abend schon, woraufhin er sich genötigt gesehen hatte, ein bisschen Druck rauszunehmen. Er knüllte das Küchenpapier zusammen und schleuderte es in den Papierkorb.
Jetzt musste er nur noch sein schlechtes Gewissen beruhigen.
Er griff nach dem Schlüsselbund und schloss die unterste Schreibtischschublade auf. Bisweilen packte ihn die Paranoia – dass seine Frau oder seine Tochter irgendwie an die Schlüssel gekommen sein und die Schublade geöffnet haben könnte. Aber Åsa und Alice wussten es anscheinend besser. Auch wenn im großen Ganzen alles schiefgegangen war mit seiner Familie, hatten sie immer noch Respekt vor ihm.
In der Schublade lagen rund zwanzig Plastikmappen, die er regelmäßig zur Hand nahm, um sich zu vergewissern, dass bei ihm selbst eigentlich nichts falschgelaufen war. Sven-Olof Pontén, gebürtig aus Vitvattnet, Jämtland.
Er war nicht krank im Kopf. Seine Familie bestand schließlich aus normalen Menschen.
Diejenigen, die wirklich krank waren, steckten dort in den Mappen auf seinem Schreibtisch.
Die Mappen enthielten Zeitungsartikel, Protokolle von Voruntersuchungen und in einigen Fällen Protokolle von Tatorten, die er im Internet gefunden hatte. Das Material kam einer Auflistung menschlicher Perversionen gleich und umfasste neunzehn männliche Täter sowie eine Frau.
Eine der Mappen war mit ARMIN MEIWES beschriftet. Er sah sich die Bilder an und überflog die Texte, die er inzwischen fast auswendig konnte.
Armin Meiwes. Ein deutscher ehemaliger Berufssoldat, der im Internet per Kleinanzeige jemanden gesucht hatte, der sich umbringen und aufessen lassen wollte. Ein Ingenieur namens Bernd Jürgen Brandes hatte auf die Anzeige geantwortet – genau davon hatte er immer geträumt.
Die Übelkeit kam mit einem Gasbläschen aus seinem Magen, breitete sich in seinem Mund aus, und gute fünf Minuten lang war Sven-Olof Pontén gezwungen, seine Fantasien des Unaussprechlichen still zu ertragen.
Mit geschlossenen Augen stellte er sich die Mahlzeit in einer Küche im deutschen Rotenburg vor und ließ die Zunge über Gaumen und Zähne gleiten. Eine Fleischfaser saß zwischen zwei Backenzähnen fest, er brachte sie mit der Zungenspitze los und spuckte sie aus.
Sven-Olof Pontén war allein zu Hause, so konnte er ganz er selbst sein, ohne sich schämen zu müssen.
Er mochte das.
Sich nicht schämen zu müssen.
Noch immer mit geschlossenen Augen roch er an seinen Fingern. Sie stanken nach Knoblauch. Ein paar Stunden zuvor hatte er Knoblauch gehackt und dann ein Ochsenfilet angebraten. Åsa hatte daneben gestanden und Gurken und Tomaten in Scheiben geschnitten, während sie über ihre geliebte gemeinsame Tochter geredet hatten. Über Alice, die zurzeit nicht zu Hause wohnte, aber bald wieder zu ihnen zurückkehren würde.
Nach dem Essen war Åsa in die Stadt gefahren, um mit einer Freundin ins Kino zu gehen, und er hatte sich hierher zurückgezogen, in sein Arbeitszimmer.
Armin Meiwes hatte nach dem Abendessen zur Entspannung einen Science-Fiction-Roman gelesen, während der Ingenieur in der Badewanne lag und blutete. Sven-Olof glaubte fast, den süßlichen Geruch wahrzunehmen und das leise Gluckern aus dem Wannenablauf zu hören.
Schließlich schlug er die Augen wieder auf.
Es gibt Männer, die in gegenseitigem Einverständnis den Schwanz des anderen aufessen, dachte er. Im Vergleich dazu bin ich doch wirklich harmlos.
Er atmete tief durch. Endlich bekam er wieder Luft, und mit einem Lächeln auf den Lippen schob er die Mappen zusammen und schloss sie wieder in der Schreibtischschublade ein.
In einer Stunde würde das Mädchen, mit dem er gechattet hatte, vor einem der Mietshäuser in Bergshamra auf ihn warten. Gar nicht weit von hier, auf der anderen Seite des Stocksundet und doch in einer anderen Welt.
Sie hieß Tara, und er wusste genau, warum sie am Ende doch eingewilligt hatte, sich mit ihm zu treffen.
Sie stammte aus einer streng gläubigen Familie, gegen die sie aufbegehrte. Sie wollte allen demonstrieren, dass nicht Gott, sondern sie selbst diejenige war, die über ihren Körper bestimmte.
In seiner Jugend war es ihm ganz ähnlich gegangen. Er hatte gegen Jesus, seinen Vater und seine Mutter rebelliert und gegen die ganze Gemeinde. Er hatte gesoffen, wild herumgevögelt und verbotene Musik gehört.
Er und Tara hatten etwas gemeinsam und somit ein gutes Gesprächsthema. Sie waren gar nicht so verschieden – und auch wenn er fünfundvierzig war und sie erst fünfzehn, würden sie schon miteinander auskommen.
Er war kein Kannibale wie Armin Meiwes.
Sven-Olof Pontén behandelte seine Mädchen gut, vorausgesetzt, sie zollten ihm den gebotenen Respekt.
Draußen frischte der Wind auf, der Winter war im Anzug.
Erster Tag
November 2012
Eine Gleichung aus zahllosen Unbekannten
Bergshamra
Das Mädchen lag auf dem Rücken auf dem frostblanken Granitfelsen vor einem der fünfstöckigen Mietshäuser in Bergshamra. Ein Taxifahrer hatte es kurz vor Mitternacht entdeckt, als er eine Kippenpause machen wollte. Zunächst hielt er es für eine Schaufensterpuppe: viel zu dünn angezogen für die Jahreszeit und mit dürren, fast weißen Armen und Beinen, die unnatürlich abgespreizt waren.
Als er näher heranging, sah er das Blut.
Dann setzte unglücklicherweise Regen ein, sodass das Blut fast völlig vom Felsen hinabgespült wurde. Potenzielle Spuren wie etwa Schuhabdrücke würden so nicht mehr gesichert werden können.
Um halb eins sah eine alleinerziehende Mutter aus dem Küchenfenster im dritten Stock. Das Blaulicht der Streifenwagen warf unregelmäßige kalte Muster über die vordersten Bäume des benachbarten Wäldchens und bis hoch zu ihrer Wohnung. Das Blinklicht erweckte die Zeichnungen ihrer Kinder an der Kühlschranktür zum Leben. Ja, sie sahen beinahe lebendig aus – schludrig gemalte Wasserfarb-Kopffüßler, Tannenzapfen und Laub wanderten über die Kühlschranktür.
Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen und überlegte, wer dort unter der Plane auf der Erde liegen mochte und was genau passiert war. Die Vorstellung, dass einer ihrer zwei Jungs vom Balkon oder aus einem Fenster stürzen und auf dem gnadenlosen Fels aufschlagen könnte, ängstigte sie seit ihrem Einzug.
Sie zog die Gardine zu und ging zu ihnen. Sie schliefen friedlich in ihren Betten, und sie schlüpfte zu ihrem Jüngsten unter die Decke. Kurz bevor sie einschlief, fiel ihr auf, dass die aufgebrachten Stimmen in der Wohnung über ihr verstummt waren.
Um ein Uhr nachts lief die Polizeiarbeit bereits auf Hochtouren. Ein Krankenwagen stand vor dem blau-weißen Absperrband, zwei Sanitäter in Wartestellung.
Das Mädchen war tot, sie konnten nichts mehr tun.
Yrsa Helgadóttir, frisch von der Polizeischule, hatte nie zuvor eine Leiche gesehen. Sie bemühte sich nach Kräften zu assistieren und kam sich dennoch wie eine Zuschauerin vor, die alles wie auf einem Fernsehbildschirm verfolgte.
Schwarz trat neben sie. »Sieh genau hin und lerne.« Er zeigte auf die vier Kriminaltechniker in blauen Schutzoveralls. »Emilia« – er wies auf eine groß gewachsene Schwarze – »sieht aus wie eine NBA-Basketballspielerin, aber sie ist die beste Technikerin, mit der ich je zusammengearbeitet habe.«
»Du meinst die WNBA?«
»Was?«
»Die Frauenliga«, erklärte Yrsa. Insgeheim wusste sie, warum sie sich mit dem Kollegen diesen verbalen Schlagabtausch lieferte; sie hoffte, dass sich mittels spöttischen Bullenjargons der Kloß in ihrem Hals auflöste.
Die Techniker hatten die erste Aufgabe soeben beendet: einen zwei Meter breiten Korridor zum Opfer und seiner unmittelbaren Umgebung zu sichern, damit der Rechtsmediziner sich frei bewegen konnte, ohne den Fundort zu kontaminieren.
Der Rechtsmediziner, der sich bisher seiner Stulle und einer Thermoskanne Kaffee gewidmet hatte, stieg aus seinem Wagen.
»Das ist Ivo Andrié«, erklärte Schwarz. »Während Emilia Basketballerin ist, ist Andrié eher der Baseballtyp.«
Eigentlich passte seine Baseballkappe nicht zu der Schutzhaube und dem Mundschutz, doch an dem Rechtsmediziner wirkte die Kombination vollkommen selbstverständlich.
Schwarz gab grünes Licht für die erste Inaugenscheinnahme der Toten, Andrié schob sich die Stirnlampe über die Baseballkappe und schritt bedächtig auf die Leiche zu. In regelmäßigen Abständen hielt er inne und sah sich um. Als er unvermittelt den Arm ausstreckte und die Handfläche nach oben drehte, fragte sich Yrsa, was da vor sich ging. War das ein spezielles Handzeichen? Hatte er etwas gefunden?
Andric´ schob seinen Mundschutz nach unten. »Es hat aufgehört zu regnen.« Er lachte sie an.
Der Kloß in ihrem Hals lockerte sich ein bisschen.
Yrsa blickte empor in den stahlgrauen Himmel, blinzelte und träumte sich fort an einen Ort, an dem es warm war. Unkompliziert. Freigiebig.
Aber nun war sie eben hier, und hier war sie zu Hause.
Die Techniker arbeiteten sich in einem immer kleineren Radius zur Leiche vor. Eine eintönige Tätigkeit, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen würde – oder länger, sofern sie etwas von Interesse fänden. Emilia machte Fotos, und im Blitzlicht der Kamera waren die Kollegen zu sehen, die sich – ebenfalls mit Stirnlampen – durch die Dunkelheit bewegten.
»Fund«, rief einer, richtete sich auf und zeigte direkt vor sich zu Boden.
Ein winziger Abschnitt mit rund zehn Zentimeter hohem Gras in einem Felsspalt. Der Gegenstand wurde fotografiert und anschließend in einem Asservatenbeutel verstaut.
Selbst aus der Ferne hatte man erkennen können, worum es sich handelte: um ein Android-Handy. Emilia lief damit auf den Transporter der Kriminaltechniker zu.
Bis Viertel vor zwei hatte der Rechtsmediziner sich bis zu der Leiche vorgearbeitet. Unter dem kleinen Planenzelt studierte er sie zunächst eingehend, dann nahm er ein Diktiergerät zur Hand und sprach hinein. Wenige Minuten später gab er den Kollegen ein Zeichen, dass auch sie die Leiche inspizieren dürften.
Yrsa ging ein paar Schritte hinter Schwarz und den anderen beiden erfahreneren Polizeimeistern her und versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt hatte.
Nicht nach dem suchen, was man erwartete, sondern nach dem, was vom Erwartbaren abwich – was manchmal das Allernächstliegende sein konnte. Mitunter aber auch das Schwierigste.
Ein Mädchen ist hier gestorben.
Eine Tochter – vielleicht eine Schwester und Cousine – liegt dort kalt unter einem Zeltdach. Bislang ohne Erklärung.
Ein Mitmensch, eine Freundin und Klassenkameradin, deren Todesumstände bisher nur eine vage Hypothese vonseiten der Ermittler darstellen, die den Fall untersuchen. Das Mädchen, die Leiche, ja, das Opfer, ist bislang immer noch bloß eine Gleichung aus zahllosen Unbekannten.
Yrsa geht die letzten langsamen Schritte auf die Leiche zu. Lässt den Blick über das Mädchen schweifen.
Vermutlich vierzehn bis sechzehn Jahre alt. Leicht bekleidet mit einem ärmellosen roten Kleid, als wäre sie unterwegs zu oder auf dem Heimweg von einer Party gewesen. Im Hinblick auf das dünne Kleid eine Party in der Nachbarschaft.
Eine schlichte Kette hat sich in den dunklen Locken verheddert. Die Haut ist blass; doch das Mädchen ist ausländischer Herkunft. Vermutlich aus dem Nahen Osten.
Der rechte Unterarm ist unnatürlich verdreht, die linke Schulter sieht eingefallen aus; die nackten Arme und Beine sehen aus, als hätte das Mädchen sie sich allesamt ausgekugelt.
Wie bei einer Puppe – genau wie der Taxifahrer die Leiche beschrieben hat, nachdem er den Notruf gewählt hatte.
Ein Augenpaar mit leerem Blick.
Erstarrt in einer einzigen Schrecksekunde.
Der Mund halb offen, die Lippen bläulich, unter der Nase Reste von angetrocknetem Blut, das der Regen nicht weggespült hat.
Dann wäre die erste Leiche also überstanden, denkt Yrsa.
So schlimm war es nun auch wieder nicht.
Trotzdem weiß sie, dass sie das hier nie vergessen wird.
Schwarz geht vor der Leiche in die Hocke und wendet sich an Ivo Andric´: »Was denkst du spontan? Selbstmord? Oder müssen wir Hurtig informieren?«
Der Rechtsmediziner schüttelt den Kopf. »Ich würde damit noch warten.« Er blickt an der Hausfassade hoch. »Aber gut, bei der Lage der Leiche im Verhältnis zum Haus will ich einen Sprung nicht ausschließen – oder einen Sturz aus einem der oberen Stockwerke. Nicht angesichts dieser Verletzungen.«
Auch Schwarz betrachtet das Mietshaus. »Hätte das nicht jemand gesehen, wenn sie gefallen oder gesprungen wäre?«
Als sie hier eingetroffen sind, lag das Haus fast völlig im Dunkeln. Inzwischen ist gut die Hälfte der Fenster erleuchtet, und hier und da sind die Umrisse von Bewohnern erkennbar. Das Blaulicht hat sie nach draußen gelockt, und kurz nachdem die Absperrung gezogen wurde, sind die besonders Neugierigen, die auf die Balkone getreten sind, um zu gaffen, aufgefordert worden, wieder in ihre Wohnungen zurückzukehren.
Rechtsmediziner Andrié zuckt mit den Schultern. »Schwer zu sagen, was die Leute mitten in der Nacht hören und sehen. Aber es ist keiner rausgekommen, um mit euch zu reden, oder?«
»Nein«, antwortet Schwarz. »Aber wir können die Nachbarn auch aktiv befragen, sobald die Verstärkung da ist. Sie müsste jeden Moment eintreffen.«
Yrsa ahnt, dass die Aufgabe ihr zufallen wird, mit irgendeinem anderen Anfänger Klinken zu putzen, und sie wirft einen letzten Blick auf die Leiche.
Mit der Lage stimmt etwas nicht.
Als wäre sie dort auf dem Rücken zur allgemeinen Zurschaustellung abgelegt worden.
Ein Stück entfernt suchen ein paar Spatzen nach Krümeln, aber das meiste ist gefroren, und sie suchen vergebens. Yrsa ahnt, dass es ein langer Winter wird, auch für die Vögel.
Es ist fünf nach zwei, als ein weiterer Streifenwagen eintrifft, und noch während sie zurückgehen, um die Kollegen zu begrüßen, legt Schwarz ihr eine Hand auf die Schulter.
»Du wirkst ein bisschen nervös«, sagt er. »Aber du wirst sehen, es ist auch nicht schlimmer als irgendein Krimi.«
»Krimi? Was soll das heißen?«
»Na ja, alle guten Krimis fangen so an: dass jemand stirbt. Und am Ende klärt sich alles auf.«
»Vielleicht ist das hier kein guter Krimi.«
Eine dumme Bemerkung, die einen dummen Konter verdient, denkt sie, und das letzte Stück zum Parkplatz wechseln sie kein Wort mehr miteinander.
»Kommt mal her.«
Es ist Emilia, die Basketballerin. Sie sitzt im Transporter der Techniker auf dem Beifahrersitz, hat einen Laptop auf den Knien und den Beutel mit dem Android-Handy in der Hand. Ein Kabel verbindet das Telefon mit dem Rechner.
»Ich hab das Telefon geknackt«, sagt sie. »Aller Wahrscheinlichkeit nach gehört es dem Opfer. Das Mädchen hieß Tara und hat gern Selfies gemacht. Ihr letzter Kontakt war eine SMS vor vier Stunden.«
Jimmy Schwarz lehnt sich an die offene Autotür. »An wen?«
Emilia macht ein nachdenkliches Gesicht. »Sie hat den Kontakt unter ›Olof‹ gespeichert, aber die Nummer lässt sich nicht zurückverfolgen, jedenfalls nicht mit dieser Ausrüstung. Anscheinend hatten sie sich hier in der Nähe verabredet.«
»Interessant. Ein guter Anfang.«
»Da ist noch etwas«, fährt Emilia fort. »Tara schreibt diesem Olof – ich zitiere: ›Kennst du den Puppenspieler?‹ Olof beantwortet die Frage mit Nein. Habt ihr eine Ahnung, was das zu bedeuten hat?«
Polizeimeister Schwarz runzelt die Stirn. »Nein, aber es gibt da jemanden, der es vielleicht weiß.«
»Aha … und wen?«
»Er heißt Kevin Jonsson und arbeitet bei der Rikskrim.«
Sechsunddreißig Stunden ohne Schlaf
Tanto
Oben auf dem Tantoberget auf Södermalm gibt es eine Flugabwehrstellung, die im Zweiten Weltkrieg die Brücken Årstabron und Liljeholmsbron vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Nur einen Katzensprung von den alten Gefechtsständen entfernt erstreckt sich eine Schrebergartensiedlung terrassenförmig bis zum Ufer hinunter. Aus einem der Schrebergärten ist Granatfeuer zu hören.
Um halb drei Uhr nachts liegt Kevin Jonsson auf dem Sofa und guckt sich den alten Sowjet-Kriegsfilm Komm und sieh auf dem Rechner an.
Die Lebenden beneiden die Toten, denkt er.
Das kleine Grundstück am Tantoberget besteht im Wesentlichen aus kahlem Fels, der kultivierbare Boden ist auf einen Streifen fruchtbarer Erde entlang des Zauns begrenzt. Das Baurecht auf dem Grundstück – einem von einhundertelf Grundstücken am südlichen Berghang – wird maximal ausgenutzt: eine vierzehn Quadratmeter große rote Hütte in Blockhausbauweise, sechs Quadratmeter offene Veranda sowie ein Werkzeugschuppen, in dem sich auch das Plumpsklo befindet. Der kleine Schrebergarten ist seit den Siebzigern in Familienbesitz; er selbst wohnt hier seit vier Jahren, den Winter über unerlaubterweise – ein Verstoß gegen die Satzung, aber der Verein sieht mittlerweile darüber hinweg.
Seit sie erfahren haben, dass er Polizist ist.
Hier ist er aufgewachsen, hier hat er die Sommer aus der Årstaviken den Berg hochkriechen sehen, und hier hat er mit seinem Vater zusammen auf der Veranda gesessen und zugeschaut, wenn unten im Kleinboothafen die Segelboote zu Wasser gelassen wurden.
In der Blockhütte stehen ein Tisch mit zwei Stühlen, ein kleines Sofa und darüber ein Hochbett. Kochplatte und Kühlschrank werden mit Propangas betrieben, und Solarzellen versorgen den Rechner und die Lampen mit Strom. An den Wänden Regale voller Bücher und DVDs.
Wenn er sich einen Film ansieht, hat er oft Papier und Stift zur Hand, um die Patzer zu notieren, Fehler im Drehbuch oder Anachronismen, sogenannte Goofs.
Er macht das nicht nur zum Spaß, sondern um seine Beobachtungsgabe zu schärfen, das kommt ihm auch im Job zugute. Diesmal liegt das Blatt Papier auf dem Tisch und ist unbeschrieben, als die letzten Szenen von Komm und sieh über den Bildschirm flimmern.
Der Protagonist, der zu Beginn des Films ein kleiner Junge war, geht nun als alter Mann in den Tannenwald und schließt sich den Partisanen an.
Er wird vom Wald verschluckt.
Die Natur geht immer als Sieger hervor. Der Mensch kann nicht gewinnen.
Schon als er klein war, hat Kevin immer nach logischen Fehlern gesucht. Riss die Fantasiewelten der anderen Kinder ein, indem er anmerkte, dass Cowboys nie mit Maschinenpistolen geschossen oder Unterhosen von Kappahl getragen hätten.
Auch im Klassenzimmer konnte er den Mund nicht halten. Auf einem Poster an der Wand waren Wikinger abgebildet, und er konnte das Bild nicht ausstehen, weil es den Mythos bediente, dass ihre Helme gehörnt gewesen seien. Goof. Auf der Weltkarte hinter dem Lehrerpult sah Grönland genauso groß aus wie Afrika, und das entsprach mitnichten den Tatsachen. Goof.
Die Behauptungen der Lehrer, er habe ADHS oder wie das hieß, blieben unwidersprochen und verwandelten sich allmählich in Wahrheiten. Kevin Jonsson war immer derjenige, der störte und die meisten Verweise bekam.
Doch eine junge Lehrerin, die in der Fünften ein Halbjahr lang Vertretung machte, war anders als die anderen. Einmal bat sie ihn, nach der Stunde dazubleiben.
Er rechnete schon mit einer Zurechtweisung, aber sie holte bloß eine Kiste hervor, eine Schachtel, in der sie Radiergummis aufbewahrte. Sie fragte ihn, was er darin sehe, und er antwortete: fünfundzwanzig Radiergummis, genau wie es die Aufschrift besagte, woraufhin sie lächelte und den Deckel abnahm.
In der Schachtel lag eine kleine rote Perle.
»Die Schachtel ist die nach außen sichtbare Fassade«, sagte sie. »Sie ist die Rolle, die du nach außen hin in der Klasse spielst und die dir alle abkaufen, auch deine Lehrer. Vielleicht glaubst sogar du selbst an diese Rolle.« Sie nahm die Perle zwischen zwei Finger, hielt sie ins Licht und fuhr fort: »Aber du bist das hier. Der, der du wirklich bist. Ich stelle die Schachtel hier auf mein Pult, und die Perle wird das ganze Halbjahr lang darin liegen bleiben. Jedes Mal, wenn es nervig wird in der Klasse, denkst du von nun an daran, was nur wir beide wissen und sonst niemand.«
Kevin behielt das Geheimnis von der Perle in der Schachtel für sich. Von da an lief es für ihn in der Schule besser.
Bis die Weihnachtsferien bevorstanden und die Vertretungslehrerin bald aufhören würde, war es, als behandelten ihn die Mitschüler irgendwie anders; sie hörten ihm besser zu. Vielleicht weil er nicht mehr ganz so viel redete.
Als er nach den Weihnachtsferien wieder in die Schule kam, war die Schachtel mit der Perle weg.
Auf seinem Rechner hat er eine Excel-Tabelle namens GPM abgespeichert – Goofs pro Minute –, in die er seit Jahren die Filme mit den meisten Patzern einträgt: alles von Fehlern im Drehbuch bis hin zu Fehlern auf der Zeitebene. Die Tabelle hat ihm vor Augen geführt, wie oft der Schein trügt. Es sind nicht einmal die B-Movies, die an der Spitze stehen, sondern die teuren Produktionen, die mit Glaubwürdigkeitsanspruch. Auf Platz eins liegt Hitchcocks Vögel, gefolgt von Apocalypse Now, der zwar weitaus mehr Schnitzer enthält, allerdings macht er die durch seine Überlänge wett.
Kevin sucht sich einen anderen Film aus, der im Hintergrund laufen soll. Er wählt Werner Herzogs Herz aus Glas und kehrt wieder auf das Sofa zurück.
Er kann den Film in- und auswendig, jede Szene.
Er wickelt sich in die Wolldecke. Sechsunddreißig Stunden ohne Schlaf machen sich bemerkbar, und die Welt kommt ihm instabil vor. Doch sein Gehirn läuft immer noch auf Hochtouren, und er fragt sich, warum alle von grauen Zellen reden. Ein funktionstüchtiges Hirn ist rein physisch hellrosa. Erst wenn man tot ist, wird es grau.
Wenn sein Gehirn auf Hochtouren läuft, zucken grellrote Blitze aus Blut, eine Zentrifuge im Kopf, und jetzt gerade herrscht Krieg zwischen den Gedanken an Papa und den Gedanken an die Arbeit.
Polizistenpapa. Papa, der unsterblich war.
Papa, der gestorben ist.
Keine drei Wochen sind seitdem vergangen, und Kevin ist inzwischen klar geworden, dass Trauer nichts ist, was in einem drin wäre und womit man sich auseinandersetzen könnte. Sie geht neben einem her und führt ein Eigenleben. Sie kauert im Augenwinkel und tippt einem auf die Schulter, sowie man glaubt, man hätte sie vergessen.
Sie ist nicht greifbar, lauert im Dunkeln unter dem Bett oder versteckt sich im Schatten einer Tür.
Der Film vor ihm rieselt dahin. Wie die Trauer. Der Legende zufolge hat Herzog sein Schauspielerensemble hypnotisiert – mit dem Ergebnis, dass sie alle einer kollektiven Depression anheimfielen.
Manchmal fehlt ihm sein Vater so sehr, dass er in einen ähnlichen Zustand verfällt.
Er atmet schwer, vielleicht weint er, vielleicht sitzt er auch bloß da und starrt ins Leere. Wärmt sich Essen auf, sieht fern oder liest ein Buch. Ohne sich zu merken, was er gegessen, gesehen oder gelesen hat.
Wenn er sich vorstellt, dass sein Vater noch lebt, ist es leichter auszuhalten. Eine Erinnerung mag er besonders gern. Gefühle, Düfte, Gespräche, Zusammenhänge, und ihm fallen Papas Hände ein.
Papa hat mal gesagt, seine Hände erinnerten ihn daran, woher er kam. Eine Fischerfamilie aus Norrland, aus dem Surströmming-Belt an der Höga Kusten. Seine Hände waren aufgesprungen vom Salzwasser, von den Fischschuppen, von den scharfen Kiemen und Flossen, die Blutgefäße platzten, wenn es draußen kalt und trocken war. Wenn seine Hände bluteten, lutschte er sich die Fingerkuppen ab und sagte, er trinke das Blut seiner Vorfahren. Er behauptete, der Surströmming-Gestank an seinen Händen sei nie verschwunden, was natürlich nicht stimmte. Der Geruch von Essigsäure und Schwefelwasserstoff existierte nur in seinem Kopf, aber die Erinnerung daran war so stark, dass sie real wurde.
Kevin betrachtet seine Hände. An ihnen haftet das schlechte Gewissen, weil er in der Unterstufe mal einen Klassenkameraden geschlagen hat, die Scham, weil er als Vierzehnjähriger zu verbotenen Fantasien onanierte.
Und Schlimmeres.
Viel, viel Schlimmeres.
Der muffige Geruch eines Geheimnisses, das nur er und eine weitere Person kennen. Ein Bruder seiner Mutter, den er morgen treffen wird, bei Papas Beerdigung.
Der Grund, warum er Polizist geworden ist, ist ein säuerlicher Geruch, der an Snus erinnert.
Dass er gleich nach der Polizeischule bei der Rikskrim anfangen durfte, weil er ein guter Kriminaltechniker war und eine herausragende Examensarbeit darüber geschrieben hatte, wie man im Internet Pädophile aufspürt, ist nur die halbe Wahrheit. Er wäre nie dort gelandet, wenn nicht die Sache in dem Zelt auf Grinda passiert wäre. Da war er neun.
Achtzehn Jahre später sitzt er da und starrt auf seine Hände, auf den Schmutz, der immer daran haften wird, und er sieht, wie die Rechte sich zur Faust ballt und die Knöchel weiß werden, ehe sie sich wieder öffnet und nach einem roten Jo-Jo auf dem Tisch streckt.
Er beginnt, damit zu spielen, ein paarmal runter und wieder rauf, er lässt es im Leerlauf drehen, fünf Zentimeter über dem Boden, im Flimmerlicht des Films.
Wenn das Jo-Jo schnurrt, kann er besser denken.
Die bedrückende, vage Erinnerung an einen Onkel in einem Zelt auf einer Insel in Stockholms Schären wird von einer klareren, schöneren Erinnerung verdrängt – aus demselben Sommer vor achtzehn Jahren.
Es war Ende August, sein Vater steckte mitten in einer komplizierten Mordermittlung und arbeitete die Woche über in Linköping.
Der Tag, an dem er endlich nach Hause kommen sollte, war der längste überhaupt in Kevins neunjährigem Leben gewesen. Am Abend fuhren seine Mutter und er dann mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Sie waren zu früh dran, und als der Zug schließlich am Bahnsteig zum Stehen kam, hielt er in den Zugfenstern fieberhaft Ausschau nach dem Gesicht seines Vaters. Zu guter Letzt sah er ihn aus dem Speisewagen winken.
Kevin lief neben dem Zug her, der nicht halten zu wollen schien, und es dauerte eine Ewigkeit, bis es so weit war und sein Vater endlich ausstieg. Er warf sich in dessen Arme, bohrte die Nase in dessen Hemd, das nach Zigarillos und nach Rasierwasser roch.
»Hej, Großer«, sagte Kevins Vater und drückte den Sohn fest an sich, strich ihm übers Haar und küsste ihn auf die Stirn. »Ich hab dir was mitgebracht.« Dann nahm er ein kleines Päckchen aus der Tasche. Seine Mutter trat hinzu und begrüßte ihn ebenfalls.
Kevin packte das Geschenk aus. Er hatte sein erstes Jo-Jo bekommen. Später am Abend zeigte sein Vater ihm ein paar Tricks, und Kevin legte das Jo-Jo vor dem Einschlafen neben sich aufs Kopfkissen. Am nächsten Morgen nahm er es mit in die Schule – und war damit der Star des ganzen Schulhofs. Er war der Erste im Viertel, der ein Jo-Jo besaß, und für eine kurze Zeit enorm beliebt.
Was sich wenig später ändern sollte, denkt Kevin, vertreibt den Gedanken allerdings sofort wieder. Er lässt das Jo-Jo auf und nieder schnellen. Er weiß noch genau, wie sein Vater erzählt hat, es sei aus småländischem Holz hergestellt, mit einem Baumwollfaden aus Amerika.
Man kann die Fasern der Schnur regelrecht spüren, wenn sie sich um den Steg wickelt. Das Kribbeln im Zeigefinger, die warme Vibration, die ihn an Baumwollfelder unter der Sonne der Südstaaten erinnert, und dann das kühle schwedische Holz in der Handfläche, von harten Wintern im småländischen Hügelland gegerbt.
Papa sah aus wie Clint Eastwood, der gleiche steinharte Blick, das gleiche markante Gesicht, der Gute aus Zwei glorreiche Halunken.
»Gedrechselt aus einem Stück Holz«, sagte er damals. »Ich hab es von einem Landstreicher bekommen, als ich neun war, genauso alt wie du jetzt.«
Kevins Vater hatte schon mal von dem hässlichen Mann erzählt, von dem alten Mann, der Vogelscheuche genannt worden war und den die Bauern dafür bezahlten, dass er sich in seinen verschlissenen Kleidern auf die Felder stellte und die Vögel vertrieb. Kevin ahnte natürlich, dass ein bisschen Flunkerei dabei war, aber das war ihm einerlei, es machte die Geschichte nur umso spannender.
Die Vogelscheuche arbeitete jedes Jahr von April bis September und wohnte im Schweinestall, deswegen sah sie auch so zerlumpt aus. Groß, mit einem dunklen Bart, der vor Dreck in alle Richtungen abstand. Er hatte eine braune runzlige Warze auf der Wange, die aussah, als würde sie jeden Moment abfallen. Vor der Vogelscheuche hatten die Kinder Angst.
Schon damals war Kevin klar, dass sein Vater nicht alles erfunden hatte; zwischen all den Worten war immer auch ein Körnchen Wahrheit gewesen. Ein dunkler Fleck.
Den dunklen Fleck wollte Papa mit einem Lachen reinwaschen.
Er erzählte, dass Ende der Vierziger die Sommer immer warm gewesen seien, dass die Sonne immer geschienen und das Wasser im Ångermanälven eine konstante Temperatur von zweiundzwanzig Grad gehabt habe. Papa hatte immer im Fluss gebadet, an einer Stelle, an der man an einem Seil schwingen und ins Wasser springen konnte, und Kevin sieht den sprudelnden Fluss regelrecht vor sich. Alles in Schwarz-Weiß, wie in Papas altem Fotoalbum.
An einem Tag hatte Papa mehrere Stunden lang im Fluss gebadet, und als er sich gerade abtrocknen und nach Hause gehen wollte, sah er, dass die Vogelscheuche wenige Meter hinter dem Baum, an dem das Seil befestigt war, in einer Senke saß.
»Der Alte grinste sein zahnloses Grinsen«, erzählte Papa. »Bleckte das rote Zahnfleisch, und dann hat er sich einen riesigen Priem Tabak unter die Lippe geschoben. Er hatte die ganze Zeit lang dagesessen. Meinte, er wollte mir ein Geschenk geben, weil ich so gut springen konnte. Dann gab er mir dieses Jo-Jo. Damals war es noch zinnoberrot, kein bisschen abgeblättert oder verblichen.«
Kevin lässt das Jo-Jo durch die Finger gleiten, betrachtet es ganz genau, wie so viele Male zuvor.
Jede Schramme, jedes abgeblätterte Plättchen Farbe hat eine Geschichte.
Er riecht daran. Ein dumpfer Holzduft und noch etwas anderes.
Vielleicht der Schweiß des Landstreichers, der noch im Holz sitzt.
»Was ist dann passiert?«, fragte Kevin, und Papa sah geistesabwesend aus, als hätte er ihn nicht gehört.
»Nichts weiter«, sagte er schließlich. »Ich hab das Jo-Jo genommen und bin mit dem Fahrrad nach Hause. Die Vogelscheuche ist noch im selben Winter erfroren, sie wurde unter einer Brücke gefunden. Die Haare waren am Boden festgefroren, sie mussten sie lossägen.«
Heute weiß Kevin, dass die Vogelscheuche in Wahrheit Gustav Fogelberg hieß. Ein Eigenbrötler, der sich an kleinen Jungen vergriff und dafür irgendwann weggesperrt wurde. Das rote Jo-Jo war eine Art Lockmittel gewesen. Papa hatte sich damit von einer Missbrauchserfahrung abgelenkt. Das Jo-Jo wurde zu einer tragenden Säule seiner Lebenslüge. Er hätte nie zugegeben, dass er zum Opfer geworden war.
Papa hatte den Landstreicher. Den hässlichen.
Und Kevin hat einen Onkel.
Das reicht jetzt langsam
Bergshamra
Die Familie wohnt in einer Wohnung zwei Querstraßen vom Leichenfundort entfernt.
Die Mutter führt Polizeimeister Schwarz in das Zimmer des Mädchens.
Gegenüber vom Bett steht ein Rokokoschreibtisch mit einem Häkeldeckchen. Der Bettüberwurf und die Kissen sind aus geblümtem Siebzigerjahre-Stoff. An den Wänden hängen verblichene Fotos des schwedischen Königspaars und eine Stickerei mit dem Schriftzug BETRAUERE NICHT, WAS DIR FEHLT, SONDERN SCHÄTZE, WAS DU HAST.
Schwarz’ erstem Eindruck zufolge sieht dieses Zimmer nicht wie ein gewöhnliches Jugendzimmer aus.
»Der Brief liegt auf dem Nachttisch«, sagt die Mutter des Mädchens. »Wir haben ihn gelesen, aber ihn wieder genau so zurückgelegt, wie wir ihn vorgefunden haben …« Ihr versagt die Stimme, und sie schlägt die Hände vors Gesicht.
Die Mutter ist jung. Sie muss minderjährig gewesen sein, als sie die Tochter bekommen hat, denkt Schwarz und seufzt im Stillen. Verflucht noch mal.
Sie bleibt auf der Schwelle stehen, während er zum Nachttisch geht.
Der Brief besteht aus drei handgeschriebenen Zeilen, und Schwarz liest sie gleich zwei Mal. Durch die dünne Wand hinter dem Bett dringen das Weinen eines Kindes und eine Männerstimme. Taras jüngere Schwester, die vom Vater getröstet wird.
An Papa, Mama und die süße Chinar.
Verzeiht mir, dass ich gesündigt habe. Ich verdiene es nicht, länger zu leben.
Ich will springen. Wir sehen uns im Himmel. Ich liebe euch.
Das Blatt ist liniert, Tara hat ihren Namen daruntergesetzt, und Schwarz’ Blick verharrt an den beiden As in Tara, die sie durch Herzchen ersetzt hat.
»Und Sie dachten, Tara hätte in ihrem Bett gelegen und geschlafen, als wir angerufen haben?«, fragt Schwarz.
Die Mutter wischt sich eine Träne von der Wange. »Ja.«
»War sie irgendwie verändert oder deprimiert in letzter Zeit?«
»Ich weiß es nicht.«
»Kontakte mit dem Psychiatrischen Dienst?«
»Psychiatrischer Dienst? Wie meinen Sie das?«
Die Frau steht noch immer in der Zimmertür, etwa drei Meter von Schwarz entfernt. Er findet das irgendwie komisch.
»Also nein?«
»Nein … Warum sollte sie?«
Er antwortet nicht. Zeigt nur auf den Brief auf dem Nachttisch.
»Nein«, wiederholt die Mutter nach einer lähmenden Pause.
»Wissen Sie, was Tara damit gemeint haben könnte – sie habe gesündigt?«
»Ich … Ich habe keine Ahnung. Nein, das weiß ich nicht.«
»Sind Sie sich sicher?«
Sie nickt.
»Hatte Tara einen Freund?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Kannte sie jemanden, der da wohnt, wo wir sie gefunden haben? In dem grauen fünfstöckigen Haus, meine ich.«
»Nein … Das glaube ich nicht. Soweit ich weiß, nicht.«
»Kannte sie einen Olof?«
Die Frage scheint sie zu überrumpeln. »Wer ist Olof?«
»Das wissen wir noch nicht. Sie hatten SMS-Kontakt vor …« Schwarz sieht auf die Uhr. Es ist kurz vor vier. »Vor knapp sechs Stunden, um kurz nach zehn.«
»Da war sie zu Hause«, entgegnet Taras Mutter. »Wir haben noch Nachrichten im Fernsehen gesehen.« Ihre Augen füllen sich wieder mit Tränen, und sie führt die Hand an den Mund.
»Und danach ist sie noch mal weg?«
Die Mutter beißt sich auf die Lippe, während eine Träne die Wange hinabrinnt und im Mundwinkel hängen bleibt. »Nein, sie ist nicht mehr weggegangen … Sie hat sich hingelegt.«
»Gut.«
Polizeimeister Jimmy Schwarz überlegt kurz, ob er fragen soll, ob die Mutter weiß, wen Tara mit dem Puppenspieler gemeint haben könnte, nach dem sie Olof gefragt hat, entscheidet sich aber dagegen.
Das hat noch Zeit.
Er hat zu wenig in der Hand und muss erst Kevin anrufen. Oder Lasse Mikkelsen, Kevins Chef bei der Rikskrim.
»Hatte Tara einen Computer, ein iPad oder Ähnliches?«, fragt er stattdessen.
Die Mutter schüttelt wieder den Kopf. »Das können wir uns nicht leisten«, sagt sie leise, dreht sich weg und nickt dann jemandem in der Diele zu.
Taras Vater betritt das Zimmer. Er trägt einen Pyjama. »Das reicht jetzt langsam«, sagt er und sieht erst Schwarz und dann seine Frau an. »Chinar braucht uns jetzt.«
»Natürlich«, erwidert Schwarz. »In einer halben Stunde kommt der Seelsorger.«
Der Mann nickt. Er sieht mindestens zehn Jahre älter aus als die Frau. Oder aber die Trauer hat bereits Spuren hinterlassen. Im kalten Schein der Flurlampe sind die Schatten unter seinen Augen pechschwarz.
Als Schwarz das Haus wieder verlassen hat, nimmt er sein Handy zur Hand, um Ivo Andrié anzurufen.
»Hej«, meldet sich der Rechtsmediziner. »Ich wollte dich auch gerade anrufen.«
»Sollen wir das Mädchen Hurtig übergeben?«, will Schwarz wissen.
Hurtig ist stellvertretender Kommissar und leitet die Ermittlungen in einer Selbstmordserie, die seit Kurzem die Polizei beschäftigt und im Präsidium Tagesthema ist.
»Nein«, sagt Andrié. »Und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist mir gleich vor Ort ins Auge gesprungen.«
Der Rechtsmediziner verstummt, und Schwarz wartet vergebens auf eine Fortsetzung.
»Was ist dir vor Ort ins Auge gesprungen?«, hakt er nach, weil ihm wieder eingefallen ist, dass Andrié gern ein bisschen umständlich ist.
»Sämtliche jugendlichen Opfer, mit denen sich Hurtig aktuell beschäftigt, haben Musik gehört, als sie sich das Leben genommen haben«, erklärt der Rechtsmediziner. »Musik von einer Kassette. Auf einem Walkman. Das war bislang immer der Modus Operandi – wenn man das bei einem Selbstmord so sagen kann. Tara passt da nicht rein.«
»Okay, ist gut. Dann können wir das also streichen, oder?«
»Ja, vor allem im Hinblick auf den zweiten Grund.«
Eine andere Marotte von Andrié ist, sich die wichtigste Information bis zum Schluss aufzuheben. Er holt tief Luft.
»Wenn das Mädchen Selbstmord begangen hat, dann hat das andere Gründe«, fährt er fort. »Sie stand vermutlich unter enormem Druck. Die Techniker haben auf ihrem Handy Daten gefunden, die darauf hindeuten.«
»Was meinst du damit?«
»Das solltest du dir mit eigenen Augen ansehen«, sagt er kryptisch, und damit ist das Gespräch für ihn beendet.
Dort verheizt man Kinder
Tanto
Ein Jo-Jo hat keinen Anfang und kein Ende, pflegte sein Vater zu sagen. Es ist wie eine Uhr. Es dreht sich und dreht sich immer weiter wie die Zeit. Ohne Anfang und ohne Ende. Unendlich.
Manche Dinge sind erblich, denkt Kevin, wickelt die Schnur auf und legt das Jo-Jo auf den Tisch. Der Film stört ihn inzwischen. Irgendwas ist damit, was ihn provoziert. Vielleicht liegt es an der schönen Musik. Mit einem Mal kommt ihm all das irgendwie total verkehrt vor, und er schaltet ihn aus.
Es ist vier Uhr morgens, in ein paar Stunden findet die Beisetzung statt. Anderthalb Tage ohne Schlaf. Kevin nimmt sich die Decke und legt sich aufs Sofa.
Er friert vor Müdigkeit.
In einer Ritze zwischen zwei Bodendielen krabbeln Käfer und Holzameisen. Flechten haben sich Teile der Veranda einverleibt, und im Geräteschuppen herrscht Chaos. Papa hätte sich darum gekümmert, denkt er. Er wäre enttäuscht von mir. Er hat sich immer um den Schrebergarten gekümmert und um alles andere. Gründlich und zuverlässig. Um alles – außer um seinen Tod.
Letzten Sommer fing es an, Papa beklagte sich, er könne beim Autofahren kaum noch die Straße erkennen. Der Sehtest ergab jedoch nur eine unbedeutende Verschlechterung. Bald darauf hatte er Probleme mit dem Gleichgewicht, als tänzelte er unfreiwillig, anstatt normal zu gehen.
Kevin hört ein leises Pfeifen. Der Wind weht von der Bucht herauf und fährt durch die Ritzen in der Hüttenwand. Eine klamme Kühle, die bis unter die Decke kriecht. Ihn fröstelt, und er wird wieder daran erinnert, was später geschah.
Die Aphasie – eine Art Sprachstörung. Am Frühstückstisch bat sein Vater um den Vergaserdeckel, meinte aber die Milchtüte. Ihm selbst war vollkommen klar, was er wollte, es kam bloß etwas anderes aus seinem Mund, und nun galt es, die richtige Übersetzung zu finden. Wenn man wusste, dass »Helm« »Fernseher« bedeutete und »Bereitschaft« »Nachrichten«, dann war klar, was er meinte, wenn er sagte, er wolle die Bereitschaft im Helm sehen.
Dann kamen der Schüttelfrost und das Zittern.
Kevins Eltern, die immer das Bett geteilt hatten, mussten wegen der Konvulsionen in getrennte Schlafzimmer ziehen. Seine Sprache glich zusehends einem Kauderwelsch, bis nichts mehr einen Sinn ergab. Es gipfelte darin, dass er sich im Vorjahreswinter im Morgenmantel auf die Verandatreppe setzte und mit einem Löffel Butter direkt vom Papier aß.
Während sich der Zustand des Vaters immer mehr verschlechterte, wurde auch der Allgemeinzustand der Mutter bedenklicher – als wäre sein Zustand auf sie übergesprungen. Nach Monaten realitätsferner Unterhaltungen und Vorkommnisse und durch ihr nachlassendes Gehör entrückte sie zunehmend der Wirklichkeit, und ihre Persönlichkeit veränderte sich.
Ungefähr zum selben Zeitpunkt, als Kevins Vater in ein Pflegeheim in Kallhäll kam, zog seine Mutter in ein Heim für Demenzkranke in Farsta. Nachdem sie fünfzig Jahre lang Tisch und Bett miteinander geteilt hatten, lagen nun gute vierzig Kilometer zwischen den beiden. So war Altenpflege, wenn man Pech hatte.
Sein Vater schlief schließlich friedlich ein – in seinem Bett im Pflegeheim. Das Personal stellte in den frühen Morgenstunden fest, was geschehen sein musste, rief ihn aber erst im Lauf des Vormittags an. »Es war ja mitten in der Nacht, und wir sind angehalten, die Angehörigen nicht unnötig zu belästigen«, sagte die junge Pflegerin, als Kevin sich erkundigte, warum sie nicht sofort Bescheid gesagt hätten.
Unnötig belästigen?
Wie kann der Tod so alltäglich sein, dass die Mitarbeiter dort ihn auf ein Störmoment reduzieren?
Kevin schließt die Augen, und alles dreht sich. Er sieht eine Beerdigung auf dem Waldfriedhof vor sich und lauter Leute, die er nicht treffen will.
Mit einer Ausnahme.
Zwischen den alten Frauen und Männern in Grau sieht er Vera vor sich, mit dem rot gefärbten Haar, Papas alte Kollegin von der Polizei und die Einzige, die ihn trösten kann. Nicht mal seine Mutter könnte das, aber die ist ohnehin nicht da, weil sie zu krank ist.
Sein älterer Bruder kommt auch. Sofern er es tatsächlich wahr macht. Er wohnt im Ausland und ist ein Idiot. Welchen Job er zurzeit hat, weiß Kevin nicht.
Vera wird fragen, wie es im Job läuft, ob es besser geht, seit er die neue Stelle hat, und er wird antworten, dass es viel besser geht und zugleich schlechter, weil er jetzt viel näher an dem ganzen Mist dran ist.
Im Zusammenhang mit seiner neuen Stelle ist er dienstlich nach Neu-Delhi geschickt worden. Die Chefs der Rikspolisen hielten es für eine gute Idee, ihn ins kalte Wasser springen zu lassen, damit er sich ein Bild davon machen konnte, worum es bei der ganzen Sache ging. Zwei Wochen lang erlebte er an der GB Road die Hölle und sah Dinge, über die er mit niemandem reden kann.
Dinge, die seine mentale Gesundheit beeinträchtigen.
Die ihm so gut wie jede Nacht Albträume bescheren.
Die Rikspolisen legte ihm nahe, zu einem Psychologen zu gehen. Doch nach der ersten Sitzung lehnte der Psychologe weitere Termine ab, und seither hat Kevin sich selbst therapiert, mit Alkohol und phasenweise mit Marihuana.
Weder das eine noch das andere hilft.
Aber wenn man die Bordelle an der GB Road besucht, dann ist man auch selber schuld.
Die GB Road ist das, was dem Fegefeuer am nächsten kommt. Dort lässt man buchstäblich Kinder durchs Feuer gehen.
Ja, dort verheizt man Kinder.
Kevin hat Fotos von Kindern gesehen, denen nicht mal der Nabel zugeheilt war.
Vera wird er erzählen, dass sie nach zwei jungen Mädchen suchen, die er zu einem Fall von Cybergrooming und Kinderpornografie vernehmen will. Sofern sie die Mädchen ausfindig machen, besteht zumindest die Möglichkeit, dass auch ein Schuldiger gefunden wird, der wegen Vergewaltigung Minderjähriger verurteilt werden kann.
Ein knappes Dutzend Fotos befindet sich auf seinem Dienstrechner in der Laptoptasche neben dem Sofa, zusammen mit einem Memo von einem der Rikskrim-Chefs.
Er schlägt die Augen wieder auf. Schlafen kann er sowieso nicht mehr und streckt sich nach der Tasche.
Bei den Fotos handelt es sich um Nahaufnahmen der Gesichter zweier Mädchen, beide circa fünfzehn, sechzehn Jahre alt. Die eine ist schwarz, hat ein schmales Gesicht und lange, glatte, silbern gefärbte Haare, vermutlich eine Perücke, während die andere blond und etwas rundlicher ist. Die Fotos sind vergrößerte Standbilder aus einem Pornofilm, die nur die Gesichter zeigen, ihre Körper sind nicht zu sehen.
Er nimmt das Memo zur Hand, eine Zusammenfassung des bisherigen Stands der Ermittlung, die im großen Ganzen darauf abzielt, die beiden Mädchen zu finden. Es wird allerdings auch erwähnt, dass es bislang keine Spuren gibt, nur dass die zwei sich in den Filmen Nova Horny und Blackie Lawless nennen.
Er hofft, dass sie jetzt glücklich ist
Graue Melancholie
Sven-Olof Pontén schlief unruhig in der Nacht, als Tara starb, träumte schlecht von seiner Kindheit in Jämtland. Der Schlaf verzerrte die sonst so schönen Erinnerungen an sein Heranwachsen in Vitvattnet zu Horrorszenarien. Seine erste Jagd, er war fünf und durfte seinen Vater und die anderen auf die Elchjagd begleiten; während der wachen Stunden am Tag eine helle Erinnerung, die nach Kiefernwald und warmem Kakao duftete. Doch in seinen Träumen sah er die Eingeweide der Tiere, die in der kalten Herbstluft heiß dampfend über das Blaubeerreisig quollen. Und die toten Augen, die ihn anstarrten.
Sven-Olof wachte früh auf, seine Frau schlief noch, als er in seinen Morgenmantel schlüpfte und in die Küche ging, um sich ein Ei zu kochen.
Er musste an Alice denken. Das Haus war leer ohne sie.
Was war da bloß schiefgegangen? Er hatte doch alles getan, was er konnte.
Es musste an der verfluchten Sexualität liegen.
An dieser Urkraft. Die hatte seine Tochter von ihm geerbt, allerdings war sie bei Alice noch früher ausgebrochen als bei ihm.
Sven-Olof Pontén mag lieber weich gekochte Eier. Drei Minuten in kochendem Wasser, dann lässt er kaltes Wasser über das Ei laufen, pellt es vorsichtig über der Spüle und setzt sich an den Küchentisch.
Sie hieß Saga und ging in die Siebte, er in die Achte. Obwohl sie beide aus frommen Elternhäusern stammten, wurden sie von der coolen Clique in der Schule akzeptiert, auch wenn sie in der Hackordnung ganz weit unten standen. Aber zumindest gehörten sie nicht zu den Zurückgebliebenen.
Zu den Außenseitern. Den anderen.
Er schnippt ein paar unsichtbare Krümel vom Tisch, stellt das Wasserglas links vor sich hin, den Eierbecher in die Mitte und die Schale mit dem Salz nach rechts, ehe er eine Prise Salz zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt und auf das Ei rieseln lässt.
Jemand fragte, in wen er verliebt sei, und weil sein mickriges Selbstvertrauen es nicht zuließ, dass er von den beliebtesten Mädchen träumte, sagte er Saga. Wie sich herausstellte, hatte sie seinen Namen genannt; ihm war klar, dass ihr Beweggrund der gleiche gewesen war wie seiner. So etwas brauchte man also nicht unnötig aufzubauschen.
Der erste Löffel mit Ei besteht nur aus Eiweiß. Es schmeckt leicht fischig, und er spült es mit einem Schluck Wasser hinunter.
Sie sind sich auf einer Party begegnet. Zuerst zögerlich, bis sie den jeweils anderen zu guter Letzt an Lipgloss, Speichel und Körperteilen teilhaben ließen, die bislang verbotenes Terrain gewesen waren.
Er rief sie ein paar Tage später an und stammelte, sie könnten sich ja mal treffen und ins Kino gehen, sofern sie sich überhaupt an ihn erinnerte. Sie schwieg erst, dann lachte sie und erklärte, dass er bestimmt ihre kleine Schwester Saga sprechen wolle.
Sven-Olof schmunzelt bei der Erinnerung. Eigelb schmeckt besser als Eiweiß. Der Farbton gleicht dem von Butter.
Er suchte den Film aus, Wenn der Postmann zweimal klingelt mit Jessica Lange und Jack Nicholson. In der langen Anfangsszene haben die beiden heißen Sex auf dem Küchentisch. Sie saßen wie versteinert in ihren Kinosesseln, und er schämte sich wie ein Hund. Als der Abspann kam, gähnte er, reckte sich und legte ihr wie beiläufig den Arm um die Schultern. Im nächsten Moment ging das Licht an, der Zauber war verflogen, und er zog eilig seinen Parka zu, um seine Erektion zu verbergen.
Sie fuhren mit dem Bus nach Hause, und aufgrund irgendeines Missverständnisses blieb es dabei.
Sven-Olof Pontén tupft sich die Mundwinkel mit einer Serviette ab, und ein Eigelbfaden bleibt an dem Papier haften. Er faltet die Serviette zusammen und denkt an Saga.
Daran, was sie auf dem Fest gemacht haben, bei dem sie sich kennengelernt hatten. Auf der Toilette.
Unter dem Morgenmantel erwacht sein Körper zum Leben, er lockert den Gürtel und schiebt den Frotteestoff zur Seite. Sieht Sagas Gesicht da unten. Sie mit dreizehn oder vierzehn, er ein Jahr älter.
Sie hat ihn geküsst. Nur ein einziges Mal, ein flüchtiger Kuss auf die Haut, dann wurde sie rot, stand auf und küsste ihn auf den Mund. Presste ihren Körper an seinen.
Ein paar Jahre später haben sie sich in einer Kneipe getroffen, über den Kinoabend gesprochen und beide gesagt, dass sie da wohl irgendwie was versäumt hätten. Darüber, was auf der Toilette passiert war, redeten sie nicht, aber er ist sich sicher, dass sie ebenfalls daran gedacht hat. Er hat es ihr angesehen.
Gemeinsam machten sie sich auf den Heimweg und wurden aus einem Auto heraus von ein paar Jugendlichen angepöbelt, denen seine Nase nicht passte. Er landete in der Notaufnahme, und wenn er sich nicht irrt, fuhr sie mit dem Taxi nach Hause.
Was aus ihr geworden ist, weiß er nicht, aber er hofft, dass sie jetzt glücklich ist.
Sven-Olof macht den Morgenmantel wieder zu, isst sein Ei auf und trinkt das Wasserglas leer. Als er ins Bad geht, um sich zu rasieren und die Zähne zu putzen, hat seine Erektion nachgelassen.
Er schaltet die elektrische Zahnbürste an und hofft, Åsa nicht zu wecken, denn er will noch eine Weile in Ruhe weiterdenken.
Er hatte Saga, aber mit wem hat Alice ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht?
Er hat keine Ahnung.
Vermutlich sind das Dinge, die in diesem Wohnheim in Skutskär besprochen werden.
Seine Tochter redet mit Fremden über Sex. Mit dem Leiter, diesem Martinsson. Diesem verständnisvollen, sanften, femininen Love Martinsson, der Alice zuhört, wenn sie ihm erzählt, was sie besser ihrem Vater erzählen sollte.
Ihm, der sie über alles liebt.
Er spuckt den Zahnpastaschaum aus, gurgelt mit Fluor-Mundwasser und macht den Badezimmerschrank auf. Rasierer, Rasierpinsel, Rasierseife und Aftershave.
Und dann diese beiden Verrückten, Nova und Mercy, was erzählt Alice denen?
Als er die letzten Male mit ihr gesprochen hat, hat sie von den beiden erzählt. Von Mercy aus Nigeria, die so stark und faszinierend sei. Und Nova, die so hübsch sei.
Was sind das für Vorbilder?, denkt er, während er Rasierschaum mit dem Pinsel aufträgt.
Er hat die Anzeigen der Mädchen im Netz gesehen. Pls call Nova und Mercy Hot Chocolate – 18. Hat sogar überlegt, darauf zu antworten. Huren und Junkies sind das, sonst nichts.
Mit seiner Rebellion gegen Familie und Kirche hat er im Sommer nach Saga begonnen. Vier, fünf oder sechs Jungs waren sie. Kleber, Plastikbeutel und ein Versteck unter einer Brücke.
Seine einzige Erfahrung, die zumindest entfernt etwas mit Drogen zu tun hat, war damals der Kleber, alles, was nötig war, um sich selbst zu finden.
Er hat erlebt, wie sich die Träume im Rausch verändern, der nur ein paar Minuten andauert, sich aber wie mehrere Tage anfühlt. Redensarten und Sprichwörter werden verständlich, das Déjà-vu geht einem in Fleisch und Blut über, aber der Körper muss auch richtig einstecken. Die Psyche ebenfalls.
Kleber schnüffeln und unter einer Brücke im Schlamm herumkriechen, denkt er und setzt den Rasierer an. Selbst wenn man sechzehn ist, hält man das nur einen Sommer lang aus. Wenn man zwölf ist, vielleicht zwei.
Sven-Olof Pontén rasiert sich, und der Duft des Aftershaves versetzt ihn erneut um dreißig Jahre zurück in jenen Sommer unter der Brücke in Jämtland. Es riecht ein bisschen so wie der Kleber.
Er zwickt sich ein paar Nasenhaare weg, stutzt die Augenbrauen und betrachtet sich im Spiegel. Ja, er ist leicht übergewichtig. Aber er sieht gar nicht so übel aus. Als Tara erfahren hat, wie alt er ist, hat sie gesagt, dass er jünger als fünfundvierzig aussehe.
Tara, die ebenfalls gegen einen Gott rebelliert hat.
Er selbst hat als Erwachsener wieder zur Kirche zurückgefunden.
Er hängt den Morgenmantel auf, stellt sich unter die Dusche und dreht das Wasser auf.