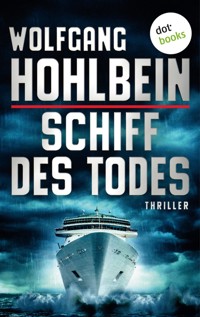
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es sollte eine Traumreise sein – und wird der schlimmste Alptraum: Der Thriller »Schiff des Todes« von Wolfgang Hohlbein als eBook bei dotbooks. Fast 2000 Passagiere betreten die »MS Ocean Queen« in Erwartung einer wundervollen Kreuzfahrt – und niemand ahnt etwas von dem namenlosen Grauen, das sie auf hoher See erwarten wird. Unter den Reisenden ist auch der Journalist Claus Mannheim, der ein Gerücht über einen blinden Passagiert aufschnappt. Sofort ist sein Reporterinstinkt geweckt und er beginnt, sich tief in den Katakomben des gigantischen Kreuzfahrtschiffes an die Spur des Unbekannten zu heften. Doch was er dabei über die Vergangenheit des Schiffes herausfindet, hätte sich Mannheim in seinen wildesten Alpträumen nicht ausmalen können: Es scheint, als wären die Geister der Vergangenheit zurückgekehrt, um sich an den ahnungslosen Lebenden zu rächen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Thriller »Schiff des Todes« vom Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein – ein Muss für alle Fans von Ruth Wares »Woman in Cabin 10« und Sebastian Fitzeks »Passagier 23«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Du bist gefangen. Du bist wehrlos. Du kannst nicht entkommen!
Blauer Himmel, weiße Wolken und der prachtvolle Blick auf endlose Wellen: Die Passagiere der MS OCEAN QUEEN freuen sich auf einen unvergesslichen Urlaub. Niemand von ihnen ahnt, dass es zwei Mitreisende gibt, die mit geheimen Plänen an Bord gekommen sind. Dass sich in den Tiefen des Schiffes ein blinder Passagier versteckt hält. Und dass die MS OCEAN QUEEN selbst ein dunkles Geheimnis hat …
Über den Autor:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch MÄRCHENMORD. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 44 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX.
Der Autor im Internet: www.hohlbein.de
Bei dotbooks veröffentlichte Wolfgang Hohlbein bereits die ELEMENTIS-Trilogie mit den Einzelbänden FLUT, FEUER und STURM sowie die Romane DAS NETZ und IM NETZ DER SPINNEN.
***
Neuausgabe Oktober 2015
Dieses Buch erschien bereits 1988 unter dem Titel Kreuzfahrt bei Bastei-Lübbe.
Copyright © der Originalausgabe 1988 by Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co., Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Tanja Winkler, Weichs
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-343-9
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Fluch an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Wolfgang Hohlbein
FLUCH – Schiff des Grauens
Mystery-Thriller
dotbooks.
Prolog
Es war dunkel hier unten. Dunkel wie in einem Grab, dachte der Mann schaudernd, schwarz wie im Bauch eines untergegangenen Schiffes in zehntausend Meter Tiefe auf dem Meeresboden. Der richtige Schauplatz für eine Gruselgeschichte, dachte er.
Trotzdem war er froh, an diesem Ort zu sein. Die Luft roch nach Moder und Rost, und von den Stahlträgern unter der Decke tropfte Wasser, das sich in kleinen, ölig schimmernden Pfützen am Boden sammelte, ehe es sich zu einem kleinen Rinnsal vereinigte und in einer Ecke zusammenfloß.
Das Dröhnen der Maschinen war verstummt, aber die Wände vibrierten noch immer im schwachen Rhythmus der kleineren Aggregate, die das Schiff auch jetzt noch am Leben hielten und seine technischen Einrichtungen mit Energie versorgten. Im Schiffsbauch, unterhalb des Maschinenraums, hatte man weniger den Eindruck, sich in einem Schiff zu befinden, sondern vielmehr im Inneren eines pulsierenden Lebewesens, eines Wesens, das atmete, fühlte – und auf eine geheimnisvolle, furchteinflößende Weise vielleicht sogar dachte.
Manchmal jedenfalls hatte er das Gefühl, angestarrt zu werden. Dabei war er allein. Ein bißchen zu allein.
Der Mann sah nervös zu der schmalen Tür. Sie war von außen verschlossen. Sie würde sich auch erst in drei oder vielleicht vier Stunden wieder öffnen, wenn Becker kam. und ihm sein Essen brachte.
Bis dahin waren sie längst auf hoher See und mit etwas Glück schon außerhalb der portugiesischen Hoheitsgewässer; zumindest aber in Sicherheit.
Sicherheit ... Das Wort hatte einen eigentümlichen Klang für ihn. Irgendwann, vor fünfzig Jahren ungefähr, hatte er vergessen, was es wirklich bedeutete.
Der winzige Raum war vollkommen leer bis auf die zerschlissene Matratze und die leere Holzkiste, die ihm für die Dauer seiner freiwilligen Gefangenschaft als Tisch und Bett dienten. Das Wasser tropfte regelmäßig und erfüllte das stählerne Gefängnis mit der Illusion von Leben. Der Boden vibrierte ganz sacht im rhythmischen Tuckern der Hilfsaggregate und ließ kleine, regelmäßige Wellenmuster über die schmutzigen Pfützen laufen. Wenn er lange genug hierblieb, dachte er mit einer Art Galgenhumor, würde er zusehen können, wie die Pfütze immer größer wurde, bis er in dem öligem Wasser ertrank. Er lächelte über seine Phantasie und führte seine Inspektion fort – es war das zehnte oder elfte Mal, daß er das tat, und er würde es wahrscheinlich noch fünfhundert weitere Male tun, ehe Becker kam und ihm mitteilte, daß sie in Athen angelegt hatten.
Viel gab es nicht zu sehen. Er kannte jeden Zentimeter der kleinen Kammer schon jetzt. In einer Woche (eine Woche? Gott, das waren siebenmal vierundzwanzig Stunden, jede aus sechzig endlosen Minuten zusammengesetzt!), in einer Woche würde er gelernt haben, sie zu hassen. Eine denkbar schäbige Umgebung, dachte der Mann, um ein neues Leben zu beginnen.
Aber es war ja nur der Anfang, und es war auch nicht sein Leben, um das es ging. Sein eigenes Leben war zu lang gewesen, als daß der kleine verbliebene Rest noch eine Rolle spielte.
Der Mann drängte den Gedanken mit Macht aus seinem Bewußtsein, lehnte sich zurück und versuchte zu schlafen. Natürlich gelang es ihm nicht. Er fror, und er hatte das Gefühl, ein Fieber breitete sich in seinem Körper aus. Es war kalt und feucht. Wie in einem Grab.
Verwirrt öffnete er die Augen. Was waren das für Gedanken? Warum fielen ihm solche Vergleiche ein? War er nicht immer ein Realist gewesen, ein Mann, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand?
Aber irgend etwas war mit ihm geschehen, seit er dieses Schiff betreten hatte. Vielleicht lag es nur an der Anspannung, daß er auf Gedanken kam, die ihm fremd waren, daß er Dinge fühlte, die ihn erschreckten.
Er hatte Erfahrungen im Fliehen und Sichverstecken. Einen großen Teil seines Lebens hatte er auf der Flucht verbracht. Immer wieder neue Verstecke. Plötzliches Untertauchenmüssen. Er hatte gelernt, das Verstreichen der Zeit auch ohne Uhr zu schätzen, manchmal mit einer Präzision, die ihn selbst erstaunte. Wenn Becker kam, würde er ihn um Medikamente bitten; Chinin vielleicht – irgend etwas, das Becker aus der Bordapotheke nehmen und ihm bringen konnte, um den Kampf gegen das Fieber aufzunehmen.
Es war ihm klar, daß Becker ein verdammt großes Risiko einging. Das Einschmuggeln eines blinden Passagiers konnte ihn seinen Job kosten. Vielleicht eine Gefängnisstrafe. Aber er ließ sich dieses Risiko gut bezahlen. Der Mann hatte alles Geld gegeben, das er aufbringen konnte, und das war nicht wenig gewesen.
Aber er hatte gar keine andere Wahl gehabt. Die portugiesische Polizei hatte drei Monate lang Jagd auf ihn gemacht, und wenn sie ihn erwischt hätte, hätte er den Rest seines Lebens in einem spanischen Gefängnis zubringen dürfen. Und spanische Gefängnisse waren auch nicht wesentlich komfortabler als dieser leere Raum tief im Bauch der MS OCEAN QUEEN.
Er wickelte sich enger in seine Decke, aber die Kälte drang hindurch. Sein Atem bildete kleine Dampfwölkchen vor seinem Gesicht. Finger und Zehen wurden allmählich taub. Sein Rücken tat weh.
Wieder der Blick zur Tür. Wo blieb Becker? Er mußte hier raus. Dieser Verschlag war vielleicht sicher, aber was nutzte ihm die Sicherheit, wenn er elend erfror?
Er stand auf, blies in die Hände und stampfte ein paarmal mit den Füßen auf, um die taube Kälte daraus zu vertreiben, und ging zur Tür. Sie war verschlossen. Natürlich. Er selbst hatte Becker ja gebeten, sie abzuschließen und den Schlüssel an sich zu nehmen, damit nicht irgend jemand zufällig hereinschneien konnte. Trotzdem rüttelte er ein paarmal vergeblich an der massiven Eisentür. Er trat mit dem Fuß dagegen.
Natürlich nutzte das nichts. Selbst wenn jemand direkt auf der anderen Seite der Tür gestanden hätte, hätte er vermutlich nichts gehört. Die Tür bestand aus zentimeterdickem Eisen, und direkt über seinem Kopf rumorten die riesigen Maschinen des Schiffes.
Zum ersten Mal, seit er vor fast fünf Stunden hier heruntergekommen war, bekam er Angst. Er kannte Becker kaum, war nur über einen Mittelsmann an ihn herangekommen. Becker, so hatte es geheißen, war Spezialist darin, Leute diskret außer Landes zu schaffen. Aber vielleicht tat er das etwas zu gründlich, überlegte der Mann. Vielleicht tauchten sie bloß nie wieder auf, weil er sie auf andere Art und Weise verschwinden ließ. Das Meer war groß. Und sehr tief.
Er schlug in blinder Panik gegen das rostige Metall der Tür. Seine Knöchel platzten auf. Blut lief über seine Hände, und er schrie, so laut er konnte, obwohl er wußte, wie sinnlos das war.
Erst, als er die Arme kaum noch heben konnte, trat er von der Tür zurück. Sein Atem ging schnell und stoßweise, und sein Herz raste schmerzhaft.
Und mit einemmal begriff er, daß Becker nicht kommen würde. Er hatte sein Geld und brauchte nur zu warten, bis er verdurstet oder erfroren war. Seine Leiche zu beseitigen, war auf hoher See kein Problem.
Der Mann ging zu der Matratze zurück und wickelte sich wieder in die Decke. Er würde abwarten. Mehr konnte er nicht tun.
Und weiter nagte die Angst in ihm. Er war Becker auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Becker war Deutscher, wie ihm plötzlich auffiel. Der Mann erschrak bis ins Innerste. Er haßte Deutsche.
Der Mann sah sich suchend in seiner Zelle um und wußte doch gleichzeitig, daß er nichts finden würde, womit er die massive Tür hätte aufbrechen können. Bis auf die Kiste, die Matratze und die kleine Campinggaslampe war der Raum leer, absolut leer. Und selbst wenn er Werkzeug gehabt hätte – er war ein sehr alter Mann. Viel zu alt, um Eisentüren aufzubrechen.
Er stöhnte leise und ballte die Fäuste so fest, daß sich die Fingernägel tief in seine Handflächen gruben. Der Schmerz ließ ihn eine Sekunde lang seine Angst vergessen.
Zitternd stand er auf, trat noch einmal an die Tür und schlug mit der flachen Hand dagegen. Das Geräusch hallte seltsam hohl in der kleinen würfelförmigen Zelle wider, und für einen Moment schien sich noch etwas anderes in das Echo zu mischen, etwas Fremdes und trotzdem auf entsetzliche Weise Bekanntes.
Der Mann fuhr sich nervös mit dem Handrücken über den Mund, drehte sich um und erstarrte mitten im Schritt, als sein Blick auf eine Stelle neben der Tür fiel, an der der Lack von der Metallwand abblätterte. Aber darunter kam kein Eisen zum Vorschein, sondern eine zweite, etwas dunklere und sehr viel ältere Lackschicht. Etwas war an dem Anblick, das den Mann alarmierte.
Er zögerte kurz, dann trat er dichter an die Wand heran. Sein Blick tastete über die postkartengroße Stelle, an der dunkelgrüne Farbe unter dem grauen Rostschutzanstrich zum Vorschein kam. Er steckte seine Hand in die Jacke, fand das Taschenmesser und zog es hervor. Die schmale Klinge verursachte unangenehm quietschende Geräusche, als sie über den Lack fuhr und die Stelle vergrößerte.
Die Farbe darunter war sehr alt. Buchstaben waren darauf gemalt, aber von der nachträglich angebrachten Farbschicht konserviert, so daß sie noch immer deutlich zu lesen waren. Buchstaben, die für niemanden auf der Welt heute noch einen Sinn ergeben hätten.
Außer für den Mann.
Mit entsetzlicher Gewißheit wußte er plötzlich, daß er nicht zum ersten Mal hier war.
Der Mann taumelte zurück. Ein krächzender Schrei entrang sich seiner Kehle. Das Taschenmesser entglitt seinen Fingern und prallte mit einem Geräusch auf den Boden, das wie höhnisches Gelächter aus stählernen Kehlen in seinen Ohren widerhallte.
Und dann ging das Licht aus.
Die kleine Gasflamme flackerte, schoß noch einmal hell empor und verlosch dann.
Für einen Moment hatte der Mann das Gefühl, sein Herzschlag würde aussetzen. Das Tröpfeln des Wassers wurde plötzlich lauter. Durch das dumpfe Hämmern seines eigenen Herzschlages glaubte er, Schritte zu vernehmen, schwere, schlurfende Schritte, begleitet von einem fürchterlichen Röcheln und Stöhnen. Es waren seine eigenen Atemzüge.
»Wer ... wer ist da?« fragte er. Seine Stimme schwankte, und die nackten Metallwände schienen den Schall aufzusaugen. Es gab kein Echo. Er hatte plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
Mit zitternden Fingern tastete er im Dunkeln nach der Lampe, bekam sie zu fassen und zog sie zu sich heran. Seine Hand glitt in die Tasche und kam mit dem Gasfeuerzeug wieder hervor. Er ließ es aufflammen, blinzelte geblendet in die kleine gelbe Flamme und führte sie dann an den Strumpf der Campingleuchte. Er flammte für eine Sekunde auf und erlosch dann wieder.
Der Mann drehte hastig am Stellrad und hörte, wie das Gas zischend entwich. Wieder ließ er sein Feuerzeug aufschnappen und hielt die Flamme in den Gasstrom. Diesmal zischte eine fast meterlange Stichflamme gegen die Decke. Aber der Strumpf fing kein Feuer.
Der Mann begann zu wimmern. Er hörte die Schritte jetzt ganz deutlich. Die Schritte und das Atmen. Er war nicht allein. Irgend etwas war bei ihm, etwas Tödliches und Fremdes, etwas, das die Dunkelheit ausnutzen würde, um ihn zu überfallen und zu töten!
Becker! dachte er. Becker wollte ihn töten! Es war kein Zufall! Sie hatten ihn nach all den Jahren aufgespürt, und sie hatten Becker geschickt, um ihn hierher zu locken. Hierher, an den einzigen Ort auf der Welt, an dem sie ihre Rache vollziehen konnten!
Mit bebenden Fingern drehte der Mann das Stellrad bis zum Anschlag auf. Das Zischen des Gasstromes wurde lauter. Die Luft schmeckte scharf, dann bitter.
Er schnippte sein Feuerzeug an und hielt die Flamme in den Gasstrom.
Der Funke schlug nach innen, aber es ging zu schnell, als daß der Mann noch etwas davon bemerkte. Er sah überhaupt nichts mehr, nicht einmal mehr den grellen Blitz, mit dem die Gaskartusche explodierte und sein Gesicht in Fetzen riß.
Kapitel 1
»Jetzt geht's los«, sagte Angie aufgeregt. Ihr Herz schlug dreimal so schnell wie normal, und ihre Handflächen waren feucht.
Sie fühlte sich wirklich ein bißchen so, wie Claus vorhin spöttisch behauptet hatte: wie ein Kind vor der geschlossenen Wohnzimmertür, hinter der es den Weihnachtsbaum wußte. Aber schließlich war es ihre erste Kreuzfahrt, und sie hatte das Recht, aufgeregt zu sein.
Vor wenigen Minuten waren die Treppen eingezogen und die letzten Taue gelöst worden. Das riesige Schiff trieb langsam aus dem Hafen hinaus, dem Sog der gerade einsetzenden Ebbe und dem stärker werdenden Zug der vier Schlepper folgend.
Angie drehte sich um, winkte Claus zu sich heran und griff nervös nach seiner Hand. Claus blickte zärtlich auf seine Frau herab. Sie kannten sich seit vier Jahren, aber er war noch immer überrascht und gerührt, wenn sie sich wie ein Kind freute. Diese Mittelmeerkreuzfahrt war so etwas wie eine verspätete Hochzeitsreise für sie. Zwar waren sie schon seit zwei Jahren verheiratet, aber es war der erste richtige Urlaub, den sie sich leisten konnten.
Nein, Angie ließ es sich nicht ausreden, die zwei Wochen an Bord der MS OCEAN QUEEN als Flitterwochen zu betrachten.
Claus beugte sich über die Reling und sah an der weißgestrichenen Flanke des Passagierdampfers hinab. Das Meer lag fast fünfzehn Meter unter ihm, und Angie sah, daß er ein bißchen blaß wurde; wahrscheinlich war ihm schwindelig. Er mochte Wasser nicht besonders, was nicht zuletzt daran lag, daß er nicht schwimmen konnte. Hastig trat er von der Reling zurück, atmete tief ein und lächelte gezwungen, als er Angies Blick begegnete.
»Was hast du?« fragte sie. »Ist dir nicht gut?«
Claus schüttelte hastig den Kopf, eine Bewegung, die sofort bestraft wurde, denn er wurde noch blasser. »Es ist nichts«, sagte er eilig.
»Nichts?« Angie grinste schadenfroh. »Dafür, daß nichts ist, siehst du aber ganz schön grün im Gesicht aus, mein Lieber.«
Claus rang sich ein gequältes Lächeln ab. »Vielleicht werde ich seekrank.«
Angie wandte sich ebenfalls von der Reling ab und hakte sich bei Claus unter. »Wenn du jetzt schon seekrank wirst, was passiert dann wohl, wenn wir wirklich auf hoher See sind?« fragte sie.
Claus zuckte die Schultern. »Keine Ahnung«, murmelte er. »Vielleicht werde ich die ganze Zeit leidend in meiner Koje liegen, und du mußt dir die Zeit mit einem feurigen Matrosen vertreiben.«
Angie blickte sich nach allen Seiten um und deutete schließlich auf einen kleinen, glatzköpfigen Asiaten in der weißen Uniform eines Stewards, der mit einem Tablett voller Gläser vorbeibalancierte. Irgendwie schien er das Gesetz der Schwerkraft überlistet zu haben, denn obwohl die Gläser wild hin- und herschwankten, schwappte nicht ein Tropfen über ihren Rand. »Der da könnte gehen«, sagte sie ernsthaft.
Claus runzelte die Stirn. »Dein Geschmack war auch schon mal besser.«
Angie sah lächelnd auf. »So? Immerhin habe ich dich geheiratet, vergiß das nicht.«
»Eben«, nickte Claus. »Aber noch so einen Prachtburschen wie mich findest du sowieso nicht mehr. Also bete lieber zu Poseidon, oder wie immer dieser Meeresgott heißt, daß wir keinen hohen Wellengang bekommen. Sonst wird es eine verdammt langweilige Reise für dich.«
Angie sah ihn nachdenklich an und blickte dann mit unverhohlener Bewunderung auf einen sonnengebräunten Mann, der lässig an der Reling lehnte.
»Das glaube ich nun wieder nicht, mein Lieber«, sagte sie betont. »Eher im Gegenteil.«
Claus folgte ihrem Blick, starrte den breitschultrigen Riesen einen Augenblick lang nachdenklich an und versuchte dann, möglichst finster auszusehen. »Ich glaube, ich werde doch nicht seekrank.«
Angie lachte leise. »Siehst du, Mutters Hausrezepte sind doch immer die besten. Du brauchst dich nur an mich zu wenden, wenn dir irgend etwas fehlt. Ich kuriere dich sofort. Was machen wir jetzt?«
Claus überlegte einen Moment. Sie waren seit mehr als sieben Stunden auf den Beinen, und er begann, sich allmählich müde zu fühlen. Außerdem hatte er Hunger. »Gehen wir essen?«
»Jetzt schon? Es ist noch nicht einmal elf.«
»Und?« erwiderte Claus. »Immerhin hast du mich mitten in der Nacht aus dem Bett gescheucht und es nicht für nötig befunden, ein Frühstück zu machen. Und auch ein Supermann wie ich kriegt ab und zu Hunger. Außerdem«, fügte er hinzu, »können wir soviel verzehren, wie wir wollen. Ist alles im Preis mit drin. Und das gedenke ich weidlich auszunützen.«
Angie sah bezeichnend an ihm herab, schwieg aber. Claus war für seine knapp dreißig Jahre alles andere als sportlich gebaut, und über dem Bauch begannen sich seine Hemden bereits zu spannen. Aber er wurde ungehalten, wenn man ihn darauf ansprach, und Angie hatte keine Lust, sich die Urlaubsstimmung durch eine Diskussion über Claus' schlanke Linie zu verderben.
Sie gingen über das Deck und in den großen, an drei Seiten verglasten Speiseraum der ersten Klasse. Zu Angies Überraschung waren die Tische bereits gut besetzt. Die Stewards schienen ihre liebe Mühe zu haben, mit dem plötzlichen Ansturm fertig zu werden.
Sie fanden einen Platz direkt vor der großen Panoramascheibe, und Claus griff nach der Speisekarte. Angie sah durch das spiegelblank geputzte Fenster nach draußen. Sie saßen auf der dem Land abgewandten Seite des Schiffes, und vor ihnen war nichts als Wasser. Das Meer schien sich unendlich vor ihnen auszubreiten und verschmolz irgendwo mit dem Horizont. Es war leicht, sich einzubilden, sie wären bereits auf hoher See. Die Meeresoberfläche wirkte unnatürlich glatt, wie vor einem Sturm. Aber der Wetterbericht hatte für ganz Europa strahlenden Sonnenschein versprochen. Nun, und selbst wenn für einen Tag schlechtes Wetter sein sollte – die OCEAN QUEEN bot genug Abwechslung, um auch einen Tag unter Deck verbringen zu können.
Jemand trat an ihren Tisch und räusperte sich gekünstelt. Angie sah auf, und Claus ließ mit einem Stirnrunzeln die Speisekarte sinken. Es war niemand anders als der Mann, der ihnen schon vorhin an der Reling aufgefallen war. Von nahem betrachtet wirkte er noch größer. Aber er hatte ein offenes, freundliches Gesicht, und sein Lächeln wirkte ein wenig schüchtern.
»Ja?« Claus blickte ihn an.
»Ich ....hm«, begann der Mann unsicher. »Entschuldigung, aber ist der Platz hier noch frei?« Er deutete auf den freien Stuhl am Kopfende des Tisches und sah zuerst Claus, dann Angie fragend an. Claus blickte an ihm vorbei und sah sich provozierend im Speisesaal um. Es waren mindestens noch achtzig Plätze frei.
»Ja«, sagte Claus. »Der auch.«
Der Mann nickte, zog den Stuhl zurück und setzte sich. »Sehr freundlich von Ihnen«, sagte er. »Gestatten Sie, daß ich mich vorstelle? Faller. Peter Faller.«
Claus nickte und warf Angie einen fragenden Blick zu.
»Sie werden sich sicher wundern, daß ich Sie so einfach überfalle, nicht?« fuhr Faller fort, als die Reaktion ausblieb, die er offensichtlich erwartet hatte. »Normalerweise ist es nicht meine Art, Fremde anzusprechen, Herr Mannheim.«
»Sie kennen mich?« fragte Claus verblüfft. »Ich wüßte nicht, wo ...«
»Ich kenne Sie, aber ich glaube nicht, daß Sie mich kennen«, sagte Faller hastig. »Wir sind gewissermaßen Kollegen.«
»Kollegen?« wunderte sich Claus. »Sind Sie auch beim Fernsehen?«
»Nein.«
Faller grinste verlegen. »Nein«, sagte er, »ich bin Professor für Psychologie an der Universität Berkeley.«
»Sie sind Amerikaner?« fragte Angie.
Faller schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Deutscher, wie Sie und Ihr Mann. Aber es hat mich schon vor fünfzehn Jahren nach Amerika verschlagen.«
»So.« Claus gab sich nun kaum noch Mühe, seinen Ärger zu verbergen. »Und was hat das mit mir zu tun?«
Faller wirkte für einen Moment noch verlegener. »Nichts ...« sagte er. »Das heißt, nicht direkt. Ich ... ich habe Ihre Reportage gesehen, vor zwei Wochen.«
»Welche?«
Faller war für einen Moment irritiert. »Sie haben mehr als diese eine gemacht?«
»Halten Sie mehr als eine Vorlesung im Jahr?« fragte Claus. »Ich habe eine ganze Menge Reportagen gemacht, und ich bin leider nicht auf dem laufenden, welcher Sender irgendwo auf der Welt gerade welchen Film ausgesendet hat.«
»Natürlich«, sagte Faller hastig. »Tut mir leid, daß ich nicht von selbst drauf gekommen bin. Ich meine die Reportage über P.S.I. Das zwölfjährige Mädchen in Lyon, das angeblich über telekinetische Kräfte verfügte. Die Marienerscheinung in Chalons-sur-Marne.
»Und?« fragte Claus ruhig.
»Völliger Humbug«, erwiderte Faller ruhig. »Ich könnte Ihnen jeden dieser Fälle in der Luft zerreißen. Aber Ihre Art, die Dinge anzugehen, hat mir gefallen. Ich beschäftige mich gewissermaßen berufsmäßig mit diesen Dingen, und da ...«
Claus blickte ihn nun erstmals interessiert an. »Sie sind Parapsychologe?«
Faller nickte und schüttelte gleich darauf den Kopf. »Nicht direkt«, gestand er. »Es gibt kaum Lehrstühle für Parapsychologie, müssen Sie wissen. Ich betreibe es sozusagen als Hobby. Aber es nimmt doch fast meine ganze Zeit in Anspruch. Nun ja, und Ihr Film hat mir gefallen. Daß Sie einem Betrüger aufgesessen sind, ist nicht Ihre Schuld. Da sind schon ganz andere hereingelegt worden. Sogar«, fügte er mit einem flüchtigen Lächeln hinzu, »schlaue Universitätsprofessoren wie ich. Aber, wie gesagt, Ihre Art, die Dinge anzupacken, hat mich beeindruckt. Ich habe mir gewünscht, Sie kennenzulernen. Und als ich Sie vorhin an Deck sah ...«
Claus nickte geschmeichelt. »Schade, daß manche Kritiker das nicht auch so sehen«, sagte er. »Die Reportage wurde ziemlich verrissen. Er war nicht unbedingt mein größter Erfolg.«
»Trotzdem – ich fand es sehr interessant. Und da ich aus eigener Erfahrung über außersinnliche ...«
Claus beugte sich interessiert vor. »Sie haben schon Erlebnisse gehabt?« fragte er. »Echte Erlebnisse?«
Angie ließ sich in ihrem Stuhl zurücksinken und seufzte. Sie hatte das dumpfe Gefühl, daß die Reise anders verlaufen würde, als sie es sich vorgestellt hatte.
Sie sollte recht behalten, denn vier Stunden später saßen sie noch immer zusammen, waren aber an die Bar umgezogen. Angie nippte an ihrem Martini und drehte das Glas so in den Fingern, daß sich das Licht der Kronleuchter in der geschliffenen Oberfläche brach. Es war der siebte oder achte Martini, den sie trank, seit sie in die Bar gegangen waren. Vielleicht auch der zehnte; sie hatte sie nicht gezählt. Sie war nicht betrunken, aber auch nicht mehr ganz nüchtern.
Sie langweilte sich. Das Gespräch der beiden Männer interessierte sie nicht im mindesten.
Sie leerte ihr Glas und gab dem Barkeeper ein Zeichen, es wieder zu füllen.
Claus wandte den Kopf und sah sie nachdenklich an. »Sag mal, Schatz«, sagte er. »Langweilst du dich? Ich möchte nicht, daß...«
Angie winkte ab. »O nein«, sagte sie. »Mach dir blosch keine Schorgen. Esch ... ist sehr inre... terre ... schpannend.« Sie stockte, blinzelte verwirrt und schüttelte mühsam den Kopf. Ihre Zunge schien seltsam schwerfällig zu sein und begann, ihr Streiche zu spielen. Aber sie war ganz und gar nicht betrunken. Der Alkohol schien seine Wirkung voll und ganz auf ihr Sprachzentrum konzentriert zu haben. Sonderbar.
»Vielleicht«, sagte Claus vorsichtig, »solltest du für eine Weile auf Mineralwasser umsteigen, Liebling.«
»Wie ... schon?« fragte Angie spitz, wenn auch nicht sehr deutlich.
»Oh«, murmelte Claus, »nur so. Ich meine nur ...«
»Du meinscht nur«, unterbrach ihn Angie. Plötzlich wurde sie zornig. »Aber vielleicht hascht du recht, und ich gehe lieber in meine Kabine«, sagte sie. Ihre Wut half ihr für einen Moment, wieder völlig klar denken – und beinahe auch reden zu können. »Ich möchte dich und deinen neuen Freund auf gar keinen Fall stören.«
Sie sprang mit einem Satz vom Hocker, griff nach ihrem Glas und leerte es mit einem Zug.
Claus sah plötzlich sehr betroffen aus. »Aber Schatz, ich...«
»Mach dir bloß keine Umstände«, fiel ihm Angie ins Wort. »Ich lasse euch zwei Helden allein. Wenn du mich irgendwann im Laufe der nächsten zwei Wochen vermissen solltest – du weißt ja noch, wo unsere Kabine ist, oder?« Sie fuhr herum, nahm ihre Handtasche von der Theke und ging hocherhobenen Hauptes davon.
Zumindest versuchte sie es. Aber das Schiff schwankte plötzlich stärker, und sie hatte erhebliche Mühe, aufrecht aus der Bar zu gehen. Draußen mußte ein bemerkenswerter Seegang herrschen.
Kapitel 2
Die Beleuchtung war schwach. Die Luft roch nach Maschinenöl und fauligem Wasser. Die Wände waren rostzerfressen und schmierig. Mehr als die Hälfte der Glühbirnen, die in kleinen vergitterten Körben an den Wänden angebracht waren, waren durchgebrannt, und niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie auszuwechseln. In einem kleinen Hohlraum unter der Treppe verfaulten die Reste einer Ratte, halb aufgefressen von ihren Artgenossen. Eine der Wände hatte einen Riß, der ungeschickt geschweißt worden und wieder aufgebrochen war. Man mußte kein Fachmann sein, um zu erkennen, daß dieser Teil des Schiffes selten betreten wurde.
Freddy Becker nestelte mit der Rechten den Schlüssel von dem Bund, den er an seinem Gürtel trug; gleichzeitig balancierte er mit der anderen Hand ein Tablett voller Sandwiches und Bierdosen.
Es war nicht gerade ein königliches Mahl, das er seinem Privatpassagier brachte, aber das Beste, was er in der Eile hatte organisieren können. Zur Not mußte es reichen. Und schließlich konnte sein »Privatgast«, froh sein, überhaupt an Bord zu sein.
Es war nicht gerade leicht gewesen, ihn auf die OCEAN QUEEN zu schmuggeln. Becker brach jetzt noch der Schweiß aus, wenn er daran dachte, wie' knapp sie der Entdeckung entgangen waren, als sie hier heruntergekommen waren. Andererseits verdiente er verdammt viel Geld damit, und ein gewisses Risiko gehörte eben dazu. Außerdem hatte er allmählich Routine. Der Mann – er wußte nicht einmal seinen Namen, und das war auch gut so – war nicht der erste, den er auf diese Weise aus dem Land schmuggelte; schnell, diskret und teuer.
Der winzige Stauraum ganz am Ende des Ganges hatte sich während der letzten fünf Jahre als wahre Goldgrube erwiesen. Aus unerfindlichen Gründen war der schmale Korridor unter dem Maschinenraum auf keiner Zeichnung des Schiffes zu finden. Becker hatte ihn nur durch Zufall entdeckt. Und er wußte ihn bestens zu nutzen.
Becker eilte den schmalen Korridor hinunter. Der Boden unter seinen Füßen vibrierte unter dem Lärm der gewaltigen Dieselmotoren, und die Luft roch so durchdringend nach Fäulnis und Moder, daß er für einen Moment kaum atmen konnte.
Plötzlich blieb Becker stehen und schnüffelte. Er kannte den Gestank hier unten zur Genüge, aber heute lag noch etwas anderes in der Luft. Es roch irgendwie ... verbrannt?
Er ging weiter und blieb schließlich vor der rostzerfressenen Tür am Ende des Ganges stehen. Wieder schnüffelte er. Der Geruch schien stärker zu werden. Es roch streng nach Gas, verbranntem Stoff und noch irgend etwas. Mit wachsender Beunruhigung nahm er den Schlüssel zur Hand, steckte ihn ins Schloß und drehte ihn rasch herum.
Eine Woge verbrannter Luft und stickiger Wärme schlug ihm entgegen, als er die Tür öffnete. Becker fluchte, setzte rasch sein Tablett ab und nahm die Taschenlampe aus dem Gürtel. Der bleiche Strahl tastete über den Boden, strich am Türrahmen entlang und verlor sich irgendwo in der Dunkelheit dahinter.
Der Raum war voller Qualm und beißendem Gestank. Er brauchte nicht sehr viel Phantasie, um sich vorzustellen, was hier geschehen war. Der Mann hatte eine Gasleuchte gehabt, um seine »Kabine« zu erhellen. Irgendwie mußte die verdammte Kartusche explodiert sein. Und in der Enge des Raumes hatte sie eine verheerende Wirkung gehabt. Becker begriff dies alles ganz schnell, ganz kalt und furchtlos. Er wußte: Der Mann war tot.
Becker hustete, nahm sein Taschentuch hervor und preßte es gegen Mund und Nase, ehe er vorsichtig durch die Tür trat. Die Wände waren schwarz, und eine dünne Schicht, die an altes Maschinenöl erinnerte, bedeckte jeden Quadratmillimeter. Der Gestank war jetzt so schlimm, daß er trotz des Taschentuches vor seinem Gesicht kaum noch atmen konnte. Er hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. Die Matratze und die Holzkiste waren vollkommen verbrannt. Selbst der Boden war geschwärzt, und dicht vor der Tür ...
Becker war ein hartgesottener Bursche. Er war bei der Fremdenlegion gewesen, hatte als Rausschmeißer in einem Amsterdamer Bordell und eine Zeitlang auf einem Schlachthof gearbeitet.
Trotzdem wurde ihm schlecht, als er die Leiche sah.
Der Mann mußte die Kartusche direkt in der Hand gehabt haben, als sie hochgegangen war. Und er hatte die ganze verdammte Ladung direkt ins Gesicht bekommen. Was da zwei Schritte vor ihm auf dem Boden lag, sah aus wie ein Bündel verbrannter nasser Lumpen.
Becker trat zurück, lehnte sich gegen die Gangwand und wartete, bis sein Magen aufgehört hatte zu revoltieren. Dann ging er wieder in den Raum zurück, sah sich noch einmal unschlüssig um und beugte sich mit zusammengebissenen Zähnen und angehaltenem Atem über den Toten.
Er legte die Taschenlampe eingeschaltet auf den Boden und drehte den Leichnam auf den Rücken. Es kostete ihn große Überwindung, in den Taschen des Toten herumzusuchen und sie zu leeren.
Er häufte alles, was er fand, auf sein Tablett, nahm schließlich sein Taschenmesser hervor und trennte auch die Etiketten aus den verkohlten Kleidern des Toten. Dann rutschte er ein Stück zurück, drehte sich von der Leiche weg und begann, die wenigen Habseligkeiten des Toten zu durchsuchen.
Es war nicht sehr viel: ein abgewetztes Portemonnaie, das an einer Seite angebrannt war und eine VISA-Karte und knapp zweitausend angekohlte griechische Drachmen enthielt. Becker steckte die Banknoten ein und warf die Kreditkarte auf das Tablett zurück. Außerdem fand er eine Brieftasche mit den persönlichen Papieren des Toten und einen Schließfachschlüssel an einer kleinen silbernen Kette. Becker legte auch den Schlüssel zurück, durchsuchte die Brieftasche aber sehr gründlich. Er mußte wissen, mit wem er es zu tun gehabt hatte.
Die Brieftasche war eine Enttäuschung. Sie enthielt einen Paß, den Becker selbst im blassen Licht der Taschenlampe als Fälschung erkannte, ein mindestens dreißig Jahre altes Farbfoto einer hübschen jungen Frau und ein zusammengefaltetes Blatt Papier, auf dem eine neunstellige Zahl stand, sorgfältig mit einer Schablone geschrieben und sehr alt. Becker konnte sehen, daß die Ziffern mindestens dreimal nachgezogen worden waren, weil sie zu verbleichen drohten.
Becker legte auch die Brieftasche samt Inhalt auf das Tablett zurück und wandte sich wieder dem Toten zu. Er wußte, daß er die Leiche nicht beseitigen konnte. Es war schwer genug, mit einem Mann ungesehen hier herunterzukommen.
Nein – er hatte gar keine andere Wahl, als den Toten hierzulassen und alle Spuren zu verwischen, die zu ihm führen konnten. Mit etwas Glück dauerte es Jahre, bis ihn jemand fand. Vielleicht nie. Aber Becker wollte kein Risiko eingehen. Es war ihm klar, daß sein einträgliches Nebengeschäft durch diesen blödsinnigen Unfall ein vorläufiges Ende gefunden hatte.
Er schleifte den Toten in die Mitte des Raumes zurück, sah sich noch einmal prüfend um und trat wieder auf den Gang hinaus. Er verschloß die Tür, drehte den Schlüssel zweimal herum, bis er auf Widerstand stieß, und brach ihn schließlich mit einem entschiedenen Ruck im Schloß ab. Dann nahm er sein Taschentuch hervor und wischte sorgfältig jeden Quadratzentimeter der Tür ab. Niemand würde hier unten Fingerabdrücke finden, nicht bei der Feuchtigkeit und all dem Schmutz, aber Becker war ein vorsichtiger Mann. Er würde am Ende dieser Reise abheuern und sich mit dem verdienten Geld ein schönes Leben machen. Und er hatte absolut keine Lust, durch irgendeinen blöden Zufall in letzter Sekunde doch noch aufzufallen.
Noch einmal sah er sich um, um sich davon zu überzeugen, daß er nichts vergessen und liegengelassen hatte, nahm dann sein Tablett auf und ging mit schnellen Schritten davon.
Kapitel 3
Selbst in den Kabinen der ersten Klasse war es nicht vollkommen still. Das Arbeitsgeräusch der Dieselmotoren war als feines, vibrierendes Summen zu hören, und irgendwo ganz in der Nähe mußte eine Party in vollem Gange sein. Die Schächte der Klimaanlage übertrugen die Musikfetzen, das Gläserklirren und das Murmeln und Lachen zahlloser Stimmen fast besser, als es ein Lautsprecher getan hätte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























