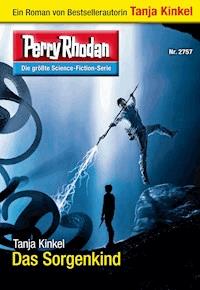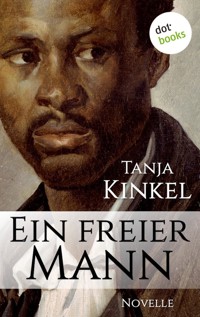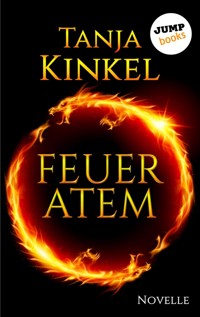9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 68er Jugend-Revolution eskaliert. Die RAF entsteht. "Schlaf der Vernunft" ist der große RAF-Roman von Bestsellerautorin Tanja Kinkel. Nach fast zwei Jahrzehnten ohne Kontakt fällt es Angelika Limacher schwer, sich nach der Begnadigung ihrer Mutter Martina auf sie einzulassen. Zu sehr lastet die Vergangenheit auf ihrer Seele: Angefangen mit dem plötzlichen Verlust ihrer Mutter, als diese in den Untergrund ging, bis hin zum Kontaktabbruch, als Martina im Gefängnis sitzend von heute auf morgen ihre Tochter nie wiedersehen wollte. Brennende Fragen nagen an Angelika: Wie konnte ihre liebevolle Mutter nur zu einer kaltblütigen Terroristin werden? Und kann sie Martina wieder gefahrlos in den Kreis ihrer Familie aufnehmen? Aber auch das Leid der Opfer verjährt nie, und so suchen auch die Söhne von Martinas Opfern nach Antworten: Warum mussten ausgerechnet ihre Väter sterben? Und wer hat damals wirklich geschossen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Tanja Kinkel
Schlaf der Vernunft
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach 20 Jahren Gefängnis wird Martina Müller zeitgleich mit der RAF-Auflösung begnadigt. Das »Mörder-Monster«, wie die Presse bei ihrer Verurteilung schrieb. Ihre Tochter Angelika, die ihre Entschlossenheit nie verstanden hat, soll ihrer Mutter nach der langen Haftzeit beistehen, obwohl jedwede Verbindung abgebrochen war. Martina, mit 48 noch jung, muss erkennen, dass nichts erreicht wurde, jeder Mord umsonst gewesen war. Um herauszufinden, ob sich ihre Mutter geändert hat, Reue in sich entdeckt, und Teil ihrer Familie werden kann, muss Angelika Martinas Spuren folgen. Von der Sympathisantin, über die Illegalität und dem Gängelband der Stasi, bis hin zum großen Attentat. Aber nicht nur sie. Durch die Begnadigungen gibt es zwar Ex-Terroristen, aber Ex-Opfer gibt es nicht, denn deren Leid verjährt nie. So taucht der Sohn eines RAF-Opfers auf, der wissen will, wer damals geschossen hat. Ehefrauen, Mütter und der einzig überlebende Leibwächter: Alle haben auch nach Jahrzehnten offene Fragen.
Inhaltsübersicht
1998 – Angelika
1967 – Martina
1998 – Besuch im Gefängnis
1969 – Martina
1998 – Entlassung
1971 – Martinas Kind
1998 – Stasi
1972 – Steffen
1998 – Steffen
1972 – Martina
1998 – Sylt
1973 – Hamburg
1998 – Ellingen
1973 – Steffen
1998 – Anna Liebert
1974 – Herbst – Martina
1998 – Der Theaterheini
1974 – November – Steffen
1998 – Keitum
1974 – November – Martina
1998 – Berlin
1974 – Martina
1998 – Berlin
1977 – Frühling – Martina
1998 – Mark Brandenburg
1977 – Frühling – Nürnberg
1998 – Abschied von Sylt
1977 – Das Attentat
1998 – Nürnberg
1998 – Hamburg
Nachwort
1998 – Angelika
Der Brief lag auf ihrem Schreibtisch, zwischen Rechnungen und Werbung. Er lag dort seit zwei Tagen. Sie hatte den Absenderstempel sofort erkannt, obwohl es Jahre her war, seit sie Post aus einer Justizvollzugsanstalt erhalten hatte.
Damals hatte sie den betreffenden Brief ungeöffnet zerrissen und sich danach noch mehr verabscheut, weil sie die Papierfetzen wieder zusammensetzte und ihn doch noch las. Beantwortet hatte sie ihn nie.
Diesmal wusste sie, dass sie ihn nicht vernichten würde, aber der Teil von ihr, der selbst in einem bald dreißigjährigen Körper für immer acht Jahre alt war, hoffte, das der Inhalt des Briefes nie wahr würde, wenn sie ihn nur lange genug ignorierte.
In der letzten Nacht hatte sie in der Gewissheit wachgelegen, dass er eine Todesnachricht enthielt. Ihr Versuch, logisch zu denken, hatte nichts genützt. Umsonst hatte sie sich gesagt, dass man sie in diesem Fall angerufen oder vielleicht sogar einen Polizeibeamten oder irgendwelche Verwaltungsleute bemüht hätte. Kaum hatte sie sich von dieser These überzeugt, protestierte ihr Verstand, dass sie sich zu wichtig nahm. Ihre Mutter zu wichtig nahm. In den frühen Achtzigern, als sie noch bei ihren Großeltern lebte und gelegentlich Spießruten zwischen Reportern lief, hätte man vielleicht angerufen, aber das war lange her. Wie benachrichtigten überhaupt Gefängnisverwaltungen die Angehörigen von Verbrechern, nach denen, anders als in ihrem Fall, nie ein Hahn gekräht hatte? Sie wusste es nicht.
Sie hatte ihrem Mann noch nichts von dem Brief erzählt. Er hätte darauf bestanden, dass sie ihn öffnete oder gleich vernichtete. Klare Entscheidungen, ohne Umschweife, keine Halbheiten, das war Justus, deswegen hatte sie ihn geheiratet. Aber es war nie etwas Klares an den Gefühlen gewesen, die sie für ihre Mutter empfand.
Ihre Mutter, die behauptet hatte, dass Kompromisse nichts als ein Zugeständnis an die Sklaverei seien.
»Deine Mutter mag fehlgeleitet sein, aber sie hat immer für ihre Überzeugungen eingestanden«, hatte ihre Patentante einmal zornig erklärt, als Angelika sich weigerte, für das Solidaritätskomitee, dem Renate vorstand, auch nur ein Geleitwort zu schreiben. »Und wofür stehst du?«
»Nicht für Mord.«
»Wer ist das tapferste Kind der Welt?«, fragte ihre Mutter in dem Sommer, als Angelika vier Jahre alt und die Erinnerungen noch golden waren. »Wer lernt heute schwimmen?«
»Ich, Mami, ich!«
Es war unbedingtes Vertrauen, mit dem sie ihrer Mutter in das Meer gefolgt war; sie hatte nicht einen Moment daran gezweifelt, dass ihre Mutter ihr nie etwas geschehen lassen würde, auch nicht durch das große Meer.
Auch vor siebzehn Jahren hatte sie einen solchen Umschlag bekommen. Man sah ihm an, dass er von einer Behörde stammte. Das amtliche Schreiben hatte ihr mitgeteilt, dass ihre Weihnachtspost von ihrer Mutter nicht angenommen worden sei und hiermit zurückgehe. Ohne Erklärung, ohne Nennung von Gründen. Damals war Angelika elf Jahre gewesen und nur zu bereit zu glauben, es müsse an der Gefängnisverwaltung liegen. Sie hatte den erhitzten Diskussionen zwischen den Großeltern und der Patentante gelauscht, heimlich, und war danach fest davon überzeugt gewesen, dass ihre Mutter von brutalen, gesichtslosen Bütteln daran gehindert wurde, ihr weiter zu schreiben, und in unmittelbarer Gefahr schwebte, im Gefängnis umgebracht zu werden. Gewiss konnte es keine andere Erklärung geben.
Daraufhin hatte sie wochenlang Alpträume gehabt, bis der nächste Brief eintraf, in der Handschrift ihrer Mutter und an die Großeltern gerichtet. Darin stand etwas von »endgültigem Bruch mit den Ketten des kleinbürgerlichen Lebensstils« und »Weigerung, mich länger zu einer Sklavenmutter machen zu lassen, die durch ihr Sklavenkind von dem bestehenden Schweinesystem unter Druck gesetzt wird, ihre Genossen zu verraten«.
»Die Mami wird jetzt eine Zeitlang weggehen. Du musst schön brav sein. Wer ist mein tapferstes Mädchen von der Welt?«
»Ich, Mami, ich!« Waren das denn alles Lügen gewesen?
Danach hatte sie lange Zeit nichts von ihr gehört. Aber sie war alt genug geworden, um sich Informationen zu suchen. Vier Tote und ein Schwerverletzter, in unter drei Minuten. Das war es, was sich hinter den grobkörnigen Fotos ihrer Mutter in jeder Sparkasse, an jeder Litfaßsäule verborgen hatte, die ihre Großeltern ihr mit allen möglichen Geschichten zu erklären versucht hatten, als sie noch jünger gewesen war.
»Sie muss dazu gezwungen worden sein«, hatte ihr Großvater beharrt, ehe er in die Demenz abgeglitten war. »Von dem Rest der Gruppe. Sie war so ein liebes, gutes Mädchen. Hat immer nur das Beste gewollt.«
Er und die Großmutter hatten sich bis zum Schluss geweigert, ihre Tochter anders zu sehen. Das gute Mädchen, das freiwillig Sozialdienste leistete, nicht die Fremde, die sich weigerte, mit ihnen zu verkehren, und ganz bestimmt nicht »das Biest von Nürnberg«, wie die Presse sie nannte, Mitbeteiligte am Tod eines Staatssekretärs des Justizministeriums, des Fahrers und zweier seiner Leibwächter, mitverantwortlich an den schweren Verletzungen des dritten Leibwächters, die diesen über Monate im Koma hielten.
Nun waren die Großeltern tot. Die Geburt von Angelikas Zwillingen hatte nur noch die Großmutter bewusst erlebt, aber die Jungen konnten sich nicht mehr an sie erinnern und kannten die Urgroßeltern nur von den Familienfotos. Von Angelikas Mutter wussten sie nichts. Gar nichts. Es war eine gemeinsame Entscheidung der Eheleute gewesen. Oder, besser gesagt, ein Vorschlag von Justus, dem Angelika sofort gefolgt war. Die Vorstellung, dass die Jungen ihre eigene Kindheit wiederholen sollten, war ihr unerträglich gewesen.
Inzwischen gingen die Zwillinge in die Schule, aber wie von Justus prophezeit, stellte niemand die Verbindung zwischen ihnen und dem her, was er beschönigend als »die alten Geschichten aus den Siebzigern« nannte. Justus hatte zu den Menschen gehört, denen der Name »Martina Müller« zunächst nichts sagte, als Angelika ihm die Gegebenheiten gestand. Dabei hatte die Geschichte ihrer Mutter, das war ihr klar, den Reiz ihrer Beziehung erhöht, genau wie der Umstand, dass Justus in fast allem den Idealen ihrer Mutter hundertprozentig widersprach: Er war ein Zahnarzt, der CSU wählte und aus der Großstadt Nürnberg nach Bamberg in eine Kleinstadt gezogen war.
Sie hatte der Mutter dennoch ihre Verlobungsanzeige geschickt, nicht, weil sie eine Antwort erwartete, sondern weil sie wusste, dass bereits die bürgerliche Sitte einer Verlobungsanzeige ihrer Mutter alles über Justus sagen würde, was nötig war. Und doch war genau diese Anzeige der Anlass für ihre Mutter gewesen, ihr Schweigen zu brechen und wieder auf ihre etwas eigenwillige Art in Verbindung mit Angelika zu treten: über Zeichnungen. Sie hatte ihr ein paar als Hochzeitsgeschenk geschickt. Zeichnungen wie diejenigen, die sie einst für die kleine Angelika gemacht hatte. Martina Müller war Kunststudentin gewesen, als sie zur neu gegründeten Hochschule für Fernsehen und Film in München ging. Selbst als sie schon längst an Demonstrationen teilnahm, hatte sie immer noch Comics geliebt und für ihre kleine Tochter deren Lieblingsfiguren an die Wand des Kinderzimmers gemalt.
Die Zeichnungen rissen für Angelika unerwartet die Barriere nieder, die sie zwischen den Erinnerungen an ihre frühe Kindheit und der Frau in der Zelle errichtet hatte, und machten ihren Versuch zunichte, diese als zwei verschiedene Personen zu sehen. Sie schrieb ihr. Sie machte auch zwei Besuche. Aber sie war kein Kind mehr. Sie kam mit Fragen, die nicht beantwortet wurden, und Vorwürfen, gegen die sich ihre Mutter mit Parolen verteidigte, als sei Angelika eine Journalistin. Nachdem die Zwillinge geboren worden waren, beschloss sie, einen Schlussstrich zu ziehen. Nun war sie selbst Mutter, und sie konnte noch weniger als vorher verstehen, was Martina getan hatte.
Unwillkürlich stellte sie sich vor, die Zwillinge würden jeden Kontakt zu ihr abbrechen. Doch das wäre etwas anderes, schließlich hatte Martina sie zuerst verlassen. Sie, Angelika, würde ihre Söhne nie im Stich lassen. Und bestimmt nicht, um Kaufhäuser anzustecken, Autobomben zu legen und Menschen umzubringen. Ihre Söhne würden nie einen Grund haben …
Die Großeltern hatten nie aufgegeben. Trotz des Getuschels unter den Nachbarn und der Zeitungsartikel, die mehr oder weniger deutlich fragten, was denn bei der Erziehung der Martina M. schiefgelaufen war. Trotz der Jahre ohne Briefe und Anrufe, sie hatten nie aufgegeben.
Zum Glück war jetzt auch nur der eine Brief gekommen. Wenn sie ihn weiter ungeöffnet ließ, räumte sie ihm nur noch mehr Bedeutung ein, weil sie nicht aufhören würde, sich die verschiedensten Möglichkeiten seines Inhalts vorzustellen. Sie würde ihn lesen und damit dem Spuk ein Ende bereiten. Ob sie ihn beantwortete, würde davon abhängen, was drinstand.
Es war keine Todesnachricht. Ganz gewiss war es keine Todesnachricht. Sie musste den Brief schon deswegen öffnen, um diesem albernen Gedanken ein Ende zu setzen.
Nachdem sie den Brief geöffnet hatte, fiel ihr als Erstes auf, dass es sich um einen Computerausdruck handelte. Also nicht von ihrer Mutter, die ihre Nachrichten grundsätzlich per Hand verfasste, auch nachdem ihr Zugang zu einer Schreibmaschine gewährt worden war. Auch nicht von der Anstaltsleitung, obwohl der Umschlag den Stempel der bayerischen Anstalt trug, in die ihre Mutter vor Jahren aus Stammheim verlegt worden war. Der Briefkopf war ihr ebenfalls unbekannt. Ein Pastor hatte ihr geschrieben. Kälte erfasste sie, und nun war sie überzeugt, dass ihre Mutter tot war. Luft kämpfte sich aus ihrem Mund, etwas, das weder ein Seufzen noch ein Aufatmen war, sondern ein Herauspressen von allem, was sich in ihr über die Jahre aufgestaut hatte.
Lies, befahl sie sich. Das wenigstens schuldest du ihr. Lies den Brief.
»Sehr geehrte Frau Limacher, ich schreibe Ihnen aus eigenem Antrieb und ohne Wissen Ihrer Mutter, die vor kurzem die Nachricht erhalten hat, dass ihre Begnadigung durch den Bundespräsidenten Herzog unmittelbar …«
Die Schrift tanzte vor ihren Augen. Begnadigung. Ihre Mutter würde freigelassen werden.
Alex erhielt die Nachricht per E-Mail; eine seine Quellen im Präsidialamt berichtete ihm, dass eine Begnadigung von Martina Müller in wenigen Wochen bevorstand. Als er die E-Mail gelesen hatte, schaffte er es gerade noch zur Toilette im Flur, ehe er sich übergab.
Dabei kam diese Nachricht nicht unerwartet. Die Presse hatte mehrfach spekuliert, dass der Bundespräsident sich nach dem von Außenminister Kinkel erreichten Gewaltverzicht der RAF mit Begnadigungen beschäftige. Die Müller hatte fast zwanzig Jahre hinter sich, und zu lebenslang verurteilte Mörder wurden meist nach fünfzehn Jahren entlassen, sofern sie nicht mehr als eine Gefahr für die Gesellschaft eingestuft wurden. Martina Müller wäre auch nicht die erste Terroristin, die man vorzeitig entließ. Seit Verena Becker 1989 begnadigt worden war, hatte es im letzten Jahrzehnt noch weitere Fälle gegeben. Ja, er hatte mit dieser Möglichkeit schon eine Weile gelebt, aber dennoch gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Nicht Martina Müller, nicht Sybille Helmstedt, und nicht Herbert Malzer. Wie oft war er gefragt worden, ob er wissen wolle, wer seinen Vater umgebracht hatte, und er hatte fast immer geantwortet, nein, das bringe ihm seinen Vater nicht zurück und könne nicht helfen, das Geschehene besser zu verarbeiten. Aber das war gelogen. Es war für ihn keine juristische Frage, wer schuld am Tod seines Vaters war, es war eine moralische. Alle Beteiligten hatten das gleiche mörderische Engagement entfaltet und waren dafür bestraft worden. Aber er wollte, dass der Schütze Reue zeigte. Von Martina Müller oder Herbert Malzer. Nur der Einzelne war in der Lage, für seine Taten Verantwortung zu übernehmen, und solange das nicht geschah, konnte er auch keinem aus der Gruppe verzeihen.
Von Berlin nach Nürnberg gab es eine direkte ICE-Verbindung. Er konnte sich nicht vorstellen, seiner Mutter diese Nachricht per Telefon zu übermitteln, und sie musste es von ihm erfahren, nicht von einem Fremden. Flüchtig zog er einen Flug in Erwägung, aber bei den üblichen Staus auf der Fahrt von und zu den jeweiligen Flughäfen käme es fast auf die gleiche Zeit hinaus.
Seine Chefin nahm ihm die Geschichte von dem plötzlichen familiären Gesundheitsproblem zum Glück ab. Er war als Reporter gut genug, um einen gewissen Handlungsspielraum zu haben, doch wenn er ihr die Wahrheit gesagt hätte, dann hätte er die Story bereits in der Nachtausgabe wiedergefunden. Nicht als Schlagzeile der ersten Seite, das waren die Überbleibsel der RAF nicht mehr wert. Aber doch in prominenter Position, und wahrscheinlich hätte das Fernsehen nach Auslieferung der ersten Ausgabe einen eigenen Bericht gesendet. Diese Möglichkeit bestand immer noch. Er war nicht der einzige Journalist mit Quellen.
Wenigstens würde niemand auf die Idee kommen, ein Kamerateam zu seiner Mutter zu schicken. Wenn man an die Opfernamen der RAF-Terroristen dachte, fielen den Leuten die der Politiker und Wirtschaftsbosse wie Schleyer, Rohwedder und Ponto ein. Nicht die der Fahrer, Personenschützer und Polizisten.
Sein Vater war froh gewesen, so froh, als er damals als Hauptfahrer für den Staatssekretär abgestellt worden war. Nicht nur, weil er so mehr in Deutschland herumkam. Er liebte Autos, und wenn es für einen Mann wie ihn unmöglich war, sich je selbst eines der Modelle aus Stuttgart mit acht Zylindern zu leisten, so konnte er sie nun fahren, warten und sogar, ehe die Vorschriften verschärft wurden, gelegentlich seine Frau und seinen kleinen Sohn mitnehmen, wenn er als Kurier eingesetzt war. Alex konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie alle drei im Mercedes 450SE gesessen hatten, als sein Vater den Auftrag hatte, eine vergessene Akte in Bonn zu holen.
»Und jetzt wirst du sehen, was der Achtzylinder auf einer Strecke ohne Geschwindigkeitsbegrenzung kann, Alex«, hatte sein Vater fröhlich erklärt.
»Nein, Sascha, bitte nicht«, hatte seine Mutter protestiert, während Alex begeistert ja geschrien hatte.
»Lieber Gott, bitte schick uns einen Stau«, hatte sie erklärt.
»Irene, du weißt doch, dass ich vorsichtig fahre. Immer. Und gerade mit dem Buben.«
Sein Vater war kein überschwenglicher Mann gewesen, kein Mann leidenschaftlicher Erklärungen, aber ein Mann, der auch noch nach einem langen Arbeitstag bis weit über Mitternacht in der Küche saß, um den Plattenspieler seines Sohnes zu reparieren. Ein Mann, der den langen Weg von Hamburg nach Nürnberg fuhr, um wie versprochen dabei zu sein, wenn sein Sohn zum ersten Mal in der Fußballmannschaft der Schule bei einem Turnier spielen durfte.
Ein Mann, der von vierundzwanzig Projektilen getroffen worden war. In dem Bekennerschreiben der RAF fiel er unter die Rubrik »Späne.«
»Wo gehobelt wird, da fallen Späne.«
Vonseiten des Staats hatte es Beileidsbekundigungen gegeben, gewiss. Aber danach kam nichts mehr. Seine Mutter und er blieben mit ihrem Kummer auf sich gestellt. Selbst wenn das Konzept einer Therapie ihnen nicht völlig fremd gewesen wäre, hätten sie es sich auch nicht leisten können, einen Therapeuten zu besuchen. Sie mussten mit ihren Alpträumen alleine fertig werden. Sein Vater war versichert gewesen, aber noch jung; die Rente reichte kaum. Seine Mutter hatte schließlich Glück gehabt, eine Stelle als Verkäuferin in einer Parfümerie zu bekommen. Zu Beginn besuchten sie hin und wieder die Familie des Staatssekretärs, die immer mehr über die Ermittlungen wusste, aber das half nicht wirklich. Statt sie miteinander zu verbinden, bewirkten die Besuche nur, dass sich ihre Wunden jedes Mal etwas weiter öffneten. Alex und der damals schon fast erwachsene Sohn von Staatssekretär Werder hatten einander nur angestarrt und nicht gewusst, was sie reden sollten. Seine Mutter wurde von Mal zu Mal bitterer und erklärte bei dem letzten Besuch, ihrem Mann wäre nie etwas geschehen, wenn er nicht ausgerechnet den Staatssekretär des Justizministeriums gefahren hätte. Das wiederum konnte Frau Werder ihr nicht verzeihen. Danach hatte es keine Treffen mehr gegeben.
Er verbrachte die Fahrt im Zug damit, sich Notizen für einen Artikel zu machen, den er nie schreiben würde. Es war einfacher, als nach Worten zu suchen, die seiner Mutter helfen würden, wenn sie erfuhr, dass einer der drei verurteilten Mörder ihr demnächst auf der Straße begegnen könnte.
Als sie Martina Müller und Herbert Malzer gefasst hatten und die Staatsanwaltschaft die Verbindung zwischen ihnen und dem Attentat auf Staatssekretär Werder herstellen konnte, war er noch naiv genug gewesen, um zu glauben, dass dadurch Gerechtigkeit erreicht werden konnte. Dabei war die dritte Beteiligte, Sybille Helmstedt, immer noch flüchtig, und von weiteren Mittätern war nie die Rede gewesen. Aber weder die Müller noch Malzer legten je Geständnisse ab. Sie wurden nach der Indizienlage verurteilt und zeigten niemals auch nur einen Hauch von Reue über ihre Tat. Wenn sie sich äußerten, dann nur darüber, wie der »Schweinestaat« sie misshandelte und sich als faschistisch entlarve. Wenigstens wurden sie angemessen verurteilt. Er hatte damals fast inbrünstig gehofft, dass all die Vorwürfe über Isolationsfolter und vorgetäuschte Selbstmorde wahr wären, und den Fehler gemacht, das in Hörweite eines Lehrers auszusprechen. Es hatte ihm einen langen Vortrag über Lynchjustiz und Rechtsverständnis sowie die Nutzlosigkeit von Rache eingebracht. Vor allem aber hatte er daraus gelernt, wie unbequem und unangenehm es den Leuten war, wenn man sich als Familienangehöriger eines Mordopfers nicht nur den Kopf tätscheln ließ und schweigend Floskeln anhörte, sondern Forderungen nach angemessener Vergeltung stellte.
Die Müller und der Malzer wurden zu viermal lebenslänglich Zuchthaus verurteilt und machten nur noch von sich reden, als sie sich an dem von Brigitte Mohnhaupt 1984 initiierten Hungerstreik beteiligten. Gott sei Dank brachte das für keinen der RAF-Terroristen Resultate. Danach hörte er nichts mehr von ihnen. Er war erwachsen geworden, und obwohl er manchmal immer noch in der Überzeugung aufwachte, sein Vater sei am Leben, und er ihn in der Sekunde der Bewusstwerdung jedes Mal aufs Neue verlor, wurde es leichter. Er konnte mit seiner Mutter über schöne Erlebnisse mit dem Vater sprechen, und beide lachten, statt zu weinen. Er konnte sich in einer Existenz ohne Vater einrichten.
Dann fiel die Mauer, und kein Jahr später kam heraus, dass Sybille Helmstedt mit neun weiteren RAF-Terroristen in der DDR untergekommen war und seit Jahren eine normale Bürgerexistenz führte. Als Lehrerin, mit Mann und Kind.
»Aber jetzt kommt sie doch ins Gefängnis?«, hatte seine Mutter gefragt, und Alex hatte ihr erklären müssen, dass Sybille Helmstedt zwar eine Gefängnisstrafe erwarte, aber nur ein paar Jahre, da sie die neu eingeführte Kronzeugenregelung für sich in Anspruch nahm.
Sybille Helmstedt hatte Informationen geliefert, zu mehreren Attentaten. Aber weil sie sich nicht selbst belasten musste, sagt sie nichts Konkretes zu dem Attentat auf Staatssekretär Werder. So wussten sie über die letzten Lebensminuten seines Vaters auch heute noch nur das, was Polizei und die Staatsanwaltschaft rekonstruiert hatten. Spätestens im nächsten Jahr würde die Helmstedt ebenfalls freikommen. Sich darauf vorzubereiten war schon schlimm genug gewesen. Aber Martina Müller? Die Helmstedt tat wenigstens so, als ob sie so etwas wie Bedauern für die Taten der RAF empfand. Die Müller dagegen tat das nicht.
Er stellte sich Martina Müller immer noch als die junge Frau auf den Fahndungsfotos vor. Natürlich würde sie inzwischen anders aussehen. Aber das machte alles noch schlimmer. Sich bei jeder unbekannten Frau Ende vierzig zu fragen, ob sie möglicherweise die Mörderin seines Vaters war – was für ein Leben sollte das sein? Martina Müller würde bei der Lebenserwartung von Frauen noch Jahrzehnte in Freiheit vor sich haben. War das gerecht?
Es musste sich herausfinden lassen, wie sie heute aussah und wo sie leben würde. Und dann würde er sie zur Rede stellen. Er hatte keine kindischen Rachephantasien mehr, redete er sich ein. Aber er wollte die Wahrheit wissen. Über den Tod seines Vaters, wer von den bekannten drei Beteiligten was getan hatte und ob es noch weitere Täter gab. Und, noch wichtiger: Warum das alles? Aus reiner Menschenfreundlichkeit hatte das Ministerium für Staatssicherheit der DDR Sybille Helmstedt und ihren Freunden bestimmt nicht Unterschlupf gewährt. Die Verbindung musste schon länger bestanden haben, aber offiziell hatte man in der BRD nie davon gewusst.
Wenn der Tod von Staatssekretär Werder nicht nur von einem Haufen mörderischer Wirrköpfe geplant und ausgeführt worden war, wenn es irgendwo noch jemanden gab, der Werders Tod gewollt hatte und der immer noch frei herumlief, wusste Martina Müller das. Da war er sicher.
Er musste nur eine Methode finden, um ihr die Wahrheit zu entlocken.
Angelikas Großeltern waren beide gläubige Protestanten gewesen. Der Großvater hatte in seiner Jugend sogar mit dem Gedanken gespielt, Geistlicher zu werden, aber sich dann für die Lehrerlaufbahn entschieden, weil die Berufung zum Pastor nicht stark genug gewesen war. Ihre Mutter war vor dem Studium in der evangelischen Jugend tätig gewesen. Bei Angelika lagen die Dinge völlig anders. In ihrer frühen Kindheit hatte Martina die Religion mit Ingrimm hinter sich gelassen, und ihr Vater war angeblich nie religiös gewesen. Später, als Angelika bei den Großeltern lebte, machte sie Tischgebete mit und ließ sich konfirmieren. Seit sie aber ab zwölf alle Zeitungsartikel über ihre Mutter gelesen hatte, wunderte sie sich nicht mehr, dass ihre Großeltern sie nie gedrängt hatten, sich in den Jugendgruppen der Gemeinde zu betätigen. Schließlich spekulierten viele Reporter, ob das frühe soziale Engagement ihrer Mutter eine Vorbereitung für Terrorismus gewesen war.
Sie hegte keinen Groll gegen die Kirche. Aber sie verspürte auch nicht das Bedürfnis, den Glauben zu suchen. Seit ihrer Konfirmierung hatte sie nicht mehr mit einem Pastor gesprochen, und Justus und sie waren nur standesamtlich verheiratet.
Der Gefängnisgeistliche, der sie mit dem so erschreckenden Brief um einen Anruf gebeten hatte, klang am Telefon jünger, als sie erwartet hatte. Fast, als sei er in ihrem Alter.
»Gerade bei einem Fall wie dem Ihrer Mutter ist es wichtig, dass sie in der Welt dort draußen nicht allein gelassen wird«, sagte er.
»Die Gefahr besteht kaum«, entgegnete Angelika ungewollt scharf. »Schließlich gibt es ein Solidaritätskomitee.«
Wenigstens nahm sie an, dass es immer noch existierte. Auch mit Renate hatte sie längere Zeit nicht gesprochen, was jedoch nicht nur an ihrer Uneinigkeit über ihre Mutter lag, sondern auch daran, dass Renate Huber inzwischen Bundestagsabgeordnete bei den Grünen war und nie einen Hehl daraus machte, dass sie von Angelikas berufslosem Zustand nach dem dritten Babyjahr genauso wenig hielt wie von ihrer Parteilosigkeit.
»Frau Limacher, das meine ich nicht«, erwiderte der Pastor.
»Ich weiß, was Sie meinen. Aber meine Mutter und ich haben keine Beziehung. Wir haben keine mehr gehabt, seit sie … seit vielen Jahren nicht mehr. Wir sind einander fremd. Ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen.«
»Ich stelle mir vor«, sagte er und klang wie ein junger Referendar, dessen Enthusiasmus dafür, mit seinen Schülern die Welt zu retten, noch ungebrochen war, »dass Ihre Mutter viele Jahre in einer Welt gelebt hat, in der sie sich an ein ›Wir gegen die‹ klammern konnte. Sie wird in eine Welt zurückkehren, in der viele Menschen in ihr ein Ungeheuer, ein Monster und eine winzige Minderheit eine gemarterte Heldin sehen. Was für sie schädlicher sein kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass jemand, der in ihr weder das eine noch das andere sieht, eine immense Hilfe wäre, Frau Limacher. Nähern Sie sich Ihrer Mutter wieder an.«
Er sprach von Annäherung, doch was er wirklich von ihr wollte, davon war Angelika überzeugt, war Vergebung. Das war es, was jeder Verteidiger ihrer Mutter von ihr gefordert hatte.
»Ich war nie besonders religiös«, gab sie schärfer als beabsichtigt zurück. Seine junglehrerhafte Art erschien ihr anmaßend. »Aber ich weiß noch, dass Sünden nicht vergeben werden können, wenn sie nicht vorher bereut werden. Oder haben Sie das in Ihrem Seminar anders gelernt?«
Er räusperte sich. Durch das Telefon spürte sie, wie er errötete.
»Ich versuche, auf den individuellen Menschen einzugehen. Wir drücken unsere Reue manchmal sehr unterschiedlich aus. Ganz ehrlich, ich habe hier schon mit Gefangenen zu tun gehabt, die ihre Kinder gleich nach der Geburt die Toilette hinuntergespült haben. Es ist alles andere als leicht, da Verständnis und Mitgefühl aufzubringen, aber wenn ich es nicht versuche, habe ich meinen Beruf verfehlt. Jeder Mensch ist von den jeweiligen seelischen, geistigen und sozialen Umständen abhängig, in denen er lebt. Das gilt und galt auch für Ihre Mutter.«
»Egal, was das für Umstände waren, sie entschuldigen nicht, dass man zur Terroristin, zur Mörderin wird«, sagte Angelika ein wenig besänftigt, doch immer noch auf der Hut davor, sich auf eine Verharmlosung einzulassen, wie Renate sie praktizierte.
»Um Entschuldigungen geht es auch nicht. Worauf ich hinaus will, ist die Art von Begreifen, die Veränderung bewirken könnte. Jeder Mensch kann irren. Wirklich schlecht ist jemand nur, wenn er das, was er tut, während er es tut, für schlecht hält«, erwiderte der Pastor. »Es wäre schön, von sich behaupten zu können, dass man selbst so einen Weg nie gegangen wäre, egal unter welchen Umständen. Aber wenn junge Menschen ein Feindbild finden und sich von allen anderen Meinungen isolieren und sich ständig in ihrer Ideologie bestätigen, ist es schwer, sich diesem Sog zu entziehen. Daher weiß ich nicht, wie viele von uns mit gutem Gewissen sagen können, dass sie in einer ähnlichen Situation nicht mitgemacht hätten, ohne sich etwas vorzumachen. Damit wir uns richtig verstehen, Frau Limacher, ich will nichts entschuldigen. Was getan wurde, muss von Ihrer Mutter und deren Gruppe verantwortet werden. Aber nicht von der nächsten Generation«, fügte er leiser hinzu, und Angelika wusste, dass er damit auf das ungeheure Schamgefühl anspielte, das sie seit frühester Kindheit plagte und das er zu Recht bei ihr vermutete.
Sie wollte ihm zuerst an den Kopf werfen, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, was sie für ihre Mutter empfand. Sie wollte fragen, wodurch ihre Mutter Hilfe verdient hatte. Aber sie sagte nichts dergleichen. Nach einer Weile fragte sie: »Hat sie gesagt, dass sie mich sehen möchte?«
»Ihr Porträt hängt in der Zelle, Frau Limacher. Mehrere Porträts, um genauer zu sein. Alle von Ihrer Mutter gezeichnet.«
Von mir als Kind, dachte Angelika. Aber das Kind, das sie gebraucht hat, bin ich nicht mehr.
Dieses Kind wäre erleichtert und glücklich darüber gewesen, dass seine Mutter es nicht vergessen hatte und Bilder von ihm zeichnete. Die erwachsene Frau wusste aber, dass mehrere Portraits von Holger Meins daneben hingen, dem Mann, der ihrer Mutter wichtiger als ihre Tochter gewesen war.
»Es wundert mich, dass sie mit Ihnen spricht«, entgegnete Angelika, um sich nicht manipulieren zu lassen. »Statt Sie als Vertreter des Systems abzulehnen. Oder hat sie ihre Meinung geändert?«
Es sollte eigentlich eine rhetorische, bittere Frage sein. Aber noch während sie sprach, kroch in ihr etwas hoch, das sich verdächtig wie Hoffnung anfühlte. Was, wenn ihre Mutter sich wirklich geändert hatte? Nicht nur in ihrer Meinung über Pastoren, nein, in ihrer Einstellung zu ihren Taten? Was, wenn das eingetreten war, worauf die Großeltern zeit ihres Lebens gehofft hatten, und Martina wieder zu derjenigen geworden war, an die sie sich hatten erinnern wollen?
»Sagen wir es so: Sie lässt sich auf Streitgespräche mit mir ein.«
Natürlich. Es war idiotisch gewesen, auf mehr zu hoffen.
»Frau Limacher, ich bin ein Vertreter des Systems. Der Kirche, und als Gefangenenseelsorger natürlich auch Mitglied der Gefängnisleitung. Sie müssen sich jedoch vorstellen, wie es ist, über viele Jahre niemanden zu haben, der einem zuhört. Jeder Mensch braucht jemanden, der ihm zuhört, egal wie groß die Bereitschaft zur Isolierung gegenüber den Mitgefangenen ist. Keiner hält das durch, obwohl man sich für diese Kollaboration mit dem Feind am liebsten geißeln möchte. Aber Sie sind Frau Müllers Tochter. Und sie wird nichts anderes in Ihnen sehen als eine Angehörige, wenn Sie bereit sind, nach ihrer Freilassung Zeit mit ihr zu verbringen.«
Angelika dachte an ihre Söhne. Sie wäre immer für sie da, egal, welchen Kummer sie ihr machen würden. War das hier etwas anderes? Ganz gleich, was geschah, sie würde den Jungen erklären müssen, was es mit ihrer unbekannten Großmutter auf sich hatte. Denn Angelika machte sich keine Illusionen: Früher oder später würden die Medien erfahren, dass ein Mitglied der RAF freigelassen wurde. Und auf dem Schulhof gab es keine Rücksichtnahme.
»Das sind alles Lügen«, behauptete Renate Huber in ihrer Erinnerung. »Und Missverständnisse. Deine Mami wollte den Menschen immer nur helfen, sie gegen das Unrecht anderer verteidigen. Es gibt auch eine ungeheure Solidarität für sie und ihre Freunde. Sie hat vielleicht manchmal ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Aber du wirst sehen, bald ist sie wieder da, und alles wird ins Reine kommen. Höre nicht auf das, was die anderen in der Schule sagen. Du brauchst dich für nichts zu schämen.«
Lügen. Daran hatte sie sich lange geklammert. Die Wahrheit hatte sie, als sie sie verstehen konnte, umso härter getroffen. Aber sie würde ihre Jungen nie anlügen, sie würde ihnen alles sagen und es nicht so hinstellen, als sei Martina Mitglied einer modernen Version der Robin-Hood-Gruppe gewesen. Wahrscheinlich hatte Renate es damals gut gemeint, aber es hatte alles nur noch schlimmer gemacht.
Sie versuchte, sich ihre Mutter und ihre Söhne im gleichen Raum vorzustellen, und scheiterte.
»Da ist noch etwas«, unterbrach der Pastor ihren Gedankengang. »Der Tod von Staatssekretär Werder, seiner Leibwächter und des Chauffeurs. Weder Ihre Mutter noch die übrigen Täter haben sich je dazu geäußert, bis auf das Bekennerschreiben ihres Kommandos natürlich. Ich glaube, es würde den Angehörigen Frieden verschaffen, wenn ein Gruppenmitglied das jetzt täte.«
Das Attentat war nicht das einzige Verbrechen gewesen, für das ihre Mutter verurteilt worden war. Sie verstand nicht, warum er gerade dieses nannte, aber das Prinzip, auf das er hinauswollte, begriff sie sehr wohl.
»Dazu müsste meine Mutter ihre Taten bereuen. Glauben Sie, dass sie dazu fähig ist? Und sagen Sie nicht wieder, ich sei ihre Tochter. Wir sind uns fremd. Sie sind derjenige, der sie in den letzten Jahren erlebt hat.«
»Um das herauszufinden, müssen Sie mit Ihrer Mutter sprechen«, entgegnete er, und Angelika war versucht, den Telefonhörer gegen die Wand zu werfen. Wie konnte sie jetzt noch ablehnen, einen Versuch zu machen? Sie war nie einem der Opferangehörigen begegnet, natürlich nicht. Aber sie hatte die Fotos in den Zeitungen und in den Fernsehnachrichten gesehen, noch zu einer Zeit, als sie sich an die Worte ihrer Patentante geklammert hatte, alle Beschuldigungen seien Lügen.
Du brauchst nur eine Entschuldigung, wisperte eine höhnische Stimme in ihr. Du brauchst nur eine Entschuldigung, um wieder um die Zuneigung deiner Mutter zu betteln. Wie alt bist du?
»Aber was hat sie getan, um begnadigt zu werden?«, fragte seine Mutter hilflos. »Ich verstehe das nicht.«
»Politik«, entgegnete Alex und stellte fest, dass es immer noch größere Grade an Bitterkeit gab, die man in ein Wort legen konnte, als man dachte. »Ich nehme an, das ist einer der Kompromisse dafür, dass die Bande sich vor ein paar Wochen endlich für aufgelöst erklärt hat.«
»Aber …«, begann seine Mutter, unterbrach sich und verstummte. Ihr Gesicht war aschgrau, man sah jede einzelne Falte. Dabei konnte er sich noch gut an eine Zeit erinnern, als ihr niemand geglaubt hatte, dass sie schon einen so großen Sohn hatte, weil sie stets so jung gewirkt hatte wie ein etwas zu groß geratenes Schulmädchen.
Er roch nun immer den Melissengeist in ihrem Atem. Nach dem Tod seines Vaters waren die Weinkrämpfe und Alpträume so schlimm geworden, dass die Ärzte ihr Pillen verschrieben hatten, die ihr eine lethargische Gleichmut verschafften, sie aber abhängig machten. Schließlich schaffte sie es, aus dieser Abhängigkeit auszubrechen, aber seither trank sie Klosterfrau Melissengeist, denn das war Medizin, kein Alkohol. Ihr Mund war davon ständig rissig und aufgesprungen.
»Wo?«, fragte seine Mutter tonlos. »Wo wird sie hingehen?«
Er wusste, wovor sie Angst hatte: der Frau auf der Straße zu begegnen, ihr und in ein, zwei Jahren ihren Komplizen, ohne es zu wissen. Das war auch bis zu ihrem Tod die Angst seiner Großmutter gewesen, deren Lebenswille aber schon die erste heftige Grippe nach dem Tod ihres Sohnes nicht mehr überstanden hatte. Seine Mutter hatte immer noch einen Aushilfsjob in der Parfümerie, inzwischen weniger des Geldes wegen, sondern weil er ihr etwas zu tun gab und sie Freunde unter den Kollegen hatte. Und nun konnte es sehr wohl sein, dass eines Tages eine Kundin Martina Müller sein würde. Die Mörderin seines Vaters würde möglicherweise völlig unbedarft das Geschäft betreten, denn er bezweifelte, dass sie sich an den Namen des Fahrers und der Personenschützer erinnerte, geschweige denn wusste, dass diese Familienangehörige gehabt hatten, die nun unterbezahlten Hilfstätigkeiten nachgehen mussten.
»Ich werde es herausfinden«, sagte er. Inzwischen war ihm eine Fährte eingefallen, der zu folgen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen würde. Die Bundestagsabgeordnete Renate Huber war mit der Müller befreundet gewesen, ehe diese sich radikalisiert hatte, und noch ein gutes Stück länger. Die Polizei hatte der Huber allerdings nie Beteiligungen an illegalen Handlungen nachweisen können, und so war es auch nie zu einer Anklage wegen linksradikalen Aktivitäten gekommen. Sie hatte sogar einem »Solidaritätskomitee für Martina Müller« vorgestanden, das Mitte der Achtziger während eines RAF-Hungerstreiks gegründet worden war. Inzwischen war sie jedoch sehr respektabel und hatte laut Berliner Klatsch Ambitionen, Ministerin zu werden, sollte Rot-Grün die Wahl gewinnen. Also würde sie die öffentliche Meinung nicht mehr mit dieser alten Freundschaft zu einer RAF-Terroristin strapazieren wollen. Aber er würde darauf wetten, dass sie genau wusste, wann die Müller entlassen wurde und wo sie sich dann aufhalten würde, ob sie nun noch immer mit ihr in freundschaftlichem Kontakt stand oder nicht. Schon aus Eigeninteresse, jeder Politiker mit langfristigen Zielen behielt potenzielle Zeitbomben für die Karriere im Auge, und das war Martina Müller für die Huber bestimmt.
Renate Huber hatte ihr Abgeordnetenbüro in Berlin, und es fiel ihm nicht weiter schwer, kurzfristig einen Termin zu bekommen. Er verbrachte den Abend mit seiner Mutter, doch die Sprachlosigkeit zwischen ihnen war fast unerträglich. Über den Vater zu reden, war von neuem zu einer offenen Wunde geworden, und seine Versuche, sie durch Geschichten aus seinem Alltag abzulenken, verliefen im Sand, weil er sich nicht darauf konzentrieren konnte. Hin und wieder verschwand sie in der Küche. Am liebsten hätte er ihr gesagt, sie könne ihren Melissengeist auch vor ihm trinken, aber das brachte er nicht über sich. Sie hing an der Illusion, dass er nichts über ihre Abhängigkeit wusste.
Nachdem sie zu Bett gegangen war, nahm er den Nachtzug nach Berlin. Schlafen kam für ihn aber nicht in Frage. Renate Huber, dachte er. Jurastudentin, als sie die Filmstudentin Martina Müller kennenlernte. Im Gegensatz zur Müller brach Renate Huber ihr Studium nicht ab, doch sie gingen zeitgleich nach Hamburg, wo beide Mitglieder im Komitee gegen Folter wurden. Dort war die Müller allem Anschein nach für die RAF rekrutiert worden und irgendwann untergetaucht. Renate Huber beendete dagegen ihr Studium in Hamburg, wo sie auch später als Anwältin innerhalb verschiedener sozialistischer Anwaltskollektive die Verfahren der Außerparlamentarischen Opposition betreute, ehe sie nach Berlin umzog und sich den Grünen anschloss. Sie war bis dahin immer eine offene Sympathisantin der linken Bewegungen gewesen und wurde polizeilich überwacht, aber man hatte nie Beweise für eine aktive Mitgliedschaft gefunden, weder hatte sie verdeckte Wohnungen angemietet, noch Autos geklaut, noch hatte man ihre Fingerabdrücke irgendwo entdeckt, wo sie nicht hätten sein sollen.
Er konnte sich aber nicht vorstellen, dass sie sich tatsächlich so abseits von allen illegalen Aktivitäten gehalten hatte, wenn sie so eng mit Martina Müller befreundet gewesen war. Aber offenbar hatte sie ihre Spuren gut genug verwischt, um den polizeilichen Überprüfungen standzuhalten. Dabei wurde sie später auch verdächtigt, als Anwältin Kassiber von inhaftierten RAF-Terroristen nach draußen geschmuggelt zu haben. Aber unter diesem Verdacht standen auch die Abgeordneten Schily und Ströbele. Nur mit ein paar Anschuldigungen würde er die Huber nicht überrumpeln können. Aber wenn sie so kurzfristig Interviews gab, war sie auf gute Presse aus, und das verschaffte ihm Spielraum.
Es war leichter, sich Strategien für den Umgang mit Renate Huber zu überlegen, als an seine Eltern zu denken. An das völlige Unvermögen, etwas zu sagen, was seiner Mutter half. An den Vater, wie er ihm aus einem Bilderbuch vorlas und geduldig die unsinnigsten Fragen beantwortete.
»Warum hat der Hase oben nur einen Zahn und unten zwei, Papa?«
»Hm, weil er seine Zähne nicht geputzt hat. Früher, da hat er nämlich mehr gehabt. Und nun lass mal deine sehen, mein Junge!«
Er versuchte, sich seinen Vater lebend vorzustellen, als Mann im Ruhestand, immer noch leidenschaftlich an Autos interessiert, vielleicht sogar ständig auf Reisen mit der Mutter, nun, da sie beide Zeit hatten und er eine gute Pension. Aber er war sich bewusst, dass es ein idealisiertes und ungenaues Bild war. Wenn sein Vater noch am Leben gewesen wäre, als Alex in die Pubertät kam, hätten sie sich hin und wieder gestritten. Vielleicht hätte der Vater seine Lieblingsbands gehasst und wäre bestimmt entsetzt gewesen über Alex’ kurzfristige Punkphase.
Alex hätte alles darum gegeben, derartige Erinnerungen zu haben. Stattdessen hatte er die Fotos vom Tatort und von der Obduktion. Das hatte einiges an Recherche, Beziehungen und Bestechung gekostet, denn natürlich sollten sie nicht den Angehörigen gezeigt oder veröffentlicht werden. Nachdem er aber selbst Mitglied der Presse geworden war, hatte er Mittel und Wege gefunden.
Renate Huber hatte, soweit er sich erinnerte, niemals auch nur ein Wort der Sympathie für die Opfer ihrer guten Freundin Martina Müller geäußert. Das Wort »Opfer« gebrauchte sie in anderen Zusammenhängen. Aber sie war nicht mehr die junge Radikale, die sich darauf verlassen konnte, dass ihr Wahlkreis in Berlin ihr zustimmte. Nein, inzwischen wollte sie auch von Leuten gewählt werden, die regelmäßig BILD lasen und nicht das geringste Verständnis für ehemalige Terroristen hatten. Der Spruch »Rot denken, grün wählen, blau machen, schwarz schaffen«, sollte sogar von ihr sein. Worte formten sich in ihm.
Nur ein paar Stunden später fand er sich in Renate Hubers Büro wieder, flirtete ein wenig mit der Sekretärin, die vielleicht noch für Auskünfte nützlich sein konnte, und erfuhr, dass er sein Interview im Laufen und Fahren würde durchführen müssen.
»Frau Huber hat einen dichten Terminkalender. Aber es ist eine Halbstundenfahrt bis zu der Schule, wo sie ihren nächsten Termin hat, und auf dem Weg dorthin können Sie Ihre Fragen stellen.« Mit einem entschuldigenden Lächeln setzte sie hinzu: »Tut mir leid, aber Sie haben gesagt, es sei eilig und müsse kurzfristig sein«
»Kein Problem«, antwortete er beruhigend und fragte sich, ob die aufstrebende grüne Politikerin von heute schon mit Auto und Fahrer unterwegs war. Die meisten Abgeordneten, die er kannte, waren diesbezüglich gerne zu ›Spesen‹ bereit. Wie sich herausstellte, war sie dazu jedoch zu klug, wenn sie einen Vertreter der Medien mit sich nahm. Sie machten sich auf den Weg zur S-Bahn.
»Wie überaus volksnah«, bemerkte er. Er kannte sie von Fotos und aus dem Fernsehen, hier, aus der Nähe betrachtet war sie eine gewandte Mitvierzigerin, die allem Anschein nach regelmäßig Sport machte und es noch nicht nötig hatte, sich auf künstliche Weise zu verjüngen. In ihre lockigen blonden Haare mischte sich allerdings das erste Grau. Sie trug Jeans, aber es entging ihm nicht, dass es sich um solche eines bekannten Designer-Labels handelte, was auch auf ihre Jacke zutraf. Die rote Bluse darunter war aus Seide. Unter anderen Umständen hätte er sie durchaus als attraktiv empfunden.
»Nur praktisch«, gab sie zurück. »Sind Sie denn mit dem Auto da? Um diese Zeit?«
»Touché.«
Sie hatte einen schnellen Schritt, ihre Brunate-Schuhe waren elegant, aber flach. Er tauschte ein paar Floskeln über den Berliner Verkehr mit ihr aus und zeigte sich gebührend beeindruckt von ihrem kurzen, sehr pressegerechten Plädoyer für stärkere Förderungen von Integrationsprojekten für Migrantenkinder.
»Und ein Versöhnungsprojekt unterstützen Sie auch, wie ich höre«, fügte er hinzu. Inzwischen standen sie in der S-Bahn, um diese Zeit gab es keine freien Sitzplätze. Zum ersten Mal zeigte sie so etwas wie Verblüffung, ein kurzes Aufflackern nur, aber er erkannte, dass er sie überrascht hatte. Kein Wunder, es gab kein solches Projekt.
»Die deutsch-israelischen Beziehungen sollten uns alle wichtig sein«, erwiderte sie ausweichend und offensichtlich ratend, worauf er sich beziehen könnte.
»Kein Zweifel, aber ich meinte eigentlich Ihr Versöhnungsprojekt, bei dem die Opfer von linksradikalen Gewalttaten mit den Tätern zusammengebracht werden. Hat sich Ihre Freundin Martina Müller schon bereit erklärt, da mitzumachen?«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte sie kühl. »Und ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass sich ein Journalist Ihres Kalibers auf das Niveau der billigen Sensationspresse begibt. Wenn Sie meine Freundschaft mit Martina Müller als große Enthüllung präsentieren wollen, sind Sie zwanzig Jahre zu spät dran.«
Oh, sie war gut. Ihm entging nicht, dass der Tadel auch eine winzig kleine Schmeichelei enthielt – »ein Journalist Ihres Kalibers« sollte implizieren, dass sie nicht nur seinen Namen kannte, sondern mit seiner Arbeit vertraut war. Es war psychologisch sehr gut gemacht: Wenn er einen anderen Hintergrund gehabt hätte, würde dieser Versuch, ihn gleichzeitig zu beschämen und an seine Eitelkeit zu appellieren, höchstwahrscheinlich funktionieren.
»Frau Huber, Sie tun mir unrecht. Die Frage war aufrichtig gemeint. Meine Quelle erzählte mir, dass Sie die Freilassung von Martina Müller nutzen wollen, um ein großangelegtes Projekt zur Versöhnung zwischen RAF-Tätern und deren Opfern zu starten, und natürlich war ich fasziniert.«
Da war es wieder, das kurze Aufflackern von Überraschung, ein kleines Zucken in den Augenlidern nur, ein kurzes Straffen des Mundes, als sie das Wort »Freilassung« hörte. Wenn er nicht völlig falschlag, hatte sie bis jetzt, entgegen seiner Erwartung, nichts darüber gewusst. Das war faszinierend.
»Dann hat man Sie … vorschnell informiert«, antwortete sie und schluckte den Köder, wie er gehofft hatte. Kein Politiker, der etwas auf sich hielt, würde es ablehnen, als Ursprung von Versöhnungsinitiativen dazustehen. Er hätte sein Vermögen darauf verwettet, dass sie nun sein frei erfundenes Projekt für ein paar Interviews lang zum Leben erwecken würde, so lange, bis eine erste Meinungsumfrage ihr verriet, ob es sich lohnte oder nicht. »Es ist alles noch sehr, sehr früh im Planungsstadium, und mit Rücksicht auf die Opferfamilien möchte ich Sie bitten, noch nichts darüber zu berichten.«
Es war zu schade, dass er nicht laut lachen konnte.
»Aber selbstverständlich … solange Sie mich über den Projektstand auf dem Laufenden halten. Für ein Interview mit Frau Müller wäre ich natürlich auch dankbar.«
»Es wäre gewiss für alle Beteiligten das Beste«, sagte Renate Huber, nun wieder selbstsicher und gefasst, »wenn Frau Müller in der nächsten Zeit keine Interviews gibt. Man könnte es falsch auslegen. Sie wissen ja selbst, wie schnell das geht.«
Er machte ein paar zustimmende Geräusche, spulte sein übliches Ritual bei Politikern ab, zuhören, nicken, kein Wort glauben, und stellte ihr noch ein paar unverfängliche Fragen zu den Themen, die gerade in den Schlagzeilen waren. Er begleitete sie noch ein paar Schritte von der S-Bahn zu der Schule, wo sie eine kurze Rede als Patin des Integrationsprojekts für Migrantenkinder zu halten hatte, bevor er sich offiziell von ihr verabschiedete, um sie danach heimlich noch etwas länger zu beobachten.
Sobald sie ihn außer Hörweite glaubte, holte sie ihr Handy hervor. Der gelassene Gesichtsausdruck war fort. Während sie leise in das Telefon sprach, schaute sie geradezu verstört drein.
Tom, ein englischer Bekannter von ihm, der für Rupert Murdoch arbeitete, hatte bereits mehrfach Handys von Angehörigen des britischen Königshauses und ein paar prominenten Schauspielern anzapfen lassen. Erich Mielke hätte sich gefreut, was heutzutage alles möglich war. Einmal hatte Tom vor Alex und anderen Freunden damit geprahlt und die Aufnahme eines äußerst intimen Gespräches vorgespielt. Sie waren alle schon halb betrunken gewesen und hatten über jedes dritte Wort gelacht, aber nüchtern hatte Alex Toms Verhalten nur noch idiotisch gefunden. Sich auf diese Weise einen Rechtsbruch nachweisen zu lassen, konnte ihn ins Gefängnis bringen, und die gewonnenen Erkenntnisse waren die Sache nicht wert gewesen. Wenn es sich um Politik, Sport oder Verbrechen gehandelt hätte, wäre es etwas anderes gewesen, aber das Privatleben einiger durchschnittlicher Prominenter … Dafür hatte er erfreulicherweise den falschen Arbeitgeber.
Hier und heute wünschte er plötzlich, er hätte Tom nach der Adresse des so überaus geschickten Hackers gefragt. Nun, das ließ sich nachholen. Vielleicht irrte er sich, vielleicht war Renate Huber eine Sackgasse in seinem Versuch, Zugang zu Martina Müller zu bekommen. Inzwischen war es 1998, sie hatte ihre Zeit mit radikalen Ideen längst hinter sich gelassen, warum also nicht auch diese alte Freundschaft? Das war nur logisch. Aber in seinen Jahren als Reporter hatte er einen Instinkt für kleinere und größere Lügen entwickelt. Dieser Instinkt sagte ihm jetzt, dass sich hinter Renate Hubers Reaktion mehr verbarg.
Wie auch immer: Er brauchte weitere Quellen. Und Zugangsmöglichkeiten. Martina Müller hatte noch mehr Studienfreunde gehabt, aber sie hatten sich alle von ihr distanziert. Ihre Eltern waren tot. Ihre Mittäter waren noch im Gefängnis, Sybille Helmstedt würde als Nächste entlassen werden, aber erst in einem Jahr. Herbert Malzer sogar noch deutlich später, wenn man ihn überhaupt jemals rausließ, da man ihm die Beteiligung an weiteren Morden zur Last legte und er als einer der brutalsten und kaltblütigsten der Terroristen galt.
Er versuchte sich an jedes Foto von Martina Müller zu erinnern, das er kannte, und an die Gesichter der Menschen, die mit ihr abgebildet waren. Da er Renate Huber gerade erst verlassen hatte, kamen ihm die Fotos mit der Grünenpolitikerin als erste in den Sinn. Eines zeigte die beiden auf einer der Demonstrationen nach dem Tod von Holger Meins, kurz bevor die Müller in den Untergrund ging. Zwei junge Frauen, die ein Banner mit der Aufschrift »Mörderstaat« in der Hand hielten. Zwei junge Frauen … und ein kleines Kind.
Jetzt fiel es ihm wieder ein. Die Müller hatte eine Tochter gehabt. Es war damals in der Presse ein paarmal erwähnt worden, im Zusammenhang mit all den anderen Kindern: Baaders Tochter, Ensslins Sohn, Meinhofs Zwillingstöchter. Aber später nicht mehr, er konnte sich nicht erinnern, sie je in weiteren Artikeln gefunden zu haben. Natürlich hatte er auch nicht Ausschau danach gehalten. Eher das Gegenteil. Martina Müller, Mutter, interessierte ihn genauso wenig wie Martina Müller, Filmstudentin.
Zumindest früher nicht. Solange sie hinter Gittern saß, war es irrelevant gewesen. Aber jetzt nicht mehr.
1967 – Martina
Martina hatte sich Berlin ganz anders vorgestellt. Nicht unbedingt schöner oder hässlicher, nur anders. Es war ihr erster Besuch, der Jahrgang hatte vor der Wahl gestanden, entweder für eine Woche die Stadt zu besuchen oder sich Vorträge der Bundeswehr in ihrer Schule anzuhören. Das war nun wirklich keine schwere Wahl gewesen. Sie wurden von drei Lehrkräften begleitet, mitsamt Mahnungen, auf keinen Fall die Grenzer zu provozieren, damit der Bus nicht stundenlang an der Grenzkontrolle feststeckte, während des Tages in Ostberlin auf keinen Fall illegal Geld zu tauschen sowie in Westberlin von sinisteren Existenzen fernzubleiben, die Kindern Drogen verkauften. Das veranlasste natürlich zwei Drittel des Jahrgangs, nach derartigen Drogenhändlern Ausschau zu halten, aber bis jetzt schien noch keiner fündig geworden zu sein.
Martina hatte die Museumsausflüge mitgemacht, teils aus Pflichtgefühl, teils weil sie die Expressionisten und die Nofretetebüste wirklich interessierten, aber was sie sich eigentlich von Berlin erhofft hatte, war nicht in Museen zu finden. Als sie den Vorschlag machte, doch auch Babelsberg mit auf den Ausflugskalender zu setzen, wurde sie von ihren Klassenkameraden ausgebuht, und die Lehrer waren auch nicht einsichtiger.
»Potsdam-Babelsberg ist das älteste Filmstudio der Welt!«
»Ja, und es liegt nicht innerhalb des Berliner Innenstadtbereichs«, sagte ihr Mathematiklehrer nüchtern. »Mit dem Eintagesvisum kannst du nicht dorthin. Außerdem wüsste ich nicht, was an den heutigen Produktionen der DEFA für Schüler kulturell interessant sein sollte. Es handelt sich dabei um eine rein kommunistische Propagandamaschine.«
»Die UFA war auch eine Propagandamaschine für die Nazis, aber Klassiker hat sie trotzdem hervorgebracht«, erwiderte Martina und erhielt einen Verweis wegen ihres Tons.
Sie war siebzehn Jahre alt. Das Gymnasium würde sie erst in zwei Jahren beenden, und dann, schwor sie sich, würde sie Kunst und Film studieren. Es würde ihre Eltern konsternieren, aber daran ließ sich nichts ändern. Die Vorstellung, Lehrerin zu werden, wie ihr Vater sich das für sie erträumte, war ihr ein Graus. Es langte ihr schon, die Tochter eines Schuldirektors zu sein. Sie wollte nicht in seine Fußstapfen treten und Tag für Tag einem Haufen kleiner Monster Grammatikregeln beibringen. Nein, ihre Zukunft stellte sie sich anders vor.
Es war Juni, und sie hatten Glück mit dem Wetter. Kein Regen in Berlin. Sie hatte heimlich einen roten Minirock eingepackt, den sie sich von einer Freundin geliehen hatte. Die begleitende Lehrerin, Frau Pitter, war einigermaßen bestürzt, als Martina zum ersten Mal darin erschien, aber sie musste zu der Schlussfolgerung gekommen sein, dass ein Verbot ohnehin nicht befolgt werden würde, also verzichtete sie darauf, eines auszusprechen. Danach folgten ein paar weitere Schülerinnen Martinas Beispiel, und die Röcke wurden bei den meisten Mädchen noch kürzer. Es brachte ihnen Pfiffe der Jungen ein, aber Martina trug den Rock nicht wegen der Mitschüler. Sie nahm keinen von ihnen ernst. Schließlich war sie mit ihnen aufgewachsen. Ihr momentaner Schwarm war Keith Richards von den Rolling Stones. Die Stones würden wahrscheinlich nie nach Nürnberg kommen, oder wenigstens nicht, ehe Martina für entzücktes Gekreisch zu alt war, aber mit München oder Berlin war das anders. Sie wollte hier in Berlin ihr erwachsenes Selbst ausprobieren: kein Schulmädchen, sondern eine junge Frau, die schick angezogen war und nach der sich interessante Männer schon mal umdrehten.
In dieser Woche waren die Schüler des Nürnberger Veit-Stoß-Gymnasiums mit Sicherheit die unwichtigsten Besucher in Berlin, denn der Schah wurde erwartet. Martinas Mutter hatte schon seit Jahren hingebungsvoll die Illustrierten-Geschichten über Reza Pahlavi und seine Frauen gelesen und verglich sie gerne mit denen aus Tausendundeiner Nacht. Als er sich von Soraya scheiden ließ, hatte es ihr das Herz gebrochen. Martina hatte ihre Mutter damals damit geneckt, dass Soraya mit dem Playboy und Fotografen Gunther Sachs doch besser dran war, und damit verraten, dass sie bei diesen Geschichten ebenfalls mitlas. Aber nur, weil Nürnberg so öde war und die meisten Beteiligten der High Society gut aussahen. Martina und ihre Freundin Susanne fanden die neue Frau des Schahs ohnehin besser, weniger tränenselig und mit einer Frisur, die Martina immer häufiger imitierte: das Haar auf eine Weise aufgesteckt, die sie älter machte, aber nicht spießig wirkte, sondern die Wangenknochen betonte und elegant aussah. Martina hatte die Theorie, dass dieser Look noch von Nofretete her stammte, und wollte das beim Besuch der berühmten Büste überprüfen. Inzwischen musste sie allerdings zugeben, dass Susanne besser darin war, sich die Haare auf diese Weise zurechtzumachen.
Susannes älterer Bruder, der ihnen mit seinem bierernsten Gesicht immer die Stimmung verdarb, hatte Martina und Susanne bei ihren Berlin-Planungen einmal unterbrochen und etwas davon gemurmelt, er habe in einer Zeitschrift namens KONKRET gelesen, dass jährlich Hunderte von Regimegegnern durch den Geheimdienst des Schahs namens SAVAK ermordet wurden.
»Hör mir doch damit auf«, hatte Susanne gesagt. »War KONKRET etwa in Persien, um das zu überprüfen? Behaupten kann jeder alles. Ich finde jedenfalls, dass Farah Diba immer toll aussieht. Daran siehst du doch, dass der Schah ein guter, moderner Herrscher sein muss. Er hat sie immer dabei.«
Susanne sammelte Illustrierten-Artikel noch eifriger als Martinas Mutter und war die Erste gewesen, die entdeckte, dass der Schah und seine Frau in der Woche nach Berlin kamen, in der ihr Klassenausflug stattfand. Aber Susanne fehlte es an Initiative, und so war es Martina gewesen, die darauf bestand, dass sie versuchen sollten, das persische Herrscherpaar aus der Nähe zu bewundern, wenn der Schah sich am frühen Nachmittag im Schöneberger Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen würde.
Als sie am Vormittag dann aber hörten, dass gleichzeitig eine Anti-Schah-Demonstration stattfinden würde, wusste Martina sofort, dass ihre Lehrerin ihnen keine Erlaubnis geben würde. Sie würden sich absetzen müssen.
»Weißt du«, sagte Martina zu Susanne, »am Freitagnachmittag steht das KaDeWe auf dem Programm. Da können wir uns im Getümmel sicher verdrücken, ohne dass die Pitter das gleich merkt.«
Die Aussicht darauf, möglicherweise in eine Demonstration zu geraten, verursachte ihr, wenn sie ehrlich war, ein gewisses wohliges Kribbeln. Auch Demos gehörten schließlich zum Leben in der Großstadt. Sie wusste nicht viel über die Gegenwartspolitik, aber der Studentenführer Rudi Dutschke war so oft in Zeitungen und Fernsehen, dass sie ihn sicherlich sofort wiedererkennen konnte. Außerdem sah er mit seinen dunklen Haaren aus wie ein französischer Schauspieler, fast wie Alain Delon.
Martina und Susanne fanden das Schöneberger Rathaus schnell, es war ja nicht allzu weit vom KaDeWe entfernt. Vor dem Rathaus waren rot-weiß gestreifte Metallgitter aufgebaut, hinter denen sich bereits einige Leute versammelt hatten. Die Mädchen gesellten sich zu ihnen, und Martina holte ihre Kamera hervor. Sie sparte noch auf die Leica ihrer Träume, deswegen war es nur eine Voigtländer, aber mit etwas Glück würde sie trotzdem ein brauchbares Foto von dem Herrscherpaar machen können.
Es dauerte nicht lange, bis sie von zwei jungen Männern angesprochen wurden. Für diesen Fall hatten sie vereinbart, auf keinen Fall zuzugeben, jünger als achtzehn zu sein, und so behaupteten sie, Urlaub in Berlin zu machen.
Die zwei Männer waren Studenten und standen wegen der Flugblätter hier, die an der Universität verteilt worden waren. Martina ließ sich eines geben, es enthielt ähnliche Anklagen wie der KONKRET-Artikel, von dem Susannes Bruder geredet hatte. Dumpf regte sich etwas in ihr, eine Mischung aus Ärger und schlechtem Gewissen. Als Kind hatte sie einmal bei den Pfadfinderinnen mitgemacht und glaubte immer noch daran, dass es wichtig war, anderen zu helfen. Aber gerade jetzt waren Susanne und sie hier, um etwas große Welt und Hauptstadtglamour zu erleben, nicht, um über etwaige Folterungen in Persien zu debattieren. Kaum hatte sie das gedacht, packte sie die Scham. Wenn Menschen wirklich unter dem Schah-Regime litten, war es gut und richtig, dass dagegen protestiert wurde. Aber war auch nur einer dieser Protestler in Persien gewesen?
Die Frage lag ihr schon auf der Zunge, aber Susanne stieß ihr mit dem Ellbogen in die Seite, um ihr zu bedeuten, vor den jungen Männern nicht besserwisserisch aufzutreten. »Wenn du wirklich dein Streberinnen-Image loswerden willst«, hatte sie Martina erst im letzten Jahr gesagt, »halt einfach ab und zu die Klappe und gib den Kerlen das Gefühl, über alles besser informiert zu sein und dich belehren zu dürfen.«
Um ihre gemischten Gefühle zu überspielen, schaute Martina noch einmal auf das Flugblatt und bemerkte, dass es vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund herausgegeben worden war. Von dem wusste sie nicht viel mehr, als dass Rudi Dutschke einer der führenden Leute war.
»Kommt, hm, Rudi Dutschke auch?«, erkundigte sie sich so beiläufig wie möglich, um zu signalisieren, dass sie nicht gänzlich unwissend war, aber gleichzeitig auch Informationen benötigte. Ihr war Dutschke zum ersten Mal im letzten Jahr aufgefallen, als er wegen der Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in die Nachrichten gekommen war. Ihrem Vater, der wegen seiner Kriegserfahrungen Pazifist war, lag das Thema Vietnam sehr am Herzen, und so war im Haushalt der Familie Müller bei den Beiträgen über Protestaktionen nie weggeschaltet worden. »Warum die jungen Leute sich heute nicht mehr die Haare schneiden wollen, verstehe ich allerdings nicht«, hatte ihr Vater kommentiert, und Martina, die ihn liebte, hatte sich das Augenrollen gerade noch verkniffen.
Der Student, von dem Martina das Flugblatt hatte, wusste nicht, ob Dutschke käme, bei der abendlichen Demonstration vor der Deutschen Oper werde er aber garantiert dabei sein.
»Da gehen wir aus«, sagte Susanne sofort. Susanne hatte eine beneidenswerte Selbstsicherheit und Unbekümmertheit in allen Dingen, die Martina zu ihr hingezogen hatten. Für Susanne gab es kein schlechtes Gewissen, keine Bedenken, was wichtig war und was nicht. Sie war in Berlin, um sich zu amüsieren und sich beeindrucken zu lassen. Einen Monarchen und seine Kaiserin zu sehen, gehörte dazu, Demonstrationen dagegen nicht.
Martina wollte gerade etwas erwidern, als zwei Busse vorfuhren, die zu ihrer Überraschung an den Absperrungen vorbei in die frei gehaltene Fläche vor dem Rathaus gelassen wurden. Heraus quollen eine Menge Männer, von denen einige Plakate mit den Bildern des Schahs und seiner Frau trugen. Frauen konnte sie keine entdecken.
»Die bestellten Jubelperser«, sagte der Student zynisch neben ihr, dann rief er laut: »Schah, Schah, Scharlatan!« Der Ruf wurde von den Leuten um ihn aufgenommen, während die Männer aus den Bussen: »Es lebe der Schah!«, zurückschrien.
»Das wird ungemütlich«, sagte Susanne beunruhigt. »Lass uns lieber …«
»Ich dachte, du willst den Schah und seine Frau sehen?«
Martina reckte den Kopf und deutete auf die Wagenkolonne, die nun in Richtung Rathaus vorfuhr, zwischen die mit dem Bus gelieferten »Jubelperser«. Jetzt wollte sie auf keinen Fall gehen. Es war endlich so weit, der Höhepunkt ihres Berlin-Besuches. Sie zückte ihre Kamera. Das Geschrei wurde auf beiden Seiten immer lauter.
»Freiheit für Persien!«
»Lang lebe der Schah!«
Martina war für eine Frau nicht klein, sondern mit 174 Zentimetern über dem Durchschnitt, aber das genügte nicht, um über die Köpfe hinwegzusehen, die sich jetzt mehr und mehr in Richtung der Barrikaden verschoben. Sich auf die Zehenspitzen zu stellen und ihre Kamera höher zu halten, half auch nicht. Sie nahm gerade noch wahr, dass die Türen des großen Mercedes an der Spitze der Wagenkolonne geöffnet wurden, aber wer ausstieg, konnte sie nicht erkennen.
»Blöde Leibwächter«, sagte Susanne neben ihr. »Das war’s. Jetzt sind sie im Rathaus. Komm, lass uns …«
Weiter kam sie nicht. Vonseiten der »Lang lebe der Schah«-Rufer sprangen ein paar Männer über die Absperrungen. Sie hielten ihre Transparente in den Händen, die sie jetzt umdrehten und so die Stangen wie Knüppel in den Händen hielten. Instinktiv schaute Martina zu den Polizisten, die entlang der Barrieren postiert waren. Diese rührten sich nicht.
»Lang lebe der Schah«, schrie einer der Männer und hieb mit seiner Stange auf einen der Studenten ein, der nur zwei Meter von Martina entfernt stand. Mehr und mehr aus seiner Jubelgruppe folgten, und nun bemerkte Martina, dass viele von ihnen Stöcke in den Händen hielten, die an Polizeiknüppel erinnerten.
»Das gibt’s doch nicht«, rief der Student neben ihr ungläubig. Er packte Martina und Susanne an den Schultern und riss sie zurück. Martina war immer noch zu überrascht, um Panik zu empfinden. Aus den Augenwinkeln sah sie mehrere Demonstranten zu Boden gehen. Ungläubig machte sie schnell einige Bilder von dem Geschehen. Das holte sie aus ihrer Sprachlosigkeit heraus. Das durfte nicht geschehen! Sie machte sich von dem Studenten los und winkte heftig den Polizisten zu. »Helfen Sie doch! Nehmen Sie die Kerle fest!«
Die Polizisten, die ihr am nächsten standen, feixten nur. Ihr Leben lang hatte sie nie daran gezweifelt, dass die Polizei zum Schutz der Bürger da war. Dass ein Polizist, gar mehrere, sich weigern könnten, Menschen vor Schlägern zu schützen, war ihr so wenig möglich erschienen wie eine Mondlandung.
»Auf den Mond kommen die nie«, hatte sie als Kind erklärt, während die Erwachsenen sich über einen russischen Satelliten namens Sputnik aufregten. Es gab Dinge, die hinterfragte sie einfach nicht. Der Mond war geheimnisvoll, magisch und unerreichbar für Menschen. Und Polizisten waren die Hüter der Ordnung, die jeden Menschen beschützten.
Inzwischen hatte der erste »Jubelperser« sie erreicht und stieß dem Studenten neben ihr mit seinem Knüppel brutal in den Magen. Martina wachte aus ihrer Schockstarre auf, wandte sich um, wollte weglaufen, erhielt einen Stoß und stürzte zu Boden. Susanne schrie ihr etwas zu und zerrte an ihrer Hand. Stolpernd kam Martina wieder hoch. Seit ihren Kindergartenjahren, in denen sie sich gelegentlich mit anderen Kindern gerauft hatte, hatte niemand sie je hart angefasst. Wenn ihre Eltern sie bestraften, was nicht oft vorkam, galt es, ohne Abendessen zu Bett zu gehen, oder ihr wurde das Taschengeld entzogen. Die jähe Angst, die Panik, die sie jetzt spürte, war ihr unbekannt. Das durfte nicht sein. Das durfte doch alles nicht sein.
Susanne schrie immer noch, und Martina rannte mit ihr fort von den prügelnden »Jubelpersern«. Die Furcht in ihr vermengte sich mit Scham. Sie hatte sich immer für mutig gehalten, für jemanden, der sich nicht leicht einschüchtern ließ. Und nun, wo das zum ersten Mal auf die Probe gestellt wurde, lief sie davon wie ein kleines Kind. Aber gleichzeitig war ihr klargeworden, dass sie ernsthaft verletzt werden konnte, verprügelt von Menschen, die sie nicht kannte und die sie nicht kannten, und das ließ ihr Herz rasen.