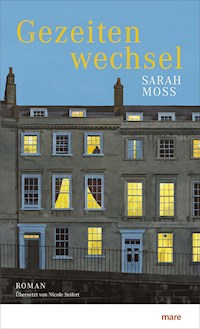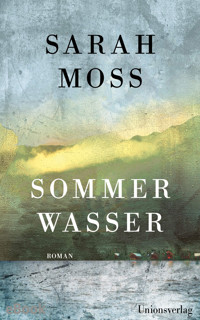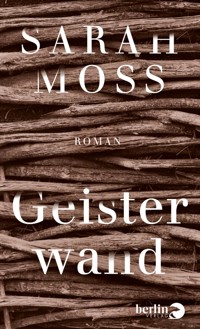Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mare Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine karge Insel im Westen Schottlands, ständige Stromausfälle und eine unsichere Telefonverbindung. Ein Zweijähriger, der die Nächte zum Tag macht, und ein Siebenjähriger, der die Tage damit verbringt, sich die originellsten Versionen des Weltuntergangs auszumalen. Dazu ein Ehemann, der einer in den Klippen heimischen Papageientaucherkolonie mehr Zeit widmet als seiner Familie: Unter diesen nicht gerade idealen Bedingungen versucht die Historikerin Anna Bennett, eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Kindheit im 18. Jahrhundert zu schreiben. Aber wie soll sie auch nur eine Zeile zu Papier bringen, wenn sie allein und völlig übernächtigt zwei unternehmungslustige Kleinkinder in einer felsigen Einöde beschäftigen muss? Als zwei rätselhafte Funde im Garten und auf dem Dachboden des sich seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Wohnhauses zu allem Überfluss Einblicke in die düstere Vergangenheit der Insel gewähren, sieht Anna endgültig ihre Felle davonschwimmen. Doch dann verbindet sich ihr chaotischer Alltag auf unerwartete Weise mit ihrem Forschungsgegenstand und der Inselhistorie ... Gleichzeitig gute Mutter und Wissenschaftlerin zu sein, noch dazu auf einer abgelegenen, windigen Nordseeinsel - keine leichte Aufgabe. Sarah Moss schildert das Dilemma ihrer Heldin mit so viel Selbstironie, Komik und Intelligenz und das Geheimnis der Insel mit so großer Spannung, dass eines sicher ist: "Schlaflos" hält wach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Sarah Moss
Schlaflos
Roman
Aus dem EnglischenvonNicole Seifert
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Die englische Originalausgabe erschien 2011 unter dem TitelNight Waking bei Granta Publications, London.
Copyright © 2011 by Sarah Moss
© 2013 by mareverlag, Hamburg
Lektorat Meike HerrmannCovergestaltung mareverlag, HamburgAbbildung [M]: Haus © R. G. Daniel / gettyimages, Baum © thaikrit / shutterstock, Frau mit Kind © red rose / shutterstock
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, HamburgDatenkonvertierung eBook bookwire
ISBN eBook: 978-3-86648-303-3ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-177-0
www.mare.de
Inhalt
Das Realitätsprinzip
Dem kindlichen Patienten nicht zugänglich
Angst, das Messer zu handhaben
Die Neugier des Kindes
Eine harmlose Schlange
Ständig mit anderen Dingen beschäftigt
Die Fähigkeit zur Selbstverteidigung
Die Fähigkeit eines Erwachsenen
Allgemein bekannt
Liebesfähigkeit
Sie ansehen, ohne zu starren
Irrationelle Gefühlserlebnisse
Die Bedürfnisse des Kindes
Die Partnerschaft zwischen Mutter und Kind
Eine nächste Generation
Was sich darin finden mag
Ausgewählte Literatur
Zitatnachweise
Dank
Über das Buch
Weitere Bücher von Sarah Moss
Weitere eBooks aus dem mareverlag
Das Realitätsprinzip
Die Annahme, daß der Übergang vom Lust- zum Realitätsprinzip eine Vorbedingung für die Sozialisierung des Individuums ist, behält ihre Richtigkeit. Sie ist nur nicht umkehrbar: der Fortschritt zum Realitätsprinzip allein gibt keine Sicherheit, daß das Individuum den sozialen Anforderungen nachkommen wird.
Anna Freud, Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung
Die Singschwäne sind nah am Ufer, wie helle Scherenschnitte treiben sie vor den in der Dämmerung verschwimmenden Wellen dahin. Nachts raunen sie einander Oboenklänge zu, Holzbläser, die sich gegenseitig beruhigen. Gewöhnliche Schwäne, die Schwäne der Königin auf dem Fluss, an dem wir zu Hause Enten füttern, haben Gesichter, die aussehen wie von irgendeiner mittelalterlichen Krankheit gezeichnet, und sie schlafen auf einem Bein stehend, die Köpfe unter den Flügeln, wie kinderlose Passagiere auf Langstreckenflügen, die es unter Schlafbrillen aus Nylon Nacht werden lassen. Die Schwäne hier scheinen nachts wach zu bleiben, sie segeln durch das schwächer werdende Licht wie Schiffe auf dem Weg in ferne Länder, und sie haben Gesichter, so gleichmäßig und neutral wie das Corps de Ballet, Gesichter, die weder Trauer noch Schmerz ausdrücken. Vielleicht ist das ein Vorzug bei Gattungen, die sich Partner fürs Leben suchen.
Ich sehe mich nach dem Haus um. Die Fassade, dunkel wie die Klippenwand am anderen Ende der Insel, weist das Abendrot ab, das noch auf dem Meer leuchtet, von dort, wo Amerika sich einem neuen Tag zuwendet, während wir uns von der Sonne abwenden. Einer der Schwäne reckt sich dem Himmel entgegen und schreit in plötzlicher Erregung auf, seine Flügel dreschen auf das Wasser ein, als wäre ihm gerade wieder eingefallen, dass ein Freund gestorben ist. Ich habe einmal eine Gans sterben sehen, eine Kanadagans, die den ganzen Weg aus der Arktis geflogen war, um ihr Leben auf dem Seitenstreifen der M 40 zu beenden, und obwohl ein Flügel noch wie zu Musik schlug, während der andere auf dem Rüttelstreifen lag, wirkte ihr Gesicht ungerührt. Ich stand auf der Brücke, sah hinaus und schuckelte den Kinderwagen, in dem das Baby nur so lange schlafen würde, wie wir uns bewegten, bis irgendein Lastwagenfahrer aus Mitleid oder Unaufmerksamkeit ein Gestöber aus Federn und rotem Matsch auf der Straße hinterließ. Unsere Schwäne sind hier vor so etwas sicher. Einen Sommer lang. Wie wir werden sie im Herbst nach Süden ziehen, aber erst einmal gibt es keine Autos, keine Straßen. Auch keine Brücken. Am dunkler werdenden Himmel über dem Hügel erscheinen die Sterne. Ich erschaudere; es ist nicht besonders kalt, aber Zeit hineinzugehen.
Der Strom ging immer noch nicht wieder, was zu dieser Jahreszeit nicht allzu schlimm ist, solange wir unsere Laptops aufgeladen haben. Giles hatte eine Kerze angezündet.
»Guck! Hier ist es.« Er gab mir einen Urlaubskatalog, umgeschlagen, sodass ein briefmarkengroßes Bild des Blackhouse unten am Strand zu sehen war, aufgenommen im letzten Sommer, ehe die Bauarbeiten begonnen hatten. Geplant ist, es als Ferienhaus zu vermieten und mit diesen Einnahmen irgendwann die Renovierungskosten zu decken. Realistisch ist, dass die mit Argon gefüllten Dreifachfenster, das Grauwassersystem (das Klo wird mit dem Wasser gespült, mit dem vorher die Kleidung gewaschen wurde) und die aufgearbeiteten Möbel (aufgearbeitet von einem Betrieb in Bath und zu einem Preis über Land und Meer transportiert, der Giles dann doch überraschte) vielleicht zu Lebzeiten unserer Enkel abbezahlt werden – falls wir Enkel bekommen –, allerdings nur, wenn Giles aufhört, unseren Freunden und, Gott behüte, seiner Familie zu erzählen, dass sie umsonst dort wohnen können. Ich hielt den Katalog ins Licht.
Verbringen Sie ein oder zwei Wochen auf Ihrer eigenen Insel! Ein atemberaubend schön umgestaltetes traditionelles Blackhouse mit herrlichem Meerblick aus jedem Fenster, gelegen auf der verlassenen Insel Colsay. Das Haus, von einem preisgekrönten Architekten frisch restauriert, verfügt über Bodendielen mit Fußbodenheizung, eine Regen- und Nebeldusche und eine Küche, die mit regionalen Materialien von Hand gebaut wurde. Kein Fernseher, aber eine umsichtig zusammengestellte Büchersammlung und Mal- und Bastelsachen für Regentage. Es gibt auf der Insel weder Straßen noch Autos. Ihr Gastgeber wird Sie im Hafen von Colla abholen und Sie während Ihres Aufenthalts jederzeit dorthin bringen, wenn Sie einkaufen, Spaziergänge oder Ausflüge machen und das Kulturerbe und die Schätze der Gegend rund um Inversaigh genießen möchten. Colsay selbst hat eine vielfältige Vogelwelt zu bieten und historische Relikte, die erkundet werden wollen. Oder Sie genießen einfach die Stille und Schönheit dieses sehr besonderen Ortes.
»›Sehr besonders‹?« Ich legte den Katalog zu schnell auf den Tisch und die Kerze ging aus. »Und diese ganzen Adjektive? Giles, du hättest mich fragen sollen, ob ich das mache. Da ist sogar ein Ausrufezeichen drin, mein Gott. Stille können die Leute auch zu Hause haben, weißt du? In Bibliotheken.«
Ich vermisse die Stille von Bibliotheken. Nicht mal Singschwäne würden sich in meinen Lieblingsbibliotheken unterhalten.
»Ich konnte dich nicht fragen.« Giles versuchte die Kerze mit einem Teelicht wieder anzuzünden. Wie vorherzusehen war, tropfte Wachs auf seine Zeitung. »Das war das Wochenende, an dem die beiden Kotzeritis hatten.«
In jener Woche war Giles jeden Tag zur Arbeit gegangen, weil es »von ihm erwartet wurde«, und ich war zu Hause geblieben und hatte Erbrochenes aus dem Teppich geschrubbt. Ich werde, wie Giles nicht müde wird zu betonen, bezahlt, egal ob ich tatsächlich arbeite oder nicht. Das steht in meinem Vertrag. »Der Forschungsstipendiat sollte so vorankommen, wie es, gemessen an der im Vorfeld eingereichten Beschreibung des Forschungsprojektes, zu erwarten ist.« Davon abgesehen kann ich meine vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, indem ich vierundzwanzigmal pro Jahr im College esse. Die meisten Stipendiaten (Damen eines gewissen Alters mit Leg-dich-nicht-mit-mir-an-Haltung) würden mich auf der Hauptstraße nicht erkennen, aber mich erkennen auf der Hauptstraße sowieso nicht viele Menschen, weil ich normalerweise einen Buggy vor mir herschiebe. Die Karre im Flur mag der Feind aller Hoffnungen sein, aber draußen ist sie die perfekte Tarnung für alle möglichen strafbaren Handlungen. Man könnte die Hauptstraße mit einem Maschinengewehr unter Beschuss nehmen und hinter dem Buggy mit nichts als High Heels an den Füßen und einem Hut auf dem Kopf davonspazieren, und niemand würde sich daran erinnern, einen gesehen zu haben.
»Wie auch immer«, sagte Giles. »Die Einsiedlerin hat die Stille genossen. Ich meine, ist das nicht der Sinn der Sache? Au.« An seinen Fingern lief Wachs hinunter.
»Ich nehme an, die Einsiedlerin war viel zu beschäftigt damit, etwas zu essen zu suchen und sich vor den Wikingern zu verstecken. Feuerzeug? Streichhölzer?«
Er zuckte mit den Schultern und wir sahen uns beide um, als könnten wir die Kinderbücher, die halb aufgegessenen Kekse und die Zeitungen erkennen, die aus jeder Öffnung des Hauses quollen und darauf warteten, weggeräumt zu werden.
»Ach, na ja. Jedenfalls können wir im Dunkeln nicht aufräumen.« Ich stieß mit dem Fuß gegen etwas Weiches, das entweder am Fußboden festklebte oder überraschend schwer war. »Ich hoffe, dir ist klar, dass du der Fährmann auf Abruf bist. Ich muss Die Saatzeit meiner Seele fertig machen. Und wer stellt diese Büchersammlung zusammen?«
Abgabetermin für »Wie gut war doch die Saatzeit meiner Seele«: Die Erfindung der Kindheit und das Aufkommen von Institutionen im England des späten achtzehnten Jahrhunderts war letzten Monat. Theoretisch sollte ich mit einem unter meinem Namen veröffentlichten Buch leichter vermittelbar sein. Praktisch gab es in der Geschichtswissenschaft keine Jobs, und wenn es sie gäbe, würden sie Leute bekommen, die in den letzten acht Jahren nicht die Hälfte ihrer Zeit damit verbracht hatten, Windeln zu wechseln, statt an der Bar des Konferenzraums Getränke zu bestellen. Giles fing an, das Wachs von der Zeitung zu pulen und zu Kügelchen zu formen.
»Nicht«, sagte ich. »Die isst Moth doch nur.«
Er ließ eins in das Teelicht fallen. »Besser als Vogeldreck.«
Ich stand auf. »Ich halte Vogeldreck auch nicht für geeignete Kindernahrung. Deshalb habe ich den Garten übrigens aufgegeben. Ich kann diese Scheißbäume nicht einpflanzen, ohne mal für ein, zwei Sekunden den Blick von ihm abzuwenden. Aber Vogeldreck ist immer noch besser als Fingerhut.«
Fingerhut enthält Digitalis, von dem einem kleinen Kind das Herz stehen bleibt, lange bevor man die Meerenge überquert hat und beim Dorfarzt angekommen ist, der an vier Vormittagen in der Woche Sprechstunde hat.
»Ich hab ihn rechtzeitig erwischt«, sagte Giles. »Ich hab ihn dazu gebracht, es auszuspucken. Das hab ich dir doch gesagt.«
»Ja. Das hast du gesagt. Ich geh ins Bett.« Ich balancierte das Teelicht auf meiner Handfläche, verbrannte mir dabei die Finger und durchquerte den Raum, wie man sich im Dunkeln auf ein Minenfeld wagt, was nur vernünftig war, da viele der kleinen Gegenstände, die ich nicht sehen konnte, Räder haben.
Ich habe aufgehört, morgens zu duschen, weil Raph mir drei Minuten gibt und dann mit der Stoppuhr auf der Badematte steht und mir erzählt, um wie viele Millimeter die dafür notwendige Energie die Polkappen weiter abgeschmolzen hat. Während Moth, der noch lebhafte Erinnerungen daran hat, wofür Brüste da sind, um den Vorhang lugt und unmissverständliche Gesten macht, wobei seine Kleidung nass wird. Nachts bei Kerzenlicht zu duschen ist aus offensichtlichen Gründen heikel, also ließ ich mir ein Bad ein, heiß und voll genug, um einen kleinen Eisbären zu ertränken, stellte mich vor das Bücherregal und fragte mich, ob ich meine Sorgen bei Marjorie schafft es auf der Chalet-Schule vergessen oder meinen Intellekt mit den Essays von Henry James wiederbeleben sollte. Ich entschied mich für Für Ihr Kind sorgen von 1947, in der Hoffnung, beim letzten Lesen übersehen zu haben, welche Lösung es für Schlaflosigkeit bei Kleinkindern gibt. Giles’ Familie benutzt dieses Haus seit dem Krieg als Aufbewahrungsort für unlesbare Bücher.
»Du bist eingeschlafen«, sagte Giles. Er hatte eine weitere Kerze und Streichhölzer gefunden, oder er war kurz draußen gewesen und hatte ein paar Feuersteine geholt.
Mein Nacken war steif und das Wasser hatte sich abgekühlt. Ich setzte mich auf und gähnte.
»Und?« Wenigstens musste ich bei Kerzenlicht nicht den Bauch einziehen.
»Irgendwann ertrinkst du noch.«
Ich rieb mir den Nacken und schöpfte mir Wasser ins Gesicht. »Ich bin sicher, ich würde aufwachen, wenn mir Wasser in die Lunge fließt. Wenn es so leicht wäre, würden die Leute sich doch nicht extra die Pulsadern aufschneiden. Klingt eigentlich nach einer ganz netten Art zu sterben.«
Er fing an, sich die Zähne zu putzen. Wenn Giles sich die Zähne putzt, ist das wahrscheinlich noch auf dem Festland zu hören. »Was ist mit den Kindern?«
»Dir tropft Zahnpasta auf den Pulli. Die sind heute dein Problem.« Was ein ganz guter Grund dafür ist, am Leben zu bleiben.
Ich wartete, bis er die Kerze auf das Regal neben der Tür gestellt hatte, und stieg dann aus der Wanne. Die Badematte war nicht, wo ich sie erhofft hatte, und ich tat, als hielte ich das, wo ich hineintrat, für Wasser – mein üblicher Vorwand, um nicht putzen zu müssen, was ich aus ideologischen Gründen, die ich keine Lust habe zu erläutern (auch mir selbst nicht), ablehne.
Er spuckte Zahnpasta aus. »Schöne Titten, Frau Gemahlin.«
»Verzieh dich bloß. Du kannst sie ja nicht mal sehen.« Und sie sind nicht schön, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Mein Handtuch roch leicht nach Fisch. Ich ging durch einen Dampfkringel zur Tür. »Ich glaube, du hast gerade den Guardian in Brand gesetzt.«
»Verdammt.« Er griff nach einem in Flammen stehenden Weekend-Magazin, das auf einem Kleiderhaufen im Bücherregal lag, und ließ es ins Bad fallen. Ich sah gerade noch einen Koch mit doppelläufigem Gewehr und Schwein, ehe sie von den grünen Flammen aufgefressen wurden und in sich zusammenfielen. »Macht nichts, das hatte ich schon gelesen.«
»Ich aber nicht. Ich hatte es aufgehoben. Für ein Bad mit elektrischem Licht und allem.«
»Lies es online. Komm, es ist schon Mitternacht.« Er ließ seine Hand über meine Schulter und unter das Handtuch gleiten und fuhr mit der Fingerspitze meine Wirbelsäule entlang.
Ich schlug ihm auf die Hand. »Wenn ich mal unbehelligt am Computer sitzen kann, dann verschwende ich keine Zeit damit, den Guardian zu lesen, dann schreibe ich mein Buch. Ich hab gesagt, verzieh dich.«
Wenn der Strom ausfällt, vermisse ich am meisten den steten Blick meines Radioweckers. Ohne die Orientierungspunkte der Uhr ist es schwer, durch die Nacht zu steuern. Ich konnte nicht lange geschlafen haben, denn in unserem nach Westen ausgerichteten Schlafzimmer war es immer noch so dunkel wie in einem Sarg, als ich von Moths Schreien wach wurde. Der Boden unter meinen Füßen war kalt und sandig. Als ich über den Flur ging, dessen vorhangloses Fenster den kommenden Tag noch nicht erahnen ließ, raschelte und knisterte es auf dem Dachboden. Ich nahm Moth auf den Arm und er hielt sich an meinen Haaren fest und rieb seine schmierige Nase an meinem Hals.
»Mami.« Hinter seinem Ohr waren Essensreste, aber seine Haare hatten immer noch den buttrigen Duft von Babys. Ich küsste seine salzige Wange und spürte sein Gewicht auf meinen Handgelenken. »Mami. Moth Angst.« Ich ging ein paar Schritte, vier vor und vier zurück, immer auf den eisernen Schutzschild aus dem neunzehnten Jahrhundert achtend, der aus dem Kamin ragt. Giles weiß noch, wie sein Vater die elektrischen Heizöfen aufgestellt hat – nicht als Zugeständnis an moderne Vorstellungen von Gemütlichkeit, sondern in Anerkennung der Tatsache, dass auf der Insel niemand mehr war, der für ihn Torf stechen konnte.
»Mami Grüffelo singen.«
»Später. Grüffelo morgen früh.«
»Mami Grüffelo singen!«
Ich streichelte ihn. »Gute Nacht, gute Nacht, Grüffelo. Der Grüffelo schläft.«
»Will Grüffelo!«
Wenn er schreit, weckt er Raphael, der nicht den Grüffelo hören will, sondern Lügen darüber, warum es diese Erde wahrscheinlich immer noch geben wird, wenn er groß ist. Ich murmelte in Moths Ohr.
»Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir zu Haus gibt’s Götterspeise …«
Er hob den Kopf.
»Im Bau.«
Ich drückte seinen Kopf wieder nach unten.
»Bei mir im Bau. Weiter.«
»Also, wenn du es weißt, warum …«
»Weiter.«
»Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider Nein, ich muss schon zum Tee …«
»Mittag.«
»Zum Mittag. Beim Grüffelo sein. Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du noch nicht …«
»Den kennst du nicht.«
Ich fürchte, dass ich das Werk von Julia Donaldson inzwischen besser kenne als das von Jean-Jacques Rousseau, aber Moths Insistieren auf wissenschaftlicher Genauigkeit zeigt mir, dass ich es immer noch nicht gut genug kenne.
»Oh! Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen?«
Moth war an meiner Brust wieder weich und schwer geworden.
»Mit feurigen Augen, einer Zunge sooo lang und Stacheln am Rücken – da wird’s einem bang.«
Ich sang mich der veganen Auflösung entgegen: »Im Wald, da hörte man niemand mehr. Die Maus knackte Nüsse und … freute … sich … sehr«, und seine Finger lagen schlaff an meinem Hals. Ich summte ein schottisches Volkslied und schlenderte, als würde ich ziellos durch das fünfte Arrondissement streifen, auf das Kinderbett zu und dann zum Bücherregal. Erkundung erfolgreich. Ich wagte eine zweite Annäherung, ging auf das Fenster zu und blieb vor dem Bett stehen, als hätte das Schaufenster eines Juweliers meine Aufmerksamkeit erregt. Moths Atem veränderte sich nicht, und ich legte ihn sanft ab, riskierte es, ihn zuzudecken, mied die knarrenden Dielen und den raschelnden Müllbeutel über dem Smoking, der aus Gründen, die Giles vermutlich logisch erschienen, an der Tür hing, und schob Giles wieder auf seine Seite des Bettes, bevor Moth aufwachte und sich verlassen in etwas wiederfand, das einer meiner Erziehungsratgeber hilfreicherweise als »vergitterten Käfig weit weg von Ihnen in der Dunkelheit« bezeichnete. Nicht weit genug weg. Als Raphael meiner Dienste bedurfte, um die somalischen Kindersoldaten aus dem Magazin des Guardian von letzter Woche unter seinem Bett hervorzutreiben, war am Himmel über den Bergen das erste graue Licht zu sehen. Ich begleitete die Kindersoldaten den ganzen Weg die Treppe hinab und versteckte mich mit meinem Laptop in dem unfertigen, atemberaubend schönen, modernen, ökologischen Umbau, bis der Morgen sich mir in Gestalt des Motorboots aufdrängte, das dem Handwerker gehörte.
Mein Buch handelt von der romantischen Feier der Kindheit als Zeit freudvoller Reinheit und der gleichzeitigen Zunahme stationärer Einrichtungen für Kinder: Internate, Waisenhäuser, Krankenhäuser und Gefängnisse. Zur selben Zeit, zu der Wordsworth in der Herrlichkeit der Kindheit schwelgte und Rousseau sagte, man solle von der instinktiven Klugheit von Kleinkindern lernen, förderten andere Leute – tatsächlich waren es manchmal auch dieselben – Institutionen, die armen Familien ihre Kinder wegnahmen und sie zu nützlichen Konsumenten und Produzenten für das Zeitalter des Kapitalismus machten. Es ändert sich nichts; genau wie in modernen Erziehungsratgebern kommen Babys entweder mit einem schönen inneren Selbst auf die Welt, das wir respektieren und freisetzen müssen (»Nehmen Sie Ihr Kind mit in Ihr Bett, wenn es nachts aufwacht«), oder sie kommen als primitive Anhäufung von Bedürfnissen zur Welt und müssen erst zur Menschlichkeit erzogen werden (»Lassen Sie Ihr Baby schreien, bis es lernt, nachts zu schlafen«). Es ist interessant, dass die Ära, die berühmt dafür ist, kindliche Unschuld zu zelebrieren, gleichzeitig und im gleichen Maße der Vorstellung anhängt, die kleinen Wilden müssten in Institutionen gezähmt werden. Als ich anfing zu recherchieren, dachte ich, dahinter stecke einfach ein Konflikt zwischen Idealismus und Pragmatismus, Nachsicht und Disziplin, aber je mehr Manifeste und Regelwerke ich las, desto klarer wurde mir, dass Institutionen ihre eigenen utopischen Absichten verfolgen. Solche Einrichtungen stellen einen Versuch dar, eine leuchtendere Zukunft auf den Weg zu bringen, zu erreichen, was einzelne Haushalte nicht leisten können. Sie sollen Dinge anders oder besser machen, dabei liegt es in der Natur entweder der Menschen oder der Anstalten, dass sie am Ende oft den Status quo bekräftigen oder gleich in Stein meißeln und die Dinge nur verschlimmern. Institutionen verkörpern, zumindest im achtzehnten Jahrhundert, Optimismus und das Vertrauen in die menschliche Fähigkeit zur Veränderung, das wir irgendwo auf dem Weg verloren haben. Meine Lektorin hat gesagt, sie nimmt das Manuskript auch noch, wenn ich es bis September abgebe, und ich glaube, das werde ich schaffen. Wenn das UMTS-Teil, das Giles mir auf dieser Insel ohne Breitband-Internetanschluss als Lösung für meinen Bedarf an Online-Datenbankrecherchen angeboten hat, öfter funktioniert als bisher, schaffe ich es. Wenn ich mich weiterhin verhalte, als brauchte ich keinen Schlaf, schaffe ich es.
Mit der Recherche im Archiv bin ich fertig, sonst wäre nicht mal ich so dumm gewesen, auf Giles’ Insel mitzukommen. Ich habe die handschriftlichen Berichte über Mahlzeiten, Rechnungen, Rauswürfe und Strafen in den Internaten der 1790er-Jahre gelesen, bin die Listen der Stifter von Findelhäusern in ganz England durchgegangen, habe vergilbte Seiten mit uneinheitlichem Schriftbild durchgeblättert: »Mit großem Vergnügen sehe ich, dass die Bewahrung von Kindern endlich der Obhut von Männern mit Verstand anheimfällt … Es ist verheerend, dass dieses Geschäft allzu lange Frauen überlassen wurde, von denen man nicht annehmen kann, dass sie über das nötige Wissen verfügen, um einer solchen Aufgabe gewachsen zu sein« (William Cadogan, An Essay Upon Nursing, London, 1753). Was die Sekundärliteratur betrifft, bin ich mehr oder weniger auf dem neuesten Stand, obwohl mir erst spät klar wurde, dass das wichtigste Werk über Kindheit und Institutionen nach dem Zweiten Weltkrieg von Anna Freud und ihren Schülern geschrieben wurde. Freud selbst stand lange ziemlich weit oben auf der Liste der Menschen, deren Werk ich gelesen haben sollte oder vorgeben sollte gelesen zu haben. Meinem Verständnis nach zeigt Freud, dass es von der Selbstbeherrschung der Eltern abhängt, ob Menschen ihre Anlagen verwirklichen können. Wobei ich ökonomische und politische Lösungen für die Leiden der Welt für angenehmer und, offen gesagt, auch für leichter umsetzbar halte: Frieden im Nahen Osten und das Ende von Hunger und Armut wären leichter durchzusetzen als gute Mütter für alle, also ziehe ich die Propheten der Linken denen des menschlichen Herzens vor, gebe Marx den Vorrang vor Freud. Man muss schließlich nicht nur bedenken, was richtig ist, sondern auch, was möglich ist. Aber als ich gesehen habe, dass die gesammelten Werke von Sigmund und Anna seit neun Jahren nicht aus der College-Bibliothek ausgeliehen wurden, habe ich beschlossen, dass ich sie genauso gut mit hierherbringen kann, hier haben sie es auch ruhig und kommen ein bisschen an die frische Luft. Der Entwurf des Ganzen steht schon, und die Idee – Giles’ Idee – war, dass ich in der Abgeschiedenheit von Colsay ideal schreiben und feilen und über Psychoanalyse meditieren könnte, ohne den übel riechenden Atem der Stipendiaten im Nacken zu spüren. Giles überschätzt meine Fähigkeit, abstrakt zu denken, und hat noch nicht ganz verstanden, wie wenig das die anderen Stipendiaten interessiert.
Ich hätte schon mal versuchen sollen, die Schlussfolgerung zu schreiben, die mir Sorgen macht, weil ich nicht sicher bin, ob das Buch überhaupt schlüssig ist. Hinter meinem Laptop flimmerten Vögel über den Himmel, vielleicht Dreizehenmöwen, und ich beobachtete noch eine andere Möwe, die im Sturzflug auf den Meeresspiegel zuflog. Vom Boot aus kann man an ruhigen Tagen die andere Hälfte ihres Lebens sehen, vom Wasser verwandelt. Bläschen strömen aus ihren Federn, während sie sich wenden wie Robben, die hinter Fischen her sind. Ich reckte den Hals, um die Schwäne zu sehen, aber sie waren irgendwo anders. Ich öffnete die Danksagung. Und nicht zuletzt danke ich Giles Cassingham, wofür genau, kann ich allerdings nicht sagen.
»Hey, du.« Giles saß am Tisch und las einen Gartenkatalog, während Moth sich stirnrunzelnd darauf konzentrierte, mithilfe eines Löffels Haferbrei in einen Umschlag zu füllen, in dem sich außerdem ein Schreiben von den Kinderfreibetrags-Leuten befand, denen es gefällt, uns abwechselnd mit Reichtümern zu überhäufen und im Gegenzug für das, was wir ihnen schulden, unsere Haferflocken einzubehalten – ohne dass wir bisher in der Lage gewesen wären herauszufinden, von welchem Faktor genau dieses Verhalten abhängig ist. »Der Strom geht wieder. Ich mache dir Tee.«
»Er hat zu viel Wasser gekocht.« Raph saß unter dem Tisch.
»Mami trinkt morgens gerne zwei Tassen.« Giles’ Blick glitt über mein Outfit, bestehend aus einer Strickjacke und einem viktorianischen Nachthemd, dessen Farbe man inzwischen nur noch als sehr gebrochenes Weiß bezeichnen konnte.
»Aber sie lässt das Wasser sowieso noch mal aufkochen, damit die zweite Tasse frisch ist. Weißt du, dass in Afrika Kinder sterben, weil sie kein Wasser haben? Ich wette, ihre Mamis trinken keinen Tee.«
Moth drehte den Umschlag um und sah zu, wie der Haferbrei zu Boden tropfte, gefolgt von einem Fallschirm aus offiziellen Briefen. Giles hatte die Ausbeute eines ganzen Küchentischs zusammengerafft und aus Oxford mitgebracht, weil er dachte, dass wir uns auf der Insel damit beschäftigen könnten. Giles’ glänzende Karriere basiert auf seiner Fähigkeit, das gegenwärtige Verhalten von Papageientauchern zu beobachten und daraus Schlussfolgerungen über ihr künftiges Verhalten zu ziehen. Ich vermute, es ist vernünftig, wenn auch wahnsinnig, zu glauben, dass Menschen eher in der Lage sind, sich zu ändern, als sie.
»Platsch«, sagte Moth. »Noch mal!«
Giles gab ihm einen anderen Umschlag.
Ich schlürfte den Tee, der lauwarm und trüb war. »Es gibt in Afrika auch Kinder, die eine Klimaanlage und Satellitenfernsehen und Chauffeure haben, weißt du. Es ist ein Kontinent, kein Flüchtlingslager.«
»Warum können wir kein Satellitenfernsehen haben?«
Giles stand auf. »Weil es ein Instrument des späten, wuchernden Kapitalismus ist, das das Gehirn verrotten lässt und für den amerikanischen Kulturimperialismus wirbt. Anna, übernimm du ab hier, ich muss los und mit Jake reden.«
»Kein Problem«, murmelte ich. »Also, Raph, denk doch mal an die CO2-Bilanz eines Fernsehers. Du kannst dir nicht um die globale Erwärmung Sorgen machen und gleichzeitig lauter tolle Geräte haben wollen.«
Er kroch durch Moths zu Boden getropften Haferbrei unter dem Tisch hervor und stand auf. »Warum nicht?«
»Warum?«, fiel Moth ein. »Moth will Mamalade.«
Ich setzte mich hin. »Iss deinen Brei, Moth. Weil elektronische Geräte viel Energie verbrauchen und eine Menge Giftmüll produzieren.«
»Was für Giftmüll?«
Ich hatte vergessen, dass wir neuerdings die Strategie verfolgten, Raphael keinen weiteren Anlass zur Sorge um den Zustand der Welt zu geben.
»Weiß ich nicht. Moth, Schatz, schmier dir nicht den Brei in die Haare. Deinem Bruder auch nicht.«
»Brei in Haare! Mami sauber machen.«
Ich fuhr mit einer alten Mullwindel über Moths Haar. Er schob sie beiseite. »Kuckuck!«
Ich hielt sie mir vor das Gesicht und zog sie dann nach oben auf meinen Kopf.
»Kuckuck!«
»Mami, du siehst wirklich dämlich aus. Willst du den ganzen Tag im Nachthemd bleiben?«
Ich biss von dem Toast ab, den Moth abgelehnt hatte.
»Nein. Ich gehe gleich hoch und werde in einem meiner fantastischen Designer-Outfits wieder erscheinen, um den Brei wegzuwischen.«
Moth fing an, sich mit einem marmeladeverschmierten Messer die Haare zu kämmen.
»Willst du den Boden wischen, Raph? Ich glaube, du bist schon groß genug, um das allein zu machen, wenn du ganz vorsichtig bist.«
»Mit dem großen Eimer?«
Ich hob Moth aus seinem Hochstuhl und suchte ihn nach versteckten Breiresten ab.
»Wenn du meinst, du bist schon groß genug, um nichts zu verschütten.«
Der Garten war Giles’ Idee. Ich habe noch nie viel Sinn darin gesehen, die Hausarbeit auch noch auf Bereiche außerhalb des Hauses auszudehnen, zumal wir jetzt den Strand vor der Tür haben, durch den die Kinder flüchtig mit dem bekannt werden können, was Giles beharrlich die natürliche Welt nennt, als wäre die menschliche Angewohnheit, Unterkünfte zu bauen, Lebensmittel zu kaufen, die sie nicht selbst angebaut haben, und Bücher zu lesen, die sie nicht selbst geschrieben haben, auf irgendeine Weise unnatürlich. Giles sagt, in Oxford wäre ich mit den Kindern zu viel drinnen geblieben, auf dem Sofa ineinander verschlungen oder uns wie die Termiten an den Bücherregalen entlangarbeitend. Giles sagt, Moth wäre besser dran, wenn er Fingerhut und Vogeldreck isst und in der freien Natur nass wird. Giles verbringt seine Tage allein, arbeitend.
»Komm«, sagte ich zu Moth. »Wir suchen Mami was zum Anziehen.«
Es dauert lange, bis Moth die Stufen hochklettert, und noch viel länger, wenn man will, dass er schnell macht. Ich bleibe hinter ihm, mit erhobenen Händen, und versuche die Zeit zu nutzen, um über mein Buch nachzudenken. Unten in der Diele liegen herrliche viktorianische Mosaikfliesen in Weiß, Schwarz und einem Rot-Ton, der mich an Metzgereien erinnert, an geschnittenes Fleisch, und beim Treppengeländer ging es um Pracht und Würde, nicht um die Sicherheit von Kleinkindern.
»Raph?«, rief ich. »Raph, willst du mit in den Garten kommen?«
Nach einer Pause, in der ich die Ritzen zwischen den Bodendielen auf dem Treppenabsatz begrüßen konnte, und einer weiteren, in der ich an sämtlichen geschnitzten Blumen der Kommode herumwischen konnte, erreichten wir mein Schlafzimmer. Moth kletterte auf das Bett und schmierte Brei auf das Kissen. Auf dem Ärmel des Pullovers, den ich die ganze Woche über getragen hatte, waren Suppenreste, aber die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, dem das etwas ausmachte, war ungefähr so groß, wie dass sich die Schwäne in Prinzessinnen verwandelten und am Strand Pirouetten drehten. Moth gab mir einen Strumpf.
»Moth auch Garten?«
Ich schüttelte den Slip von gestern aus meiner Jeans. Es ist nicht wirklich ein Garten. Wir haben Krokusse und im Juni ein paar verwegene und verkrüppelte Narzissen. Und Giles, der den gängigen Interpretationen der historischen Zeugnisse zum Trotz an Autarkie glaubt, was den Obst- und Gemüseanbau hier oben betrifft, hat im Internet ein paar widerstandsfähige Zwergapfelbäume gefunden.
Als er die letzte der vier Bootsfahrten hinter sich gebracht hatte, die nötig waren, um sie von Colla hierherzubringen, kam Jake, der irgendwas wegen der Dachbalken von ihm wollte, und die Stipendiatin der Geschichtswissenschaft musste feststellen, dass sie nicht in der Lage war, Löcher für isländische Bäume zu graben, während ihr Nachwuchs Vogeldreck von den Steinen leckte.
»Moth im Garten Würmer essen«, sagte Moth und setzte sich auf meinen nackten Fuß. Ich wackelte unter seinem Hintern mit den Zehen und er kicherte. Einen zweiten Strumpf schien ich nicht zu haben.
»Raphael?«, rief ich. Manchmal ist dieses Haus zu groß, auch wenn ich es meistens ganz gut finde, dass die Steinmauern das Geschrei wütender Kleinkinder dämpfen. In Giles’ Sockenschublade waren saubere Socken, zu Paaren zusammengelegt, also zog ich einen an und streckte Moth die Hand hin. »Komm. Wir pflanzen ein paar Bäume.«
Ich suche noch nach einer Antwort auf die Frage, was ich mit Moth machen soll, während ich versuche, mich meinen sonstigen Aufgaben zu widmen. Eine Frage, die sich zu Hause nie gestellt hat. In Oxford, meine ich. Wenn ich bei der Arbeit war, habe ich gearbeitet, und wenn ich zu Hause war, habe ich mich um die Kinder gekümmert und ständig darauf geachtet, gerade dem vorzulesen, der sonst als Erster einen Trotzanfall bekommen würde. Endlich dann die fernen Ufer Abendessen, Bad und Bett. Danach wurde ich noch ein paarmal wegen verlegter Teddys gerufen, weil jemand Wasser trinken wollte oder es nötig war, vor dem Einschlafen mehr Einsicht in das Verhältnis von Triebkraft und Masse zu gewinnen, und dann hatte das intellektuelle Leben wieder die Oberhand, zumindest bis Moth zum ersten Mal aufwachte. Niemand hat von mir erwartet, Bäume zu pflanzen. Niemand hat von Moth erwartet, sich allein zu beschäftigen. Ich habe noch nie einen Baum gepflanzt. Von dem gepflasterten Platz vor dem Haus hörte ich das rhythmische Aufklatschen von Raphaels Hüpfball.
»Moth? Möchtest du mal gucken, wie die Bäume wachsen?«
Moth wankte über das Gras und trampelte auf der Suche nach Vogeldreck die aufkeimenden Narzissen nieder. Vielleicht enthält er einen äußerst wichtigen Nährstoff, der dem, was ich koche, unverzeihlicherweise fehlt.
»Moth? Sollen wir mit Mamis großem Spaten ein bisschen graben?«
Keine Antwort. Ich folgte ihm.
»Mit Mamis großem, scharfem Spaten?«
Er sah sich um. »Scharfen Spaten?«
Ich nickte. »Sehr scharf.«
»Sehr scharfen Spaten.«
Stille.
»Moth sehr scharfen Spaten.«
Er machte kehrt und trudelte auf den scharfen Spaten zu. Es konnte nur ein Fortschritt sein, ihn vom Vogeldreck weg und in den Bereich meines Arbeitsvorhabens hinein zu bekommen. Ich gähnte und streckte mich. Noch Stunden bis zum Schlafengehen. Ich versuchte zu überlegen, wie man ein Loch in die Erde gräbt.
Moth stakste um die Bäume herum, die alle mit einem Leinensack umhüllt waren, und griff nach dem Spaten. Er konnte ihn nicht hochheben.
»Moth sehr scharfen Spaten!«
»Ja. Moth, mein Schatz, willst du Mami helfen, ein Loch zu graben? Ein schön tiefes Loch, in dem die Wurzeln der Bäume Platz haben?«
Er fing an, den Spaten über das Gras zu ziehen, ein Jäger, der so stolz auf sein Mammut war, dass er nicht auf Unterstützung warten konnte.
»Nein. Moth Spaten.«
»Aber der Spaten ist dafür da, Löcher zu graben. Sollen wir ein Loch graben? Moth und Mami?«
»Nein.«
»Aber, Moth, guck mal. Dazu benutzt man einen Spaten.«
Ich nahm ihn mir. Er zog daran.
»Mami hergeben. Moth Spaten.«
»Aber guck mal, Schätzchen …«
Er schmiss sich zu Boden und riss die Arme über den Kopf. Das Geschrei klang, als sähe ein unschuldiges Kind gerade die Gefolgsleute von Herodes auf sich zukommen.
»Na gut, na gut. Moth Spaten.«
Er hatte schon wieder Luft geholt und sah mich an, als wollte er dem Gefolgsmann zu verstehen geben, dass es sich bei diesem konkreten Kind eigentlich um ein Mädchen handelte, er also verschont werden müsse.
»Na gut, Moth spielt mit dem Spaten. Mami findet schon was anderes.«
»Moth Spaten.«
Er setzte sich auf und begann, den Griff zu streicheln.
»Schlaf, Spaten, schlaf, der Vater hüt die Schaf.«
In einem flachen Korb neben den umhüllten Bäumen lag eine Pflanzkelle. Mit der sich in der von Wurzeln durchzogenen Erde nicht mehr bewirken ließ, als zu erwarten gewesen wäre.
»Schlaf jetzt, kleiner Spaten.« Moth beugte sich vor und küsste den Griff des Spatens. »Moths Schatz. Schlaf jetzt.«
Ich fragte mich, ob ich den Spaten wieder der erwachsenen Welt zuführen konnte, wenn er erst einmal eingeschlafen war.
»Ist der Spaten eingeschlafen?«
»Schsch.« Er tätschelte ihn. »Leise, Mami. Spaten schläft.«
Ich kniete mich hin, um mehr Druck auf die Pflanzkelle auszuüben. Genauso gut hätte ich mit einem Löffel graben können. Der Hüpfball war auffällig still geworden.
Zum Mittagessen gab es eine Art Kartoffelomelett, das ich Giles gegenüber als Frittata bezeichnete. Es wäre besser gewesen, wenn ich die Kartoffeln entweder vorher gekocht oder sie ungefähr eine Stunde früher in die Pfanne getan hätte, aber ein Vorteil seiner Kindheit im Internat ist, dass Giles außer den schlimmsten Fehlgriffen alles essen kann und wird. Theoretisch bin ich gegen Kochen. Es ist kein Zufall, dass Fertigmahlzeiten und Supermärkte zur selben Zeit auftauchten wie die Gesetze zur Gleichstellung von Mann und Frau. Praktisch bedeutet Kochen, dass man sich in der Küche verstecken, das Messer schwingen und Radio Four hören kann und trotzdem noch eine gute Mutter ist – eine Spielart häuslicher Dienstbarkeit, die allerdings nicht ganz dem entsprechen dürfte, was Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst oder Betty Friedan sich vorgestellt haben. Hier auf der Insel macht es sogar noch weniger Spaß, weil ich meistens kein Radio Four empfangen kann, das Gemüse einmal pro Woche seekrank aus Colla kommt und das Olivenöl, das Giles sich angewöhnt hat über meine fragwürdigeren Kreationen zu tröpfeln wie eine Art Upperclass-Ketchup, vermutlich teurer ist als Heroin. Das in jedem Fall wirksamer sein dürfte.
Nach der Frittata ging ich weg, während Giles noch den Kaffee machte. Das habe ich von ihm gelernt. Man sagt nicht: »Macht es dir was aus, wenn ich ein Stündchen arbeite, und würdest du Moth zum Mittagsschlaf hinlegen und Raph in das einbeziehen, was du als Nächstes vorhast?« Man sagt noch nicht mal: »Ich versuch ein bisschen zu arbeiten, wenn das okay ist.« Sogar das würde als verhandelbar ausgelegt werden. Man verlässt einfach das Zimmer, als wäre einem gar nicht in den Sinn gekommen, dass jemand die Küche aufräumen, Moths Windel wechseln und eine halbe Stunde über seinem Bettchen hängen muss, um seinen Rücken zu streicheln, während Raph das Geländer runterrutscht und jodelt, wie es ihm sein Patenonkel Matthias beigebracht hat, und dass jemand das Klo putzen und Raph mit dem Lego helfen muss, das Moth aufisst, wenn er Gelegenheit dazu bekommt, und dass jemand Brei machen und dann Moth wecken muss, der sonst den ganzen Nachmittag schläft und die ganze Nacht wach bleibt, als gehöre er einem dieser weinseligen Mittelmeer-Völker an, bei denen die Erwachsenen keine Zeit für sich selbst zu brauchen scheinen. Ich schlich um das Haus, entwendete mein Laptop aus dem grünen Luxusferienhaus beziehungsweise der Baustelle, auf der ich zu leicht zu finden wäre, und ging am Ufer entlang in Richtung des alten Dorfes. Eigentlich ist es nicht mal ein Weiler, bestehend aus den Ruinen von zwölf Steincottages, die kaum größer sind als die Küche von Colsay House. Sie wurden seit dem späten neunzehnten Jahrhundert nach und nach verlassen, und nur das Cottage, in dem bis zuletzt jemand wohnte, verfügt noch über einen Großteil des Daches. Es war bisher ein kühler Sommer, und ich habe mich gefragt, ob ich im Kamin ein kleines Feuer machen könnte, aber das Dorf ist vom großen Haus aus zu sehen, und das Letzte, was die arbeitende Mutter tun sollte, ist Rauchsignale aussenden, die ihren Aufenthaltsort preisgeben, also begnügte ich mich mit Halbfingerhandschuhen und einem Mantel, der mir das bedauerlich angebrachte Gefühl vermittelte, beständig im Aufbruch zu sein. Zum Haus gehört außerdem ein Küchentisch und Schafmist auf dem Boden, und an einer Wand hängt das gerahmte Foto eines jungen Mannes, der eine Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg trägt. Aber es ist ein Raum mit intakter Decke, in dem ich Internetzugang habe, also alles, was ich wirklich brauche.
Ich öffnete die Einleitung – normalerweise vermeide ich das, denn sie ist nicht sehr gut. Ich finde es schwer, den Anfang zu begründen. Ich beginne wenig originell mit dem Wolfsjungen von Aveyron, der am Anfang von mehr als einer weiteren Geschichte der Kindheit steht. Der Wolfsjunge wurde 1797 schlafend im Wald in der Nähe von Aveyron gefunden, in den französischen Alpen. Er war ungefähr zwölf, hatte eine tiefe Narbe, die von Ohr zu Ohr verlief, und verfügte weder über Kleidung noch über Sprache. Mehrere Jahre lang hatte er bei den umliegenden Bauernhäusern etwas zu essen erbettelt, aber niemand wusste oder bekannte zu wissen, woher er kam und wohin er wieder ging. Es wurde das perfekte Thema für philosophische Überlegungen – ein menschliches Wesen, das ohne Gesellschaft aufgewachsen war (wobei sie die Menschen ignorierten, die ihn geboren haben mussten, ihn gestillt und davon abgehalten hatten, Fingerhut und Vogeldreck zu essen, als er noch zu jung war, um es besser zu wissen, und die ihm, viele Jahre später, den Hals aufschlitzten und ihn tot im Wald zurückließen). Jean-Marc Itard, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, den Wolfsjungen zu zivilisieren, schrieb:
Wie hätte man erwarten können, dass er um die Existenz Gottes wüsste? Zeigte man ihm den Himmel, die grünen Felder, die Weite der Erde, das Werk der Natur – er sähe in alldem nichts, sofern es nicht etwas zu essen wäre. Und da haben Sie den einzigen Weg, auf dem äußere Dinge in das Bewusstsein eindringen.
Ich starrte eine Weile darauf. Gott oder Essen, wonach würde man an einem Berghang suchen?
»Mami?«
»Um Gottes willen, Raph, was machst du denn hier?«
»Mami, möchtest du, dass ich dir einen Dynamo für dein Laptop mache? Du könntest darauf sitzen und in die Pedale treten und so die Energie für den Rechner produzieren. Dann könntest du trainieren, während du schreibst.«
»Nein, könnte ich nicht, weil ich nicht genug Zeit zum Schreiben habe, um auch nur eine Weintraube zu verbrennen. Angenommen, es gäbe hier irgendwo Weintrauben. Raph, bitte geh Papa suchen. Bitte lass mich schreiben. Nur solange Moth schläft.«
Sein Haar war am Hinterkopf, wo er nachts darauflag, verfilzt, und sein Oberteil, das ich vor drei Jahren zwei Nummern zu groß gekauft hatte, endete kurz über dem Bauchnabel.
»Es müsste wahrscheinlich irgendwo befestigt werden, wahrscheinlich wäre es nicht möglich, es herumzuschieben, aber ich könnte es entwerfen, das wäre gar nicht so schwer. Du müsstest ziemlich schnell machen, wenn du ein Spiel spielen möchtest oder so, aber für das Schreibprogramm könntest du wahrscheinlich genug Strom generieren. Ich könnte es auch so ausrüsten, dass der Strom in den Ofen oder eine Elektroheizung geleitet werden kann. Ich könnte im Internet nach den Materialien suchen …«
Er sah aus dem Fenster, während er sprach, in Richtung des leer stehenden Hühner- und des dachlosen Schweinestalls.
»Raph, bitte. Das wäre bestimmt ganz toll. Aber lass mich jetzt einen Blick auf die Einleitung werfen.«
»Wir könnten doch im Blackhouse einen Fitnessraum einrichten, damit die Leute ihren eigenen Strom erzeugen. Es könnte ein Laufband geben – das wäre ganz einfach zu bauen, so eine Art Hamsterrad, wie die Römer sie gemacht haben, damit die Sklaven die Kräne bewegen.« Er begann, mit den Armen zu wirbeln, wie die Leute, die auf dem Rollfeld rückwärts vor den Flugzeugen herlaufen. »Man könnte es eigentlich auch mit Bankdrücken machen, das wäre dann zwar ziemlich riesig, aber das ginge bestimmt.«
Das hier dargestellte Nebeneinander von romantischer Erwartung und der Locke’schen Bedarfsdeckungswirtschaft steht im Zentrum dieses Buches. Die Wildheit des Wolfsjungen besteht, wie gezeigt wird, nicht in seiner spirituellen Beziehung zu Himmel und Landschaft, wie der Leser des frühen neunzehnten Jahrhunderts erwarten würde, sondern in der Abwesenheit derselben. Es ist kein Kind, das »den herrlichen Wolken hinterherzieht«, sondern ein kindlicher homo oeconomicus, ein Wesen, dessen Potenzial als Konsument und Produzent durch ein in hohem Maße theoretisches Programm freigesetzt werden muss. Mit ebendiesem homo oeconomicus beschäftigt sich auch ein großer Teil der populäreren Texte über die Kindheit, insbesondere das neue Genre der Erziehungsratgeber. Elternschaft ist nicht länger einfach ein biologischer Zustand; sie ist zu einem Unternehmen geworden, bei dem man scheitern kann, und es ist diese Möglichkeit des Scheiterns, die Raum schafft für die Institutionen, die anbieten, an die Stelle gescheiterter Familien und Gemeinschaften zu treten.
Wir wissen nicht mehr, dachte ich, als dass wir unsere Menschlichkeit durch die Eltern erlangen und dass wir sie verlieren können, ja dass Menschen so schlimm verletzt werden können, dass sie die Fähigkeit verlieren, menschlich zu sein. Der Wolfsjunge hat niemals eine Sprache erlernt, nie gelernt zu spielen oder zu lieben oder auch nur nachts durchzuschlafen. Weil seine Eltern ihn weggeworfen haben. Wer bin ich, für die Weitergabe von Menschlichkeit zuständig zu sein? Ich löschte das erste homo oeconomicus und dachte über ein Synonym nach.
»Mami?«
»Was?«
»Miss Towers bei mir in der Schule hat gesagt, wir sollen ›wie bitte‹ sagen.«
»Da irrt sie sich. Was ist denn?«
»Wenn wir diesen Öko-Fitnessraum haben, ja? Soll der dann auch den Fernseher drüben mit Strom versorgen?«
»Da ist kein Fernseher.«
»Nein, aber da könnte ja einer sein. Weil, wenn sie ihn selbst mit Strom versorgen, dann wirkt das dem späten kapitalistischen Kulturimperialismus entgegen, ja?«
»Raph, hör auf, die ganze Zeit ›ja‹ zu sagen.«
Die Uhr auf meinem Laptop ging nach, aber trotzdem war ich seit über einer Stunde weg und es wurde Zeit, Moth zu wecken. Giles lässt ihn schlafen, nicht unbedingt, weil er meint, die Nächte wären mein Problem – das hoffe ich zumindest –, sondern weil er unfähig ist, so zu handeln, dass es eine Auswirkung auf etwas hat, was sechs Stunden in der Zukunft liegt.
»Komm, wir wecken Moth.«
Colsay House,Colsay
30. September 1878
Liebste Allie,
ich hatte gehofft, in Inversaigh einen Brief von Dir vorzufinden, da mir gesagt wurde, es könne einige Wochen dauern, bis es jemandem genehm ist, wieder einmal die Meerenge zu überqueren, aber es macht nichts. Ich hoffe, zu Hause ist alles gut und Papas Musen benehmen sich. Ich stelle mir immer vor, wie neun kleine Mädchen aus dem Atelier stürmen, noch nicht fertig angekleidet, und Mamas Damen beschließen, sie einzufangen und ihnen Vernunft beizubringen, und wie verärgert Miss Horton dann wäre! Schreib mir bald, Liebste, ja? Ich habe einen sehr freundlichen Brief von Miss Emily bekommen, in dem sie mir versichert, dass ich jede Ausrüstung und jeden Rat bekomme, den ich benötige, und einen von Sir Hugo persönlich hat sie ebenfalls beigelegt. Er bittet mich, ihm meinen Eindruck von den Menschen hier in Colsay zu beschreiben und dabei besonders den Nöten ein Augenmerk zu schenken, die sich meiner Einschätzung nach durch kleinere Summen lindern lassen. So würde sich ein gebieterischer Hausherr wohl kaum äußern!
Meine Anreise war überwiegend ereignislos, obwohl Du recht hattest, ich hätte mehr zum Lesen mitnehmen sollen. In dem Hotel in Edinburgh kam ich mir so auffällig vor, dass ich den großen Speisesaal mied und mich aus Feigheit von Brötchen aus einer nahe gelegenen Garküche ernährte, die ich im Bett zu mir genommen habe, da es dort ja keine Zeugen gab! Nach einer recht heiklen Überfahrt bin ich hier vor zwei Tagen angekommen und habe meine Zeit seitdem damit verbracht, den großen Schrankkoffer auszupacken, durch den Weiler und am Ufer entlangzuspazieren und zu versuchen, mich mit der Haushälterin anzufreunden. Ich nehme an, ich muss morgen mit der Arbeit beginnen. Die Einheimischen habe ich bisher nur flüchtig gesehen, und ich hatte den Eindruck, dass sie nicht den Wunsch nach einer näheren Bekanntschaft verspüren – die Frauen haben auf der Straße miteinander gesprochen (die Straße ist ein grob gepflasterter Bereich zwischen den Häusern, recht ungeeignet für Räder, was jedoch nicht ins Gewicht fällt, da es hier, wie mir scheint, keine Möglichkeit der Beförderung gibt), aber sie sind in ihren Häusern verschwunden, als sie mich kommen sahen. Möglicherweise ist dieser Eindruck meiner Müdigkeit an den ersten Tagen an einem neuen Ort geschuldet.
Ich soll im Großen Haus wohnen (das so genannt wird, obwohl gerade einmal unsere Bibliothek und Papas Atelier hineinpassen würden), und wenngleich es, verglichen mit den Behausungen der Dorfbewohner, behaglich ist – kannst Du Dir vorstellen, dass einige von ihnen noch mit ihren Tieren zusammen leben und essen? –, frage ich mich, ob sich das nicht am Ende als Nachteil erweist. Vermutlich weiß jeder, dass Miss Emily mich hierherbestellt hat und mich bezahlt, aber ich frage mich doch, ob meine Arbeit nicht leichter wäre, wenn ich unter den Menschen leben würde, die ich betreuen soll. Das Große Haus liegt etwas abseits vom Dorf und von den Feldern, auch vom Meer, als sollte das zeigen, dass seine Bewohner weder Felder noch Fischernetze brauchen, um ihren Tisch zu decken. Obwohl ich schon sagen muss, dass es schwer wäre, die Federbetten und gusseisernen Öfen zurückzulassen, nach allem, was ich von den Unterkünften im Dorf gesehen habe! Mal Dir kein uraltes Schloss aus, wie es Papas Herz erfreuen würde; wenn es hier Gespenster gibt, dann müssen es die jungen Geister der Armen und Kranken sein, denn ich vermute, dass Sir Hugos Vater die alten Unterkünfte der Jungfern der Highlands und der jungen Gefolgsleute von Prinz Charlie abgerissen hat, als er die Insel kaufte, und sie durch saubere, neuartige Hütten ersetzt hat, die in nichts über dem Stand ihrer Bewohner liegen und Raum für die Familie oder ein paar Fischer bieten, aber in keiner Weise mit dem Haus zu vergleichen sind, das die Cassinghams in Edinburgh bewohnen. Sag es Papa nicht, aber in Wahrheit kann ich mich über einen gefliesten Fußboden und Schießscharten nicht beklagen, solange ich ein Schiebefenster und einen schönen kleinen Schutzschild vor dem Kamin habe, an dem ich meine Füße rösten kann, wenn der Wind in den Traufrinnen wühlt und der Regen auf die Dachziegel peitscht, die über das Meer hierhergebracht wurden, damit die Cassinghams es behaglich haben (ich teile allerdings seine Abneigung gegen die geflieste Halle, die aussieht wie ein öffentliches Bad – selbst von einem frischgebackenen Aristokraten würde man mehr erwarten).
Ich habe ein kleines Zimmer an der Seite des Hauses, in dem die Mädchen schliefen, wenn die Cassinghams hier den Sommer verbrachten, bevor Sir Hugo wieder geheiratet hat. Ich habe gefragt, wann die Familie die Insel zuletzt besucht hat; offenbar gibt es einen Sohn, Hartley, der im Frühling mehrere Wochen hier war, aber niemanden für sich eingenommen zu haben scheint – der Hotelbesitzer aus Inversaigh sagt: »Die Insulaner sind an die Art der jungen Leute von heute nicht gewöhnt und es gibt viele, die denken, dass er es besser wissen sollte, als den Pächtern seines Vaters solche Schwierigkeiten zu machen.« Ich habe bemerkt, man sollte meinen, dass es auf Colsay nicht allzu viele Möglichkeiten gebe zu sündigen, und er hat, ganz im Stil von Samuel Johnson, geantwortet, dass die Erlösung nicht vom Wohnort abhängig ist – worin man ihm kaum widersprechen kann! Er hat eine nur natürliche Neugier für meine eigenen Beweggründe gezeigt, auf die Insel zu kommen, da sicher nur wenige englische Damen eine Neigung erkennen lassen, Colsay zu besuchen, aber als er begriff, dass ich ausgebildete Krankenschwester bin und keine Dame mit viel Muße, sagte er nur, es sei eine Schande, dass die Cassinghams sich nicht in der Lage gesehen hätten, früher etwas zu tun. Ich wies darauf hin, dass es Sir Hugo und seine Schwester waren, die mich hergeschickt haben, aus reiner Menschenliebe (sofern Menschenliebe jemals rein sein kann), aber dieses Gespräch ist der erste Hinweis auf die Missstimmungen, von denen wir so viel gelesen haben. Mir kommt es in der Tat ungerecht vor, dass politische Umstände einen Schatten auf Miss Emilys Wohltätigkeit werfen.
Die deutlich geschwätzigere Tochter des Gastwirts sagte, dass die zweite Lady Hugo sich weigere herzukommen, sie ziehe Nizza vor – und man versteht, warum, denn wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich streng genommen gar nichts, so sehr regnet es, aus Wolken, die so tief hängen, dass sogar die Gartenmauer verschleiert ist. Seltsam, dass Aubreys Gemälde denselben Ort zeigen sollen, aber nicht mal er konnte dieses Licht über dem Meer erfinden. Ich hoffe sehr, dass ich hier all das tun kann, was er sich von mir erhofft. Ich wünschte, ich wüsste, was Aubrey sagte, als er mich Sir Hugo anempfahl, und manchmal frage ich mich wirklich, warum ihm so viel daran lag, dass ich diese Stellung bekomme – ich empfinde es wie eine Prüfung, aber ob es dabei um meine Zuneigung für ihn oder um meinen Charakter oder meine beruflichen Fähigkeiten geht, vermag ich nicht zu sagen. In jedem Fall scheint es, als würden sie alle großes Vertrauen in mich setzen, und ich gebe zu, dass es mich ein wenig erschüttert, wie ich hier bisher empfangen wurde. Miss Emily hat eine Frau namens Mrs. Barwick geschickt, die aus Colsay kommt, aber als ihre Zofe ausgebildet wurde und als solche tätig war, bis sie ihre Sandkastenliebe heiratete und wieder hierher zurückkam. Sie soll sich um den Haushalt kümmern und mir bei anderen Dingen behilflich sein. Aus ihrer Kleidung schließe ich, dass Mrs. Barwick verwitwet ist, obwohl es meines Wissens nur bei den älteren Frauen Sitte ist, Schwarz zu tragen, aber Mrs. Barwicks Kleidung sieht nicht aus, als wäre sie hier gefertigt worden. Wie es scheint, werde ich ihre Dienste nicht nur als Haushälterin und Köchin, sondern auch als Dolmetscherin in Anspruch nehmen müssen, denn viele Frauen sprechen nicht sehr gut Englisch und dürften in Augenblicken größter Bedeutung natürlich noch mehr dazu neigen, in ihre Muttersprache zu verfallen!
Heute bin ich zum Friedhof hinuntergegangen (gut verpackt, mit dem Regenmantel von Miss Emily noch obendrüber), in der Erwartung, viel zu viele kleine Hügel vorzufinden, aber als ich zu Mrs. Barwick zurückkam, die mein unstetes Fortkommen vom Fenster aus beobachtet haben muss, bemerkte sie, dass es »zu viel Arbeit sei, für jedes geborene Baby wieder zu graben«, und dass sich bei der letzten Beerdigung bereits zwei Särge im Grab befunden hätten, vom alten James McGillies gar nicht zu reden. Ich habe nicht nachgefragt, ob es sich bei dem alten James McGillies um den ursprünglichen Grabbesitzer handelte oder um den Gräber dieser unruhigen Ruhestätte!
Wie auch immer, meine Kerze brennt herunter, und wenn ich mir ab morgen meinen Lohn verdienen soll, gehe ich besser schlafen. Schreib mir bald und sag Mama, sie soll es auch tun – ich werde Papa nicht bitten, seine Musen allein zu lassen, denn wer weiß, was sie machen, wenn sie nicht beaufsichtigt sind (vielleicht inspirieren sie die arme Hettie, oder sie lenken die Köchin ab, sodass sie Sonette anfertigt statt Soufflés, und dann wäre Papa verärgert!).
Herzliche Grüße an alle, wie immer,May
Dem kindlichen Patienten nicht zugänglich
Das Eisenbahnspiel ist je nach seiner Form für eine ganze Reihe von unbewußten Phantasien charakteristisch: eine nicht endende Folge von Zusammenstößen verrät, daß das spielende Kind im Unbewußten mit den Rätseln des elterlichen Geschlechtsverkehrs beschäftigt ist; die Vorliebe für Tunnels und Untergrundbahnen entspricht der Neugier für das Körperinnere; schwer beladene Fahrzeuge symbolisieren Schwangerschaftsgedanken; die Konzentration auf gutes Funktionieren und Schnelligkeit stammt aus der Freude des männlichen Kindes an der Penisfunktion. (…) Daß der Analytiker selbst das Unbewußte hinter dem Bewußtsein zu sehen gelernt hat, heißt noch nicht, daß er es auch in der Therapie dem kindlichen Patienten zugänglich machen kann. Typische Entsprechungen zwischen Es-Inhalten und Ichhaltungen sind keine guten Grundlagen für die Deutungsarbeit in der Analyse. Symboldeutungen überspringen und vernachlässigen die Ichmaßnahmen gegen abgewehrte Inhalte.
Anna Freud, Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung
Nachtwache, 01:17 Uhr
Ich erinnere mich an die Pilates-Übungen, die ich gemacht habe, als es noch Pilates-Lehrerinnen in der Nähe gab und andere Mittelklassemütter, die einmal zu oft in den Spiegel gesehen hatten, aber auch nicht genug Selbstverachtung aufbrachten, um ins Fitnessstudio zu gehen. Spüren Sie, wie sich Ihre Wirbel entlang des Rückenmarks entspannen, sagte die Lehrerin immer. (Was eigentlich kein beruhigendes Bild ist, denn wir brauchen die Wirbel doch sicher, um das Rückenmark zu schützen? Verspannte Schultern scheinen für Erkenntnis und motorische Fähigkeiten kein zu hoher Preis zu sein.) Ich hänge gebeugt über dem Kinderbett, meinen Zeigefinger in Moths klebriger Faust, seit sechsunddreißig Minuten, in denen ich vier Fluchtversuche unternommen, sechzehnmal von Anfang bis Ende »Schlaf, Kindlein, schlaf« gesungen habe und zu der Überzeugung gelangt bin, dass das Kribbeln in meinen Händen auf eine neurologische Erkrankung und einen frühen, wenn auch langsamen Tod hindeutet. Wie viele Jahre meines Lebens würde ich geben für acht Stunden ungestörten Schlaf?
Es hängt davon ab, wie lang mein Leben sein wird. Von hundert Jahren würde ich zehn geben. Ich überlege, wie viel ich zwischen neunzig und hundert lesen könnte. Es stünde mir frei, in dem zu leben, was meine Mutter immer »diese ganze Unordnung« genannt hat, und mich von Kitkat und Chips mit Salz und Essig zu ernähren. Ich habe schon immer für Seniorenwohnanlagen geschwärmt. Ich bin mit dem Fahrrad manchmal an solchen Wohnungen vorbeigekommen, wenn ich zum Pilates oder mit den Kindern zum Schwimmen gefahren bin, und beim Hineinspähen sah ich alte Damen in geblümten Ohrensesseln und kleinen Küchen, die mich an das Barbie-Haus erinnerten, das ich niemals hatte, und sie lasen oder sahen mitten am Vormittag fern. Ich wettete, dass sie in diesen Küchen für sich selbst Kuchen backten, und manchmal trafen sich einige von ihnen in einem Wohnzimmer mit getäfelten Wänden, einem Klavier und Beistelltischchen, auf denen Blumenarrangements und Blechdosen mit Schokoladenkeksen standen, wie in einem Kostümfilm, der im achtzehnten Jahrhundert spielt. Nein, ich werde kein Jahrzehnt zuckerberauschten Sichgehenlassens drangeben, nicht mal, um zu schlafen. Ich versuche, meinen Finger zu bewegen, und Moth schnieft und macht ein Auge auf. Okay, fünf Jahre von hundert. Wenn ich abgeschieden irgendwo schlafen kann, wo es schalldicht ist, und ich weiß, dass Giles für die Kinder sorgt.
Und global betrachtet, was würde ich für ein bisschen Schlaf geben? Wäre mir, wenn ich die Wahl hätte, Frieden in Palästina wichtiger oder zwölf Stunden im Bett? Sauberes Wasser für die Kinder in Afrika oder eine Woche, in der ich vom Muttersein freihätte? Dass sich eine CO2-neutrale Industrie durchsetzt, oder ein Monat ungestörter Nächte? Wie gut, dass Satan nicht mitten in der Nacht zu den Müttern schlafloser Kleinkinder kommt, um ihnen irgendwelche Angebote zu machen.
Moths Griff lockert sich. Beiläufig ziehe ich meinen Finger Millimeter für Millimeter heraus, wobei ich meine Hand über seine halte, damit sich die Form des Schattens auf dem Kinderbett oder sein Atemfluss nicht verändern. Ich strecke vorsichtig meinen Rücken. Er dreht sich um.
»Mami hierbleiben!«
Ich beuge mich wieder hinunter, biete ihm die andere Hand an, damit ich die taube Schulter bewegen kann.
»Nein. Annere Hand.«
Wie viele Jahre würde ich jetzt geben? In genau diesem geplagten Augenblick? Wenn ich nicht sofort wieder ins Bett gehe und schlafe, laufe ich aus dem Haus und über die Steine ins Meer, und ich werde immer weiter laufen, bis die Insel nur noch ein Fleck auf den schimmernden Wellen ist und das kalte Wasser in meine Lungen steigt.
Ich tue es nicht.
»Du könntest es ja auch bleiben lassen.« Giles, der offenbar Jake gebeten hat, ihm vom Endpunkt des englischen Zeitungsvertriebsnetzes auf dem Festland einen Guardian mitzubringen, sah vom Sportteil auf. Mein Blick fiel auf die Titelseite, auf der eine Mutter mit Kopftuch ein schlaffes Kind in den Armen wiegte.
»Zeig das um Gottes willen nicht Raph. Wir hatten das doch alles schon. Moth kann länger schreien, als ich ihm dabei zuhören kann. Er hat die ultimative Waffe, und ich habe keine. Er hält es inzwischen schon für lustig, wenn ich schluchze und meinen Kopf an die Wand schlage.«
Giles stellte seinen Kaffee auf einen älteren, aber ungeöffneten Brief von den Kinderfreibetrags-Leuten. »Ich wünschte, du würdest das nicht tun. Das ist nicht gerade ein gutes Vorbild, oder?«
»Ach, Scheiße, Giles. Probier du mal aus, wie es ist, drei Stunden über dem Kinderbett zu hängen, in die Dunkelheit zu starren und zu beten, dass du stirbst.«
»Scheiße«, sagte Moth und ließ seine Schale auf den Tisch donnern.
»Anna!« Giles hasst es, wenn die Kinder fluchen.
»Was? Hast du Sorge, dass er dich vor den Nachbarn in Verlegenheit bringt? Dass er die Möwen mit seiner gottlosen Sprache schockiert? Warum verpisst du dich nicht zu deiner homosozialen Bonding-Session im Ökohaus, während ich das Frühstück wegräume und noch mal versuche, deine verdammten Bäume einzupflanzen.«
»Verpiss dich«, sagte Moth zu seinem Löffel. »Verdammte Bäume.«
Giles stand auf, nicht so bestürzt, dass er nicht daran gedacht hätte, den Guardian mitzunehmen. »Es ist erschütternd, wenn du so redest.«
Ich goss mir Tee ein. »Ja, weißt du, mich erschüttert es, wenn ich die ganze Nacht wach bin und du so tust, als würdest du schlafen, und dann vergeht mein Tag damit, den Haushalt zu machen und mich um die Kinder zu kümmern, und ich hab keine Zeit zu schreiben, während du rumstolzierst und Vögel zählst und mit Jake Tee trinkst.«
Er ging langsam aus dem Zimmer. »Anna, ich zähle keine Vögel. Ich versuche herauszufinden, warum die Papageientaucher-Population in den letzten vier Jahren um fünfundzwanzig Prozent zurückgegangen ist …«
»Also hast du sie gezählt.«
»Und was den Haushalt angeht, kann ich nur sagen, wenn du wirklich den Tag damit verbringst, bist du nicht besonders effizient.«
»Ich bin Historikerin, falls du dich noch erinnerst. Ich bin Rackind-Stipendiatin in St. Mary Hall. Wenn es dir um den Haushalt geht, hättest du eine dieser Clarissas heiraten sollen, die deine Mutter ständig angeschleppt hat. Und dann hättest du ihr eine Pferdekoppel und seltene Zuchtlabradore und wahrscheinlich auch ein Hausmädchen besorgen müssen.«
Er verließ das Haus.
»Labbadore«, sagte Moth. »Labbadore böse?«
»Ja. Wild.« Ich trank von dem Tee, der kalt war. »Komm, wir suchen deinen Bruder.«
Raph spielte wieder seine Katastrophenspiele. Er lag auf dem Fußboden des Spielzimmers, einem Raum mit Stuck an der Decke, der, bis Giles Colsay erbte, das Esszimmer gewesen war und in dem seine Eltern sich mit der Tischwäsche, dem verzierten Silber und der Bratensoße aus ihrem Leben in Sussex umgeben hatten. Es war nicht Giles’ Mutter Julia, sondern seine italienische Freundin gewesen (die, über deren Verlust ich ihn hinweggetröstet habe), die ihm beigebracht hatte, was gutes Essen ist. Ihre Risotti hatten nicht die Leichenhaus-Note meiner seltenen hausgemachten Versuche; englische Tomaten bekamen unter ihren schlanken Fingern ein volles Aroma, aber irgendwann wurde sie wieder in das Land der Wildschweinsalami mit Fenchelsamen und Steinpilzen zurückgebeamt. Wahrscheinlich. Giles ist zu galant, ihnen wie mir gegenüber, um über seine Exfreundinnen zu sprechen. Jedenfalls wird Julia mich noch weniger mögen als ohnehin schon, wenn sie sieht, dass in ihrem nun überwiegend mit Lego eingerichteten Esszimmer Acrylteppiche mit Straßen und Verkehrskreiseln liegen und Notfallpläne mit Raphs Diagrammen von atombetriebenen Popcornmaschinen und mit Wasserkraft betriebenen Hubschraubern.
»Was machst du, Raph?«
»Zug!«, sagte Moth und zappelte auf meiner Hüfte. »Runter.«
Ich drückte ihn noch fester an mich. Das Letzte, was jemand braucht, der die Apokalypse nachstellt, ist ein Kleinkind, das alles noch schlimmer macht. Raphael musste seit Stunden wach sein. Er hatte sämtliche Holzschienen zu einem System verbaut, ohne dass es irgendwo ein offenes Ende oder ein übriges Stück gegeben hätte und ohne die Plastikverbindungen zu benutzen, die aus weiblichen Verbindungen männliche machten – ein Kunststück, das verschiedenen Akademikern aus Oxford auch nach der dritten Flasche Wein nicht gelungen ist.
»Nichts.«
Da war ein Bahnhof mit Gleisen, auf denen ein kleiner Zug wartete, ein größerer mit InterCity-Lackierung schwebte unter dem Fenster. Die Anordnung war unmissverständlich.
»Woher weißt du von dem Paddington-Zusammenstoß?«
»Sammenstoß!«, sagte Moth.
»Ich mache nichts Schlimmes. Bitte geh weg.«
»Ich weiß, dass du nichts Schlimmes machst. Ich bin nur überrascht, dass du davon gehört hast. Warst du da überhaupt schon geboren?«
»Mami, bitte bring Moth weg. Er macht sonst alles kaputt.«