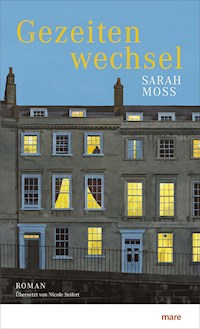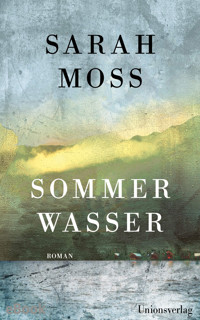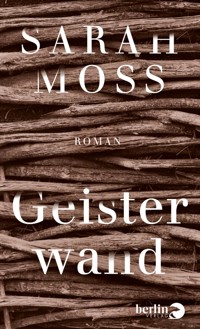Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mare Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was ist das für ein Land, in dessen Supermärkten man vergeblich nach frischem Gemüse sucht, dafür aber auf abgepacktes Walfleisch stößt? In dem man Waffen mit an Bord eines Flugzeugs nehmen darf (und sogar fünf Kilo Munition, solange diese in einer anderen Tasche stecken)? In dem das Verkehrsamt ein sagenhaftes unsichtbares Volk befragt, bevor es den Verlauf einer neuen Straße plant? Die Antwort lautet: Island. In dem Jahr, als ganz Europa auf das kleine Land im hohen Norden schaut, weil seine Wirtschaft implodiert und sein (seither berühmtester) Vulkan Eyjafjallajökull explodiert, zieht die Britin Sarah Moss mit ihrem Mann und den zwei kleinen Söhnen nach Reykjavík, wo sie vor allem eins lernt: zu staunen. Über das merkwürdige isländische Konsumverhalten, lebensgefährliche Vorfahrtsregeln, über 13 atheistische Weihnachtsmänner, flüssige Lava, kochenden Treibsand, Mondschatten und über Polarlichter, die in den sommers ewig hellen Nächten wie außerirdische Wesen über den Himmel wabern. "Sommerhelle Nächte" ist eine geistreiche Reflexion darüber, was es bedeutet, fremd zu sein, und eine empathische Erkundung der von extremen Umweltbedingungen geprägten Kultur Islands. Moss' ironische Erzählweise und ihre Gabe, Alltagssituationen zu beobachten und daraus treffsichere Schlüsse sowohl auf die isländische Mentalität wie auch auf sich selbst zu ziehen, machen ihren Reisebericht zu einer ebenso informativen wie kurzweiligen Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
mare
Sarah Moss
Sommerhelle Nächte
Unser Jahr in Island
Aus dem Englischenvon Nicole Seifert
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetunter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Die englische Originalausgabe erschien 2012unter dem Titel Names for the Sea: Strangers in Icelandbei Granta Publications, London.
Copyright © Sarah Moss 2012
© 2014 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Simone Hoschack, mareverlag, HamburgCoverabbildung © Heike Ollertz
Lektorat Meike HerrmannTypografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, HamburgDatenkonvertierung eBook bookwire
ISBN eBook: 978-3-86648-307-1ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-186-2
www.mare.de
Für all unsere Freunde in Island
Prolog
Der Dampf über dem Schwimmbecken schimmert vom reflektierten Licht. Für die Passagiere des Flugzeuges, das sich am Himmel nähert, muss die nächtliche Stadt, müssen die sich schlängelnden Scheinwerferlichter und die nadelkopfgroßen Straßenlaternen aussehen wie die Einfassung eines Juweliers für elf türkisfarbene Becken. Garðabær, Kópavogur draußen auf der Landzunge, Álftanes mit seiner Rutsche, Seltjarnarnes, das Salzwasserbecken, und Laugardalur, so groß, dass man den Pool an einem kalten Tag vor Dampf nicht überblicken kann. Zu Hause orientiere ich mich an Lebensmittelgeschäften und Buchhandlungen. In Reykjavík gibt es vielleicht noch ein halbes Dutzend unabhängiger Lebensmittelgeschäfte, die Buchhandlungen gehören alle zu einer Kette, die Schwimmbecken aber sind unverwechselbar. Ich bin jetzt am tieferen Ende des Garðabær, wo das Wasser kälter ist. Es riecht leicht nach Schwefel. Ich schwimme langsam, eher darauf bedacht, meinen Körper unter Wasser und aus der kalten Luft herauszuhalten, als darauf, in absehbarer Zeit das Ende der Bahn zu erreichen. Der Wind drückt die Äste der Kiefern rings um das Becken gegen die Stämme. Schwarz stehen sie vor einem Himmel, der durch das schmutzige Licht, das der Schnee reflektiert, braun erscheint. Im Moment schwimmt niemand sonst, nur im flachen Bereich haben sich ein paar Erwachsene versammelt, wie Nilpferde oder vielleicht wie römische Senatoren, die im wärmeren Wasser dahintreiben und sich unterhalten. Ich schwimme weiter; unter ihnen würde ich mir vorkommen wie Banquos Geist, als einzige Ausländerin, mit Brille und der falschen Art Badeanzug und kaum in der Lage, einem Gespräch zu folgen. Am tiefen Ende mache ich eine Pause, strecke die Füße durch die warmen Wasserschichten bis in die kalten am Boden, drehe mich um und breite die Arme aus. Und dort, mit dem Gesicht unterhalb der Erdoberfläche, sehe ich im Norden das Licht, wo der Himmel von den Bogenlichtern auf dem Basketballplatz hinter mir verschleiert wird und von den Scheinwerfern der SUVs, die ich hinter der Mauer durch den Matsch auf der Autobahn fahren höre. Der nördliche Himmel, dunkel über dem Meer, ist grün gesprenkelt, als wäre Farbe verschüttet worden. Sie verschwindet und breitet sich dann wieder aus. Ich wende den Kopf, nasse Haarsträhnen streichen mir wie Algen über den Nacken, und sehe im Nordwesten ein blasseres Licht flackern wie ein flatterndes Laken. Grün und Weiß greifen nacheinander und springen dann auseinander, wie Magnete, die einander abstoßen und zueinander gezwungen werden. Ich trete Wasser und sehe zu.
Aurora borealis. Reykjavík, November 2009.
Der erste Blick auf Island
Ich weiß nicht, woher meine Sehnsucht nach nördlichen Inseln stammt. Vielleicht habe ich sie geerbt. Wenn wir in den Ferien meiner Kindheit nicht durch Osteuropa gefahren sind, waren wir auf Orkney oder auf den Hebriden. Mein Großvater, der in den 1920er-Jahren in Leeds aufgewachsen ist, ging im Alter von sechzehn Jahren auf einen Fischtrawler, der Island zum Ziel hatte – nicht, weil er sich fürs Fischen interessiert hätte, sondern weil er schon immer in den Norden wollte. Meine Großmutter war in den 1930er-Jahren mit ihren Freunden auf Mull vor der Nordwestküste Schottlands zelten und ist in den Fünfzigern mit meiner Mutter und in den Achtzigern mit mir erneut dorthin gefahren. Mich bringt nicht die Arktis zum Träumen, der Schauplatz ewiger Breitengrad-Rivalitäten, es sind die grauen Archipele, die Sprungbretter des Atlantiks. Scilly, Aran, Harris, Lewis, Orkney, Fair Isle, Shetland, Färöer, das südliche Grönland, die kanadischen Seeprovinzen; eine Seestraße, die historische Siedlungen miteinander verbindet und seit Jahrhunderten befahren wird. Die Arktis ist gleich hinter dem Horizont, die sechs Monate währende Dunkelheit immer im Hinterkopf, an den sommerlangen Tag kann man im Winter nicht glauben, und wenn er kommt, vermag man ihn nicht in Zweifel zu ziehen. Hier, direkt unter der Spitze der Erde, gibt es Städte und Dörfer, ein Gewirr menschlichen Lebens, im Schatten arktischer Eschatologie. Immer wieder kehre ich an den Nordatlantik zurück, arbeite mich nach Norden und Westen vor, wie es die Kelten und Wikinger getan haben. Nach dem Schulabschluss mieten eine Freundin und ich eine Hütte in Rousay auf Orkney und verbringen zwei Wochen damit, in neolithische Gräber hinabzusteigen, am felsigen Ufer entlang- und durch die Heide zu laufen, während wir versuchen, nicht über unser bevorstehendes Erwachsenenleben nachzudenken. Als Studenten begeben eine andere Freundin und ich uns schlecht beraten auf eine Radtour über die Shetlandinseln, wo wir bergab gegen den Wind anstrampeln müssen, aber eine wildere, fremdere Landschaft sehen als auf Orkney, wo alles glatter ist. Ich reise auf die Färöer-Inseln. Einige Inseln sind nicht mehr als aus dem Meer ragende Klippen, und die alten Norweger, die einst über Orkney und auch über die Shetlands herrschten, scheinen irgendwie immer noch da zu sein. Auf der Universität belege ich ein Seminar zu alten nordischen Sagen, in der Erwartung, dass sie mich faszinieren, und den Sommer meines ersten Studienjahres plane ich in Island zu verbringen. Ich gewinne einen Preis, der an Studenten des Grundstudiums vergeben wird, für die »Förderung der Kenntnisse bezüglich der Schönheit der Landschaft«, und kaufe ein Busticket, mit dem ich die Route 1 abfahren will, die einzige Straße, die Island umrundet. Meine Freundin Kathy liebt die nordischen Inseln ebenfalls und willigt ein, mitzukommen.
In England haben Reisen nach Island Tradition. Vor allem im neunzehnten Jahrhundert reiste man auf den Spuren der mittelalterlichen Sagen. Ich lese W. G. Collingwood, der in Islands Heimatkundemuseen eine Spur aus Aquarellbildern hinterlassen hat, und William Morris, der 1871 und 1873 nach Island reiste und eine Reihe weitschweifiger, dem Altnordischen zuneigender Gedichte schrieb, als wolle er den Beitrag der normannischen Eroberung zur englischen Sprache rückgängig machen:
Der erste Blick auf Island
Da, endlich, auf unserem dümpelnden Schiff, kommt Land in Sicht. Gezackte Felsen bewachen am östlichen Ufer der Mündung die breiten, öden Auen, Und schwarz erheben sich Hügelrücken, von mattem Grün gestreift, Ein Berg ragt auf, im Westen, wo Wolken und Meer sich begegnen, Trutzig vom Sockel zur Spitze, wie vormals die Bauten der Götter, Die kargen Flanken von Wolken umkränzt, von Schnee befleckt, grau, Und hell am frühen Morgen, der gerade, am Ende des Tages, beginnt.
Ach! Was haben wir zu finden gehofft, dass unsere Herzen so heiß sind vor Sehnsucht? Reicht das für unsere Rast, der Anblick desolater Gestade Und kahler Gebirge in Grabesstille, wo nur der Wind weder schläft noch verstummt? Warum bloß wollen wir nach Weite und Breite ein Land durchstreifen, So furchtbar, das knirschende Eis, und Zeichen von kaum verborgenem Feuer, Wenn nicht, weil mitten in Tälern, das graue Gras von steinigen Strömen durchzogen, Die alten Sagen des Nordens leben, und der unsterbliche Glanz der Träume?
Karge Flanken, steinige Ströme – irgendwas an dieser sprachlichen Nachgestaltung stört mich. Es ist nicht nötig und tendenziell verlogen, vorzugeben, dass wir in Wirklichkeit alle Wikinger sind. Mein Verlangen, nach Island zu reisen, geht nicht auf den heimlichen Wunsch zurück, einen gehörnten Helm aufzusetzen oder Met aus Totenschädeln zu trinken, ich möchte nicht mal gewundene Silberbroschen tragen oder mich in Runen ausdrücken. Ich mag Tolkien nicht, einen weiteren Oxford-Absolventen, der vom Altnordischen besessen ist, mit seinen Kriegsspielen und ausgedachten Sprachen in einer Welt ohne Frauen. Wonach ich in Island auch suche – in der Tradition englischer Schriften über den Ort steht es nicht.
Im Juli 1995 gehen Kathy und ich an Bord der MSNorröna, des Passagierschiffes, das Schottland mit den Färöer-Inseln und Island verbindet und dabei der Route der Wikinger folgt, allerdings fünfmal so schnell vorwärtskommt wie sie. Wir stehen an Deck, beobachten, wie Matrosen die Leinen losmachen, und dann, wie die Küste von Aberdeenshire hinter den Horizont gleitet. Die anderen gehen nach drinnen, aber diese anderen haben auch Kabinen und können es sich leisten, im Restaurant zu essen. Als der Himmel sich verdunkelt, im Hochsommer im Norden Schottlands, beginnt das Schiff zu schwanken. Die letzten Passagiere gehen hinein. Wir bleiben an Deck, zitternd, und beobachten die von Gischt durchzogenen dunklen Wellen, bis mir so kalt ist und ich so seekrank bin, dass es mir besser erscheint, in einer Plastikkoje in der Gemeinschaftskabine zu liegen, als über der Reling zu würgen. Kathy bleibt an Deck, stoisch, mit hochgezogener Kapuze.
Stunden später wache ich auf. Mir ist immer noch übel. In der Dunkelheit spielt es keine Rolle, ob ich die Augen öffne oder schließe. Nichts spielt eine Rolle. Die Männer in den Kojen um mich herum schnarchen, und es riecht nach Erbrochenem und Schweiß. Ich kann nicht schlucken. Ich vergrabe meine Nase in dem rosa geblümten Daunenschlafsack, den ich als Kind mit im Campingurlaub hatte. Er riecht nach altem Staub und fühlt sich an meiner Haut trocken an wie Papier. Ich möchte sterben. (Dieser Gedanke taucht alle paar Minuten in meinem Kopf auf, seit ich das Deck verlassen habe, wie ein Goldfisch, der im Glas seine Runden dreht.) Der Motor dröhnt, und meine Koje schaukelt, rauf und runter, rauf und runter. Ich weiß, dass ich mich nicht noch einmal übergeben muss, es ist nichts mehr übrig, und den Versuch, schluckweise Wasser zu mir zu nehmen, habe ich aufgegeben, ebenso den Versuch, mich aufzusetzen. Rauf und runter – und runter – und runter. Ich hoffe, wir sinken. Ich will sterben. Die Kabine liegt tief im Inneren des Schiffes. Über meinem Kopf ist Wasser, und wenn wir sinken würden, drängte das Wasser in die Kabine und würde steigen und steigen, und selbst wenn ich versuchte, die Tür zu finden, wäre sie schwer und aus Metall, und von der anderen Seite drückte das Wasser dagegen. Außerdem habe ich gesehen, wo in den Gängen sich die Eisentüren verschließen würden, um das Schiff zu stabilisieren, wobei sie die Menschen einsperren würden, die sich keine angemessenen Kabinen leisten können, wenn das kalte Meer steigt und steigt, über Taillen und Schultern und – aber das spielt keine Rolle, denn ich will sterben.
Da ist ein Riss in der Dunkelheit. Er tut meinen Augen weh.
»Sarah?«, flüstert Kathy. »Sarah, komm raus. Man kann es sehen. Island. Und die Sonne geht auf.«
Ich wende mich ab. Ist mir egal.
»Los, komm«, sagt sie. »An Deck wird es dir besser gehen. Hier unten muss einem ja schlecht werden. Ich gehe wieder raus.«
Ich glaube ihr nicht. Frische Luft habe ich hinter mir.
»Die Sonne scheint auf einen Gletscher«, sagt sie. »Er sieht aus wie diese japanischen Berge. Ich werde ihn malen.«
Also setze ich mich auf, und es ist schlimmer. Aber ich kann mir grob vorstellen, dass es eine Zukunft geben könnte, in der ich es bereuen würde, die ersten Sonnenstrahlen nicht vom Meer aus auf den Gletscher scheinen gesehen zu haben. Ich stehe auf und halte mich an ihr fest, und Kathy hilft mir die buckeligen, mit Erbrochenem verschmierten Stufen hoch. Und sie hat recht. (Kathy hat meistens recht.) Hinter uns geht neonrosa die Sonne auf, und am Horizont im Nordwesten schiebt sich ein dreieckiger, schneebedeckter Berg heran. Das Meer ist noch schwarz, die Wellen schäumen weiß im frühen Licht. Ich setze mich hin, und Kathy wickelt mir meinen Schal um und gibt mir einen Pfefferminzriegel, über den ich nachdenken kann. »Er müsste auf dem Weg nach unten ungefähr so schmecken wie auf dem Weg nach oben«, merkt sie an und holt einen kleinen Zeichenblock, ihre Wasserfarben und eine Wasserflasche mit Drehverschluss aus der Tasche ihrer Regenjacke. Später werde ich versuchen, ein paar Sätze oder ein Gedicht zu jedem ihrer Bilder zu schreiben, aber im Augenblick bin ich damit zufrieden, hier zu sitzen, an meinem Pfefferminzriegel zu lecken und zu beobachten, wie zu beiden Seiten des großen Berges ein kleiner erscheint. Als die Sonne etwas höher am Himmel steht, füllen sich die Räume zwischen den Dreiecken mit grünen Fjorden. Bald sind hier und da weiße Häuser mit roten Dächern zu sehen und dann grasende Schafe und Autos, die wie Ameisen herumeilen, obwohl es vier Uhr morgens ist. Vielleicht will ich doch nicht tot sein.
Wir waren neunzehn – Kathys neunzehnten Geburtstag feierten wir mit einem Nachmittag im Whirlpool an einem Berghang in Akureyri und einem Kuchen, der mit unechtem Marzipan überzogen war – und reisten sechs Wochen lang durch Island. Wir zelteten wild, weil wir uns Campingplätze nicht leisten konnten, und lebten von einer immer spärlicher und exzentrischer werdenden Kost, weil wir uns Essen eigentlich auch nicht leisten konnten. 1995 hatten Studenten keine Handys, und das Internet war etwas für Freaks – es gab welche, die mehrmals pro Woche ihre E-Mails checkten. (Warum reden sie nicht einfach mit den Leuten, fragten wir uns. Oder schreiben einen netten Brief.) Wir waren nicht zu erreichen, waren fort, für sechs ganze Wochen. Damals sendete Radio Four gelegentlich noch Suchmeldungen, und Mr. und Mrs. Framlington aus Ely, die gerade Urlaub an der Ardèche machten, wurden gebeten, Kontakt zu ihrem Sohn Henry aufzunehmen, aber wir hatten kein Radio und hätten den Sender sowieso nicht empfangen können. Wir schrieben Briefe, aber Briefmarken mussten warten, bis wir wieder zu Hause waren und Geld für Porto übrig hatten. Wir hatten jede ein Busticket, das uns einmal um die Insel und wieder nach Egilsstaðir brachte, wo die Fähre ablegte, die uns nach Hause bringen würde. Wir hatten ein Zelt und einen Primuskocher, eine Taschenbuchausgabe von Shakespeares Gesammelten Werken, Ingwer, Knoblauch und ein paar Kräuter. Die Pfefferminzriegel waren nach den ersten zwei Tagen alle, und danach streiften wir durch die Minimärkte und versuchten, für eine Króna so viele Kalorien wie möglich zu bekommen, ohne Pflanzenöl trinken zu müssen (subventionierte Butter wäre wohl angenehmer gewesen und auch kaum teurer). Einmal fand ich ein ermäßigtes Glas amerikanische Erdnussbutter, aber danach einigten wir uns auf isländischen Frischkäse in eigenartigen Geschmacksrichtungen und gelegentlich eine Tüte Chips. Der Bus hielt ungefähr alle dreißig Meilen an einer Tankstelle, und sonst rief man es einfach dem Fahrer zu, wenn man aussteigen wollte. Manchmal planten wir es vorher, aber meistens sahen wir eine geeignete Stelle und brüllten los. Wir zelteten idiotischerweise auf einer Klippe und wurden nachts fast heruntergeweht, hatten keinen Brennspiritus für den Kocher mehr und stellten fest, dass wir zu jung waren, um in Island welchen zu kaufen. (Ältere deutsche Rucksacktouristen kamen uns zu Hilfe, aber erst, als wir mehrere Tage lang ohne gekochtes Essen und heißes Wasser ausgeharrt hatten.) Wir liefen durch eine Mondlandschaft, deren mit weißen Blumen übersäter, rissiger schwarzer Fels sich bis zum Horizont erstreckte, durch orange- und rosafarbenen Morast, der unter unseren Füßen brodelte, und um einen Vulkankrater herum, von dem aus wir das Eismeer sehen konnten. Wir sahen Papageientaucher von den Klippen auf den schwarzen Sand darunter fallen und türkisfarbene Minieisberge, die sich von einem Gletscher lösten. Es war die ganze Zeit hell, ein Sommertag dauerte sechs Wochen, und ich schlief nach Lust und Laune, wie ein Baby, ausnahmsweise schien meine Schlaflosigkeit normal zu sein. Ich konnte mir Bruchstücke von modernem Isländisch so weit erklären, dass ich Zeichen und gelegentlich eine Schlagzeile verstand, aber wir versuchten nicht, mit irgendjemandem zu sprechen. Warum sollten sie mit uns sprechen wollen? Die einheimischen jungen Frauen – die Zugang zu Badezimmern und Waschmaschinen hatten und Kleider trugen, die für drinnen gedacht waren – wirkten selbstsicherer und glamouröser als wir. Und außerdem waren wir nicht wegen der Menschen dort. Menschen gab es schon zu Hause genug, um nicht zu sagen, zu viele. Wir waren wegen der Landschaft gekommen, wegen der hellen Nächte und der dunklen Küsten, wegen des Regens, der über die Birken fegt, und um die ganze Scheibe der flachen Welt für uns zu haben.
Ich hatte immer vor, nach Island zurückzukehren. Kathy und ich machten unsere Abschlüsse, machten noch ein paar mehr Abschlüsse, heirateten und fanden Jobs. Ich bekam zwei Söhne, sie zog in die Niederlande. Wir trafen uns häufig, telefonierten regelmäßig miteinander, und spätabends, wenn die Flasche leer war oder nachdem unsere Ehemänner zum vierten Mal vorbeigekommen waren und irgendwas von Auslandsgespräch gebrummelt hatten, erinnerten wir uns an Island. Daran, wie ich bei strömendem Regen nackt nach draußen gelaufen bin, um die Abspannleinen festzuzurren (weil ich nicht wollte, dass mein Schlafanzug nass wird). Daran, wie Kathy, die draußen malte, ein paar Blaubeerbüsche fand, die von der Sonne ganz warm waren, und wie wir dann einen ganzen Berghang voller Blaubeeren fanden und ihn abweideten wie ausgehungerte Schafe, nachdem wir seit Beginn unserer Reise weder Obst noch Gemüse gegessen hatten. Daran, wie ein isländisches Kind im Bus den kompletten Monty-Python-Sketch vom toten Papagei aufsagte und die Betonung dabei perfekt imitierte. Es war die Landschaft, in der wir erwachsen geworden waren, an die wir uns erinnerten, es waren nicht die Menschen, die dort lebten.
Ich beneidete Kathy um ihr neues Leben in den Niederlanden, darum, dass sie die neue Sprache immer besser beherrschte, den neuen Ort und die neue Kultur entdeckte. Mein Mann und ich hatten immer vorgehabt, »im Ausland« zu leben, als wäre das Ausland ein Ort, der sich nur über sein Nicht-englisch-Sein definiert. Schottland hätte vielleicht gereicht, Frankreich wäre besser gewesen, Dänemark oder erst recht Schweden mit ihren Sozialdemokratien nordischer Prägung ideal, aber inzwischen sah ich die akademischen Jobangebote in den USA, in Kanada und Australien durch. Wir ließen uns in Kent nieder, weniger als zehn Meilen von dem Ort entfernt, in dem Anthony aufgewachsen war. Wir kauften ein Haus. Unser großer Sohn kam in die Schule, der kleine in den Kindergarten. Wir hatten interessante Berufe und verdienten gut. Alles war wunderbar, und es gab keinen Grund, warum es nicht die nächsten dreißig Jahre genauso wunderbar hätte weitergehen sollen. Dann verlor Anthony seinen Job. Max war in seiner Schule unglücklich. Island war, wie ich spätabends in der Zeitung las, das glücklichste Land der Welt, ein nordisches Paradies, dort herrschte Gleichberechtigung, es gab gute Schulen, und man interessierte sich für Kunst. Dieses Mal war es nicht die Landschaft, die uns anzog – sondern die Vorstellung von einer besseren Gesellschaft. Und auf der Website der National University, auf die ich am nächsten Tag bei der Arbeit einen Blick riskierte, hieß es, Island bräuchte jemanden, der sich auf britische Literatur des neunzehnten Jahrhunderts spezialisiert hatte.
Freistellung
Ein halbes Jahr später stehe ich in Islands National Museum, wo ich mir die Ausstellung über die materielle Kultur im zwanzigsten Jahrhundert angesehen habe, und blicke auf den Flachbildfernseher, über den die neuesten Nachrichten laufen. Der Internationale Währungsfonds greift ein, um Island vor dem Staatsbankrott zu bewahren, lese ich. Es ist November 2008, und ich habe gerade mein Bewerbungsgespräch hinter mir und die Stelle mündlich zugesagt. Beim Mittagessen haben meine zukünftigen Kollegen darüber gesprochen, dass sie für die nächsten Seminare nur Texte verwenden werden, die über das Projekt Gutenberg erhältlich sind, weil sie davon ausgehen, dass die Einfuhr von Büchern gestoppt werden wird. Die Direktorin der Internationalen Schule gesteht offen ihre Bedenken, dass alle ausländischen Familien das Land verlassen werden. Der Wert meines veranschlagten Gehalts fällt im Lauf der Woche um ein Drittel. Na ja, argumentieren wir, die Isländer werden nicht Hunger leiden, wir also auch nicht. Ich weiß nicht, warum uns der Kollaps der isländischen Wirtschaft, die kreppa, nicht abschreckt; es scheint mir wichtig, die Armut nicht zu fürchten. Wahrscheinlich, denke ich, wird es sogar ganz interessant.
Unsere Kartons begeben sich Mitte Juli auf die Reise, eine Woche vor uns. In Island beginnt das Schuljahr Ende August, wir geben den Kindern also einen Monat, um sich an ein neues Haus, eine neue Sprache, neues Essen und – vielleicht – neue Freunde zu gewöhnen, ehe wir ihnen eine neue Schule und einen neuen Kindergarten präsentieren. Wir nehmen so wenig wie möglich mit, zum einen, weil der Transport teuer ist, zum anderen, weil uns langsam klar wird, dass wir dem ganzen Zeug entkommen können, das unser Haus verstopft, dass wir einfach weggehen und es hinter uns lassen können, wie Menschen, die vor einer Seuche fliehen. Ich packe alles, was wir vier meiner Meinung nach in dem Jahr brauchen werden, in sieben Pappkartons. Einer ist voller Spielzeug, nur Lieblingssachen und nichts Großes. Das Puppenhaus wird das Jahr bei unseren Freunden verbringen, die um die Ecke wohnen, das Holzparkhaus geht leihweise an den kleinen Jungen am Ende der Straße, der immer ganz versessen darauf war, der Spielzeugherd an Oxfam – nachdem er lange genug auf dem Dachboden stand und ich sicher sein konnte, dass ihn niemand vermissen würde. Wir nehmen Winterkleidung mit, die von Tobias eine Nummer größer als sein zweijähriges Sommer-Ich. In einem weiteren Karton sind fast nur Lebensmittel, weil wir im Mai zehn Tage in Reykjavík waren, um ein Haus zu suchen, und eine Vorstellung vom begrenzten Sortiment isländischer Supermärkte haben. Wir nehmen fünf Liter Olivenöl mit, zwölf Dosen Sardellen und zwölf Gläser Kapern, Misopaste, Granatapfelsirup, Kakaonibs, Samen, um Koriander, Basilikum und Minze zu ziehen. Geräucherte Chilischoten, Sumach, Piment, getrockneten Dill, Kümmel, eingeweckte Zitronen, drei Arten Paprikagewürz, getrocknete Limonenblätter. Auf viktorianische Arktisexpeditionen wurde graviertes Silberbesteck mitgenommen, Serviettenringe und bestickte Hausschuhe – Dinge, mit deren Hilfe die Forscher sich daran erinnern wollten, wer sie waren, für deren Vorhandensein es sonst keinerlei Rechtfertigung gab und die ein paar Jahre später im Schnee verstreut gefunden wurden, neben den Knochen ihrer Besitzer. Dagegen sind die Manifestationen einer englischen großstädtischen Mittelklasse-Identität wenigstens essbar. Drei Kartons sind voller Bücher, die am schwersten auszusuchen sind. Woher soll ich im Juli wissen, was ich im Februar lesen möchte? Ohne welchen der mehreren Tausend Bände in unserem Haus kann ich nicht leben? Ich gebe ein Seminar zur Prosa des neunzehnten Jahrhunderts, für das ich fast einen ganzen Karton brauche, und ein weiteres zur romantischen Dichtung. Ich brauche die Romane, die ich noch einmal lesen möchte, und ich brauche meine Lieblingskochbücher (Rezepte bekommt man doch online, protestiert Kim, die unser Haus mieten wird und sich leichtfüßig durchs Land bewegt, all ihre Besitztümer im Kofferraum ihres Autos, aber das ist nicht dasselbe). Meine Buchkäufe werden extravaganter, als ich versuche, die Käufe eines Jahres vorwegzunehmen, für mich wie für Max, der alle zwei Tage ein Buch durchliest. Welche Bücher sind für ihn angemessen, wenn er auf die acht zugeht? Welche Größe müssen die Schneestiefel von Tobias haben?
Ich verschließe den letzten Karton und gehe umher, auf der Suche nach Dingen, die in letzter Minute noch eingepackt werden sollten. Ich habe alles ausgeräumt, was wir mitnehmen, und das Haus sieht kein bisschen anders aus als vorher. Das Spielzimmer ist immer noch voller Spielsachen, die Küche voller Teller und Pfannen und Kuchenformen, der Wok ist noch da und die Eismaschine und die Teekanne und die Paella-Pfanne und die guten Messer und der Toaster (wir haben beschlossen, ohne ihn auszukommen – schließlich hatte den Großteil der Menschheitsgeschichte über niemand einen Toaster, ohne dass das schwerwiegende Folgen gehabt hätte). Die Bücherregale sind immer noch übervoll, die Bücher, die nicht mehr dazwischenpassen, liegen auf ihren eng zusammengepressten Gefährten. Die Diele ist immer noch voller Schuhe und wird vom Buggy verstopft. Oben quellen immer noch Klamotten aus meinen Kommodenschubladen, und die, die nicht mehr reinpassen, rutschen von einem unserer zahlreichen viktorianischen Sessel. Wir können immer noch nicht alle Handtücher in die für sie vorgesehene Schublade quetschen, also liegt auf der Mahagonikommode ein Stapel, gestützt von Spielzeug und Post, die zu langweilig ist, um sie zu öffnen, aber zu wichtig, um sie wegzuschmeißen. In den Kinderzimmern ist noch mehr Spielzeug, sind noch mehr Bücher, mehr Zeichnungen, vor allem auf dem Boden, weil die Schränke voll sind mit Anthonys Sammlung antiker Landkarten und meiner Wolle und den Kristallgläsern, die zu gut sind, um sie zu benutzen, und dem Teeservice meiner Urgroßmutter und dem zerfallenden Wollbehang, der mit unserem Himmelbett geliefert wurde. Mir ist klar, dass Entrümpeln so eine Art kapitalistische Bulimie ist, aber ich frage mich zum ersten Mal, ob es nicht (wie andere Formen ökonomischer Funktionsstörungen) auch ganz nett wäre.
Der Juli ist eine gute Zeit, um in Island einzutreffen. Auf der Fahrt vom Flughafen sehen wir in den Spalten des Lavafeldes neben der Straße Wildblumen und Vogelbeerbüsche wachsen, und die Berge zeichnen sich klar vor einem blauen Himmel ab. Die Stadt liegt in einem Teich aus Sonnenlicht, die roten Wellblechhäuser mit ihren weißen Dächern sehen vor dem dunklen Meer aus, als wären sie aus Lego. Im Stadtzentrum, wo wir die ersten Tage in einem Hotel verbringen werden, sitzen die Menschen draußen vor den Cafés, überall spricht man englisch, und Touristen und andere Menschen, die ebenfalls einen Stadtplan brauchen, strömen in die Kunsthandwerksläden und Museen von Reykjavík. Wir gehen mit den Kindern raus und zeigen ihnen den Ort, an den wir sie gebracht haben. Seht mal, sagen wir, da läuft ein Schiff in den Hafen ein! Guckt mal, ein Spielplatz! Da! Das Licht auf den Bergen! Seid ihr nicht froh, hier zu sein? Wir nehmen die Personenfähre nach Viðey, einer Insel in der Bucht, und die Kinder fliegen auf der Schaukel bis zum Gipfel des Berges hinter ihnen und hoch in den blauen Himmel. Wir gehen ins Maritime Museum, und Max schließt sich anderen kleinen Jungen aus anderen Ländern an, die die eine Kanone auf dem Schiff von Islands Küstenwache bestaunen. Es gibt hier keine Marine, keine Armee und keine Luftwaffe. Wir gehen die Hauptstraße, den Laugavegur, auf und ab, teilen uns die Kaffeepausen ein und bestaunen die Reihen von Kinderwagen, in denen Babys vor den Läden die Zeit bis zur Rückkehr ihrer Eltern verschlafen.
Wir warten darauf, dass die Handwerker mit unserer Wohnung fertig sind, die wir noch nicht gesehen haben. Hulda Kristín hat sie uns organisiert, eine Doktorandin meines neuen Fachbereichs. Hulda Kristín ist halb Libanesin und halb Isländerin, aber in London aufgewachsen. Sie hat einen Isländer geheiratet und kam hierher, als ihre Söhne, die wie meine vier Jahre auseinander sind, im Vorschulalter waren. Wir haben sie kennengelernt, als wir im Mai nach Reykjavík kamen, um eine Wohnung, eine Schule und einen Kindergarten zu suchen, und unerwartet große Probleme mit der Wohnung hatten. Isländer mieten im Allgemeinen nicht; neunzig Prozent der Häuser werden von ihren Eigentümern bewohnt, und wenn man zur Miete wohnt, zeugt das von Jugend oder Armut. Wegen der Internationalen Schule mussten wir etwas in Garðabær finden, Islands reichstem Vorort, aber es gab nichts zu mieten, obwohl sich an der Küste neu gebaute, leer stehende Wohnblocks drängten. Hulda Kristín hörte, wie ich mich bei Pétur beklagte, meinem neuen Fachbereichsleiter. Ich telefoniere mal ein bisschen rum, sagte sie. Wahrscheinlich kann ich was auftreiben. Ihr Mann ist für die Sicherheitsvorkehrungen an Gebäuden in ganz Island zuständig und kennt die meisten Handwerker. Sie trieb tatsächlich etwas auf, und wir sehen unser neues Heim zum ersten Mal durch die getönten Scheiben ihres klobigen SUV.
Die anderen Wohnungen in unserem Block stehen leer. Das Eckhaus gehört zu einem Bauprojekt, das halb fertig war, als die Banken zusammenbrachen und den Bauherren das Geld ausging, und es ist immer noch halb fertig, so als hätten die Bauarbeiter ihr Werkzeug eines Tages im Winter 2008 fallen gelassen und wären weggegangen. Falls die Luxuswohnungen auf der anderen Straßenseite jemals fertig werden, können wir im Norden nicht mehr das Meer sehen. Fürs Erste sehen wir die Wellen zwischen den Metallstäben, die aus dem Betonfundament ragen. In der anderen Richtung sehen wir die Stadt, über uns einen gelben Kran, der den Ausblick auf die Gebirgskette Esja in zwei Hälften teilt. Außer uns wohnt niemand in dem Gebäude. Die Treppen sind nicht fertig, roher Beton. Der Fahrstuhl gleitet in seinem Glasturm nur für uns rauf und runter. Die automatischen Türen in der Lobby öffnen sich nur für uns. Zu der Wohnung gehört einer von vielen Lagerräumen, die sich in einer Art Katakomben befinden, jeder ist einer der Wohnungen zugeteilt, und im Keller gibt es einen zweiten Lagerraum für Skier und Boote, von dem aus man in die beheizte Garage gelangt, in der das Licht angeht und sich die Türen öffnen, wenn man näher kommt. Hier unten, schlage ich Anthony vor, können die Kinder im Winter Fußball spielen. Oder wir ziehen in industriellem Maßstab Pilze.
Die Wohnung selbst ist lichtdurchflutet. Im Herbst werden wir feststellen, dass es drinnen oft irgendwie heller ist als draußen, aber jetzt, im Juli, ist Island in seinem hellen Zustand, Tag und Nacht, und unsere bodentiefen Fenster und weißen Wände verstärken ihn noch. Wir haben eine Wäschekammer, die ich als Arbeitszimmer in Beschlag nehme, und einen begehbaren Kleiderschrank, der alle Kleider aufnehmen würde, die wir in beiden Jahrhunderten besessen haben, und immer noch Platz für meinen Geheimvorrat geschmuggelter Schokolade ließe. Die niedrigste Einstellung für die Fußbodenheizung beträgt zwanzig Grad. Anthony und ich sind beide in alten Häusern aufgewachsen, in denen es durch die Bodendielen und bis in den Schornstein hinauf zog, wir können uns beide daran erinnern, dass wir vom Bett aus gesehen haben, wie die Vorhänge im Winter vor den verschlossenen Fenstern wehten, und in Canterbury haben wir ein ebensolches Haus gekauft. Die neue Wohnung hat Dreifachverglasung und keine Vorhänge. Jetzt, an den heißesten Sommertagen, ist es draußen fast so warm wie drinnen. Wir öffnen alle Fenster und hören am Ende der Straße Kinder am Strand planschen. Die Jungs stürmen auf den Balkon, der nach Norden geht und im Schatten der unfertigen Wohnblocks auf der anderen Straßenseite liegt.
Hulda Kristín fährt mich zu Ikea, wo ich Bettbezüge, Handtücher und ein paar Töpfe kaufe, so wenige wie möglich. Ich entscheide mich für vier Gartenstühle – billiger als Esszimmerstühle – und einen Tisch. Später kommt Pétur vom anderen Ende der Stadt, um uns einen Satz Flatpack-Regale und einen alten Tisch zu bringen, den ich als Schreibtisch benutzen kann, und dann sieht er sich um und nimmt mich mit in den Supermarkt in der nächsten Stadt. Warum nehmen wir nicht den?, frage ich, als wir an dem Großmarkt vorbeikommen, der in der Nähe unserer Wohnung liegt, zu Fuß erreichbar, sodass wir ohne Auto auskommen könnten. Das ist Hagkaup, sagt er. Viel zu teuer. Das wäre, als würdest du dein Waschmittel bei Harrods kaufen. Zurück in der Wohnung, kommt er noch mit rein, nimmt den ganzen Fisch aus, den ich aus Versehen gekauft habe, säubert ihn und baut die Regale für uns auf. Ich bin dankbar wie ein Kind. Zu Hause würde ich Pétur und Hulda Kristín zum Abendessen einladen, ihnen Blumen oder Wein schenken, Hulda Kristíns Kinder einen Tag übernehmen oder Pétur einen Kuchen ohne Gluten backen. Aber ich habe nur vier Stühle, vier Teller, zwei Töpfe. Es gibt in Garðabær keinen Floristen. Ich brauche Hilfe, um eine Glühbirne zu kaufen, um einen Termin beim Arzt zu bekommen, um das Telefon anzuschließen, um uns Busfahrscheine zu besorgen, die, wie sich herausstellt, in den Schwimmbädern verkauft werden. Die Anleitung für die Konfiguration unserer Internetverbindung ist auf Isländisch. Es gibt keinen Waschsalon. Wir sind hilflos, die Erwachsenen sind wieder Kinder, wir haben nichts anzubieten als unseren Dank, und unsere neuen Freunde sind unsere Eltern, auf die wir vertrauen. Danke, sagen wir. Danke.
Und dann fahren sie weg, Pétur in sein Sommerhaus draußen im Westen, Hulda Kristín begleitet ihren Mann im Wohnmobil auf eine Urlaubstour, auf der sie öffentliche Gebäude in abgelegenen Städten besichtigen, deren Sicherheitsinspektion im Sommer stattfinden muss, wenn die Straßen frei sind. Ihr müsst anfangen, dran zu glauben, dass ihr das alleine schafft, sagt Pétur und vergewissert sich, dass wir seine Handynummer haben. Es wird schon gut gehen, sagt Hulda Kristín und überprüft noch mal, ob ich die Nummer des medizinischen Notdienstes habe, falls Tobias noch mal einen Asthmaanfall bekommt. Unsere zweite Kindheit ist vorbei, und wir müssen uns hinauswagen.
Wir fangen vorn an, mit dem Essen. Hagkaup ist faszinierend, wie ausländische Supermärkte immer faszinierend sind, weil sie einen Einblick in andere Anschauungen erlauben. Es ist kein internationales Gesetz, dass Obst und Gemüse am Eingang angeboten werden. Hagkaup beginnt mit Kosmetik, vor allem französischer, allerdings zum doppelten Preis. Dann gibt es zwei Sorten Äpfel namens »rot« (große, mehlige, amerikanische) und »grün« (französische Granny Smith). Es gibt belgische Erdbeeren, hart und sauer, chilenische Orangen und Bananen. Wir haben Kent mitten in der Kirschsaison verlassen, wenn in jeder Parkbucht jemand mit einem Lieferwagen voller Kirschen frisch vom Bauern steht. Kleine gelb-rote, große violette, die kein Kind mit einem Bissen schafft, und meine Lieblingskirschen, leicht sauer und tiefrot. Unser Pflaumenbaum trug Früchte, und wir konnten im Garten stehen und Pflaumen essen, die von der Sonne ganz warm waren. Die Tomaten wurden reif, und Anthony, der auf einem für Kent typischen Obsthof aufgewachsen ist, begann seine alljährliche Beschwörung der Apfelsorten: James Grieve, St. Edmunds Pipin, Maid of Kent, Worcester Pearmain. Als wir zum sonntäglichen Mittagessen bei Anthonys Eltern waren, nahmen wir pfundweise rote und weiße Johannisbeeren mit, Zucchini, die drohten zu Kürbissen zu werden, und so viele Himbeeren, dass ich ernsthaft überlegte, Marmelade zu kochen. Hier gibt es kaum Bäume, egal welcher Art, und die Gärten, an denen wir vorbeigehen, scheinen nur absichtlich frei gelassene Flächen zwischen Haus und Straße zu sein: Rasen, Steine, Polarbirken und Vogelbeerbäume, die nicht größer sind als ich. Bei Hagkaup gibt es Himbeeren – bei Hagkaup gibt es für gutes Geld alles, sogar Zebrasteaks und schottischen Fasan –, aber sie ruhen in einer einzigen Lage auf Luftpolsterfolie, und eine Packung mit ungefähr einem Dutzend Beeren kostet so viel wie zwei Pfund Fisch. Ja, sagen wir, klar. Wir sind hier am Rand des nördlichen Polarkreises. Und wer will schon Flugobst? Die Isländer müssen jahrhundertelang ohne Obst ausgekommen sein. Kohlköpfe gibt es in rauen Mengen, aber auch sie scheinen einen weiten Weg hinter sich zu haben und wirken schlaff. Sogar bei Hagkaup ist das Obst oft weich, die Zucchini sind runzlig und sauer, die Kohlblätter schlapp wie feuchte Handtücher. Man muss auf die Haltbarkeitsdaten auf den Milchprodukten achten. An Harrods erinnern hier nur die Preise.
Wir wagen uns weiter raus. Die Busse fahren im Sommer seltener, offenbar, weil die Hauptnutzer öffentlicher Verkehrsmittel Highschool-Schüler sind. Die Busse sind fast immer leer, hat uns Pétur erzählt, nur morgens zwischen halb acht und halb neun und nachmittags zwischen zwei und drei sind sie voll, wenn die Highschool anfängt und zu Ende ist. Erwachsene Isländer teilen, was das Busfahren betrifft, die Ansichten von Margaret Thatcher. Laut Pétur haben hier mehr Menschen ein Auto als irgendwo sonst in Europa. Auf jeder Auffahrt stehen drei oder vier Autos, und die Autos sind neuer als zu Hause und größer, darunter monströse SUVs, die in den Rest Europas gar nicht eingeführt werden. Isländer verehren Amerika, sagt Pétur. Die meisten Menschen hier werden erst glücklich sein, wenn wir die Amerikaner in Sachen CO2-Ausstoß und Umweltverschmutzung geschlagen haben. Niemand geht irgendwohin zu Fuß; die Menschen halten einen für verrückt, wenn man zu Fuß geht. Was ist mit Fahrradfahren, frage ich, weil an der Küste Wege entlangführen, die in meinen Augen aussehen wie Fahrradwege. Nein, sagt er. Die Menschen finden, das Wetter sei zu schlecht, aber es ist nicht viel schlechter als in Dänemark, und dort fährt man so viel Rad wie sonst fast nirgends in Europa. Die Norweger und Schweden gehen mehr zu Fuß und fahren weniger Auto, sie haben auch weniger Autos als die Isländer, außerdem ist ihr Schadstoffausstoß niedriger – und das, obwohl skandinavische Winter sogar kälter sind, denn Island ist eine Insel im Golfstrom, wohingegen in Norwegen und Schweden kontinentales Klima herrscht. Während des Booms, sagt Pétur, sind isländische Paare manchmal mit zwei Jeeps zur selben Party gefahren. Ja, und für ihren Sohn hatten sie noch einen dritten dabei, fügt seine Tochter hinzu. Ich glaube, es war ein Witz, aber ich bin nicht sicher.
Am Anfang denken wir, diese Abhängigkeit vom Auto spiegele sich in der Stadtplanung wider. In Garðabær oder irgendwo in Reykjavík zu Fuß zu gehen – von den ältesten Ecken im Stadtzentrum einmal abgesehen – ist, als ginge man durch amerikanische Vorstädte. Es gibt keine Bürgersteige. Die Läden befinden sich allesamt in Malls, die für Fußgänger gar keinen Eingang haben. Wir müssen den Buggy über zweispurige Fahrbahnen und grasbewachsene Dämme schieben. Wenn wir zu dem anderen Supermarkt gehen, haben wir die Wahl – wir können das Lavafeld überqueren oder über die Autobahn gehen. Der Buggy ist weder für das eine noch das andere geeignet, aber wir brauchen ihn, um die Lebensmittel nach Hause zu bringen und um Tobias zu transportieren. (Später entdecken wir ein Netz gepflasterter Fuß- und Fahrradwege, die sich durch Parks und Grünanlagen ziehen und einem ganz anderen Stadtplan als dem der Autofahrer folgen.) Ich hebe den Kopf und betrachte den Hügel. Die Sonne scheint aus Nordwesten auf Kiefernwälder und blitzt in den Bächen wider. Das Meer hinter der zweispurigen Fahrbahn ist für meine Augen zu hell, und auf der anderen Seite der Bucht steht auf der Landzunge wie ein Leuchtturm die weiße Kirche von Kópavogur. Seevögel gleiten über die Halbinsel Álftanes, rufen sich von Fels zu Fels etwas zu. Der Himmel, das Licht und das Wasser lösen physisch etwas in mir aus; jedes Mal, wenn ich aufsehe, weiten sich meine Lungen, und das Gefühl der Unzulänglichkeit lastet nicht mehr so schwer auf meinen Schultern. Ich bin fasziniert von diesem Ort, aber ich verstehe ihn nicht, und bisher habe ich nicht mehr begriffen, als dass es nicht leicht wird, ihn zu verstehen.
Ein paar Wochen nachdem Pétur und Hulda Kristín gefahren sind, ruft Matthew an. Matthew hat seine Doktorarbeit ein paar Jahre vor mir an derselben Universität geschrieben, und bei meinem Besuch im Mai haben wir festgestellt, dass wir Menschen kennen, die sich kennen. Er hat sich in eine Isländerin verliebt und ist nach Reykjavík gezogen, als er seinen Dr. phil. hatte. Inzwischen arbeitet er seit vierzehn Jahren an der Háskóli Íslands, der Universität von Island. Er weiß noch genauer als Hulda Kristín, woher ich komme. Was kann ich tun, fragt er. Sag mir, was du brauchst. Jemanden, mit dem ich reden kann, sage ich. Jemanden, über den ich reden kann. Und eine Waschmaschine und einen Hochstuhl, denn Tobias ist zu klein für die Gartenstühle, und einen Mülleimer, den es nirgendwo zu kaufen gibt, wo ich zu Fuß hinkäme. Und einen Kühlschrank. Aber wir sind knapp bei Kasse. Wo sind hier die Secondhandshops? Oh, sagt er. Ah. Das ist so eine Sache in Island. Es gibt keinen Secondhandmarkt. Die Menschen kaufen einfach nichts Gebrauchtes. Ich komme zu euch.
Matthew fährt mit uns in den Zoo und in den Freizeitpark. Die Sonne ist heiß, und unter den Bäumen im Botanischen Garten posieren Bräute. Über dem Wasser sonnt sich die Esja-Gebirgskette, und die Kinder sehen sich die Robben in ihrem Becken und die Pferde auf der Koppel an und fahren Karussell. Also, sagt Matthew, was macht der Kulturschock? Wollt ihr schon nach Hause? Ich atme tief ein. Die meisten Freunde, die ich in meinem ersten Jahr an der Universität kennenlernte, waren Austauschstudenten, die ihre Abende gern damit verbrachten, sich über England zu beschweren – nur das Übliche: die Abwasserrohre, das Essen, das Wetter. Im Alter von achtzehn hielt ich ihre Unzufriedenheit für ein Zeichen von Weltgewandtheit, aber gegen Ende des Jahres murmelte ich, wenn es ihnen nicht gefalle, sollten sie doch nach Hause fahren. Ehe wir nach Island gingen, beschloss ich, dass ich keine jammernde Ausländerin sein würde. Bisher haben Anthony und ich uns, auch wenn wir unter uns waren, nicht beklagt, aber jetzt bei Matthew bricht irgendwie alles aus mir heraus, während Anthony mit den Jungs auf einem See voller weißbeiniger paddelnder Kinder Tretboot fährt. Ich wasche die Wäsche im Badezimmer per Hand und lasse sie auf einem Ständer trocknen, den wir mit dem Bus aus Hafnarfjörður geholt haben. Bei trockenem Wetter und zweiundzwanzig Stunden Sonnenschein ist eine Ladung kaum trocken, wenn ich die nächste tropfend auf den Balkon bringe. Das Essen lagern wir in einer Kühlbox auf dem Balkon. Den Müll tun wir in eine Plastiktüte, die von einem der leeren Küchenschränke aus Granit und Eiche hängt. Ich möchte Island sehen, aber man braucht Stunden, um mit einem Zweijährigen irgendwohin zu kommen, die Busse fahren unregelmäßig, und es vergehen Tage, ohne dass wir woanders gewesen wären als am Strand und im Supermarkt. Wir sind ständig nur in Gesellschaft der anderen drei, und ich muss dringend lesen und schreiben.
Matthew nimmt mich mit in einen Baumarkt, um einen Mülleimer zu kaufen, und in die National Library, wo er meine wenig überzeugende Behauptung bestätigt, dass ich Mitarbeiterin der Universität bin, und mir einen Ausweis besorgt. Aus dem obersten Stockwerk der Bibliothek sieht man von oben auf die Kiefern, die auf dem alten Friedhof stehen und zur Esja hinüberwinken. Es ist eine Naheinstellung der Aussicht, die ich von meinem Schreibtisch in der Wohnung habe, und ich lerne schnell, das Wetter einzuschätzen, indem ich den Berg betrachte. Wenn man die Esja von Reykjavík aus vollständig sehen kann, wird es nicht regnen, allerdings regnet es in unserem ersten Monat sowieso nicht viel. Die Sonne umrundet wieder und wieder den Himmel. Das Licht wechselt ständig: das Gelb des Morgens, das um sieben Uhr verschwunden ist, das Weiß des Tages, in dessen Verlauf die Schatten über die Stadt ziehen wie über eine Sonnenuhr, um die Gebäude schwappen wie Wein in einem geschwenkten Glas, und dann das Altgold und Rosa eines Sonnenuntergangs, der Stunden dauert. Wenn ich von meinem Buch aufsehe, kann ich an der Farbe des Lichts über der Esja erkennen, wann es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Ich besetze einen Tisch am Fenster und fühle mich langsam wieder wie ich selbst, versteckt in einem Labyrinth aus Bücherregalen, hoch über der Universität. Ein paar Bücher, die ich in jeder National- oder Universitätsbibliothek erwarte, sind nicht da, darunter die Gesammelten Werke Sigmund Freuds und eine ordentliche Ausgabe von Wordsworth, und mich beschleicht leichte Sorge, wenn ich an meine Kurse im Herbst denke. Aber erst mal habe ich eine Zufluchtsstätte gefunden. Ich nehme mir ein paar Tage, um an meinem Buch zu arbeiten, und Matthew und Hulda Kristín tun sich zusammen und treiben innerhalb einer Woche eine Secondhand-Waschmaschine, einen Kühlschrank und einen dänischen Hochstuhl aus Buchenholz auf. Ich denke, es gibt keinen Secondhandmarkt, sage ich. Gibt es auch nicht, antworten sie. Das verstehen Ausländer nie. Der Kühlschrank stammt aus der Garage von Hulda Kristíns Stiefvater, die Waschmaschine von der Cousine ihrer Nachbarin, die eine neue gekauft hat und froh, wenn auch überrascht war, für die alte noch Geld zu bekommen. Der Hochstuhl stand auf dem Dachboden von Hulda Kristín und wartete auf einen Verwandten, der ihn irgendwann braucht. Es gibt kaum Läden, in denen man Secondhandsachen kaufen kann, aber dasselbe Netzwerk, das zum richtigen Zeitpunkt die richtige Wohnung auftreibt, beschafft, wenn man Geduld hat, auch Haushaltsgeräte. Danke, sage ich wieder einmal. Danke.
Ich bin dankbar, aber es ist mir auch unangenehm. Menschen, die wir noch nicht lange kennen, haben uns viel Zeit und Mühe sowie materielle Dinge geopfert, und ich habe keine Möglichkeit, mich zu revanchieren. Mach dir keine Gedanken, sagt Matthew, als wir durch den Skulpturengarten in der Nähe seiner Wohnung schlendern, den Kindern folgend, die sich in den Büschen verstecken. Du wirst irgendwann Gelegenheit haben. So funktioniert das hier: Du sagst den Leuten, du suchst ein Auto, und die Freundin des Onkels von irgendjemandem zieht nach Amerika, also verkauft sie es dir zu einem guten Preis, und dann braucht sie vielleicht jemanden, der in der Nähe lebt und ein Auge auf ihre Wohnung hat, während sie weg ist. Oder du hilfst deinem Cousin zweiten Grades beim Umzug, und im nächsten Jahr verschafft er deiner Tochter einen Ferienjob. (Oder einen Bankkredit?, frage ich mich. Oder seine Anteile an den Stadtwerken, die er gerade beschlossen hat abzustoßen?) Das ist in Ordnung, sage ich, wenn man hier lebt und es die eigene Familie ist, aber keiner von euch schuldet uns irgendwas. Wir sind alle selbst mal hierhergezogen, sagt er. Normalerweise mag es die erweiterte Familie sein, aber Hulda Kristín und Pétur und alle, die ich kenne, wissen, wie es ist, wenn man als Ausländer herkommt und niemanden hat. Ohne einen Klan läuft hier gar nichts, es sei denn, man gibt wahnsinnig viel Geld aus. Also helfen wir euch, und ihr werdet irgendwann etwas für uns tun können, keine Sorge.
Ausländer, denke ich. Ausländer, útlendingur. Foreigner. Ich gehöre zum Fachbereich Ausländische Sprachen. Briten meiner Generation benutzen das Wort nicht, jedenfalls nicht so beiläufig wie die Isländer. »Foreigner« ist ein Wort, das ich mit der Daily Mail und der British National Party assoziiere, ein Begriff, den nur Leute verwenden, die damit den Gegensatz von wir und die betonen wollen. Es irritiert mich jedes Mal, wenn ich jemanden dieses Wort benutzen höre, der gebildet und intelligent ist, aber ich höre es ständig. Egal, wie lange wir bleiben, denke ich, ich werde mir diese Mentalität nicht zu eigen machen, ich werde mich oder jemand anderen nicht als Ausländer definieren. (Es geht nicht um »diese Mentalität«, sagt Pétur. »Diese Mentalität« ist englisch, imperialistisch, kolonialistisch, es hat mit Island nichts zu tun. Aber ich brauche Monate, geblendet von meinem eigenen Ausländerdasein und meinem unreflektierten Gefühl, dass das Englische den Briten gehört, um zu verstehen, was er mir sagt: Das Englisch, das die Isländer sprechen – und sie sprechen fast alle Englisch –, ist nicht dieselbe Sprache wie meine Muttersprache; »Foreigner« bedeutet im isländischen Englisch nicht immer, was es zu Hause bedeuten würde.) Matthew sagt, er habe gehört, dass Isländer Englisch als útlenska bezeichnen, ausländisch, die Sprache der Ausländer. Hulda Kristín hat mir erzählt, dass der Bauherr Sicherheiten wollte, wenn er eine Wohnung an Ausländer vermietet. Das ist verständlich, fügte sie hinzu, es gab in Island keine Drogen, bis vor ein paar Jahren die Immigranten gekommen sind, und man hört manchmal schreckliche Dinge.
Wir leben uns langsam ein. Die isländischen Sommerferien dauern drei Monate, lange genug, damit die Leute nach Hause auf den Hof fahren und die Ernte einbringen können, und Reykjavík im Juli ist wie Paris im August: keine Einheimischen, kleine Geschäfte sind geschlossen, nur Touristen bewegen sich langsam über die Hauptstraßen. Es ist noch nicht an der Zeit, unser richtiges Leben in Island zu beginnen – wir sind selbst noch Touristen –, aber wir haben jetzt eine Grundlage. Ich kann den Bus nehmen und in der Bibliothek arbeiten, und Anthony kann in der Zwischenzeit mit den Kindern ins Schwimmbad gehen oder über den Küstenweg bis zu den Schaukeln auf der Landzunge oder an den Strand am Ende der Straße. Wir essen Fisch, der sehr viel günstiger ist als zu Hause und ausnahmslos frisch, selbst im billigsten Supermarkt, in dem Obst und Gemüse zu schimmeligen Haufen aufgeschichtet ist. Pétur erzählt, als er zum ersten Mal nach Island kam, hätten viele seiner Freunde einen Fischer in der Familie gehabt, der sie unentgeltlich belieferte. Wir erfahren, dass isländisches, im Treibhaus gewachsenes Gemüse garantiert guter Qualität ist, außerdem ist es billiger als importiertes (ebenfalls eine neue Situation, sagt Matthew; erst während des Booms, als reiche isländische Reisende anfingen, Rucola und Paprika statt Kohl- und Steckrüben nachzufragen, fingen isländische Bauern an, Salat und anderes Grünzeug anzupflanzen). Isländisches Lamm, stellen wir fest, ist ein anderes Tier als sein kleiner, dicker englischer Cousin. Das Fleisch ähnelt dem von Wild, und der Geschmack erinnert an den Duft des Grases, das draußen in der Sonne wächst. Isländische Kartoffeln stammen von einer speziellen Züchtung aus dem neunzehnten Jahrhundert ab und sind süßer und fester als englische. Ich verstehe erstmals, warum die frühesten englischen Kartoffelrezepte für Desserts und Puddingtörtchen waren. Wir essen also einfach und konzentrieren uns dabei auf das Wesentliche: Fisch und Kartoffeln oder Lamm und Kartoffeln mit isländischem Salat, und Gerstenfladenbrot, flatkökur, mit isländischem Käse, der wie sehr milder Gouda schmeckt und meistens in Form gelber Ziegelsteine daherkommt, auf denen kase steht. Isländer essen nicht viel Obst, sagt Hulda Kristín, aber wenn man welches möchte, sollte man es tiefgefroren kaufen, und wir finden Fünfkilosäcke mit gefrorenen polnischen Beeren, stopfen einen unter den Buggy und schieben ihn nach Hause. Wir versuchen, nicht an Obst aus Kent zu denken, und uns kommt nicht in den Sinn, zu überlegen, was wir im Winter für frisches Obst tun würden. Pétur, der seit vierzig Jahren hier ist, nimmt, was ich für das Obst-und-Gemüse-Problem halte, gar nicht wahr, und das, obwohl seine Frau Vegetarierin ist. Als wir im Mai hier waren, habe ich ein Buch über isländische Küche gekauft, und dann, hoffnungsfroh, ein Buch von einem norwegischen Koch, das mir, wie ich dachte, helfen würde, mit isländischen Zutaten intelligente und authentische Dinge anzustellen. In dem norwegischen Buch steht ein exzellentes Pfannkuchenrezept, aber ansonsten ist es voller gut gemeinter Vorschläge, was für Mahlzeiten man mit frisch gepflückten Erdbeeren zubereiten kann, mit Krebsen, die man in Gebirgsbächen gefangen hat, oder einer Schwemme Lachse – alles Dinge, die mir nicht zur Verfügung stehen. Das isländische Buch, Nanna Rögnvaldardóttirs Icelandic Food and Cookery, ist eine fesselnde Lektüre. Zu Beginn beschreibt Rögnvaldardóttir die große Veränderung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der isländischen Gesellschaft vor sich ging, bedingt durch plötzlichen Wohlstand, Amerikanisierung und – 1944 – die vollständige Unabhängigkeit von Dänemark:
Ich bin in den 1960er-Jahren auf einem abgelegenen Hof im Norden Islands aufgewachsen. Seitdem hat sich die isländische Gesellschaft so sehr verändert, dass es mir manchmal erscheint, als müsse es in den 1860er-Jahren gewesen sein, nicht zuletzt in kulinarischer Hinsicht. In meiner Kindheit gab es einerseits traditionell isländische Gerichte – gesalzen, geräuchert, durch Milchsäuregärung haltbar gemacht, getrocknet – und andererseits die dänisch geprägte Küche der Haushaltsschule, die meine Mutter besucht hat: schwere Soßen, Gebratenes und endlos Porridge, Süßspeisen und Suppen.
Über diese »Haushaltsschulen« höre ich mehr von meinen Studenten, deren Großmütter sie als Vorbereitung auf ihr Leben als Hausfrauen, vor allem auf Bauernhöfen, besucht haben. Auch nach 1944 wurde jungen Frauen noch beigebracht, mehr oder weniger abgeänderte dänische Gerichte zu kochen. Es erinnert an die halbherzige Anpassung der englischen Rezepte an indische Zutaten und Garmethoden unter dem Raja. Beim Backen ist der dänische Einfluss auf isländisches Essen noch sehr präsent, vor allem beim Hefe- und Zimtgebäck, aber auch bei den Grundnahrungsmitteln isländischer Hausmannskost: gebratenes Fleisch mit »brauner Soße«, geschichtete Sahnetorten und Scones. Ich wüsste gern, was es davor gab. Ich möchte authentische isländische Küche, auch wenn ich weiß, dass sich in jeder Küche verschiedene Kulturen durchmischen.
Aus der Zeit vor dem achtzehnten Jahrhundert sind keine schriftlichen Berichte über isländisches Essen überliefert. Island war unbewohnt, bis um 900 n. Chr. Siedler aus Norwegen kamen. Unterwegs Richtung Westen, lasen sie irische, walisische und schottische Ehefrauen und Bedienstete auf. Die Kelten kommen in der traditionellen isländischen Geschichtsschreibung, die auf den Sagen basiert, kaum vor. Die Sagen sind lange, erzählende Gedichte über die Jahre der Besiedlung, die erstmals im zwölften und dreizehnten Jahrhundert niedergeschrieben wurden, mehrere Jahrhunderte nach den Ereignissen, die sie beschreiben. Im zwanzigsten Jahrhundert stellten isländische Historiker den Status der Sagen als historische Dokumente infrage, inzwischen werden die Gedichte eher als literarische Werke betrachtet, und trotzdem haben sie etwas von heiligen Texten an sich. Viele Isländer zitieren die Sagen auf eine Weise, auf die Puritaner des siebzehnten Jahrhunderts aus der Bibel zitiert haben dürften. Gelegentlich endet eine Diskussion bei einem Fachbereichstreffen damit, dass jemand etwas in isländischen, alliterierenden Versen äußert. Gegen Ende des Jahres werde ich in der Lage sein, diesen Treffen überwiegend zu folgen, nicht jedoch den Gedichten. Ich werde Matthew zuflüstern, er soll übersetzen, und er wird mit unbewegter Miene etwas antworten wie »Das rechte Pferd fliegt flugs bei Frost«. Was?, werde ich fragen. Was? Aber da nicken schon alle zustimmend, das Thema scheint geklärt, und ich weiß, die Sagen haben wieder gesprochen. Sie vereinen die Funktionen der Bibel mit denen des Reichsgrundbuches Englands aus dem elften Jahrhundert, stellen die Entdeckungs- und Eroberungsfahrten der Wikinger aber so dar, dass die Anwesenheit der Kelten keine Rolle spielt.
In mancher Hinsicht boten die Essgewohnheiten der Hebriden-Inseln, von denen die Sklaven kamen, eine bessere Vorlage für die Verpflegung in Island als die der Norweger. Die norwegischen Siedler waren es gewohnt, Wild zu jagen, Früchte und Beeren zu sammeln, für zusätzliche Proteine nahmen sie Nüsse und Eicheln zu sich. In Norwegen kam man leicht an Salz, mit dem man Fleisch und Fisch konservieren konnte, und es herrschte kein Mangel an Brennholz, weshalb man mehrmals täglich kochen und brennstoffintensive Zubereitungsmethoden anwenden, also zum Beispiel backen konnte. In Island, wie auch auf den Inseln des Nordatlantiks, von denen viele Ehefrauen und Bedienstete der Siedler kamen, gab es außer Robben keine einheimischen Säugetiere, es gab kein Obst, nur wenige Beeren und keine Nüsse. Island war waldig, als die Siedler ankamen, doch die Wälder wurden von Anfang an ausgebeutet, und die kahle, baumlose Landschaft, die das letzte Jahrtausend prägte, entstand wahrscheinlich in den ersten Jahrhunderten der Besiedlung. Brennstoff war somit knapp, und man stach Torf, wie auf den Hebriden.
Angesichts der Länge und Strenge isländischer Winter war es überlebensnotwendig, Lebensmittel haltbar zu machen. Fisch wurde – und wird immer noch – in Hütten über dem Strand windgetrocknet. Fleisch wurde im Kamin geräuchert. Aber die meisten Dinge wurden durch Milchgärung konserviert. Die Siedler brachten aus Norwegen Kühe mit, doch seltsamerweise gibt es keine Tradition der Käsefertigung, abgesehen von dem frischkäseartigen Quark namens skyr, den die meisten Isländer immer noch mindestens einmal am Tag essen. Das Abfallprodukt von skyr ist Molke, die oft als Getränk aufgetischt, aber auch zum Konservieren benutzt wurde. In Fässer mit vergorener Molke wurde alles eingelegt:
Fischgräten und Viehknochen wurden manchmal in der vergorenen Molke gelagert, bis sie weich wurden, und dann wurden sie gekocht und gegessen … Essen, das haltbar gemacht werden soll – zum Beispiel Blutwurst, Leberwurst, fettes Fleisch, Schafskopf, Presskopf, Walspeck, Robbenflossen usw. –, wird für gewöhnlich gekocht und gekühlt und dann in Fässer gelegt, die mit vergorener Molke gefüllt werden. Auf diese Weise hält es mehrere Monate und nimmt langsam einen sauren Geschmack an. Es heißt manchmal, alles Essen schmecke irgendwann gleich, wenn es lange genug in Molke liegt, und da ist etwas Wahres daran.
Es war nie leicht, in Island Getreide anzubauen, Weizen etwa ließ sich gar nicht anbauen. Öfen waren wegen des Mangels an Brennholz unbekannt, also nahm man das Getreide – wiederum wie auf den Hebriden – in Form von Porridge oder Fladenbrot zu sich. Die meisten Menschen aber vertrauten stattdessen auf getrockneten Fisch, der mit (ungesalzener) Butter bestrichen und wie Brot als Beilage oder kleiner Imbiss gegessen wurde und manchmal immer noch wird. Mit »Isländisch Moos« – einer Art Flechte, die noch heute für Tees verwendet wird – und Algen wurde das Getreide gestreckt, außerdem scheinen sie die einzige Vitamin-C-Quelle gewesen zu sein.
Ich fühle mich nicht besonders ermutigt. Die Gerstenfladenbrote vom Samstagsmarkt am Hafen sind gut und erinnern mich an die Haferkekse aus Staffordshire, die ich als Kind liebend gern mit Käse oder Butter aß. Die Kinder mögen den windgetrockneten Fisch, aber ich kann den Geruch nicht ertragen. Wir alle essen skyr, vergorene Molke ertrage ich jedoch nicht und Blutwurst oder Leberwurst noch viel weniger. In den Rezepten aus Icelandic Food and Cookery wird von Kartoffeln bis zu geräuchertem Lamm alles mit weißer Soße zugedeckt, die manchmal mit Ketchup oder Ananassaft gestreckt wird. Salate bestehen aus Kohl oder Karotten und viel Mayonnaise. Ein Rezept schlägt vor, dass ich Lämmerherzen so lange im Fond köcheln lasse, bis sie zart sind, woraufhin ich den Fond mit Margarine und Mehl andicke. Wie machst du das, frage ich Pétur, was isst du? Ach, sagt er vage, man gewöhnt sich an alles. Aber wenn ich mehr über nordisches Essen wissen wolle, solle ich mich an Mæjas Mann Mads wenden. Mæja?, frage ich. Ja, Mæja, sagt Pétur. Du weißt schon, Mæja. Mæja Garðarsdóttir. Jeder kennt Mæja. Ich nicht, aber bald werde ich sie kennenlernen.
Mæja ist Dozentin für Linguistik und interessiert sich besonders für den Erwerb von Zweitsprachen. Sie ist praktisch im Laden ihres Vaters aufgewachsen, gleich um die Ecke von der Universität, was ungewöhnlich für ihre Generation ist, weil da noch fast alle vom Bauernhof stammen, auf den sie bei jeder Gelegenheit zurückkehren. Mæja lebt ein paar Blocks von diesem Laden entfernt, zusammen mit Mads, der Däne und gelernter Koch ist und jetzt im Nordic House Gastronomie lehrt. Das Nordic House ist ein panskandinavisches Kulturzentrum, inoffizieller Teil der Universität, das sich in einem Alvar-Aalto-Gebäude auf dem Feuchtreservat zwischen meinem Bürogebäude, Nyi Garður, und dem nationalen Flughafen befindet. Mads und ich vereinbaren, uns dort zu treffen, damit er mir erzählen kann, was ich über Island und die neue nordische Küche wissen möchte.
Es ist ein heißer Tag, oder jedenfalls wäre es ein heißer Tag, wenn der Wind nicht wäre – diese Art Sätze sagen die Menschen in Island genauso oft wie die im Norden Englands. Ich überquere die Parkplätze, die sich in dieser Stadt wie Seen zwischen den Gebäuden erstrecken, und gehe die flachen Schieferstufen zum Nordic House hoch. Es ist eins dieser Häuser, die mehr Sonnenlicht zu enthalten scheinen, als draußen vorhanden ist, und es gibt Stellen, an denen man sich hinsetzen und Worte in Englisch und allen nordischen Sprachen lesen kann. Im Atrium sind gestrickte und gefilzte Mützen in Rot- und Grüntönen ausgestellt, angeordnet wie Reptilien. Außerdem hängt die Speisekarte des Dill aus, des Restaurants für neue nordische Küche, die ich voller Neid lese. Wie die meisten Restaurants in Reykjavík ist auch dieses zu teuer für jemanden, der im öffentlichen Sektor arbeitet, aber ich gebe mir selbst das Versprechen, dass Anthony und ich auf jeden Fall ein Mal herkommen werden, falls wir einen Babysitter finden und einen Grund zu feiern. Fisch, Kräuter, Beeren, wilde Pilze, Sauerampfer: Da kann ich etwas lernen.
Mads kommt mit ausgestreckter Hand auf mich zu und lächelt hinter seinem Bart und der Brille. Willkommen, sagt er. Willkommen im Nordic House, willkommen in Island. Soll ich Sie herumführen? Wir gehen durch breite weiße Flure mit Holzfußboden, an den Wänden hängen gerahmte Tuschezeichnungen. Alle Bürotüren stehen offen, sodass ich in die lichterfüllten Räume mit honigfarbenen Möbeln, hellen Teppichen und Kissen sehen kann, in denen Menschen zu nordischer Literatur und Kunst und nordischem Design forschen. Das Nordic House hat die Gastronomie kürzlich als eine der Künste anerkannt, erzählt Mads, es beginnen also gerade alle möglichen neuen Projekte. Wir gehen eine weiße Wendeltreppe hinunter in die Bibliothek, die eher als Arbeitsraum für Lesende und Schreibende gedacht ist denn als Buchlager, mit großen Tischen und niedrigen Stühlen. Alle Möbel, sagt Mads, wurden von Aalto für dieses Gebäude entworfen, sogar die Türgriffe und Lichtschalter. Beneidenswert, an so einem Ort arbeiten zu können, antworte ich.
Wir kehren ins Atrium zurück. Gehen wir ins Café, schlägt Mads vor. Ich kann Ihnen auch den Garten zeigen. Wir gehen raus, über den Rasen, auf dem Gänseküken laufen üben, während ihre Mütter nach Störenfrieden Ausschau halten. Es gibt Gemüsebeete, Johannisbeersträucher und sogar einen Obstbaum, der hinter etwas steht, das ich für ein Gewächshaus halte. Das ist eins meiner neuen Projekte, erklärt mir Mads. Die Leute sagen, Äpfel würden hier nicht wachsen, weil die Winter zu kalt sind, aber ich glaube, dass es doch geht. Mit einigen Sorten jedenfalls. Die Winter sind inzwischen so viel kürzer und milder als noch vor ein paar Jahren. Hier ist der Rhabarber, den die meisten Menschen im Garten haben. Rhabarber war bis vor Kurzem so ziemlich die einzige Marmelade, die es in Island gab. Und Johannisbeeren – die Büsche tragen Früchte, wie Sie sehen. Und dann haben wir isländische Kartoffeln, die sich genetisch von europäischen unterscheiden, und Kohl und Zwiebeln. Grünkohl, Rosenkohl, Blumenkohl. Ich möchte alles anbauen, was geht. Ich möchte den Leuten zeigen, was wir in Island alles anbauen können, sogar in der Stadt. Und mit Gewächshäusern ist natürlich noch mehr möglich. Sollen wir Kaffee trinken gehen?
Wir treten in das Glashaus, dessen Dach einen Leuchtturmstrahl zur Sonne zurückwirft. Es ist Café und Gewächshaus zugleich. Die Kellnerin öffnet die Lamellenblenden, weil es wirklich heiß ist, und bringt uns Kaffee und Mandelkuchen, der das Beste ist, was ich gegessen habe, seit wir den Wochenmarkt in Canterbury hinter uns gelassen haben. Es ist wunderbar, sage ich zu Mads. Ihr Garten und das Nordic House und das Café. Ich esse meinen Kuchen und entspanne mich in Gesellschaft von jemandem, der versteht, wie ich über Essen denke und warum es mir so viel bedeutet, jemand, der – da er selbst Exilant ist – emotional wie intellektuell nachvollziehen kann, warum es schwer ist, die eigenen Kochgewohnheiten abzulegen wie Sommerkleidung oder die gewohnte Zeitung. Ich dachte, das gibt es in Island nicht, sage ich. Ich dachte, hier interessiert sich niemand dafür, woher das Essen kommt.