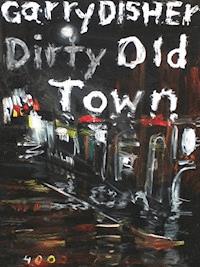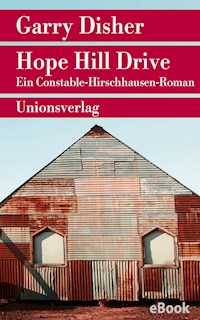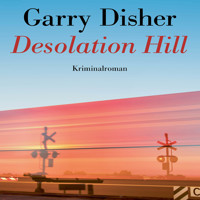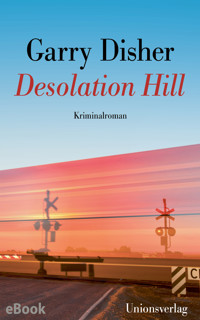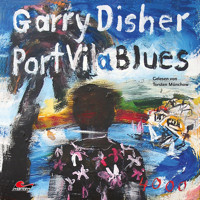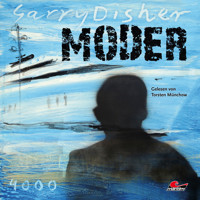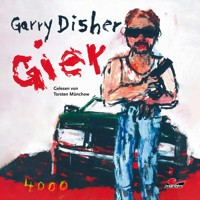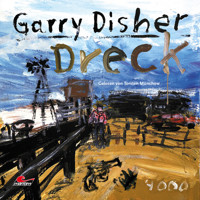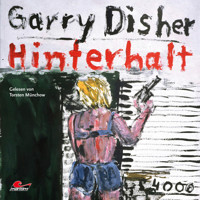9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Detective Inspector Hal Challis den brutalen Mord an Janine McQuarrie untersuchen soll, die auf einer einsamen Landstraße vor den Augen ihrer siebenjährigen Tochter erschossen wurde, werden seine Ermittlungen durch ein Gewirr von Lügen und Heimlichkeiten behindert. Als wenig hilfreich erweist sich, dass Janines Schwiegervater der Vorgesetzte von Challis bei der Polizei ist. Hal Challis’ Liaison mit der Chefredakteurin der Lokalzeitung sorgt zusätzlich für Misstrauen bei den Polizeibeamten von Waterloo, die sich nicht gern in die Karten blicken lassen. Und auch die Gäste der Sexpartys in den properen Vorstadthäusern wollen um jeden Preis anonym bleiben. Jeder in Waterloo hat etwas zu verbergen und etwas zu verlieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als Detective Inspector Hal Challis den brutalen Mord an Janine McQuarrie untersuchen soll, die auf einer einsamen Landstraße vor den Augen ihrer siebenjährigen Tochter erschossen wurde, werden seine Ermittlungen durch ein Gewirr von Lügen und Heimlichkeiten behindert. Jeder in Waterloo hat etwas zu verbergen und etwas zu verlieren.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Garry Disher (*1949) wuchs im ländlichen Südaustralien auf. Seine Bücher wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal der wichtigste australische Krimipreis, der Ned Kelly Award, viermal der Deutsche Krimipreis sowie eine Nominierung für den Booker Prize.
Zur Webseite von Garry Disher.
Peter Torberg (*1958) studierte in Münster und in Milwaukee. Seit 1990 arbeitet er hauptberuflich als freier Übersetzer, u. a. der Werke von Paul Auster, Michael Ondaatje, Ishmael Reed, Mark Twain, Irvine Welsh und Oscar Wilde.
Zur Webseite von Peter Torberg.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Garry Disher
Schnappschuss
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Ein Inspector-Challis-Roman (3)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Snapshot bei Text Publishing, Melbourne.
Originaltitel: Snapshot (2005)
© by Garry Disher 2005
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: designclass (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30358-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 18:12h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SCHNAPPSCHUSS
1 – Samstagabend hatte sie zugeschaut, wie Robert es mit …2 – Sie waren zu zweit, Fahrer und harter Bursche …3 – Normalerweise begann Hal Challis den Tag mit einem …4 – Dem DC zufolge, der Challis am Tatort des …5 – Detective Sergeant Ellen Destry hatte ihren halben freien …6 – Scobie Sutton, ein dürrer Mann mit dem Gesichtsausdruck …7 – Tessa Kane wusste um viertel vor zehn von …8 – Ellen und Scobie waren in Mount Eliza …9 – Scobie saß hinterm Steuer, und Ellen saß voller …10 – Bei der Fahrbereitschaft unterschrieben sie die Übernahme eines …11 – Robert McQuarrie kam herein. Er wirkte blass …12 – Die beiden Constables Pam Murphy und John Tankard …13 – Hoppla, sie hatte die Polizisten in ihrem Sportwagen …14 – »Lass mich fahren«, sagte John Tankard nach dem …15 – Challis und Ellen hielten in Frankston, um zu …16 – Scobie Sutton hatte erfahren, dass Mrs. Humphreys ihn …17 – Mead führte Tessa durch das Internierungslager und achtete …18 – Einsatzzentrale, 17 Uhr19 – Nach Challis’ Erfahrung kehrten nur sehr wenige Verbrecher …20 – Ellen machte eine Lasagne zum Abendessen, weil sie …21 – Um halb sieben in der Früh marschierte Challis …22 – Eine Stunde später setzte sich Ellen an den …23 – Isolation führt zu Reinheit und Stärke, schrieb Vyner …24 – Ellen saß im Dienst-Falcon auf dem Parkplatz hinter …25 – Auf der anderen Seite der Halbinsel sagte gerade …26 – Von ihrem Bürotelefon im Gebäude des Progress gab …27 – Nach der morgendlichen Lagebesprechung hatte Challis Anfragen um …28 – »Ich hatte nicht mit schweren Geschützen gerechnet« …29 – Challis wartete an der Tür zur Einsatzzentrale …30 – Mittwochabend gegen 20 Uhr, fast sechsunddreißig Stunden nach …31 – Tessa Kane arbeitete lange und brütete noch über …32 – Sie bildeten drei Teams und schlugen am frühen …33 – Robert McQuarrie und die anderen Betroffenen gaben an …34 – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags war ein …35 – Während Challis warten musste, kochte er sich einen …36 – Das war ’n ganz schöner Mist, wie wir …37 – Donnerstagnachmittag saß Tank hinterm Lenkrad. Während er den …38 – Ellen, die noch immer ein leichtes Ziehen in …39 – Andy Asche war schon längst wieder in Waterloo40 – Challis verbrachte den Großteil des Freitagmorgens im Büro …41 – Raymond Lowrys Frau war eine kleine, entmutigt wirkende …42 – Challis hatte keine andere Wahl. Er musste Lowry …43 – Scobie Sutton wollte gerade nach Hause fahren …44 – Es war Wochenende, und plötzlich schien der Winter …45 – Montagmorgen46 – Ellen war von der Sitzung beeindruckt, das musste …47 – Zur gleichen Zeit saß Pam Murphy in einem …48 – Um 20 Uhr saß Ellen immer noch allein …49 – Es war dunkel geworden, der Abend war neblig …50 – Ellen stellte ihren Wagen zwei Blocks entfernt ab …51 – Challis war gerade erst zur Haustür hinein …52 – Dienstag gegen 16 Uhr schrieb Vyner: Männer sind …53 – Am Mittwoch kurz nach der Mittagspause tauchte Ellen …54 – Challis, der einen dunklen Anzug und eine schwarze …55 – Doch damit kamen die Ermittlungen fast zum Erliegen …56 – An einem Sonntag Anfang August, fast vier Wochen …57 – Ellen Destry starrte düster die Leiche an …58 – Als Challis eintraf, fand er entlang des Zaunes …59 – Am Montag fuhr Challis in die Stadt und …60 – Am Donnerstag bemerkte John Tankard: »Dieser Job ist …61 – Am späten Nachmittag hatten sie zu dem Namen …62 – »Ist er immer noch im Internierungslager?«, fragte Challis63 – Vyner war wie verabredet gegen 16 Uhr dort …64 – Challis und Ellen waren nicht die Ersten am …Mehr über dieses Buch
Über Garry Disher
Garry Disher: Gedanken über die Arbeit am Schreibtisch
Garry Disher: »Ich genieße es, im deutschsprachigen Raum auf Lesereise zu gehen.«
Über Peter Torberg
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Garry Disher
Zum Thema Australien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für Frank Nowatzki
1
Samstagabend hatte sie zugeschaut, wie Robert es mit vier Frauen hintereinander trieb. Sie selber hatte Sex mit zwei Männern. Nun war es Dienstag, und sie fuhr mit ihrer siebenjährigen Tochter über den Highway. Samstag abends Sex mit Fremden, Dienstag früh mit ihrer Tochter im Familienkombi: die Gegenpole ihrer Existenz? Nun nicht mehr. Dagegen hatte Janine McQuarrie etwas unternommen.
»Wann sind wir endlich da?«, fragte Georgia mit piepsender Stimme.
Noch so ein Klischee in einem Leben voller Klischees. »Bald, mein Schatz. Dauert nicht mehr lang.«
Sie musste sich konzentrieren. Die schwache Wintersonne warf verwirrende Schatten, aber vor allem musste sie bald mehrmals rechts abbiegen. Einmal vom Highway runter, dann vom Peninsula Freeway und dann von der Penzance Beach Road, die sich in schwindelerregende Höhe über dem Meer hinaufschraubte. Vor einer Kreuzung, an der die Ampel grün war, fuhr sie langsamer. Hier sollte sie rechts abbiegen, aber das bedeutete, dass sie dem Gegenverkehr, der unablässig auf sie zuströmte, Vorfahrt lassen musste, und was, wenn irgendein Irrer nicht mehr bremsen konnte, bevor sie ganz abgebogen war? Sie versuchte zu schlucken. Ihr Mund war ganz ausgetrocknet. Jemand hupte sie an. Ohne abzubiegen, fuhr sie über die Kreuzung.
All diese Leute letzten Samstag waren sich so nahe gekommen, wie es körperlich nur ging, doch Janine hatte keinerlei Zusammengehörigkeitsgefühl erwartet, nicht gesucht und auch nicht gefunden. Sie wusste von früheren Gelegenheiten, dass die anderen Paare Ausschau nach einander hielten. Die Frauen schauten nach ihren Männern, hatten stets ein Lächeln, einen Kuss, eine liebevolle Geste parat, die besagen sollte: »Wollte nur mal sehen, ob du glücklich bist.« Und die Männer schauten, wie es ihren Frauen erging: »Alles in Ordnung? Ich liebe dich.« Ja, manchmal kamen sie zusammen und hatten Sex miteinander, bevor sie zu einer anderen Spielecke weiterzogen. Aber das war nicht Roberts Art. Er wünschte ihr noch nicht mal viel Spaß, sondern war sofort hinter den jüngeren Ehefrauen her und den Frauen, die allein gekommen waren. Dann wurde er von Gier gepackt, die sie in seinen Augen aufblitzen sehen konnte. Letzten Samstag war es nicht anders gewesen. Bis drei Uhr früh hatte er sie dort festgehalten, selbst nachdem die meisten anderen schon lange nach Hause gegangen waren.
»Ma?«
»Was denn?«
»Krieg ich ein Happy Meal?«
»Mal sehen.«
Georgia neben ihr fing an zu singen.
Drei Monate lang hatte ihr Mann sie bearbeitet, bis sie endlich einwilligte. Als er das erste Mal vorschlug, sie sollten doch auf eine Swingerparty gehen, hatte Janine erst geglaubt, Robert würde einen Witz machen, aber schnell festgestellt, dass er es ernst meinte. Ihr war ein wenig unbehaglich dabei, aber eher wegen der Geschmacklosigkeit und der Gefahr, ertappt zu werden, weniger wegen des Eindrucks, dass er sie vielleicht körperlich nicht mehr begehrte.
»Warum willst du denn Sex mit anderen Frauen haben?«, hatte sie ihn gefragt und dabei ein leichtes Zittern in die Stimme gelegt.
»Aber du kannst doch Sex mit anderen Männern haben«, hatte er verständnisinnig geantwortet, »mit so vielen, wie du magst.«
»Ach, machst du den Zuhälter, Robert?«
»Nein, natürlich nicht, das wird unserem Liebesleben Würze verleihen.«
Janine musste zugeben, dass ihr gemeinsames Liebesleben schläfrig bis nicht existent war. Das war es immer noch – zumindest mit Robert.
Drei Monate lang ließ sie ihn in dem Glauben, er würde sie dazu überreden, überzeugen, verführen. »Du wirst nette Leute kennen lernen«, sagte er einmal. »Sehr offenherzige Menschen.«
Das war die Bestätigung. Er hatte schon Erfahrungen mit so etwas. Sie machte eine kurze Pause und fragte dann mit leiser Stimme: »Willst du mir damit sagen, dass du schon mal auf so einer Party warst?«
»Ja«, antwortete er und versuchte, nicht beschämt oder ausweichend zu klingen, sondern offen und ehrlich, vielleicht sogar ein wenig herausfordernd und couragiert. Wut stieg in ihr auf, aber das behielt sie für sich. Er war so durchschaubar, so klein. Sie tat scheu, ein wenig eingeschüchtert, und fragte: »Ach, sind denn Männer allein überhaupt zugelassen?«
»Auf manchen Partys schon«, antwortete er. »Dann kostet es mehr, und wenn man als schmieriger Typ rüberkommt, wird man schnell ausgeschlossen.«
Schmierig war Robert nicht, und gruseln musste man sich auch nicht vor ihm. Er sah eigentlich nach nichts Besonderem aus. Schmierig waren nur seine Moralvorstellungen.
»Du hast keinen Grund, dich bedroht zu fühlen oder eifersüchtig zu sein«, sagte er mit sanfter Stimme und streichelte ihren Arm, ihren Hals, ihre Brüste, und tatsächlich erregte sie das, ihr Körper verriet sie. »Das schmiedet das Band zwischen den Paaren nur umso fester«, fuhr er fort. »Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Es geht um gegenseitiges Vertrauen. Eine ganz grundsätzliche Sache.«
Und so weiter und so fort, drei Monate lang.
»Ich will nicht mit einem Heizungsmonteur schlafen«, sagte sie schließlich. Sie wusste ganz genau, auf welche Knöpfe sie bei ihm drücken musste.
Er schüttelte den Kopf, ganz Gentleman. »Natürlich finden sich dort Leute aus allen Gesellschaftsschichten«, sagte er, »aber ich werde dafür sorgen, dass wir nur auf die besseren Partys gehen.«
Ja genau, Partys, auf denen rechte, neunmalkluge Söhne von Police Superintendents zugelassen sind, dachte sie an der nächsten Kreuzung, und ihr Magen wurde zu Stein, als sie endlich den Mut aufbrachte, durch den ihr entgegenbrausenden Verkehr hindurch rechts abzubiegen. Kurz darauf fuhr sie den Anstieg hoch, landeinwärts, fort von der Küste, über schmale, sonnenlose, mit tropfnassen Kiefern und Eukalyptusbäumen gesäumte Straßen. Der Winter hatte eingesetzt.
Schließlich gaukelte sie Robert vor, dass er sie weich gekriegt hatte, und ließ sich von ihm zu seinen banalen kleinen Vorstadtorgien mitnehmen. Sie ging aus Neugier mit, aber auch, um etwas gegen ihn in der Hand zu haben. Bei den ersten drei Malen bestand sie darauf, nur als Zuschauerin teilzunehmen – Robert juckte es natürlich, gleich mitzumachen.
Bei der vierten Party trank sie erst ziemlich, um so den Eindruck zu vermitteln, sie müsse sich Mut antrinken – doch dann stellte sie zu ihrer eigenen Verärgerung fest, dass sie den Alkohol tatsächlich nötig hatte. »Gut so, mein Schatz«, sagte Robert.
Zu ihrer Überraschung stellte sich das Ganze als ziemlich erotisch heraus. Ein Haus in Mornington, die Straße mit Platanen gesäumt, hohe Hecken, um die Blicke der Passanten oder neugieriger Nachbarn abzuhalten. Robert zeigte ihr das Anwesen und stellte den Wagen dann in einer Seitenstraße ab. »Wir tun nichts Verbotenes«, sagte er, »aber wir wollen auch kein unnötiges Aufsehen erregen.« Wie für eine normale Party gekleidet, gingen sie zum Haus und wurden an der Tür empfangen.
Es war zehn Uhr abends, die meisten Gäste waren schon anwesend, etwa zwanzig Pärchen und ein Dutzend Frauen. Janine hatte einige von ihnen schon bei früheren Gelegenheiten gesehen. Sie standen mit Drinks in den Händen herum, unterhielten sich über Football, die Börse und darüber, wer die Kinder hütete – in Janines und Roberts Fall war es Janines Schwester Meg.
Gegen halb elf hatten sich alle entspannt. Jacketts wurden abgelegt, Lichter gedämpft, es gab Geknutsche, in einer Ecke des Wohnzimmers lief auf einem Breitbildfernseher ein Porno.
Bald darauf verschwanden die Männer und Frauen in den »Umkleidezimmern«, hängten Hosen, Jeans, Kleider und Blusen weg und tauchten wieder auf, die Männer in Tangas, die Frauen in schwarzen Schlüpfern, Miedern, Jazzpants.
Nach den drei vorangegangenen Besuchen hatte sich Janine schon daran gewöhnt. Auch als Gast musste man sich »leger« kleiden.
Sie trank noch einen Wodka, zog sich dann bis auf den Schlüpfer aus und ging oben ohne in eines der Schlafzimmer, einen großen Raum, in dem zwei Doppelbetten zusammengeschoben worden waren. Schwarze Satinlaken, Kerzen, die ein schummriges Licht warfen, aber so standen, dass sie nicht umgestoßen werden konnten. Auf einem Beistelltisch eine Schale mit Kondomen und ein Gleitgelspender. Zwei Paare schliefen miteinander, andere standen im Schatten und schauten zu, traten manchmal vor und besahen sich das feuchte Geschehen aus der Nähe. Janine, die sich nach den Wodkas besser fühlte und herumschlenderte, spürte, wie die Lust sie schlagartig überkam und ihr heiß und unangenehm durch die Magengrube fuhr. Sie hockte sich auf eine Bettkante, berührte eine Frau an der Brust, einen Mann am Penis und fragte: »Darf ich?«
Es war wichtig, zu fragen und sich nicht einfach aufzudrängen. Die beiden lächelten. Ja, sie durfte. Mach doch einfach mit, Schätzchen, wie wärs?
Janine war immer noch unsicher. Ein Großteil von ihr wollte, ein anderer Teil nicht. Wenn sie sich vielleicht nur aufs Bett legte … die Zeit verging. Manche blieben stehen, schlenderten in eine andere Spielecke oder schlossen sich ihnen an. »Gefällt dir das?«, fragten sie, »oder das?« »Hier oder da?« »Was ist dir lieber?« »Darf ich das hier machen?« »Was macht dich an?« Gegen Mitternacht hatte Janine mit drei Männern geschlafen.
Ihre persönliche Erweckung erlebte sie, anders als Robert beabsichtigt hatte, als sie vor ein paar Wochen Liebe und Erregung in den Armen eines Mannes fand, der nicht zu dieser Swingerszene gehörte.
Janine schlug sich die Gedanken daran aus dem Kopf und konzentrierte sich auf die Straße. Jetzt, da sie auf der Penzance Beach Road war, fühlte sie sich etwas sicherer. Sie fuhr durch eine Gegend mit asphaltierten Straßen, von denen Schotterwege abzweigten, und kam an Weingütern, Beerenfarmen, Kunsthandwerksgalerien vorbei und begegnete dabei mehr Autos, als ihr eigentlich lieb war. Von Westernport aus hatte sich dichter Nebel über die Halbinsel gesenkt. Sie versuchte, sich im Geiste die Fahrtroute vorzustellen, aber sie war noch nie hier entlanggefahren. Robert war der Fahrer in der Familie.
Robert mit seinem Blödsinn von wegen höherer Form sexueller Freiheit. Von Anfang an hatte Janine gewusst, dass Robert und die anderen die ganze Angelegenheit nur ins rechte Licht rücken wollten, damit sie sich wegen dessen, was sie da in Wahrheit taten, besser fühlten. »Die Aufhebung der Eifersucht« nannten sie das, »wahrhaftiges Teilen« und eben »die höchste Form sexueller Freiheit«. Janine hatte auf ein paar Websites noch mehr solcher Sprüche gefunden: »Spaß und Erotik für alle gemeinsam«, verkündete ein Anbieter, der auch Kleinanzeigen schaltete, die darauf abzielten, gleichgesinnte Pärchen zusammenzubringen.
Auch in den Verhaltensregeln kam dieser Ton durch. Natürlich nannte sie niemand Verhaltensregeln, sondern »Umgangsformen«: vorher duschen, Safer Sex, kein Analverkehr, die Wünsche des anderen respektieren. Nein heißt Nein, erst fragen und den passenden Augenblick abwarten, zuschauen erlaubt. In den Spielbereichen nur erotische Kleidung, einen Drink zur Auflockerung gern, aber niemand will mit einem Betrunkenen zusammen sein.
Trotz all des Unsinns drumherum war es beim ersten Mal durchaus erregend gewesen, und so blieb es auch eine Weile. Manchmal passten die Bestandteile – die Gerüche, Geräusche, Eindrücke – so gut zusammen, dass Janine ganz geil wurde. Frei, lebendig oder leicht verrucht, um nur einiges von dem Blödsinn zu nennen, den die anderen ab und zu von sich gaben, kam sie sich allerdings nicht vor. Und ihre Beziehung zu Robert hatte sich auch nicht gebessert – nicht, dass sie das damals gewollt hätte und heute, wo sie einen echten Mann, die echte Liebe gefunden hatte, erst recht nicht. Janine empfand das alles eher als harte Arbeit, und sie verachtete das ganze Drumherum. Alle waren so nett, bemühten sich so sehr darum, dass alle Gelegenheit hatten, in dieses einzudringen, jenes zu berühren, dieses zu lutschen, jenes zu streicheln, tu dies, bitte, tu das noch mal, bitte. Sie war Psychologin von Beruf, aber man brauchte keinen Universitätsabschluss, um zu erkennen, dass diese ganze Sexpartyszene auf die Bedürfnisse des Mannes zugeschnitten war, nicht auf die der Frau, und ganz symptomatisch war für fundamentale Ängste, für das verzweifelte Klammern an die Jugend, für die Suche nach Selbstachtung und für den jämmerlichen, illusorischen Wunsch, begehrt und geliebt zu werden.
Robert und seine Kumpel brauchten mal eine gehörige Portion Wirklichkeit. Die Möglichkeit dazu war Janine in den Schoß gefallen. Vor genau einer Woche hatte der Waterloo Progress, eine kleine Wochenzeitung, einen langen Artikel über die Swingerszene veröffentlicht. Die Herausgeberin hatte offenbar an einer Party irgendwo auf der Halbinsel teilgenommen und mit Einverständnis der Veranstalter und Teilnehmer darüber geschrieben. Der Artikel hatte bei den braven, anständigen Bürgern, die insgeheim nach etwas Würze in ihrem Leben gierten, für ziemlichen Wirbel gesorgt. Keine Fotos, keine echten Namen – und genau das hatte Janine auf die Idee gebracht. Gestern dürften Robert und drei seiner Kumpel ihre Post geöffnet und Fotos von sich in all ihrer natürlichen Schönheit gefunden haben, wie sie es vor einem Haufen anderer Nackter mit Frauen trieben, die nicht ihre Ehefrauen waren.
Mit einem normalen Fotoapparat oder einer kleinen Spionkamera hätte sie die Aufnahmen nicht machen können. Aber ein Handy mit Foto und Video, das war was ganz anderes. Auf diesen Partys brauchte man ja ein Handy, in ein Handtuch gewickelt, im Tanga oder Mieder versteckt, für den Notfall, dass die Babysitterin anrief.
Ein paar schnelle Schnappschüsse, ein paar Sekunden Video: Hausärzte, Geschäftsleute, Schuldirektorinnen, Anwälte und Buchhalter, die in irgendeinem hässlichen Vorortschlafzimmer mit Fremden bumsen. Sogar ein paar Schnappschüsse von Robert. Janine zitterte geradezu vor Freude. Und wenn sie die Bilder seinem Vater, dem Police Superintendent, dem Hüter der Ordnung, zeigte?
Nein, vielleicht ein andermal.
Janine hatte den vier Männern, deren Gesichter deutlich genug zu sehen waren, um erkannt zu werden, jeweils ein Foto geschickt. Keine Geldforderungen, keine Notiz. Sie wollte nur für ein wenig Unruhe innerhalb der Swingerszene sorgen. Sie musste grinsen wie ein Haifisch. Die Angst, sich auf einmal im Internet wieder zu finden, so dachte sie, dürfte wohl nicht allzu tief in dem winzig kleinen Verstand dieser Männer verborgen liegen.
Offenbar hatte Robert den Umschlag am Vortag während der Arbeit geöffnet. Als er nach Hause kam, erlaubte sie sich einen kleinen Scherz, rieb sich an ihm, fühlte nach seinem Schwanz und fragte: »Können wir nächstes Wochenende wieder auf eine Party gehen? Ich kann an nichts anderes denken. Du hattest Recht, es ist befreiend.«
Er verzog den Mund vor Entsetzen und Abscheu und wand sich aus ihren Armen. »Ich glaube, das ist keine so gute Idee«, hatte er mit gepresster Stimme gesagt, bevor er wütend geworden war und sie beinahe geschlagen hätte. Janine hatte schon immer angenommen, dass er zu Gewalt neigte. Robert war genau die Art von Mann, der seine Frau umbringen und dann darauf plädieren konnte, sie habe ihn provoziert. Janine wusste, dass es eine ganze Menge Männer gab – Richter und Verteidiger –, die ihn damit durchkommen lassen würden. Schließlich schloss er sich den ganzen Abend über in sein Büro ein. Um sechs Uhr früh war er dann nach Sydney geflogen.
In diesem Augenblick riss die Stimme ihrer Tochter Janine aus den Gedanken. »Kann ich die Heizung anmachen?«
»Klar.«
Es war kalt für Anfang Juli – was wohl einen langen, trüben Winter befürchten ließ, nahm Janine an. Sie schaute zu, wie Georgia profihaft die Heizungs- und Ventilatorregler des Volvo betätigte; die Konzentration stand in dem süßen Gesicht mit seinem Kranz aus feinen blonden Locken geschrieben. Janine wunderte sich, wie Robert und sie nur so etwas Hübsches zustande gekriegt hatten. Sie fuhren weiter durch die nebelverhangene Landschaft, und nach einer Weile rutschte Georgia auf ihrem Platz nach vorn und fragte: »Ma, ist es noch weit?«
»Ich glaube nicht«, antwortete Janine und klang zuversichtlicher, als sie eigentlich war.
Sie fuhren eine Kammstraße entlang, alle paar hundert Meter standen Milchkannen als Briefkästen und Tafeln, auf denen für ›Pferdemist‹ geworben wurde. Dicht stehende Bäume und Unterholz verbargen Zufahrten, die hinunter zu Häusern und Gärten führten, die in den Hügeln verstreut lagen. »Ich glaube, hier ist es«, fuhr Janine fort und wies auf niedrige Ziegelsäulen und ein offenes Holztor. Sie bremste vorsichtig, um nicht den Fahrer des Wagens hinter sich zu verschrecken, blinkte, bog von der Straße ab und fuhr in einem sanften Bogen einen Schotterweg hinab zu einem Wendeplatz neben einem Schindelhaus.
»Schau mal, Schätzchen«, sagte sie und zeigte nach vorn, wo der Nebel sich teilte und einen atemberaubenden Blick auf ein Tal, das Meer und Phillip Island freigab. Doch Georgia ging nicht darauf ein. »Hier ist es unheimlich«, sagte sie und meinte damit das schmutzige alte Schindelhaus. »Muss ich im Auto warten?«
»Du darfst bestimmt fernsehen oder so, da bin ich sicher«, antwortete Janine.
Sie war so durcheinander, dass sie lieber noch mal auf der Straßenkarte nachschaute, ob sie auch richtig war, und atmete erleichtert auf, als sie einen Wagen mit knirschenden Reifen kommen hörte.
2
Sie waren zu zweit, Fahrer und harter Bursche. Sie rollten die Einfahrt entlang in einem Holden Commodore, Modell 1983, aber immer noch häufig auf den Straßen anzutreffen, wenn auch nicht in schmutzigem Weiß mit einer hellgelben Tür.
Eine Frau, mehr wusste Gent nicht. Er wusste auch nicht, was sie angestellt hatte, nur, dass Vyner ihr mal die Meinung geigen, sie warnen, vielleicht ein paar Ohrfeigen verpassen sollte. Dafür war Vyner zuständig, nicht er. Er war der Fahrer, er lieferte nur den Wagen und die Ortskenntnisse für die gewundenen Straßen in dieser Gegend der Halbinsel, in der es kleine Städtchen, Obstplantagen und Weingärten gab. Vom Meer her zog Nebel auf, verdeckte Straßen und Schiffsrouten und bot gute Deckung für ihren Job.
Die Einfahrt fiel steil von der Hauptstraße ab, und die Bremsen des Commodore waren abgefahren. »Scheißkarre«, sagte Vyner, sein Beifahrer.
Gent rutschte unbehaglich hinter dem Steuer herum. Vyner hatte ihm gesagt, er solle einen vernünftigen Wagen klauen mit ausreichend PS, aber nichts Ausgefallenes.
»Was Besseres hab ich nicht gefunden«, murmelte Gent und trat schuldbewusst mehrmals auf die Bremse des Wagens, der seiner Cousine gehörte.
Der Typ ist ’ne Pfeife, dachte Vyner auf dem Beifahrersitz, zog mit der einen behandschuhten Hand eine Pistole aus der Tasche und schraubte mit der anderen den Schalldämpfer auf. Er wartete mit kaum verhohlener Ungeduld darauf, dass Gent endlich anhielt, dann stieg er aus und ging auf den Wagen der Frau zu, einen silberfarbenen Volvo Kombi. Die Frau stieg entschuldigend lächelnd aus. Vyner hasste das. Wo er herkam, da handelte man erst und stellte dann Fragen. Jugendstrafgericht mit dreizehn, staatliche Fürsorgeanstalt mit vierzehn, Verurteilung zu einer Strafe in einer Jugendstrafanstalt mit fünfzehn. Dann die Navy, wo er ein paar Jahre lang alles daransetzte, um so nützliche Dinge wie technologisch hochentwickelte Tötungstechniken aus größerer Entfernung zu erlernen. 2003 wurde er nach einem Zwischenfall am Persischen Golf entlassen. Der Seelenklempner, der ihn beurteilen sollte, beschied: Leading Seaman Vyner besitzt einen scharfen Verstand, doch ist er manipulativ, lügt zwanghaft und hat einen ausgeprägten Sinn für Grausamkeit bewiesen.
Na ja, wie Vyner an diesem Morgen in sein Tagebuch geschrieben hatte: Kein Komet hat Funken von Freude und Licht über mich verstreut. Das hundsgewöhnliche Leben war ihm auf den Fersen, doch er strebte nach den höheren Bewusstseinsebenen der Weisheit.
Wie zum Beispiel jetzt, als es darum ging, eine Frau vor den Augen ihres Kindes niederzuschießen – denn auf dem Beifahrersitz saß ein Kind, das eigentlich in der Schule hätte sein müssen, wo doch Dienstag war. Das Kind hatte keine Angst, sondern war nur neugierig, doch die Frau schon. Sie hatte die Waffe bemerkt.
Sie reckte ihm ihre Hände entgegen und flehte ihn an: »Nein, bitte nicht, das war nur ein Scherz, ich wollte sie niemandem zeigen, ich wollte kein Geld.« Dann schlug sie die Autotür zu und wich vor Vyner zurück, sagte noch ein paar andere Dinge wie: »Ich bin die falsche Person« und »Was hab ich Ihnen denn getan?« und »Tun Sie meiner Tochter nichts«, aber Vyner hatte einen Job zu erledigen.
Er ging weiter, und als die Frau kehrtmachte und zur Frontseite des Volvo eilte, änderte Vyner sein Schritttempo nicht, sondern hob die Pistole und zielte. Sie umrundete die Motorhaube des Wagens, lief geduckt an der anderen Seite zum Wagenende, also machte Vyner geduldig kehrt und ging ihr entgegen. Ein Katz-und-Maus-Spiel, die Frau wimmerte, Vyner achtete auf seinen ruhigen Puls und langsamen Atem. Ein Eintrag in seinem Tagebuch: Heute standen mir die Engel zur Seite.
Nathan Gent, der hinter dem Steuer des Commodore saß, überkam die Wahrheit wie ein Schock. Er saß offenmäulig da, der Commodore schüttelte sich unrhythmisch auf vielleicht vier von sechs Zylindern, und Gent erkannte, dass er für einen Mord angeheuert worden war. Er schloss den Mund, seine fauligen Zähne schlugen aufeinander, und er gab ein wenig Gas, bis er den Motor gleichmäßiger laufen hörte. »Ein kleines Geschäft«, hatte Vyner gesagt. »Dauert nicht lange.« Vyner – hart, dürr und agil wie eine Peitsche – war schon immer ein harter Hund gewesen, aber Gent hatte nicht gewusst, dass er Leute umgebracht hatte, mal abgesehen von vielleicht ein paar irakischen Kameltreibern. Gent spürte, wie er langsam die Nerven verlor. Er schaute zu, kniff den Hintern zusammen, und sah, wie Vyner und die Frau von beiden Seiten des Wagens gleichzeitig die hintere Stoßstange des Volvo erreichten. Die Frau zuckte zusammen und rannte geduckt den Weg zurück. Vyner hatte alle Zeit der Welt und folgte ihr.
Dann verließ die Frau ihre Deckung. Sie wusste, das Ende war gekommen, und sie hatte vor, Vyner von dem Kind fortzulocken, das im Wagen gefangen war – zumindest hoffte Gent das, und eine alte Verbitterung überkam ihn, als er an seine eigene Mutter denken musste, die ihm zuliebe nie auch nur das kleinste bisschen geopfert hatte. Er sah, wie die Frau vom Carport weg zu einem kleinen Gartenschuppen huschte, einem Durcheinander aus Rechen, Schaufeln, Zaunpfählen, Rasenkantenschneider und Rasenmäher – in Nathan Gents Augen sah er wie ein Victa aus, er sollte mit dem Pick-up eines Kumpels noch mal herkommen, den Kram aufladen und den Mäher für fünfzig Mäuse im Hinterzimmer des Fiddler’s Creek Pub verscherbeln.
Na, besser nicht. Tatort, mit Polizeiband abgesperrt, die Bullen würden bestimmt wissen wollen, was er auf dem Grundstück zu suchen hatte.
Aber Mord. Verdammt, Mittäter bei einem Mord. Um sich zu beruhigen, rieb sich Gent den Stumpf, wo früher sein rechter Ringfinger gewesen war. Eine Schiffskette irgendwo im Persischen Golf hatte ihn abgerissen.
Dann fiel ihm wieder ein, was Vyner wegen des Diebstahls eines Wagens gesagt hatte, und insgeheim dankte er Gott für den Nebel. Und für den Ort: Das Haus lag unter Straßenniveau, die Straße selbst schlängelte sich an einem Kamm entlang, und das Gelände fiel zu beiden Seiten steil ab. Vorbeifahrende mussten schon anhalten, aussteigen und sich an das oberste Ende der Zufahrt stellen, um zu Wendeplatz und Carport hinunterschauen und Augenzeuge werden zu können. Nachbarn gab es auch keine. Aber verdammt noch mal, warum hatte er keinen Wagen geklaut, wie Vyner gesagt hatte?
Gent schaute zu, wie Vyner auf die Frau, die sich nun neben die Scheune kauerte, zielte und zweimal schoss. Es knallte nur leise, gedämpft von Nebel und Schalldämpfer. Dann kehrte Vyner eilig zum Wagen der Frau zurück.
Das Kind wusste, was los war. Ein kleines Mädchen, vielleicht sechs oder sieben, sprang in seinem roten Parka aus dem Wagen, rannte los, die Locken hüpften, Vyner verfolgte sie mit der Pistole. Gent sah, wie er schoss und sie verfehlte. Sie rannte auf den Commodore zu, Gent dachte: Nein, verpiss dich, ich kann dir nicht helfen. Er streckte die Hand aus dem Fenster und scheuchte sie davon. Sie starrte ihn lange mit offenem Mund an und rannte dann in Richtung einer Reihe von Pappeln davon, die am Rande des Gartens standen. Gent sah, wie Vyner zielte und abdrückte. Nichts. Vyner glotzte die Waffe angewidert an und kehrte dann auf der Suche nach den ausgeworfenen Patronenhülsen zum Schuppen zurück. Einen Augenblick später stieg er in den Commodore und brüllte: »Na los.«
Ich muss das Arschloch bei Laune halten, dachte Vyner. Gent hatte zu lange da rumgesessen – aber eigentlich waren es höchstens zwei Minuten gewesen. Er hoffte, dass sich der Typ nicht als Risiko herausstellte. Gent war erst Anfang zwanzig, aber er ging vor lauter Bier und Drogen schnell vor die Hunde. Ein aufgeschwemmter Kerl mit Hängeschultern, der behauptete, jede Seitenstraße auf der Halbinsel zu kennen – und wahrscheinlich auch jeden Hinterhof und jede Hintertür, dachte Vyner.
Gent kriegte fünftausend Dollar für seinen Job und wusste, was ihn erwartete, wenn er die Schnauze nicht hielt.
Sie kamen ans obere Ende der Zufahrt, Vyner zog das Magazin aus seiner Browning und verfluchte die Waffe. Man sollte doch annehmen, dass die Navy zuverlässige Handfeuerwaffen besitzt, schon aus Gründen der Landesverteidigung und all dem. Nicht, dass er vorgehabt hätte, diese Waffe zu behalten und als Beweisstück mit sich herumzuschleppen. Er würde das tun, was er immer getan hatte, er würde sie in einen Betonblock eingießen und ihn auf den Müllplatz einer Baustelle werfen. In dem Wandsafe in seiner Wohnung in Melbourne lagen noch zwei Browning-Pistolen von der Navy, die würde er sich heute Abend erst einmal genau anschauen und reinigen. Er wollte nicht, dass sie wieder versagten, vor allem nicht, wenn er sich selbst verteidigen musste. Beschissene Waffe. Unglücklicherweise war es zu spät, sich seine fünfhundert Dollar pro Stück zurückzuholen, der Waffenmeister bei der Navy, der sie ihm verkauft hatte, war nämlich tot. Hatte sich eine Kugel durch den Kopf gejagt.
Vyner schraubte den Schalldämpfer ab – wenigstens der hatte funktioniert – und ließ ihn in die Innentasche seiner Jacke gleiten, dann stopfte er die Browning in eine andere Tasche, der Abzugshahn verfing sich im Stoff und riss ein Loch. Beschissenes nutzloses Teil. Vyner hatte etwas Ausgefeilteres haben wollen, eine Glock Automatik oder einen kurzläufigen Steyr-Karabiner und ein hochmodernes Nachtzielgerät, aber alles, was der Kerl von der Navy ihm verkaufen wollte, waren drei alte Brownings aus dem Lager, die zum Kadettentraining verwendet und nun nach und nach ausgemustert wurden. »Die kann ich im Papierkram untergehen lassen«, hatte sein Kumpel gesagt, »aber der neue Kram, keine Chance.«
Vyner zog die Handschuhe aus und klappte die Sonnenblende runter, um sich im Schminkspiegel zu betrachten. Er hatte nichts zwischen den Zähnen hängen. Sein altvertrautes Gesicht sah ihn an. Er steckte seine Kappe ein und strich sich die Haare nach hinten.
»Verdammte Scheiße!«, brüllte Gent und trat hart auf die Bremse, als der Commodore am oberen Ende der Zufahrt an die Straße kam. Der Wagen kam abrupt zum Halt, als plötzlich ein Taxi aus dem Nebel herangeschossen kam und im Bruchteil einer Sekunde wieder darin verschwand.
3
Normalerweise begann Hal Challis den Tag mit einem Spaziergang in der Nähe seines Hauses, doch diesmal wollte er Raymond Lowry unvorbereitet erwischen und ihn nach den gestohlenen Gewehren befragen. Also zog er um halb sieben seinen Mantel an, nahm Brieftasche und Laptop und setzte sich hinter das Lenkrad seines Triumph. Fünf Minuten später versuchte er immer noch, ihn in Gang zu kriegen. Schließlich sprang der Motor an, hustete ein paarmal träge qualmend, und Challis notierte sich im Geiste, den Wagen bei der Werkstatt anzumelden, um ihn durchsehen und neu einstellen zu lassen.
Er fuhr in Richtung Waterloo ostwärts durch Farmland. Die Nebelschleier, die von der See kamen, umstrichen ihn, hüllten die Eukalyptusbäume und Kiefern am Straßenrand ein und ließen das Universum schrumpfen. Nebelschleier, so als würde die Westernport Bay, die nun verschwunden, sonst aber als Streifen silbrigen Wassers in der Entfernung zu sehen war, Trauer tragen. Challis nahm an, dass dem wirklich so war. Letzte Nacht war es plötzlich bitterkalt geworden, die Kälte war in Kontakt mit dem Salzwasser gekommen, das noch immer warm war vom milden Herbst, und das Ergebnis war nun dieser dichte, alles verwandelnde Nebel. Challis wusste aus Erfahrung, dass er sich stundenlang über der Halbinsel halten konnte und eine Gefährdung für die Schifffahrt, die Schulbusse, Taxis und Pendler darstellte. Und für die Polizei. Challis war bei der Mordkommission, doch heute bedauerte er die Kollegen von der Verkehrspolizei. Irre überholten ihn mit über hundert Sachen und wurden wieder vom Nebel verschluckt. Sie waren sauer auf ihn, den Penner in seinem alten Triumph. Alt, schlechte Kompression, und die Heizung funktionierte auch nicht.
Bald kam Challis zu einem Streifen offenen Landes neben einem Mangrovengürtel und schließlich zu den Reifenverkäufern, Tankstellen und Gebrauchtwagenhändlern, die die Außenbezirke von Waterloo sprenkelten. Neue, billig gebaute Häuser drängten sich zusammen und duckten sich kläglich unter dem Nebel. In den neuen Siedlungen war die Arbeitslosigkeit hoch, in der High Street standen Geschäfte leer, die Sozialarbeiter hatten jede Menge zu tun. Doch auf einem kleinen Hügel, von dem aus man die Stadt überblicken konnte, lag ein umzäuntes Viertel von millionenteuren Häusern mit Blick über die Westernport Bay.
Waterloo war die größte Gemeinde auf dieser Seite der Halbinsel und wurde auf einer Seite von Farmland umschlossen und auf der anderen von Mangrovensümpfen und der Bucht. Drei Supermärkte, vier Banken, eine weiterführende Schule, ein paar staatliche und katholische Grundschulen, Leichtindustrie, eine Raffinerie auf der anderen Seite des Yachtclubs, eine Bibliothek, ein Freibad, eine Hand voll Pubs, vier Billigramschläden, mehrere leer stehende Ladenzeilen. Eine Stadt mit Problemen. Aber sie wuchs, und sie lag keine eineinviertel Stunden Fahrzeit von Melbourne entfernt.
Challis bremste an einem Kreisverkehr und fuhr dann die High Street entlang zur Küste, wo er auf dem Weg zum Boardwalk, der sich durch die Mangroven schlängelte, am Schwimmzentrum und am Yachtclub vorbeikam. Dort stellte er den Wagen ab, stieg aus und ging eine Stunde lang spazieren. Die ausgetretenen Kiefernbohlen dämpften seine Schritte und ließen sie hohl klingen. Unter ihm lief das Gezeitenwasser ab, ein- oder zweimal spürte er einen starken Windstoß und hörte eine eilig warnende Klingel, und ein Radfahrer schoss vorbei, der viel zu schnell fuhr für einen schmalen Pfad bei diesem trübgrauen Licht.
Halb acht. Challis blieb stehen, beobachtete einen schwarzen Schwan und dachte an seine tote Frau. Sie hatte sein Bedürfnis, früh aufzustehen und spazieren zu gehen, allein spazieren zu gehen, nie verstanden. Vielleicht war dieser grundsätzliche Unterschied zwischen ihnen schon der Anfang vom Ende gewesen. Bei seinen einsamen Gängen konzentrierte er sich: Er konnte dabei Probleme lösen, Strategien planen, Berichte entwerfen, lebte dabei seine stärksten Emotionen aus. Andere Menschen – auch seine Frau – wollten sich beim Gehen unterhalten oder lieber zwischendurch was trinken, aber Challis ging, um zu denken, um sein Blut in Bewegung zu bringen und um Innenschau zu halten.
Seltsam, dass er immer noch im Geiste mit ihr redete. Seltsam, dass sie immer noch die Person war, der er Streitigkeiten und Informationen weitergab, so als sei sie immer noch wichtiger als jeder andere Mensch, so als habe sie nicht versucht, ihn umzubringen, so als habe ihr eigener Tod das alles nicht beendet.
7 Uhr 45. Er löste sich vom Anblick des Schwans, kehrte zum Auto zurück und fuhr zur High Street. Die Frühaufsteher in der Bäckerei, dem Café und dem Zeitungsladen schlossen ihre Türen auf, fegten den Bürgersteig, bestückten ihre Registrierkassen. Challis betrat das Café Laconic, kaufte sich einen Kaffee und ein Croissant zum Mitnehmen, setzte sich in seinen Wagen, sah sich um, wartete, trank und aß.
Fünf Minuten vor acht tauchte Lowry auf. Er kam vom Parkplatz hinter der Ladenzeile. Der Mann, ein großer, stämmiger Kerl, der gern viel Zähne zeigte, wenn er redete, trug Jeans, einen Parka und eine Wollmütze. Challis schaute zu, wie Lowry in den Taschen nach den Schlüsseln kramte und die Tür zu seinem Geschäft aufschloss. Alle Fenster und die Tür waren mit Anzeigen für Handys und Telefontarife zugepflastert. »Waterloo Mobile World« hieß der Laden.
Challis ließ Lowry ein paar Minuten Zeit, dann betrat er das Geschäft und löste dabei einen Summer aus. »Wir öffnen erst um …«, hob Lowry an, doch dann hielt ihn etwas vom Weitersprechen ab, eine gewisse Stille und Konzentriertheit an Challis.
»Was wollen Sie?«
»Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten«, antwortete Challis.
Raymond Lowry ließ an Mund und Schultern Zorn und Verwirrung erkennen. »Worüber?«
»Die gerichtliche Untersuchung der Todesursache ist am Donnerstag«, sagte Challis. »Ich schließe gerade meinen Bericht für den Coroner ab.«
»Ich bin sofort wieder da«, sagte Lowry resigniert. Er schloss die Ladentür ab und bat Challis dann mit einer Geste, ihm in den voll gestopften hinteren Raum zu folgen, wo er sich sofort hinter einen Schreibtisch setzte und Eintragungen in sein Hauptbuch vornahm. In dem kleinen Raum war es stickig. Ein Ventilator pustete glühend heiße Luft an Challis’ Knöchel.
Schließlich blickte Lowry auf. »Tut mir leid. Bei diesem Geschäft gibts ’ne Menge Papierkram zu erledigen.«
Challis besah sich die grauen Stahlregale, die mit Handyschachteln und Zubehör voll gestopft waren. »Läuft denn das Geschäft?«
»Kann nicht klagen.«
»Besser als das Leben in der Navy?«
Lowry zuckte mit den Schultern.
Die Marinebasis lag ein paar Kilometer entfernt. Lowry hatte dort eine Weile gedient, eine Frau aus der Gegend kennen gelernt und schließlich den Dienst quittiert. »Da kann man keine Kinder großziehen«, sagte er, »andauernd wird man versetzt. Und mit dem hier komm ich ganz gut über die Runden.«
Lowry, der solide Geschäftsmann und Familienvater. Challis erwiderte nichts darauf, sondern wartete ab, ein alter Trick von ihm.
»Hören Sie«, sagte Lowry mit einem entwaffnenden Lächeln, bei dem er seine großen prächtigen Zähne bleckte, »was soll ich Ihnen noch sagen? Ich kannte den Typen kaum.«
An einem Samstagabend im Mai war ein Waffenmeister von der Marinebasis, der bis oben hin voll war mit einer Mischung aus Alkohol und Drogen, aus dem Fiddler’s Creek geworfen worden. Zwei Stunden später war er unbemerkt mit einer Pistole aus der Waffenkammer wiedergekommen, hatte einen Türsteher erschossen und war dann zum Stützpunkt zurückgekehrt. Noch etwas später hatte er sich mit derselben Waffe getötet. Das hatte weit reichende Folgen: Achtzehn Kadetten waren entlassen worden, nachdem ein Drogentest positiv ausgefallen war, und bei der Waffenkammer wurde Inventur gemacht. Bei einer ersten Kontrolle stellte sich heraus, dass ein paar Pistolen fehlten, alte Bestände, die hatten ausgemustert werden sollen. Challis wollte dringend wissen, wo diese Waffen nun waren.
»Sie kannten ihn kaum? Da habe ich aber was anderes gehört«, log Challis. »Ich habe gehört, dass Sie beide gute Kumpel waren. Haben Sie den Kontakt nach draußen hergestellt? Er hat den Papierkram gefälscht, um den Diebstahl von mehreren Waffen zu kaschieren, und Sie haben sie verscherbelt?«
»Bestimmt nicht. Keine Waffen.«
Mit anderen Worten, ja, er war vergangenes Jahr dabei erwischt worden, wie er mit gestohlener Ware hehlte, aber niemals würde er so etwas mit gestohlenen Handfeuerwaffen tun. »Und wer hat dann für ihn mit den Waffen gehandelt?«
Lowry breitete die Arme aus. »Woher zum Teufel soll ich das wissen?«
»Wie geht es Ihrer Frau?«, fragte Challis.
Lowry stutzte über diese Richtungsänderung. Er hatte kurz geschorenes Haar und fuhr sich nun mit einer Hand über die Stoppeln, so als wolle er seine Gedanken ordnen. »Wir haben uns getrennt.«
Challis wusste das schon aus Lowrys Akte. Mrs. Lowry hatte letztes Jahr eine einstweilige Verfügung gegen ihren Gatten erwirkt, hatte sich später von ihm scheiden lassen und das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekommen. Lowry hatte sich einer Organisation namens Fathers First angeschlossen und sich allseits unbeliebt gemacht. »Tut mir leid, das zu hören.«
Lowry wurde rot. »Hören Sie, bin ich vielleicht verhaftet? Wollen Sie Anklage gegen mich erheben, oder was?«
Challis lächelte humorlos. »Wir werden sehen«, sagte er. Dann ging er zu seinem Wagen zurück und hoffte inständig, die Karre würde ihn nicht blamieren, sondern anspringen, während Lowry ihn durch die Scheibe seines Ladens beobachtete.
Das Polizeirevier hatte zwei Stockwerke. Büros, Zellen, Kantine und Befragungszimmer im Erdgeschoss, Besprechungszimmer, die Büros der CIU, der Crime Investigation Unit, und eine kleine Turnhalle im ersten Stock.
Challis betrat das Revier durch die Hintertür und ging zu seinem Postfach im Flur hinter dem Empfang. Er griff hinein, zog einen Stapel Memos heraus und blätterte ihn durch.
Den Großteil davon stopfte er in den überquellenden Papierkorb in der Nähe, doch beim Anblick eines Memos von Superintendent McQuarrie an alle höheren Dienstgrade hielt er zornig inne: Der Assistant Commissioner wird dieses Jahr ein paar schwierige Probleme zu klären haben. Es wird von Ihnen erwartet, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. Die finanziell kritische Lage in der Region in den Griff zu bekommen, stellt sich als überragende Aufgabe heraus. Jede Bestellung, jede einzelne Geldausgabe wird einer kritischen Überprüfung unterzogen.
Challis hatte solche Budgetkürzungen schon mehrmals erlebt. Üblicherweise schoss dann der Papierverbrauch in die Höhe, die Flut an Dienstanweisungen nahm weiter zu, und die Gelder für Taschenlampenbatterien, Dolmetscher, Kugelschreiber, Reinigungsutensilien oder Anrufe per Handy versiegten. Noch ernster war die Anordnung, dass jeder Einheit die Nutzung der Dienste einer anderen Einheit in Rechnung gestellt werden konnte, der Zugang zu Telefonaufzeichnungen von Opfern und Verdächtigen war eingeschränkt worden, und das Budget für die Telefonüberwachung war äußerst begrenzt. Ausschusssitzungen brachten zur Verbrechensbekämpfung gar nichts, so sah Challis das.
Er machte kehrt und ging zur Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte. »Hal«, unterbrach ihn eine Stimme.
Challis drehte sich um. Senior Sergeant Kellock – ein Ochse von Mann und der Dienst habende Revierleiter – winkte ihn zu sich. Challis nickte zur Begrüßung und betrat Kellocks Büro. »Das hier ist für Sie abgegeben worden«, sagte Kellock.
Es handelte sich um ein in braunes Papier gewickeltes Paket von der Größe einer Kiste Wein. Sehr gemischte Gefühle überkamen Challis, als er den Absender las: die Eltern seiner toten Frau. Er mochte sie, sie mochten ihn, aber er hatte versucht, sich von ihnen ein wenig zu distanzieren. »Danke«, murmelte er.
»Kollege, wir sind kein Postschalter«, sagte Kellock.
Challis wusste, dass das Paket beim Wachhabenden gelandet war. Abgesehen von reiner Neugier gab es keinen Grund, warum Kellock Anstoß daran nahm. Zutiefst erzürnt nahm Challis die Kiste und trug sie in den ersten Stock hinauf.
Die Crime Investigation Unit war ein Großraumbüro voller Schreibtische, Aktenschränke, Telefone, Wandkarten und Computer. CIU Sergeant Ellen Destry hatte einen halben Tag frei. Scobie Sutton, einer der Detective Constables, hatte diesen Vormittag im Gericht zu tun. Ein weiterer DC war auf einem einwöchigen Intensivkurs in der City, und der vierte war im Urlaub. Challis’ Tag sollte heute wohl ruhig werden.
Challis’ Arbeitsbereich war ein abgetrenntes Kämmerchen in einer Ecke des Großraumbüros, von wo aus er einen wenig berauschenden Blick auf den Parkplatz hinter dem Gebäude hatte. Dort ließ er das Paket zu Boden plumpsen, schaltete den Dienstcomputer ein und schaute nach seiner E-Mail. Es gab nur eine Nachricht von Superintendent McQuarrie, der ihn darum bat, einen Bericht über die regionale Polizeiarbeit zu verfassen. Challis, in dessen Hirn leise Wut brannte, druckte die E-Mail aus und versuchte, in den Anweisungen einen Sinn zu entdecken. Gab es denn überhaupt einen erkennbaren Unterschied zwischen »Auftrag«, »Ergebnisorientierung« und »Zielsetzung«? Und was war aus der Polizeiarbeit geworden? Nur Wörter, Wörter ohne Bedeutung.
Challis hatte jetzt schon die Schnauze voll. Er kochte sich einen Kaffee und streckte die Hand nach dem staubigen Radio aus, das auf dem Regal voller Gesetzestexte, Polizeihandbücher und verschlissener Aktendeckel stand. Als die Neun-Uhr-Nachrichten im Hintergrund murmelten, schaltete Challis seinen Laptop ein, zog die Notizen aus der Tasche und brütete über dem Bericht für den Coroner, in dem es um den Schusswaffengebrauch bei der Navy ging.
Aber eigentlich schob er nur das Unausweichliche vor sich her. Er hob das Paket vom Boden, riss das Papier ab und fand darin eine zugeklebte Pappschachtel mit einer kurzen Mitteilung, die auf dem Deckel klebte.
Liebster Hal,
diese Sachen von Angie sind vor ein paar Tagen bei uns eingetroffen. Offenbar sind sie im Gefängnis aufbewahrt und dort vergessen worden. Wir glauben, dass du die Sachen haben solltest. Verfahre damit nach deinem Gutdünken. Pass auf dich auf, lieber Hal. Wir denken oft an dich.
Alles Liebe,
Bob und Marg
Challis öffnete den Deckel und besah sich die traurigen Reste aus dem Leben seiner Frau: Taschenbücher, eine Bürste mit Kamm, Make-up, ein Taschenfotoalbum, eine Armbanduhr, die Kleidung, die sie bei ihrer Verhaftung getragen hatte. Er schluckte und wollte weinen. Als die Gewohnheiten und Anforderungen seines Alltags sich wieder meldeten, stopfte er die Schachtel samt Inhalt in den Papierkorb.
Es war noch zu früh, um zu erkennen, ob diese Geste etwas zu bedeuten hatte.
Challis wandte sich wieder seinem Bericht zu. Das Telefon klingelte. Superintendent McQuarrie war am anderen Ende, aber nicht der elegante Golfer und Arschkriecher der Handelskammer, sondern ein gebrochener Mann.
4
Dem DC zufolge, der Challis am Tatort des Mordes erwartete, hatte die Notrufzentrale den Fall an die Polizei von Rosebud abgegeben. Dort hatte man angenommen, dass es sich um einen üblen Scherz handelte, um ein Kind, das mit dem Handy der Mutter herumspielte, und schließlich zwei Uniformierte in einem Streifenwagen hingeschickt. Die Polizisten hatten einen kurzen Blick auf den Tatort geworfen, ihn abgesperrt und die Kriminalpolizisten in Rosebud informiert. Dann hatte das Kind, das ganz vom Blut der Mutter verschmiert, aber erstaunlich gefasst war, erklärt, dass ihr Großvater ein Polizist sei, ein wichtiger Polizist, Superintendent McQuarrie.
»Was sollte ich machen«, sagte der DC aus Rosebud, »wir mussten ihn doch anrufen.«
Challis nickte. Er nannte dem uniformierten Constable, der am oberen Ende der Zufahrt die Anwesenheitsliste führte, seinen Namen und blieb einen Augenblick stehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Oben die asphaltierte Straße, an deren grasigen Rändern verschiedene Polizeifahrzeuge, darunter sein eigener Wagen, abgestellt waren. Dazu noch der Leichenwagen des Bestattungsinstitutes, das von der Regierung damit beauftragt war, verdächtige Todesfälle ins Leichenschauhaus zu bringen. Absterbende Eukalyptusbäume, Pittosporen, Kiefern und Farne. Etwas weiter vorn eine steile Schotterzufahrt hinunter zu einem kleinen Schindelhaus, wo ein silberfarbener Volvo Kombi mit offenen Türen stand.
Dort unten befanden sich ebenfalls eine Reihe von Männern und Frauen in weißen oder blauen Einmaloveralls und Überschuhen. Sie standen neben oder unter einem aufblasbaren Zelt, das die Leiche und die unmittelbare Umgebung vor Wind und Regen schützen sollte. Ein Fotograf machte Bilder und Videoaufnahmen von der Leiche und von ihrer Position im Vergleich zum Wagen, den Beeten, dem Haus und dem kleinen Aluminiumschuppen. Die Dienst habende Rechtsmedizinerin Freya Berg kniete neben der Leiche. Challis konnte McQuarrie nirgendwo entdecken.
Dann ging er die Einfahrt hinunter, und der Detective aus Rosebud, ein Mann mit schiefer Nase und verknittertem grauen Anzug begleitete ihn. »Wo ist der Superintendent?«
»Hat das Kind mit nach Hause genommen.«
»Verdammt«, entfuhr es Challis. Einerseits wusste er, dass das Kind nun Zuspruch brauchte; andererseits wollte er gern ihre Version der Geschichte hören, bevor sie sie zu vielen anderen erzählt hatte. McQuarrie war ein erfahrener Polizeibeamter, aber er war auch der Großvater des Kindes. Bestimmt wollte er sie schützen, bestimmt wollte er ihr Fragen stellen, und womöglich redete er ihr ein, was sie angeblich gesehen hatte.
»Sir?«, fragte der Detective.
Challis lächelte den Mann an. Er wollte nicht, dass der andere glaubte, er würde die Gefühle des trauernden Kindes mit Füßen treten. »Ich hatte gehofft, ihn hier zu erwischen.«
»Er möchte Sie am späten Vormittag bei sich zu Hause sprechen.«
Ach herrje, dachte Challis und sah auf die Uhr. Er musste sofort mit McQuarries Enkelin sprechen, nicht später. Er begrüßte ein paar Bekannte von der Spurensicherung und schnauzte dann scharf einen uniformierten Constable an, der sich einen Kaugummi in den Mund geschoben hatte und das zusammengeknüllte Papier unter einen Strauch warf. Der DC aus Rosebud eilte dorthin und bellte: »Sie Idiot, und wenn wir das nun als Beweisstück mitgenommen hätten? Heben Sie das auf.«
Als er zurückkehrte, fragte ihn Challis: »Hat das Kind irgendetwas gesagt?«
»Das Kind heißt Georgia«, antwortete der Detective mit leichtem Tadel in der Stimme. »Sie sagte, es seien zwei Männer in einem alten weißen Auto mit einer gelben Tür gewesen. Der eine habe ihre Mutter erschossen, der andere sei im Wagen sitzen geblieben.«
»Und was haben die beiden hier gemacht? Warum war Georgia nicht in der Schule?«
Es war klamm, der morgendliche Nebel vom Meer reichte bis weit ins Inland. Der DC versuchte, sich noch tiefer in seinen Mantel zu ducken, sein Gesicht war vor Kälte schon ganz rosig, und sein kahl werdender Kopf gab viel Wärme an die Luft ab. »Es ist Lehrplanbesprechung, also schulfrei, deshalb verbrachte sie den Tag mit ihrer Mutter. Ich konnte nicht viel mehr aus ihr herausbekommen, wollte sie auch nicht drängen. Sie wollte sowieso erst mit mir reden, als die Uniformierten ihr bestätigten, dass ich Polizist bin. Und dann tauchte McQuarrie auf.«
Ich nehme lieber Ellen Destry mit zu der Befragung, dachte Challis. »Und sie hat vom Handy ihrer Mutter aus den Notruf angerufen?«
»Ja. Das Handy haben wir im Wagen gefunden«, sagte der Beamte.
»Und warum hat ihr Vater sie nicht abgeholt?«
Der Beamte sah in seine Notizen. »Robert McQuarrie … wohnt mit dem Opfer und ihrer gemeinsamen Tochter in Mount Eliza … ist heute geschäftlich in Sydney. Ist auf dem Heimflug.«
»Also war er nicht der Täter.«
»Er hätte jemanden anheuern können.«
»Auch wieder wahr.«
Die Statistik besagte, dass neun von zehn Gewaltverbrechen – Mord, Totschlag – von jemandem begangen werden, den das Opfer kannte, und in fünf von zehn Fällen von einem Angehörigen ersten Grades. Challis setzte bei seinen Untersuchungen stets dort an. »Mein herzliches Beileid«, sagte er zu dem Mann eines Mordopfers, gleichzeitig aber betrachtete er ihn eingehend und suchte nach allem, was dessen Gesicht und Augen in diesem Augenblick verrieten, und nach allem, wodurch er dessen intimes Leben enthüllen konnte – Kontoauszüge, Briefe, Kreditkartenabrechnungen. Gelegentlich hatte er sogar schon mit sanfter Stimme zu Ehemännern, Frauen, Liebhabern, Freundinnen gesagt: »Verzeihen Sie mir, aber Sie sind mein Hauptverdächtiger. Ich kann erst andernorts suchen, wenn ich Sie von der Liste der Verdächtigen streichen kann.«
Challis sah zu dem kleinen Haus hinüber. »Ist jemand zu Hause?«
»Nein.«
»Wissen wir, wer dort wohnt?«
Der DC sah wieder in seine Notizen. »Eine Frau namens Joy Humphreys, so die Streife.«
»Hat Georgia gesagt, warum sie hierher gefahren sind?«
»Nein, nur dass sie heute keine Schule hatte und die Kinderbetreuung ausgefallen ist, deshalb hat sie den Tag mit ihrer Mutter verbracht.«
»Wissen wir, was die Mutter macht?«
»Das hier habe ich in ihrer Brieftasche gefunden.«
Eine kleine geprägte Visitenkarte, darauf fett der Name Janine McQuarrie, darunter kursiv »Bayside Counselling Services« und die Worte »Mediation, Konfliktbewältigung, Erziehungsfragen, Stressbewältigung, Übungen zu Selbstwert und Durchsetzungsvermögen, psychologische Betreuung«.
»Eine Psychologin? Hat sie einen Klienten besucht?«
»Keine Ahnung.«
»Weitere Zeugen?«
»Wir haben Leute losgeschickt, die an alle Türen klopfen. Bisher hat sich noch kein Zeuge gemeldet.«
Challis besah sich das kleine Haus. Es wirkte verwohnt und altmodisch, so als würde dort eine ältere Person leben, die jede Hoffnung aufgegeben oder keine Kraft mehr hatte, das Haus zu pflegen.
»Vielleicht ist man ihnen gefolgt«, sagte Challis, »oder es handelt sich um einen Fall von falscher Person am falschen Ort. Vielleicht könnten Sie damit anfangen, diese Joy Humphreys ausfindig zu machen.«
Der DC aus Rosebud schüttelte selbstzufrieden den Kopf. »Geht nicht. Der Superintendent meinte, er würde Ihnen den Fall übergeben, nach Waterloo. Er hat mir nur aufgetragen, so lange hier zu bleiben, bis Sie eintreffen.« Er hielt inne. »Hab den Artikel im Progress letzte Woche gelesen«, fuhr er mit einem leichten Hauch von kumpelhafter Neugier fort.
Challis machte ein mürrisches Gesicht. Seine Beziehung zu Tessa Kane, der Herausgeberin des Progress, war Vergangenheit. Sie waren wieder bei dem Punkt unbehaglicher Bekanntschaft angekommen, doch seit ihrem Artikel über die Swingerpartys in der Ausgabe der letzten Woche hatte Challis jede Menge süffisantes Lächeln und Augenzwinkern zu erdulden gehabt. Die Leute schienen irgendwie davon auszugehen, dass er sie ständig auf irgendwelche Orgien begleitet hätte und das immer noch tat. Er sah dem DC aus Rosebud so lange fest in die Augen, bis der Mann peinlich berührt den Blick senkte.
»Na dann, viel Glück.«
Challis verabschiedete sich mit einem säuerlichen Nicken von ihm. In diesem Augenblick verkündete Freya Berg, dass sie die Leiche freigeben wollte, und Challis ging zu ihr hinüber. »Na, was gibts denn?«
Das war ein stehender Witz zwischen ihnen beiden. In einer dieser amerikanischen Krimiserien, die sie beide so verachteten, schien der Text fast vollständig daraus zu bestehen, dass der Hauptermittler fragte: »Na, was gibts denn?« und dann sagte, »Halten Sie mich auf dem Laufenden.«
Freya wirkte gelassen, und schaute so, als amüsiere sie sich ununterbrochen. »Gut genährte Frau, blah, blah, blah, ein Schuss in den Rücken, einer in den Hinterkopf, noch keine zwei Stunden tot.«
Man hatte die Tote mit dem Gesicht nach unten gefunden, doch während der Untersuchung hatte Freya die Leiche umgedreht, und nun lag die Frau tot und schlaff mit schmerzverzerrtem Gesicht da. Hosenbeine und Knie waren feucht, das cremefarbene Top an der Taille verdreht, die offene Jacke lehmverschmiert.
Challis sah zu den Spurenfahndern hinüber. »Patronenhülsen?«
»Nichts, Hal.«
Er wandte sich wieder zu Freya. »Austrittswunden?«
Sie schüttelte den Kopf. »Die Kugeln stecken noch.«
»Wann können Sie die Autopsie vornehmen?«
»Im Laufe des Nachmittags.«
»Halten Sie mich auf dem Laufenden«, witzelte Challis.
Auf dem Rückweg zu seinem Wagen schaute Challis auf sein Handy. Wie zu erwarten, hatte er mehrere Anrufe von Reportern erhalten, darunter auch von Tessa Kane. Er seufzte und fühlte sich belagert. In diesem Fall musste mit großem Interesse der Medien gerechnet werden. Und Tessa wollte eine Insiderstory. Challis hatte das Gefühl, ihr das schuldig zu sein, gleichzeitig aber war sie oft recht kritisch gegenüber der Polizei. Der Progress unterschied sich deutlich von all den anderen Kleinstadtwochenblättchen – die zu neunzig Prozent aus Kleinanzeigen bestanden und zu zehn Prozent aus Wohlfühlgeschichtchen über lokale Sportgrößen, über den bellenden Hund, der eine Witwe aus einem brennenden Haus gerettet hatte, und über den Bürgermeister, der einen Baum gepflanzt hatte. Regelmäßig äußerte sich der Progress über lokale Fragen zu sozialer Gerechtigkeit, auch über das Internierungslager in der Nähe von Waterloo, über Armut und Not in den neueren Siedlungen. Es konnte einen nicht überraschen, dass Tessa Kane von vielen verachtet wurde, auch von Superintendent McQuarrie.
Challis grübelte. Ihm war nicht danach, jetzt schon mit ihr zu reden. Vielleicht spukte er in ihren Gedanken herum, lauerte im Unterbewussten, so wie sie in seinem Verstand herumspukte, aber die Tage, als er sie umgehend und ganz automatisch anrief und ihr Einzelheiten einer Story durchgab, waren lange vorbei.
Schließlich führte er zwei Telefonate, eines mit der Bitte um neuere Informationen zu gestohlenen, herrenlosen und ausgebrannten Wagen auf der Halbinsel, ein zweites mit McQuarrie.
»Meine Enkeltochter ist immer noch ganz durcheinander, Inspector«, betonte der Superintendent. »Ich weiß, Sie müssen mit ihr sprechen, solange sie das Geschehene noch lebhaft im Gedächtnis hat, aber sie braucht noch eine Weile, verstehen Sie? Mal sehen, wie sie sich zu Mittag fühlt.«
»In Ordnung, Sir«, sagte Challis.
Jetzt ging es darum herauszufinden, ob es eine Verbindung zwischen dem Opfer und der Frau gab, die im Haus Nummer 283 wohnte. Challis wollte nicht eindringen, also weckte er den Triumph mit viel Mühe zum Leben und fuhr zweihundert Meter bis zum Nachbargrundstück, auf dem ein lang gestrecktes Ziegelhaus mit Dachlichtbändern stand. Eine Frau im Overall schob eine Schubkarre mit Mulch durch den Garten hinterm Haus. Sie hatte ein glattes, jugendlich wirkendes Gesicht und stellte sich als Lisa Welch vor.
»Sie sind heute Morgen schon der zweite Polizist, der bei mir anklopft«, sagte sie argwöhnisch und wischte sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich weiß, es geht um nebenan, aber der andere wollte mir nicht sagen, was los ist. Ich hab sowieso nichts gehört oder gesehen.«
»Das kommt Ihnen vielleicht wie Vergeudung von Dienstzeit vor«, entgegnete Challis, »aber wir würden gern mit der Frau reden, die dort wohnt.«
»Mrs. Humphreys? Joy? Die ist gerade im Krankenhaus.«
Challis sah sie fest an. »Wissen Sie, weswegen?«
»Künstliches Hüftgelenk. Joy ist Ende siebzig.«
Challis dachte darüber nach. Konnte eine ältere Frau das eigentliche Ziel sein? Konnte eine junge Frau mit einer älteren verwechselt werden? »In welchem Krankenhaus?«
»Waterloo.«
Na, wie passend. »Lebt sie allein?«
»Ich glaube, ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben.«
Challis hakte geduldig nach: »Und seither – Besucher, die länger blieben, Untermieter, irgendetwas in der Art?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich bin neu hier in der Gegend, ich weiß nicht, wer kommt und wer geht.«
Challis steckte Notizblock und Stift ein. »Danke, Sie haben mir sehr geholfen.«
Er sah, wie sie schluckte.
Sie wirkte sehr angespannt. »Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ist bei ihr eingebrochen worden?«
Challis zögerte. Auch möglich, dass diese Frau hier das eigentliche Ziel des Angriffs war. Und wenn, würde sie weglaufen, wenn sie erfuhr, was nebenan geschehen war? Statt sie noch einmal aufsuchen zu müssen, sagte Challis: »Mrs. Welch, es hat eine Schießerei gegeben. Eine Frau ist tot. Nicht Mrs. Humphreys«, fügte er hinzu und hob beschwichtigend die Hände. »Eine jüngere Frau.«
»O Gott.«
»Haben Sie irgendwelche Feinde?«