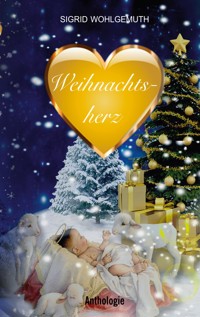6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Seit der Kindheit meidet Ariane Gewässer jeglicher Art. Sie leidet unter Aquaphobie. Dem Rat von Therapeuten, sich der Angst zu stellen, widersetzt sie sich. Auf einer Reise kommt es zu einem Vorfall mit dramatischen Folgen. Sie beschließt: So kann es nicht weitergehen! Nachdem Ariane eine Dokumentation sieht, bei der es um Rückführungen geht, sucht sie eine Spezialistin auf. Die Sitzung bewegt Ariane dazu, auf die griechische Insel Kreta auszuwandern. Dort macht sie sich auf die Suche nach dem Mörder aus ihrem vermeintlichen Vorleben. Spielt die Fantasie ihr einen Streich oder steckt hinter der Phobie ein jahrzehntelang gehütetes Geheimnis?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Widmung
Kreta –
Meine Herzenswärme. Lebenselixier.
Inhaltsverzeichnis
Die Rückführung
Vor sechs Monaten
Zwei Monate vor der Rückführung
Rückkehr ins Alltagsleben
Ariane wandert aus
Kretisches Zuhause
Die Suche nach dem Mörder fängt an
Das Meer aus der Ferne betrachten
Ariane trifft auf Stefan
Vertrauen
Rückführungsarbeiten
Stefans Vergangenheit
Der Zucchini-Zubereitungs-Test
Tatortbegehung
Unglaublich – wahr
Zucchiniernte
Der Rosengarten
Rosenduft voller Harmonie und Frieden
Rückführung
Der Wohnzimmerschrank
Verliebt
Die Gestalt auf dem Gesichtsfelsen
Die Wahrheit über den Rosengarten
Was verbirgt sich hinter der Schranktür?
Überraschender Besuch
Wiedersehen
Die Wahrheit kommt ans Licht
Fragen zum Weg der Heilung
Harmonie und Frieden
Arianes Zucchini Rezepte
Zucchini Omelett
Maisnudeln mit Zucchinisoße
Hackfleisch mit Zucchini überbacken
Zucchini mit Champignons
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Herzlichen Dank für die harmonische Zusammenarbeit.
Über Sigrid Wohlgemuth
Veröffentlichungen
Die Rückführung
»Ariane, das ist Humbug! An so etwas glaubst du doch etwa nicht wirklich, oder?!«, schrie Judith außer sich.
Ich legte den Finger auf die Lippen, bat sie, leiser zu sprechen. Wir befanden uns vor der Praxis von Thessa Schramer, der Spezialistin deutschlandweit für Rückführungen.
»Und warum bist du mitgekommen?«, flüsterte ich.
»Weil ich davon ausging, du würdest eine Psychologin aufsuchen.«
»Davon gibt es genug in Köln, da hätten wir keine zweihundert Kilometer nach Frankfurt fahren müssen. Denkst du, ich würde jede Woche eine solch weite Strecke zurücklegen?«
Judith zog die Schultern hoch. Sie schien perplex, dies konnte ich an ihrem Gesichtsausdruck erkennen.
Ich hatte meine Freundin aus der Schulzeit gebeten, mit mir zu fahren, jedoch verschwiegen, dass es sich um eine Art Hypnose handelte, die mich in mein früheres Leben zurückführen sollte.
»Du gehst da jetzt nicht rein«, sagte sie bestimmt und hielt mich am Ärmel fest.
»Ich muss.« Sanft löste ich mich von ihr, legte die Hand auf die Klinke.
Judith schob mich zur Seite, baute sich vor der Tür auf. »Bitte, tue es nicht. Das ist Scharlatanerie.«
»Es ist meine letzte Chance. Ich wüsste sonst keinen anderen Ausweg aus meinen Angstzuständen. Bitte, lass es mich wenigstens versuchen.«
»Hast du ernsthaft darüber nachgedacht, dass es deine Angstzustände verschlimmern könnte? Wer weiß, was diese Frau dir eintrichtern wird, damit sie weiterhin Geld mit dir verdienen kann.« Sie schob sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich aus einem bunten Band gelöst hatte.
»Ich geh das Risiko ein, mir bleibt keine Wahl.«
»Bist du ganz sicher, Ariane?«
Judiths besorgten Blick würde ich eine Weile nicht vergessen. Ich wusste, sie meinte es gut mit mir. Wir waren seit über drei Jahrzehnten befreundet. Durchlebten alle Höhen und Tiefen unseres Lebens gemeinsam. Ich hatte Judith im Vorfeld nicht erzählen können, was ich vorhatte, und stellte sie vor vollendete Tatsachen. Ein Vertrauensbruch, doch es ging nicht anders, weil ich wusste, dass sie von Esoterik nichts hielt. Allein wollte ich die Rückführung jedoch nicht durchstehen.
»Ich brauche dich, Judith, bitte.«
Sie schluckte trocken und nickte. Dann gab sie die Tür frei.
Stumm drückte ich Judith den Schlüssel in die Hand. Ging schleppend aufs Auto zu. Sie öffnete den Wagen und ich legte mich zusammengekrümmt auf die Rückbank. Seitdem wir die Praxis verlassen hatten, brachte ich kein einziges Wort über die Lippen und vermied den Blickkontakt zu ihr. Ich fühlte mich in einer Art Tunnel, wusste nicht, welche Richtung ich einschlagen sollte, um ans Licht zu gelangen. Würde ich es jemals erreichen?
»Bitte sprich mit mir, was ist passiert?« Judith hatte sich hinters Steuer gesetzt, zu mir gedreht und rüttelte mich am Arm.
Ich konnte nicht reagieren. Gefangen von den Bildern, die ich zu sehen bekommen hatte. Nachdem Judith ein weiteres Mal vergeblich versucht hatte, mich zum Sprechen zu bringen, startete sie den Wagen. Meine Freundin zog die Nase hoch, ich war mir sicher, sie weinte. Doch ich konnte mich nicht um sie kümmern, hatte genug mit mir selbst zu tun. Mit diesem gigantischen Teil in mir, den ich nicht zu fassen wusste.
Zügig kamen wir durch den Nachmittagsverkehr. Ich tat, als würde ich schlafen. Judith sprach mich auf der gesamten Heimfahrt nicht mehr an, drehte das Radio leise. Zuhause angekommen, gab mir Judith den Schlüsselbund zurück. Ein kurzes Aufblicken von mir, dann trat ich ins Haus, zog die Eingangstür hinter mir zu und hinderte sie daran, mir zu folgen.
Im Wohnzimmer ließ ich mich auf den Boden sinken, drückte den Rücken an die Couch, als wäre sie mein einziger Halt.
Judith war offensichtlich ums Haus herumgelaufen und klopfte an die Terrassentür. Presste das Gesicht an die Scheibe.
»Mach bitte auf. Lass uns reden. Du machst mir Angst«, rief sie dem Weinen nahe.
Ich war nicht fähig, mich zu rühren, selbst wenn ich es gewollt hätte. Irgendwann gab Judith auf. Die Dunkelheit hielt Einzug. Ich rollte mich auf dem Teppich zusammen, schlief ein. Wollte fliehen, egal wohin. Hauptsache weg von der Entscheidung, die ich zu treffen hatte. Weit weg.
Vor sechs Monaten
Judith und ich kannten uns seit dem ersten Schuljahr. Freundeten uns schnell an, wurden unzertrennlich. Gemeinsam entschieden wir, den Beruf der Steuerfachgehilfin zu erlernen. Mit vierundzwanzig kauften wir uns in eine Partnerschaft, einer Steuerkanzlei, ein. Nach einem Jahr und dem Abschluss zum Steuerberater zahlten wir den vorherigen Eigentümer aus. Niemals kam es zu Unstimmigkeiten, wir klärten alles in einem Gespräch.
Bis vor sechs Monaten. Ich hatte es satt jeden Morgen aufzustehen, um ins Büro zu gehen. Schlapp und ausgelaugt fühlte ich mich. Seit drei Jahren hatte ich durchgearbeitet ohne jeglichen Urlaub. Unsere Kanzlei lief gut, zu gut, denn mir fehlte die Zeit an meine persönlichen Wünsche zu denken. Judith nahm ihren Urlaub großzügig wahr. Verheiratet und zwei Kinder, da brauchte sie die Auszeit, um mit der Familie mehrere erholsame Wochen im Jahr zu verbringen. Ich gönnte es ihr. Doch dann kam der Tag, an dem ich einiges aufs Spiel setzte.
Im April, genau zu den Osterferien, buchte ich kurzfristig einen Flug auf die griechische Insel Kreta, ohne es vorher mit Judith abzusprechen.
Sie hatte längst die Ferien verplant, befand sich bereits in den Vorbereitungen. Mit meiner Spontanbuchung machte ich ihr einen Strich durch die Rechnung. Eine kurze Nachricht hinterließ ich auf Judiths Schreibtisch. Es tut mir leid, ich muss raus, bevor ich durchdrehe. Torschlusspanik. Verzeih mir.
Damit fiel für sie der Familienurlaub an der Nordsee im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Sie blieb zu Hause, ihr Mann und die Kinder fuhren. Das war das erste Mal in unserer dreiunddreißigjährigen Freundschaft, dass wir nicht über etwas gesprochen hatten, was uns am Herzen lag. Ich wusste nicht, was mich dazu trieb, einen solchen Vertrauensbruch zu begehen. Und ob ich mit den Konsequenzen leben konnte, stand nicht fest. Etwas wütete in mir, unterschwellig, ohne dass ich es wirklich greifen konnte.
Und ausgerechnet Kreta! Eine Insel, die im Mittelmeer lag. Bereits in meiner Kindheit scheute ich das Meer, sogar ein Fluss bereitete mir Angstzustände. Woher diese Ausbrüche kamen? Keine Ahnung, dies konnten weder meine Eltern erklären noch die zahlreichen Therapeuten herausfinden, die ich seit meinem zehnten Lebensjahr aufsuchte. Bis dato hatte ich in den Urlauben das Festland bevorzugt, weit vom Meer entfernt, am liebsten mit dem Auto in die Berge. Und jetzt hatte ich gebucht! Wie es dazu kam?
Mir fehlte die Anschrift eines Finanzamtes. Auf der Suche im Netz wurde auf der rechten Seite Werbung geschaltet. Zwei Wochen Kreta für sechshundertneunundneunzig Euro. Ein Last-Minute-Angebot, zwei Tage vor Ferienbeginn. Ich klickte auf den Link. Sah mir flüchtig das Angebot an und buchte, ohne weiter darüber nachzudenken. Ich fühlte mich ferngesteuert.
Auch nachdem ich den Ausdruck der Hotelbuchung in der Hand hielt, kam kein Gefühl in mir auf. Weder Freude noch Zweifel. Ich wusste einzig und allein, es war die richtige Entscheidung. Nach einer Stunde und dem Realisieren, was ich gemacht hatte, stellte sich Angst ein. Schließlich würde der Flug übers Meer führen. Ich musste unbedingt dafür sorgen, dass ich keinen Fensterplatz bekam.
Um die Angst zu unterdrücken, schluckte ich sofort Beruhigungstabletten, die ich seit Jahrzehnten mit mir führte und oft genug nahm.
Schließlich gab es in Köln Brücken, die überquert werden mussten. Allein schon, wenn ich zum Flughafen wollte. Auch bei starrem Geradeaussehen, einzig der Gedanke, dass der Rhein unter mir floss, trieb meine Furcht zum Höhepunkt. Nur mit einer schnell wirkenden Tablette, die sich unter der Zunge auflöste, konnte ich die Überfahrt schaffen. Auch an jenem Morgen, als ich die Flucht ergriffen hatte, um nach Kreta zu fliegen.
Nach drei Stunden Flug landete die Maschine auf dem Flughafen Níkos Kazanzákis in Heráklion. Ich befand mich in einem Zustand der Leichtigkeit, denn ich hatte die Medikamentenstückzahl erhöht, um die Reise zu überstehen. Leicht schwindlig stieg ich die Flugzeugtreppen hinunter und freute mich über festen Boden unter den Füßen. Obwohl es mir vorkam, als würde ich schweben. Zum Glück brauchte ich zum Hotel nicht selbst zu fahren. Ich schaffte es zum Bus, ließ mich auf einen der hintersten Sitze fallen, schloss die Augen. Der Reiseleiter zählte durch die Reihen und teilte mit, dass eine knapp zweistündige Fahrt vor uns lag. Ich schlief erschöpft ein und bekam nicht mit, dass wir am Meer entlang in den Osten der Insel fuhren.
Jemand rüttelte mich an der Schulter. »Hallo, wir sind da«, vernahm ich eine männliche angenehme Stimme.
Ich schüttelte den Kopf, wollte nicht aus meiner Traumwelt gerissen werden. Das Rütteln wurde heftiger und nun schien die Stimme besorgt.
»Geht es Ihnen nicht gut? Brauchen Sie einen Arzt?«
Ich richtete mich auf, sah den Mann an. »Entschuldigung, ich muss wohl eingeschlafen sein.« Verlegen strich ich durch mein Haar. Sicherlich würde es nach allen Seiten abstehen und ich keinen guten Eindruck auf den nett aussehenden Mann machen. Er hatte strahlend weiße Zähne, ob sie gebleicht waren? Ich las sein Namensschild: Leftéris Solidákis. Er reichte mir die Hand, half mir hoch. Mir wurde schwindelig, ich lehnte mich kurz an ihn, denn ich hatte das Gefühl umzufallen.
»Möchten Sie sich lieber wieder setzen? Soll ich den Hotelarzt kommen lassen?«
»Nein, es geht.«
Woher spricht dieser Mann ein solch gutes Deutsch, dachte ich, während ich vorsichtig aus dem Bus stieg. Leftéris blieb an meiner Seite, stützte mich auf dem Weg zur Rezeption. »Wenn Sie mir Ihren Pass geben, melde ich Sie an, damit es schneller geht und Sie sich gegebenenfalls gleich hinlegen können.«
Stumm reichte ich ihm den Ausweis und meine Hotelbestätigung.
Vor der Rezeption warteten die anderen Gäste. Kinder hüpften in der Vorhalle umher oder zerrten an den Ärmeln ihrer Mütter. Laut meldeten sie an, endlich in den Pool springen zu wollen. Vergeblich versuchten die Eltern, die Sprösslinge zu beruhigen, versprachen ihnen ein Eis, wenn sie sich ein wenig gedulden würden.
Ich bekam diese Szenen verzerrt mit, es kam mir unerträglich laut vor. Die Versuchung, mir die Ohren zuzuhalten, war groß. Ich riss mich zusammen, lenkte mein Augenmerk auf den Reiseleiter. Leftéris drängte sich an den Gästen vorbei hinter den Tresen.
Keine fünf Minuten später brachte er mich zu meiner Unterkunft, einem weißen Haus mit blauen Fenstern. Eine rosafarbene Bougainvillea schlängelte sich über die gesamte Vorderfront bis hin zum Balkon auf der ersten Etage. Leftéris stieg die Treppe zum Obergeschoss hinauf. Ich hielt mich am Geländer fest, folgte langsam, indem ich mich stückchenweise hochzog und vorsichtig eine Stufe nach der anderen nahm. Leftéris öffnete die Eingangstür. Eiskalte Luft schlug mir aus dem Inneren des Zimmers entgegen. Die Klimaanlage lief auf Hochtouren, dabei waren die Temperaturen im April angenehm. Ich überlegte, wie sehr dieser Kühlluxus das Klima erwärmen würde und für einen Weltuntergang mitsorgte. War ich verrückt? Was für Gedanken durchquerten meine Gehirnhälften? Sicherlich lag es am übertriebenen Pillenkonsum. Ich sollte zukünftig vorsichtiger damit umgehen.
»Könnten Sie bitte die Klimaanlage abschalten?«, fragte ich und öffnete die Balkontür.
Verdammt! Ein Zimmer mit Meerblick. Ich hielt den Atem an, schlagartig überfiel mich der Schwindel, mir wurde schwarz vor Augen. Dass ich zu Boden stürzte, bekam ich wie durch einen Schleier mit.
Leise Stimmen drangen an mein Ohr. Ich spürte, dass mir jemand etwas um den Arm band und ließ es geschehen. In meiner Gedankenwelt hinter geschlossenen Lidern befand ich mich auf einem Berg, in den Alpen. Ein leichter Wind wehte mir um die Nasenspitze, die Stirn fühlte sich feucht an. Die Stimmen wurden deutlicher.
»Legen Sie ihr ein nasses Tuch in den Nacken, lagern Sie ihre Beine hoch«, vernahm ich eine weibliche Stimme.
Jemand hob meine Beine an, schob etwas darunter. Vorsichtig öffnete ich die Augen zu einem Schlitz und erkannte, dass mir der Blutdruck gemessen wurde. Eine weißgekleidete Frau saß auf dem Bettrand. Drei weitere Personen standen um mich herum. Dort! Ich erkannte Leftéris, öffnete gänzlich die Augen und lächelte ihn an.
Er beugte sich zu mir herunter. »Bin ich froh, da sind Sie ja wieder.«
»War ich weg?«
»Wissen Sie, wo Sie sich befinden?«, fragte mich die Frau, die mir die Manschette abnahm.
»Im Bett«, antwortete ich.
»Und wo?«
Ein Stich zog durch den Kopf. Das Herz schlug schneller, ich atmete hastig. Die Balkontür, das Meer! Ich richtete mich auf, wollte mir Gewissheit verschaffen.
»Bleiben Sie bitte liegen.« Sanft wurde ich aufs Kissen zurückgedrückt. »Ihr Blutdruck ist ziemlich niedrig, dazu haben Sie einen erhöhten Puls. Ich würde Ihnen gerne eine Spritze geben, damit Sie stabil werden. Nehmen Sie Medikamente?« Sie kramte in der Arzttasche.
»Nein, doch ...« Ich setzte mich auf. »Meine Handtasche, bitte.« Leftéris hob sie vom Boden auf und reichte sie mir. Ich holte das Päckchen Pillen heraus. »Ich habe wohl zu viel davon genommen«, flüsterte ich. Es war mir peinlich in Anwesenheit der Fremden den erhöhten Konsum zuzugeben. Mit einer bittenden Handbewegung schickte die Ärztin die Leute aus dem Zimmer.
»Ich schaue später nochmals nach Ihnen, wenn es recht ist.« Leftéris winkte mir zu.
Zur Antwort nickte ich. Dann sah ich die Ärztin an und erwartete eine Standpauke wegen des Missbrauchs von Medikamenten. Ich hatte es nicht absichtlich gemacht, es war passiert. Tränen traten in die Augen.
»Das Beste ist, Sie schlafen sich aus und wenn es Ihnen nicht gut geht, rufen Sie bei der Rezeption an, die werden mich sofort verständigen.« Sie erhob sich.
»Danke für Ihre Hilfe.«
»Das ist mein Job.« Sie räumte das Blutdruckmessgerät in den Arztkoffer, schloss ihn. Mit einem aufmunternden Lächeln verließ sie das Zimmer.
Meine Güte, Ariane! Ich versuchte mich bequem auszustrecken. Was hast du getan? Du sitzt jetzt ganz schön im Schlamassel und auf einer Insel fest. Rundherum Wasser! Was hast du dir dabei gedacht? Nichts habe ich gedacht, sonst hätte ich den Flug nicht gebucht. Fing ich langsam an zu spinnen? Wie konnte ich mich in eine solch ausweglose Situation bringen? Unmöglich, die nächsten vierzehn Tage im Zimmer zu verbringen, mit geschlossenen Türen und Fenstern. Irgendwann würde der Hunger siegen und ich da raus müssen, vor die Tür, mit Blick aufs Meer.
Vorsichtig erhob ich mich, denn ich verspürte ein dringendes Bedürfnis. Schwindel und Übelkeit überkamen mich. Bis ins Bad waren es wenige Schritte. Ich versuchte mein Augenmerk nicht auf den Balkon zu richten, aus Angst, ich würde sofort wieder umfallen. Alleine, ohne dass mich jemand ins Bett legen würde. Im Spiegel erkannte ich mein eigenes Gesicht nicht. Kreideweiß, dunkle Augenränder und ein stumpfer Blick. Mein langes Haar sah strähnig aus.
Ich setzte mich auf die Toilette, erleichterte mich. Beim Aufstehen zitterten die Beine vor Erschöpfung. Geht’s noch? Ich zog mich am Handtuchhalter hoch. Der Wunsch kam in mir auf, zu duschen, doch die Angst auszurutschen und zu fallen siegte, sodass ich mir das Gesicht kurz wusch.
Aus dem Koffer holte ich das Nachtzeug. Ließ die getragene Kleidung auf den Boden sinken, zog den Schlafanzug über. Kurz sah ich mich auf der rechten Seite des Zimmers um. Bloß nicht zu weit nach links, dort erwartete mich das Meer.
Ein Kühlschrank stand in der Ecke. In der Hoffnung, etwas zu trinken darin vorzufinden, öffnete ich ihn. Holte Wasser heraus uns setzte die Flasche sofort an. Eiskalt rann die Flüssigkeit durch die Kehle und verbreitete sich im Körper. Mein Problem mit der Balkontür sollte ich schnellstmöglich hinter mich bringen. Es kostete mich Überwindung, doch in der Nacht würde es sicherlich kühler werden. Wieso hatte ich zuvor niemanden gebeten, sie zu schließen. Verdammt!
Mit geschlossenen Augen tastete ich mich dorthin vor. Fand die Klinke und augenblicklich konnte ich besser durchatmen. Für den Moment hatte ich die Gefahr gebannt. Darüber, wie es weitergehen sollte, konnte ich mir im Moment keine Gedanken machen. Ich legte mich unter die Bettdecke und schloss die Augen. Bevor ich ins Traumland versank, hörte ich ein Klopfen an der Tür.
»Ja!«, rief ich.
»Hier ist Leftéris, ich wollte nochmals nach Ihnen sehen. Geht es Ihnen gut?«
»Danke, ich liege im Bett und versuche zu schlafen.«
»Gute Nacht.« Ich hörte Schritte, die sich entfernten.
Ein netter Mann, ging mir als letzter Gedanke durch den Kopf, bevor ich mich in meine Traumwelt verabschiedete, in der es kein Meer gab.
In den frühen Morgenstunden erwachte ich, sah auf die Uhr. Kurz nach acht. Im ersten Augenblick fand ich mich nicht zurecht. Erst jetzt betrachtete ich mein Zimmer genauer. Ich war auf der sicheren Seite, durch die Spalten an der Balkontür schimmerte das Tageslicht, kein Meer.
Erst jetzt erkannte ich, dass an der Tür ein Sonnenladen angebracht war. Ich lag in einem modernen Holzbett. Nachttisch und Schrank waren aus dem gleichen Holz gefertigt. In einer blauen Vase auf der Anrichte befand sich ein bunter Rosenstrauß. Der Duft der Blüten schwebte in der Luft.
Dass mir das gestern nicht aufgefallen war. Du warst im Rausch gefangen, kam mir in Erinnerung, ich lachte laut und kurz auf. Oje, was dachten die Menschen von mir, die alle ums Bett herumgestanden hatten.
Mein Magen knurrte. Seit dem gestrigen Morgen hatte ich keine Nahrung mehr zu mir genommen. Im Kühlschrank befand sich nichts Essbares, das würde für mich bedeuten, ich müsste es wagen, vor die Tür zu treten. Mit geschlossenen Augen würde ich den Speisesaal sicherlich nicht finden. Ob das Hotel einen Zimmerservice anbot? Irgendwo lag sicherlich eine Infomappe. Ich ging den Raum mit den Augen ab. Neben der Blumenvase wurde ich fündig.
Ich stand auf, verspürte dabei keinen Schwindel und schaffte es ohne Probleme bis zur Anrichte und zurück. Schnell überflog ich die Angebote. Da! Ich hatte Glück. Sie brachten Speisen aufs Zimmer. Eine Karte lag dabei. Ich entschied mich für Spiegeleier mit Speck, Brot, frisch gepressten Orangensaft und einen starken Kaffee. Während ich auf die Bestellung wartete, ging ich unter die Dusche, fühlte mich danach erholt und frisch.
Ich hatte mich gerade angezogen, als es an der Tür klopfte. Kurz hielt ich inne. Wenn ich öffnete, würde mich das Meer niederraffen, obwohl, ich war am Tag zuvor eine Treppe hochgegangen, vielleicht würde ich es nicht zu sehen bekommen. Ich ging auf Nummer sicher.
»Es ist offen, kommen Sie bitte rein.« Statt dass jemand eintrat, erklang ein weiteres Klopfen. Ich wiederholte meine Bitte in Englisch. Es funktionierte.
Der Kellner stellte mir das Tablett auf die Anrichte, ließ mich einen Zettel unterschreiben und verschwand mit einem freundlichen Gruß. Geschafft!
Ich setzte mich mit dem Frühstückstablett aufs Bett und ließ es mir schmecken. Mir war bewusst, dass ich mir danach Gedanken darüber machen musste, wie ich den Tag verbringen wollte. Doch mit vollem Magen dachte es sich besser, so verschob ich die Überlegungen eine Weile. Statt mir über meine Lage klar zu werden, verkroch ich mich zurück ins Bett.
Gegen Mittag wurde ich von Geräuschen geweckt. Ich vernahm weibliche Stimmen, die sich in der Landessprache unterhielten. Ein kurzes Klopfen, ein »Housekeeping«, schon öffnete sich die Tür. Eine Griechin trat ein. Ohne sich umzusehen, öffnete sie die Balkontür, ich zog mir die Bettdecke übers Gesicht. Die Frau summte fröhlich, ich hörte sie im Badezimmer hantieren, stellte mir vor, wie sie die Handtücher auswechselte. Ich gab keinen Laut von mir, hoffte, sie würde danach sofort gehen. Warum sollte sie das Zimmer putzen wollen? Ich war erst am Nachmittag zuvor angekommen.
Ein Schrei! Nun hatte sie mich entdeckt. Fremdsprachige Worte, gemischt mit »Sorry«, und die Tür schlug zu. Die Zimmertür ja, doch die Balkontür stand offen. Mein Herz bollerte bei dem Gedanken, ich fing heftig an zu atmen. Es half nichts, ich musste es wie zuvor mit geschlossenen Augen versuchen. Ich tastete mich am Bett entlang und schloss schleunigst das Draußen aus.
Erledigt, ich konnte mich im Raum frei bewegen. Ich kam nicht drumherum mir eine Lösung einfallen zu lassen. Was hatte ich zu bewältigen? Im Kopf erstellte ich mir eine Liste. Fakt, ich konnte das Zimmer nicht verlassen. Wie regelte ich Hunger und die Putzfrau? Essen konnte ich mir herbringen lassen, die Putzfrau müsste darüber informiert werden, dass ich immer im Zimmer anwesend sein würde. Im Grunde ganz einfach.
Ich rief die Rezeption an und brachte mein Anliegen vor. Erleichtert setzte ich mich aufs Bett, mit dem Fuß spielte ich mit den Sonnenstrahlen, die sich durch den Laden stahlen. Ich spürte die Wärme, die meine Zehen kitzelte. Schaute sehnsüchtig auf die geschlossene Tür.
Dort draußen erwachte der Frühling auf der Insel. Leichtes Meeresrauschen drang an mein Ohr und mich überlief eine Gänsehaut. Egal, ich fühlte mich sicher im Schutz des Fensterladens. Doch konnte ich die nächsten dreizehn verbleibenden Tage im Zimmer verbringen? Befand ich mich auf dem geraden Wege, verrückt zu werden? Sollte ich mich der Herausforderung stellen? Wenn mir meine Therapeuten sagten: ›Sie müssen ans Meer und sich Ihren Ängsten stellen‹, wechselte ich zu einem neuen, bis mir die gleichen Worte zu Ohren kamen. Wie auch immer, ich stand dazu, das Wagnis nicht einzugehen, aus Gewissheit, ich würde an einem Herzinfarkt sterben. Wollte ich das? Ausgerechnet auf einer Insel, vom Meer umgeben? Sicher nicht! Ich bestellte mir einen Club-Salat.
Danach machte ich es mir im Bett gemütlich, schob die Kissen hoch, setzte mich dagegen, nahm meinen E-Book-Reader zur Hand und entschied mich für einen Liebesroman.
Fünf Tage vergingen ohne große Vorkommnisse. Das Personal hatte sich daran gewöhnt, dass ich auf dem Zimmer speiste. Die Putzfrau ließ sich nicht davon abhalten, ihre Arbeit zu verrichten, während ich bei ihrem Erscheinen mit dem Rücken zur Tür saß und las. Stets grüßte sie freundlich. Ich beobachtete sie nie, aus Angst, ich könnte versehentlich einen Blick aufs Meer erhaschen, denn die Balkontür stand so lange offen, bis die Frau die Tätigkeit verrichtet hatte.
Am siebten Tag bat der Reiseleiter um Einlass.
»Ist offen.« Ich rückte schnell in meine sichere Ecke. »Schließen Sie bitte die Tür«, bat ich. Erst als ich das Klicken in die Rasterung hörte, drehte ich mich zu ihm um.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte ich und rieb mir die plötzlich feucht gewordenen Hände am Rock ab.
»Ich wollte nach Ihnen schauen. Mir wurde gesagt, dass Sie das Zimmer nicht verlassen. Geht es Ihnen nicht gut? Brauchen Sie einen Arzt?« Er lächelte, obwohl der Blick aus seinen dunklen Augen besorgt herüberkam.
»Mir geht es gut. Ich möchte meine Ruhe haben.«
»Entschuldigen Sie meine Frage, hatten Sie bei Ihrer Buchung nicht gesehen, dass es sich um ein All-inclusive-Hotel handelt?« Leftéris kam einen Schritt näher.
»Möchten Sie sich setzen?« Ich zeigte auf den Stuhl neben der Anrichte. Er zog ihn in die Mitte des Zimmers.
»Es ist ziemlich dunkel hier drinnen, haben Sie etwas dagegen, wenn ich die Balkontür öffne?« Er ging darauf zu.
»Nicht aufmachen!«, schrie ich.
Leftéris zuckte zusammen, drehte sich um. »Entschuldigen Sie.«
Ich versuchte meinen Atem unter Kontrolle zu bringen. Ein – aus, ein – aus.
Der Reiseleiter schritt auf mich zu. »Ich wollte Sie nicht ...«, fing er an, ich winkte ab.
»Schon gut.«
Nun ließ er sich auf den Stuhl fallen, sah mich dabei an. Ich nahm auf dem Bettrand Platz, faltete die Hände im Schoß, rieb sie aneinander. Leftéris behielt den Blick auf mich gerichtet.
Mich beschlich das Gefühl, dass er so lange dort sitzen bliebe, bis ich ihm mein Verhalten erklären würde. Wie oft hatte ich das im Leben bereits getan? All die Ärzte, die ich aufgesucht hatte, die mir helfen sollten und doch nur mit einem klug und gut gemeinten Ratschlag rüberkamen. Auf einmal mehr oder weniger darüber zu sprechen kam es nicht an.
»Ich leide unter Angstzuständen, die ausgelöst werden, wenn ich das Meer, einen See oder Fluss sehe, sogar beim Anblick einer gefüllten Badewanne passiert es.« Ich zählte die Schattenrisse der Balkontür auf dem Boden, um ja nicht aufschauen zu müssen.
Leftéris räusperte sich. »Okay.« Er dehnte es lang, schien verwirrt zu sein, mit der Situation nicht klar zu kommen. Nach gefühlten zehn Minuten brach er das Schweigen. »Und wieso buchen Sie ausgerechnet einen Inselurlaub?«
Ich schaute auf und ihm lange ins Gesicht, dann hob ich die Schultern hoch, ließ sie sofort wieder sinken. Leftéris verzog keine Miene. Hatte er vor, die Angelegenheit gemeinsam mit mir auszusitzen? Hielt er mich für verrückt? War ich es nicht? Ein Schamgefühl stellte sich ein. Wie konnte es so weit mit mir kommen? Was war in mich gefahren, als ich den Flug buchte?
»Haben Sie niemanden, der Ihnen nahesteht, mit dem Sie darüber reden können?«, brach seine sanfte Stimme die Stille.
Judith! Sie hatte sicherlich versucht, mich zu erreichen. Mein Handy hatte ich ausgeschaltet, seitdem ich in den Flieger gestiegen war. Was war mit mir los? Ich besprach sonst alles mit ihr. Entschlossen stand ich auf, nahm das Mobiltelefon aus der Tasche, schaltete es ein. Dreiunddreißig verpasste Anrufe, die Mailbox voll.
Schuldgefühle! Genau die hatten mir gerade noch gefehlt. Ich drückte Judiths Nummer, um Sekunden später einen Abbruch vorzunehmen. Ihre Reaktion konnte ich mir bildlich vorstellen. Ausrasten würde sie, schließlich ging ihr verpatzter Familienurlaub auf meine Kosten. Doch was viel schlimmer war, ich hatte ihr einfach nur eine schriftliche Nachricht hinterlassen und sie im Ungewissen gelassen. Sie würde sich Sorgen machen.
»Möchten Sie, dass ich gehe?«
Leftéris! Ihn hatte ich bereits vergessen, dabei saß er mir genau gegenüber. Ich hielt mir die Hände vors Gesicht, hoffte dadurch unsichtbar zu werden. Einfach zu verschwinden, endlich die Ängste loszuwerden, die mich seit der Kindheit gefangen hielten.
Plötzlich spürte ich eine Hand auf meinem Arm. Ein wenig rau fühlte sie sich an, passte nicht zu seiner sanften Stimme. Ich wünschte ich könnte all meine Sorgen abschütteln.
»Darf ich fragen, wen Sie anrufen wollten?« Er setzte sich neben mich.
»Judith, meine beste Freundin.«
»Und warum haben Sie die Verbindung unterbrochen?«
»Ich habe sie im Stich gelassen, bin einfach geflogen. Ach, Sie wissen nicht, wie viel Unheil ich angerichtet habe mit meinem Flug auf die Insel. Was mich in dem Moment geritten hat – ich kann es nicht nachvollziehen.«
»Alles hat im Leben einen Sinn.«
Ach du meine Güte! Ob er Psychologie studierte und sich im Sommer Geld als Reiseleiter hinzuverdiente? Ich sah ihn an. Nonsens, der war ungefähr in meinem Alter. An den Schläfen glitzerten die ersten grauen Strähnen. Dann gehörte er zu der Männersorte, die tiefsinniger dachte. Vielleicht ein Frauenversteher. Ich lachte auf.
»Was ist daran witzig?« Verdutzter wie er konnte niemand schauen. Das brachte mich ein weiteres Mal zum Lachen. Er stand auf. »Ich wollte Ihnen behilflich sein.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, öffnete er die Tür, ich verkroch mich in meine Ecke, schon war er weg. Was hatte ich angerichtet? Einen weiteren Menschen, der es gut mit mir meinte, vor den Kopf gestoßen. Ich hockte noch in meiner Sicherheitsecke, als die Tür erneut aufging und Leftéris im Rahmen stand.
Ich senkte den Blick zum Boden. Er hatte die Tür nicht geschlossen, stand einfach da wie ein Fels in der Brandung. Unbeweglich. Ich atmete erleichtert auf, er hatte begriffen, schloss die Welt dort draußen für mich aus.
Vorsichtig kam ich aus meiner Deckung, murmelte: »Es tut mir leid. Sie müssen denken, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank, wäre durchgeknallt. Und wissen Sie was, ich glaube es langsam selbst.«
Er schritt auf mich zu, nahm mich bei den Armen, führte mich zum Bett. Wir setzten uns, ich war mir seiner Nähe bewusst, sie engte mich ein. Ich rückte ein Stück ab. »Was halten Sie davon, wenn wir uns duzen? Ich denke, dann redet es sich leichter.«
Ich nickte.
»Gut. Ich bin Leftéris.« Er hielt mir die Hand entgegen.
»Ariane.« Ich schlug ein.
»Das wäre erst einmal geschafft. Wenn ich dich richtig verstehe, kannst du das Haus nicht verlassen, weil du sofort einen Blick aufs Meer hast und damit deine Ängste ausgelöst werden.«
»Ja.«
»Heute Abend habe ich eine Gesprächsstunde mit den Gästen. Danach komme ich, verbinde dir die Augen, helfe dir die Stufen hinunter. Dann verlassen wir die Hotelanlage durch den Personaleingang und gehen spazieren. Richtung Berge. Bist du einverstanden?«
»Ich soll das Zimmer verlassen?«
»Ja. Wenn du mir vertraust, dass ich dich sicher die Stufen hinunterführe und dir verspreche, dass du das Meer nicht zu sehen bekommst.«
»Wie soll das funktionieren? Das Meer liegt direkt vor dieser Tür.« Um meine Aussage zu unterstreichen, zeigte ich in die Richtung.
»Ist es dir zuvor aufgefallen, als du das Zimmer bezogen hast oder erst, als du die Balkontür geöffnet hast?«
»Nach Öffnen der Balkontür.«
Mein Herz machte einen Sprung. Gab es eine Möglichkeit, meinem mir selbst auferlegten Gefängnis für kurze Zeit zu entkommen?
Den Nachmittag über beschäftigte ich mich mit der Kleiderwahl für den abnormen Spaziergang. Nach langer Überlegung entschied ich mich für eine Jeans, eine langärmlige blaue Bluse und festes Schuhwerk. Ungeduldig ging ich im Zimmer auf und ab, konnte Leftéris’ Erscheinen kaum erwarten. Ich versuchte mir auszumalen, wie schön die Gegend sein würde. Aus Erzählungen war mir bekannt, dass südlich gelegene Inseln im Frühling grün und saftig aussehen sollten, bevor die große Hitzeperiode sie braun erscheinen ließ. Welche Bäume wohl in der Umgebung wuchsen? Palmen? Ich hatte die Herfahrt verschlafen, darum konnte ich mir nicht vorstellen, wie es vor der Tür aussehen würde, bis auf die Bougainvillea, die am Haus emporragte. Endlich war es so weit, ich hörte Schritte, ging ins Bad, um nicht in meiner Ecke zu hocken. Noch bevor Leftéris klopfen konnte, rief ich: »Ist offen!«
Erst als ich mich sicher fühlte, dass die Außenwelt vorerst ausgeschlossen war, kam ich aus dem Bad.
»Bist du bereit?« Er hob die Augenbinde hoch.
War ich so weit? Über meine Haut zog ein Kribbeln. Nahm die Angst mich in den Griff? Unterdrücken ging nicht, ich wusste, dann würde es schlimmer werden. Ausstehen wollte ich es im Moment auch nicht.
Zum Glück reichte Leftéris mir die Hand, schlagartig verschwand das Unwohlsein. Mit Bedacht verband er mir die Augen.
»Es sind elf Stufen. Du musst mitzählen. Ich gehe vor, halte dich bei den Händen, und dann ganz langsam vorwärts. Einverstanden?« Meine Aufregung steigerte sich, darum bestand die Antwort aus einem Nicken.
»Bist du sicher, dass du bereit bist?«
»Ja«, kam es fast flüsternd über meine trockenen Lippen.
»Ich öffne jetzt die Tür.«
»Einverstanden.«
Er führte mich durch den Raum, dann schlug mir ein kühler Windzug entgegen. Ich fröstelte, traute mich auf einmal nicht mehr einen Fuß vor den anderen zu setzen.
»Ist dir kalt?«
»Es scheint ziemlich windig zu sein.«
»Nordwind. Hast du eine Jacke dabei?«
»Über dem Stuhl, bei der Anrichte.«
»Ich lass dich kurz los, um sie dir zu holen, ist das in Ordnung für dich?«
War es in Ordnung? Konnte ich den Moment meistern, ohne seine rauen Hände, an denen ich mich festzukrallen schien? Ich musste, sonst würde ich diesem Raum am heutigen Abend nicht entfliehen können, wer weiß, vielleicht niemals mehr im Leben! Ich würde einsam und verlassen in diesem Zimmer dahinvegetieren, bis mir das Geld ausging, und dann? Der Hotelmanager würde mich vor die Tür setzen. Schutzlos. Ich schüttelte heftig den Kopf, wollte die Gedanken damit vertreiben. Leftéris nahm dies als Verneinung an. »Wir gehen gemeinsam zum Stuhl und holen die Jacke.«
Gute Idee, sogleich fühlte ich mich sicherer. Er half mir beim Anziehen, zog den Reißverschluss hoch.
»Ist es so okay?«
Wie fürsorglich er mich behandelte. Eine mollige Wärme stieg in mir auf, dass mir die Jacke in dem Moment überflüssig erschien. Auf der Treppe änderte ich die Meinung. Der Wind umwirbelte mich.
»Und ab jetzt zählen. Eins, zwei, langsam, gut so, drei ...«
»Elf«, kam es erleichtert von mir.
»Du hast es geschafft. Nun hake dich bei mir ein. Er nahm meinen rechten Arm, schob ihn unter seinen, legte eine Hand beruhigend auf meine. »Wie fühlst du dich?«
»Gut, obwohl mir salzige Luft in die Nase steigt und ich das Meer rauschen höre.«
»Die Wellen brechen an den Felsen. Wir gehen auf einem aus Steinen angelegten Weg hinüber zum Personaltrakt.«
Konzentriert auf seine Stimme, schritt ich weiter.
»Achtung, zwei Stufen. Sobald wir im Gebäude sind, nehme ich dir die Binde ab. Das Meer liegt hinter uns.«
»Und du bist sicher, ich werde es nicht sehen können.«
»Nur hören.«
»Ich glaube dir.«
Ich vertraute einem mir fast wildfremden Menschen mehr als meiner langjährigen Freundin Judith. Hätte ich mich von ihr blind durch eine Hotelanlage führen lassen? Die Frage wäre gar nicht aufgekommen, sie hätte es zu unterbinden gewusst und mir klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass ich mich zusammenreißen sollte. Augen zu und durch, aber nur im wörtlichen Sinn. Stellte ich gerade meine Freundschaft zu Judith in Frage? Hatten mich die Tage der selbst auferlegten Einzelhaft verändert? Judith stand mir in jeder Situation zur Seite. Wir teilten halt nicht ständig die gleiche Meinung. War es nicht das, was wir an uns schätzten? Dass wir verschieden waren, niemand im Schatten des anderen stand, seinen Standpunkt frei und ehrlich vertreten durfte. Abgesehen von meinen Angstzuständen, die immer zu unnötigen Diskussionen führten. Konnte ich Judith dafür böse sein? Nein! Wichtiger als nachgrübeln, dass ich mich auf Leftéris konzentrierte.
Ich blinzelte, als er mir die Binde von den Augen nahm. Musste mich an die Lichtverhältnisse gewöhnen. Wir standen unter einem Türbogen, die Sonne schien mir ins Gesicht. Nachdem ich klarer sehen konnte, erkannte ich in der Ferne Berge. Wir gingen aus der Hotelanlage hinaus und kamen auf eine Landstraße.
Der Weg führte uns an Olivenhainen vorbei.
»Die Bäume stehen in Blüte. In wenigen Wochen werden die ersten Oliven sichtbar werden.« Leftéris griff nach einem Zweig und deutete auf die wenigen grünen Minifrüchte, die sich langsam zeigten. Ich rieb sie zwischen meinen Fingern.
»Die Bäume werden alt, dieser ist sicherlich an die hundert Jahre. Schau seine Rinde an«, meinte er.
Ich konnte nicht anders und stieg ein Stück die Böschung hinunter, strich über die knochige Rinde. Längst hatte ich das Meer vergessen und hörte nicht einmal mehr das Rauschen. Verzaubert von der Landschaft, die ich mir karger vorgestellt hatte. Die Olivenbäume schimmerten grün, auch wenn auf den Blättern eine Staubschicht lag. Es fiel mir schwer, mich loszureißen.
Hätte ich mich weiterhin im Zimmer verkrochen, würde ich diesen Moment nicht erleben. Plötzlich spürte ich, dass meine Schuhe feucht wurden.
»Komm.« Leftéris reichte mir die Hand. »Der Bauer hat die Bewässerung angestellt.«
Ich kletterte hoch, wischte mir die Hände an der Hose ab. Wahrscheinlich nicht gut genug, denn Leftéris machte mich auf Schmutz auf meinem Handrücken aufmerksam. Der Jackenärmel musste dran glauben. Ich lächelte bei dem Gedanken, wie frei ich mich auf einmal fühlte.
»Ich wollte mit dir dort auf den Berg.« Er zeigte in die Richtung. »Magst du?«
»Und was machen wir da oben?« Ich blieb stehen, sah mir den Weg an, der hinaufführte. Steil und steinig. Zum Glück hatte ich mich für festes Schuhwerk entschieden.
»Die Gegend anschauen.«
Ein Schreck durchfuhr meinen Körper, der Magen zog sich zusammen.
Leftéris musste es bemerkt haben, denn er reagierte spontan, indem er meine Hand in die seine nahm.
»Beruhige dich, auf der anderen Seite des Berges liegt eine kleine Kirche im Tal, mitten in einem Olivenhain. Dort ragt die Turmspitze hinaus, das ist interessant zu sehen.«
»Eine solch kleine Kapelle?«
»Oder die Bäume sind hochgewachsen. Du kannst selbst entscheiden, aus welcher Perspektive du es sehen magst.« Er machte einen Schritt nach vorne.
Weiterhin verharrte ich auf meinem sicheren Platz. Ein Pick-up fuhr vorbei, hupte. Leftéris grüßte den Fahrer, der daraufhin anhielt. Auf der Ladefläche waren drei Hunde an kurzen Leinen angebunden, sie kläfften aggressiv zu mir herüber. Das steigerte meine Panik, ich lief die Böschung hinunter, knickte dabei um. Hinter mir vernahm ich einen Laut, wahrscheinlich war Leftéris den Abhang heruntergesprungen. Ich drehte mich nicht um. Der Autofahrer rief etwas in der Landessprache, dann hörte ich, dass der Wagen sich mitsamt den Hunden entfernte. Erschöpft hockte ich mich an einen Baumstamm, rieb mir den linken Knöchel.
»Verdammt«, ich hieb mit der Faust aufs feuchte Erdreich.
»Verdammt!« Mehr kam nicht über meine Lippen. Tränen liefen unaufhaltsam über die Wangen.
Leftéris kniete nieder, versuchte mich zu beruhigen, indem er sanft über mein Haar strich.
Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich war kein Kind mehr, doch ich verhielt mich nicht normal für eine erwachsene Frau, mitten im Leben.
Was für ein Leben?, ging es mir absurderweise durch den Kopf. Mit ständigen Panikanfällen, mit Aussetzern, mit unmöglichen Reaktionen auf Alltägliches. Längst kein Leben mehr für mich. Wieso traf mich diese Erkenntnis erst jetzt, nachdem ich bellenden Hunden entflohen war, die mich nicht einmal hätten verfolgen können? Aufzusehen traute ich mich nicht. Mein Begleiter hockte weiterhin vor mir. Zum Glück hatte er die Berührung aufgegeben.
»Ariane, tut der Fuß weh? Darf ich ihn mir anschauen?«
Ich streckte das Bein aus. Bevor Leftéris das Hosenbein hochschob, holte er sich mit meinem Nicken eine stumme Zustimmung ein.
»Das sollte am besten direkt gekühlt werden.« Er sah sich um, zog sein T-Shirt aus, hielt es unter den Bewässerungsschlauch. Nass getränkt band er es mir um den Knöchel.
»Das tut gut«, seufzte ich.
»Meinst du, es funktioniert mit dem Aufstehen?«
»Ich versuche es.« Das erste Auftreten tat weh, doch schon beim zweiten Schritt merkte ich, dass ich den Fuß normal belasten konnte. Es zwickte eher, als dass es schmerzte. Trotzdem humpelte ich über den Olivenhain. Leftéris führte mich den ebenen Weg zurück zur Hauptstraße, statt die Böschung hochzusteigen. Dabei hielt er meine nicht ganz saubere Hand. Es beruhigte mich, gab mir für den Moment Sicherheit.
»Was machen wir jetzt?«, fragte ich, als ich asphaltierten Belag unter den Füßen spürte.
»Es kommt darauf an, wie du dich fühlst. Ist es dir möglich auf den Berg zu gehen?«
Ich schaute hinauf und entschied mich für den Rückweg ins Hotel. Mein Bein schonen, kühlen und ... ja, was und? Mich verkriechen, wie in den letzten Tagen. Vor mir lagen weitere acht auf dieser Insel, umgeben von gewaltigen Wassermengen. Einsam eingesperrt im dunklen Zimmer, nur mit den wenigen Sonnenstrahlen, die sich den Eintritt in meine geschaffene Schutzwelt nicht verbieten ließen.
»Magst du, wenn ich ein Weilchen bei dir bleibe?«, fragte Leftéris, nachdem wir den für mich mit verbundenen Augen zurückgelegten Weg hinter uns gebracht hatten und die Zimmertür geschlossen war.
»Hast du niemanden, der auf dich wartet?«
Verwundert sah er mich an. Warum? Schlagartig wurde mir bewusst, dass es bei allen Zusammentreffen ausschließlich um mich ging. Nicht ein einziges Mal hatte ich darüber nachgedacht, wie es ihm wohl bei all dem Trubel um meine Person ging. Hatte es als Selbstverständlichkeit und Hilfsbereitschaft, vielleicht sogar ein wenig als Helfersyndrom von ihm angesehen.
»Vielleicht der ein oder andere Kollege, der mit mir ein Bierchen trinken möchte.« Er lächelte.
Das gefiel mir, er nahm mir mein ›einnehmendes‹ Wesen nicht übel. Nun hatte ich mich bereits so weit vorgetraut, da blieb die Frage »Und deine Frau?« nicht aus.
»Lebt mit unseren drei Kindern in Athen«, bekam ich die prompte Antwort.
»Du bist verheiratet und hast Kinder?« Meine Stimme klang überrascht, obwohl in seinem Alter, mit dem attraktiven Aussehen schien es selbstverständlich, dass er nicht alleine durchs Leben ging. Hätten meine Panikanfälle nicht jeden Mann ins Nirwana verscheucht, würde ich sicherlich auch eine Familie haben. Oder nicht? Schon länger her, dass ich mir darüber Gedanken gemacht hatte. Und nun passte es mir gerade nicht, weitere Sekunden daran zu verschwenden.
»Seid ihr getrennt?« War ich mit der Frage zu persönlich geworden? Ich kannte ihn so gut wie gar nicht, obwohl ich mich in seiner Gegenwart sicher fühlte. Trotzdem waren wir uns im Grunde fremd. Er mir weniger als ich ihm. Leftéris hatte einen Teil meiner Macken bereits zu spüren bekommen. Und sich nicht abgewendet! Warum? Im Kopf spukten einige Antworten herum. Getrennt lebend, geschieden, er fand mich nett, hübsch, hatte Interesse an mir. Geistesabwesend schüttelte ich den Kopf. Was für eine Spinnerin. Leftéris übte seinen Job als Reiseleiter hervorragend aus, indem er sich um einen durchgeknallten Gast ebenso kümmerte wie um einen normalen. Obwohl ich mich dann fragte, unter welche Norm normal fiel.
»Die Wirtschafskrise hat mich nach Kreta gebracht. Auf dem Festland, in der Nähe meiner Familie, fand ich keine Anstellung. Wenn mir etwas angeboten wurde, dann mit einem solch geringen Einkommen, dass ich uns nicht durch den Sommer, geschweige denn durch den Winter gebracht hätte. Der Patenonkel meines Sohns hat mir die Chance auf eine Anstellung gegeben, weil er Teilhaber dieses Hotels ist. Somit zog ich her.« Ohne mich zu fragen, setzte er sich auf den Stuhl. Erst da wurde mir bewusst, dass wir die gesamte Zeit im Raum standen. Mir fiel auf, dass ich eine Schonhaltung für den Knöchel eingenommen hatte. Gewissensbisse kamen in mir auf. Wofür?, schalt ich mich. Ich sollte endlich aufhören mir für solche Lappalien Schuldgefühle einzureden. Jedenfalls hatten mir dies einige meiner Therapeuten geraten. Vielleicht sollte ich anfangen den einen oder anderen Rat zu befolgen?
Stumm, mit meinen Gedanken beschäftigt, schaute ich auf Leftéris, ließ mich ihm gegenüber auf der Bettkante nieder. »Kommt deine Familie dich besuchen?«
»Sobald die Sommerferien anfangen, ich kann es kaum erwarten.« Auf seinen Gesichtszügen lag ein sehnsüchtiger Ausdruck.
Und welche Rolle spielte ich? Hatte ich mich in ihn verknallt? Ich horchte in mich hinein, fühlte keine Schmetterlinge im Bauch. Nein, ich sah in Leftéris eher einen Retter in der Not. Wie sollte es nun mit uns weitergehen? Was hieß mit uns? Mit mir!
»Warum kümmerst du dich um mich?«
»Weil ich sehe, dass es dir nicht gut geht.«
Offensichtlicher konnte es nicht sein. Mein Verhalten seit der Anreise unübersehbar, es sei denn, er wäre blind. Obwohl, ein Blinder fühlt oft intensiver als ein Sehender, wurde behauptet. Selbst ich hatte mit verbundenen Augen mehr vom Meer zu spüren bekommen, als ich ... Rauschen drang an mein Ohr. So stark hatte ich das Meer sonst vom Zimmer aus nie gehört, es schien unruhiger geworden zu sein. Ob der Ozean meine stummen Überlegungen empfing? Wenn Leftéris meine Gedanken lesen könnte, würde ich im Erdboden versinken.
»Kann ich dich alleine lassen? Es ist spät, ich muss morgen früh zum Flughafen. Eine Reisegruppe kommt