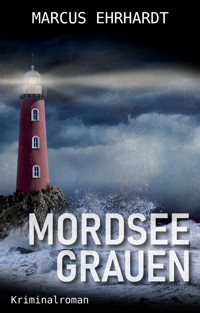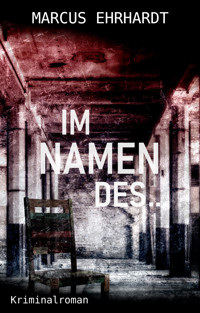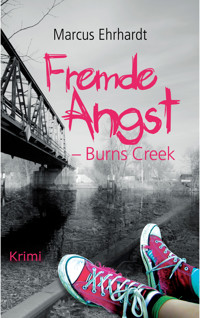3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Während einer Demonstration im Herzen Berlins explodieren zwei Reisebusse. Lennard Bruckmann verfolgt gebannt die Berichte über den Anschlag im TV, als er auf dem Bildschirm eine unmögliche Entdeckung macht: Unter den Teilnehmern der Demo erkennt er seine Jugendfreundin, seine Freundin, die vor 15 Jahren starb. Und für deren Tod Lennard sich verantwortlich fühlt. Besessen davon, sie zu finden, macht er sich auf die Suche, obwohl ihm niemand glaubt. Seine Recherchen sorgen für mächtig Wirbel und rufen schon bald die Polizei auf den Plan, denn auch die Ermittler zeigen großes Interesse an der Frau. Doch welches Geheimnis umgibt die Unbekannte? Und warum tauchen plötzlich weitere, gefährliche Mitspieler in diesem undurchsichtigen Spiel auf? Ein Spiel, dessen Ausmaß Lennards Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Ein Spiel, das nicht nur ihn in tödliche Gefahr bringt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
SCHULD STIRBT NIE
Thriller
Marcus Ehrhardt
Inhaltsverzeichnis
Impressum:
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Danksagung
Über den Autor
Bisher erschienen:
Eine Bitte am Schluss
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Impressum:
© 2020
Marcus Ehrhardt
Klemensstraße 26
49377 Vechta
Herstellung und Verlag der Printausgabe:
BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN:9783752660777
Korrektorat / Lektorat: Tanja Loibl
Covergestaltung: MTEL-Design
unter Verwendung eines Motivs
von Shutterstock Nr. 1046891332
Alle Rechte vorbehalten. Jede Weitergabe oder Vervielfältigung in jeglicher Form ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erlaubt.
Kapitel 1
Heute, Berlin
Die Menschenmenge drängte sich dicht durch die Straße, ganz so, als ob es die Seuche nicht gäbe. Das war ja auch der Grund für diese Demonstration, machte sich Nadja zum wiederholten Male klar, die im mittleren Bereich des Pulks mitlief. Keiner der Demonstranten nahm Notiz von der jungen Frau, die sich immer weiter nach vorn arbeitete, was sich einfacher gestalten würde, wenn sich die Teilnehmer an die Abstandsvorgaben hielten. Kommt jetzt auch nicht mehr darauf an, dachte sie grimmig und schob sich zwischen einer Gruppe Gleichgesinnter hindurch, die lachten und herumalberten, als befänden sie sich gerade auf einem Junggesellenabschied. Einzig die selbst gekritzelten Anti-Merkel-Sprüche auf ihren durchgeschwitzten Shirts passten nicht zu dieser Vorstellung.
»Hörst du mich?«, fragte Nadja, als ob sie mit einem unsichtbaren Begleiter sprechen würde. Sie schaute sich um, doch niemand starrte sie deswegen an. Auch den Polizisten der Hundertschaft, die sie nicht darum beneidete, in schwerer Montur quasi Spalier für den Demonstrationszug stehen zu müssen, schien sie nicht aufzufallen. Zumindest sah sie keinen Beamten, der sie fixierte und vielleicht auch noch etwas in sein Mikro sprach. Andererseits wunderte es Nadja auch nicht, hatte sie sich doch lange genug Gedanken über das Outfit gemacht, das sie heute trug, bei dem Unauffälligkeit an erster Stelle stand.
»Ja, tadellos«, hörte sie ihren Gesprächspartner über den mit einem Clip an ihrem Ohr befestigten Lautsprecher antworten, den ihr darüberfallendes Haar verdeckte.
»Lauter bitte, Juri«, wiederholte sie, weil die Geräuschkulisse um sie herum wie in Wellen immer wieder aufbrauste und abebbte, je nachdem, welche Teilnehmergruppe gerade meinte, ihren Forderungen lautstark Nachdruck verleihen zu müssen.
»Ja!«, sagte er wieder, deutlich lauter.
»So ist es besser«, bestätigte sie mit leicht bebender Stimme. »Wie lange habe ich noch?«
»Etwa eine halbe Minute.« Nadja schluckte. Die Zeit verging viel zu schnell, trotz der Planänderung. Noch vor wenigen Wochen hatten sie vorgehabt, diese Aktion während einer ›Fridays for Future‹-Demo zu starten. Es war einfach zu verlockend: so viele potentielle Opfer aus gutsituierten Elternhäusern, ein frontaler Schlag mitten ins Gesicht der Eliten.
Die Seuche durchkreuzte ihren Plan. Doch sie ließen sich nicht davon entmutigen, sondern warteten geduldig die nächste Gelegenheit ab. Und die war mit der heutigen Hygiene-Demo gekommen. Warum haderst du dann mit dir?, fragte sie sich gedanklich. Du wolltest es doch so, also zieh es jetzt durch!
»Alles klar«, sagte sie nur und griff in ihre Handtasche. Nur noch wenige Reihen liefen vor ihr, sie hatte also den Kopf des Protestzuges erreicht. Der kleine Metallkasten in ihrer Hand fühlte sich kühl an. Langsam zog sie ihn hervor und streckte ihren Arm aus. Einige Leute um sie herum wichen von ihr, als würde sie ihnen suspekt vorkommen. Wenn ihr wüsstet, ging es Nadja durch den Kopf.
»Jetzt«, hörte sie Juri sagen, dann schloss sie die Augen und drückte auf den Knopf, den sie leicht erhaben auf der Vorderseite des Kästchens unter ihrem Zeigefinger spürte. Klick! Für einen Moment schien Nadjas Welt stillzustehen – dann brach die Hölle los ...
Kapitel 2
Zur selben Zeit, nordöstliches Brandenburg
Jetzt stand es unwiederbringlich fest: Richard Bruckmann war fort. Tot und begraben. Das heißt, nicht ganz, denn noch stand ich vor der offenen, an die zwei Meter tiefen Grube, in gebührender Distanz zu den weiteren Teilnehmern der Trauerfeier. Eineinhalb Meter Mindestabstand, so lautete eine der Regeln, die als Schutz dienen sollten gegen das verdammte Covid-19-Virus, das uns und die ganze Welt vor ein paar Monaten überrollt und immer noch im Griff hatte. Unser Landkreis war bislang von der Pandemie weitestgehend verschont geblieben, nur eine Handvoll Menschen hatte sich infiziert und alle waren gut durch diese Krankheit gekommen. Von daher war es eine logische Folge, dass die Einheimischen es nicht zu genau nahmen mit den noch verbliebenen Einschränkungen, mit denen uns die Regierung belegt hatte.
»Ist doch eh alles eine Erfindung von denen da oben«, sagten sie, »Bill Gates will uns alle chippen und später ermorden«, »Alles Fake-News« oder »Das Virus ist auch nicht gefährlicher als `ne Grippe.« Ich hatte keine Ahnung, wer richtig lag, ob wir ohne den sogenannten Lockdown ähnlich glimpflich durch die Pandemie gekommen wären, oder, wie einige Studien nahelegten, wir zehntausende Menschenleben allein in Deutschland durch die strengen Maßnahmen gerettet hatten. Wie auch immer, solange ich nicht mit irgendwelchen abstrusen Verschwörungstheorien belästigt wurde, ließ ich jede Meinung gelten.
Die Mittagssonne schien durch das Geäst der ehrfurchterregenden alten Ulme, die neben der Grabstelle in den Himmel ragte. Ihre Zweige wiegten sich im seichten Südwestwind, wodurch die Schatten wie tanzende Ameisen um die Grube kreisten. Das hätte ihm gefallen, dessen war ich mir sicher. Genauso, wie er die fast 30 Grad Celsius begrüßt hätte, mit der die Sonne erbarmungslos auf die vornehmlich in Schwarz gekleidete Trauergemeinde niederbrannte. Neben sicher vielen ehrlichen Tränen rannen so weitaus mehr Schweißtropfen über die Gesichter der Menschen, die sich zum letzten Geleit des Mannes eingefunden hatten, der vielen ein Freund, einigen ein Vorbild und mir stets ein guter Berater gewesen war.
Der Pfarrer richtete erneut das Wort an die Menschen, nachdem er in der Kapelle zuvor bereits eine angemessene Abschiedsrede gehalten hatte. Was genau er sagte, verstand ich nicht, beziehungsweise, ich hörte nicht hin, denn ich war mit meinen Gedanken abgeschweift, erinnerte mich an Situationen, die ich mit dem Mann vor mir im Sarg erlebt hatte.
Erst der Arm Isabells an meiner Taille ließ mich wieder ins Hier und Jetzt zurückkehren. Sie legte ihren Kopf an meine Schulter und drückte sich fest an mich. Auch meine Freundin hatte meinen Vater gemocht, wobei sie sich in den drei Jahren unserer Beziehung höchstens zehn oder zwölf Mal getroffen hatten.
»Wie geht´s dir, Lennard?«, fragte sie mich leise, kaum hörbar. Wie sollte es einem schon gehen, wenn der eigene Vater plötzlich und unerwartet starb, nachdem man als Einzelkind bereits seine Mutter verloren hatte? Fühlte ich mich einsam? Entwurzelt? Genau konnte ich es in diesem Moment gar nicht beschreiben, es war ein Sammelsurium von Emotionen, die sich seit der Nachricht seines Todes vor knapp zwei Wochen bei mir aufgestaut hatten.
»Okay«, antwortete ich deshalb lediglich. Isabell kannte mich gut genug, um sich im Augenblick damit zufriedenzugeben und mich nicht weiter zu bedrängen. Wie in Trance nahm ich in der Folge die anderen Trauergäste wahr, die nacheinander jeweils eine Schaufel Erde auf den Sargdeckel warfen, mir kondolierten und sich anschließend von der Grabstelle entfernten, bis sich am Schluss der Pfarrer von uns verabschiedete und neben mir nur noch Isabell und Philip standen. Da ich in den letzten Jahren in Berlin lebte und meinen Vater eher selten in unserem Heimatdorf in Brandenburg besucht hatte, war das Verhältnis zu den anderen Bewohnern merklich abgekühlt. Daher hatte ich mich gemeinsam mit Isabell gegen den hier üblichen Leichenschmaus entschieden, zu dem sonst Nachbarn und Freunde eingeladen wurden.
***
Mein Elternhaus kam mir seltsam fremd vor. Auch wenn ich hier meine gesamte Kindheit verbracht hatte, viele schöne, traurige, aber auch lustige Erlebnisse damit in Verbindung brachte, es war so gar nicht mehr dasselbe, wenn mein Vater nicht irgendwo herum zimmerte, in der Küche stand und Essen für uns zubereitete oder einfach ein philosophisches Gespräch über meine Zukunft mit mir auf der Veranda führte.
»Schade, dass Jonas nicht gekommen ist«, sagte Philip, während er die Kühlschranktür öffnete und eine Dose Bier herausholte. »Sonst noch jemand?«, fragte er, sie hochhaltend.
»Gern«, sagte Isabell, woraufhin er ihr die Dose zuwarf, die sie elegant auffing.
»Im Moment nicht«, erwiderte ich, ohne auf unseren Freund Jonas einzugehen, der sich seit dem Tod meinens Vaters weder hatte hören noch sehen lassen. Das wunderte mich allerdings auch nicht, denn wir hatten uns über die Zeit entfremdet und es musste Jahre her sein, dass ich ihn zufällig getroffen hatte. Getroffen, aber nicht gesprochen. Beim letzten Mal gingen wir nämlich lediglich aneinander vorbei und grüßten uns knapp. Durch meinen Wegzug nach Berlin zerbröckelten so ziemlich alle sozialen Verbindungen hier. Bei Philip sah es durch seine eher zwielichtigen neuen Bekannten, die ihm schließlich einen mehrmonatigen Knastaufenthalt eingebrockt hatten, nicht anders aus. Umso bemerkenswerter fand ich, dass er und Isabell sich gut verstanden, obwohl sie genau wussten, auf welche Art und Weise der jeweils andere den Lebensunterhalt verdiente. Isabell hatte mir diesbezüglich einmal verraten, dass es ihr komplett egal wäre, wenn er krumme Dinge drehte, auch wenn sie dadurch gegen eine Handvoll Dienstvorschriften verstoßen würde. Aufpassen müsste er nur, wenn er in ihrem Aufgabengebiet tätig werden oder zum Gewaltverbrecher mutieren würde. »Dann pack ich ihn an den Eiern«, hatte sie ernst gesagt und mit einer hochgezogenen Augenbraue hinzugefügt: »Du weißt, dass ich einen festen Griff habe.« Oh, ja, den hatte sie. Doch Philip neigte überhaupt nicht zur Gewalt, auch wenn er schon immer eine große Klappe hatte und durch seine kräftige Erscheinung bereits früher dafür gesorgt hatte, dass uns die älteren Jungs in Ruhe ließen. Und mit seinen Autoschiebereien – er war darin verstrickt gewesen, dass Luxuskarossen in Berlin gestohlen und zügig nach Polen und in die Ukraine zur weiteren Verwendung ›überführt‹ wurden – kam er Frau Polizeioberkommissarin Isabell Meyer nicht in die Quere, die bei der Drogenfahndung zu Hause war.
»Hast du denn noch Kontakt zu Jonas?«, wollte Isabell von Philip wissen.
»Nur sporadisch. Das letzte Mal hab ich ihn vor etlichen Wochen auf dem Sportplatz gesehen, als unser FC gespielt hat. Unterhalten hat er sich aber nicht mit mir.« Philip nahm einen großen Schluck. »Es geziemt sich für einen Studienrat wohl nicht, mit einem wie mir gesehen zu werden.«
»Er wird schon seine Gründe haben«, warf ich ein und bedeutete meinem Freund, mir jetzt doch ein Bier zu geben, was in der nächsten Sekunde in Form eines Dosengeschosses angeflogen kam. Es zischte, als ich die Lasche hochzog und der Schaum heraustrat. Ich schaffte es, das meiste davon abzutrinken. Nur wenig rann am Blech hinunter und tropfte auf die Holzdielen des Küchenbodens. Dann erhob ich den Arm: »Auf Richard Bruckmann.«
»Auf Richard Bruckmann«, sagte auch Philip, während er mit mir anstieß.
»Er war einer von den Guten und musste zu früh gehen«, fügte Isabell hinzu und sprach damit das aus, was wir alle dachten. Ihre Dose schepperte ebenfalls gegen unsere. Wie auf Kommando kippten wir den Gerstensaft gleichzeitig in uns hinein und nachdem Philip einen herzhaften Rülpser losgelassen hatte, wandte er sich mir zu.
»Was machst du mit der Bude? Willst du sie verkaufen oder vermieten?«
»Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das Haus zu verkaufen, hört sich aber momentan für mich doch sehr endgültig an.« Zwangsläufig hatte ich mir den Kopf über diese Frage schon zerbrochen, was allerdings damit zu tun hatte, dass mir ein paar Tage nach Paps Tod sein Bankberater von den Hypotheken erzählt hatte, die er in den letzten Jahren aufgenommen hatte, sodass Belastungen von etwa hunderttausend Euro darauf lagen. Ich hatte keine Ahnung, was mein Vater mit der Kohle angestellt hatte und wollte auch nicht darüber nachdenken. Aber ich hätte meiner Freundin davon erzählen sollen, soviel war schon mal klar. Nun gut, das würde ich nachholen.
»Lass dir damit noch Zeit«, riet mir Isabell. »Es ist schließlich dein Elternhaus, wenn du es verkaufst, verkaufst du damit auch einen Teil von dir. Glaub mir, ich weiß, wie sich das anfühlt.«
»Mh.« Ich stimmte ihr nickend zu. Es war keine hohle Phrase, denn meine Freundin wusste, wovon sie sprach. Ihre Eltern hatten sich getrennt, als sie ein Teenager war. Dadurch verloren sie schließlich die kleine Villa in der Nähe der U-Bahn-Station Nikolassee im Berliner Bezirk Steglitz-Charlottenburg an die Bank, da sie nach der Trennung trotz ihrer gutbezahlten Jobs die Raten nicht mehr aufbringen konnten. Das Brummen ihres Smartphones unterbrach meinen Gedankengang und ich beobachtete, wie ihr die Gesichtszüge entglitten.
»Was?«, rief sie aufgebracht ins Gerät und fuhr sich mit der Hand durch die langen, blonden Haare, die sie jetzt offen trug, nachdem sie sie auf der Beerdigung zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Ich sah besorgt von ihr zu Philip, der mit gerunzelter Stirn fragend zurückblickte, und wieder zu Isabell. »Mh, verstehe, mh, alles klar, ich mach mich sofort auf den Weg«, erklärte sie dem Anrufer und beendete das Gespräch. Kopfschüttelnd schaute sie vom Display hoch.
»Was ist los?«, fragte ich mit sorgenvoller Stimme.
»Ich muss zurück nach Berlin. Es gab einen Vorfall mit wahrscheinlich terroristischem Hintergrund.« Einen Vorfall? Einen Anschlag? Ohne Konkretes zu wissen, beschlich mich ein seltsames Gefühl der Hilflosigkeit. Spätestens seitdem Ende 2016 ein gestohlener Sattelschlepper über 50 Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg angefahren und dabei elf Menschen getötet hatte, war mir und wahrscheinlich den meisten Deutschen klar, dass uns der Terror endgültig erreicht hatte. Sicher, die Gedanken an 9-11, die Anschlagsserie in Paris 2015 oder den Anschlag in Tunesien, bei dem etliche Touristen am Strand erschossen worden waren, ließen mir noch immer einen Schauer den Rücken hinunterlaufen, dennoch hatten diese Geschehnisse etwas nicht Greifbares, Abstraktes. Ganz anders als ein Vorfall quasi vor meiner Haustür. Philip reagierte etwas schneller als ich.
»Aber du bist doch bei der Drogenfahndung?«
»Richtig«, erwiderte sie auf seinen Einwurf, »doch in so einem Fall werden alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Das verläuft nach einem strengen Protokoll, über das ich dir leider keine Details sagen darf.« Sie trat auf mich zu und nahm mich in den Arm. »Tut mir leid, Schatz, ich muss los.«
»Ja, natürlich, nimm ruhig den Wagen. Phil kann mich zur Bahn bringen. Deine Sachen bring ich dann heute Abend mit.«
»Danke«, sagte sie und gab mir einen kurzen Kuss. »Mach´s gut, Philip, bis zum nächsten Mal.«
»Hau rein und holt euch das Dreckschwein.« Wir schauten meiner Freundin hinterher, wie sie nach ihrer Lederjacke und der Handtasche griff und auf die Tür zuging, die von der Küche zur Hofauffahrt führte, auf der unser Wagen parkte. »Tolle Frau«, sagte er anerkennend, nachdem wir hörten, wie sie vom Hof fuhr.
»Hast du ihr etwa wieder auf den Arsch geguckt?«, stichelte ich.
»Wenn sie so damit vor mir herumwackelt«, gab er zurück. »Aber nun mach die Glotze an, ich will wissen, was da passiert ist.«
»Oh, ja klar, ich auch.« Wir gingen ins Wohnzimmer, wo ich den alten Röhrenfernseher anschaltete, den mein Vater noch nicht gegen einen modernen Flatscreen eingetauscht hatte. Offizieller Grund dafür war seine unumstößliche Auffassung, dass dessen Bild schärfer und besser wäre. Insgeheim war ihm sicher bewusst gewesen, dass es rein nostalgische Gründe waren, denn der Grünstich des Gerätes konnte auch ihm nicht verborgen geblieben sein. Nach einer kurzen Vorlaufzeit materialisierte sich ein Bild auf der gewölbten Glasfront.
»Es ist doch immer wieder ein Genuss mit diesem Gerät, wenn nur das nervige Rauschen nicht wäre«, erklärte Philip, ließ sich auf den Sessel fallen und legte die Füße auf den kleinen Hocker. Sein zufriedener Gesichtsausdruck gefror in dem Moment, in dem wir das Bild auf der Mattscheibe erkennen konnten. »Oh, mein Gott!«, entfuhr es ihm und sein Mund blieb offen stehen.
»Das kann doch nicht wahr sein!« Fassungslos verfolgte ich die TV-Aufnahmen. Aus der Vogelperspektive – wahrscheinlich wurde von einem Helikopter oder einer Drohne aus gefilmt – erkannte ich den Straßenring, der sich wie ein Schal um die Siegessäule legte. Das war es aber auch schon mit der Normalität. Hektisch wirkende Zivilisten, uniformierte und schwer bewaffnete Cops einer Hundertschaft, blinkende Lichter von wie an einer Perlenschnur aufgereihten Polizei- und Rettungswagen sowie die der Feuerwehr auf der einen, schwarzer Rauch, der aus zwei brennenden Reisebussen aufstieg, auf der anderen Seite, ließen die Szenerie wirken wie nach einem Flieger- oder Raketenangriff. So, wie man es sonst in den Nachrichten über Beirut, Kabul oder Palästina sah. Nur war es jetzt in meiner Heimatstadt – mitten in Berlin, dem Herzen der Bundesrepublik, der Stadt, die in Deutschland wie keine zweite für Offenheit und Vielfalt stand.
Überall auf der mehrspurigen Straße lagen Geröll und Fahrzeugteile herum, die offensichtlich von den Bussen stammten. Eine neugierige Menschenmenge drängte zur Unfallstelle, die Handys gezückt, bereit, ein paar möglichst schockierende Bilder oder Videos zu machen, um sie später Freunden in den sozialen Netzwerken zeigen zu können. Mich widerten sie an, diese verdammten Schaulustigen, und ich wünschte mir, die Cops würden mal richtig durchgreifen. Doch die hatten Mühe, den Pöbel von der Unglücksstelle fernzuhalten.
»Mach mal den Ton lauter«, sagte Philip und erst jetzt fiel mir auf, dass das Gerät stummgeschaltet war.
»... aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu zwei direkt aufeinanderfolgenden Explosionen zweier Reisebusse, die sofort danach Feuer fingen«, hörten wir die Nachrichtensprecherin sagen. »Nach Aussage der beiden Fahrer, die wie durch ein Wunder mit ein paar kleineren Brand- und Schürfwunden davongekommen sind, befanden sich zum Zeitpunkt der Explosionen keine Fahrgäste in den Bussen, teilte uns die Polizei mit. Die Teilnehmer der Hygiene-Demo, die heute planmäßig über die Straße des 17. Juni bis zum Reichstag ziehen wollten, um dort vor dem Bundestag zu demonstrieren, hatten die Fahrzeuge glücklicherweise noch nicht erreicht, als der Anschlag ausgeführt wurde. Somit ist nach momentanem Erkenntnisstand niemand zu größeren körperlichen Schäden gekommen. Einige Menschen wurden von herumfliegenden Fahrzeugteilen getroffen, wodurch es zu Prellungen und leichteren Schnittverletzungen gekommen ist. Die mit über 500 Einsatzkräften vertretene Polizei, die einen extremistischen Hintergrund nicht ausschließt, hat den Regierungsbezirk weiträumig abgeriegelt und in diesen Minuten sind Beamte mit Spürhunden damit beschäftigt, die Umgebung nach weiteren Gefahrenquellen abzusuchen. In wenigen Minuten erwarten wir eine Pressekonferenz des Innensenators, zu der wir live schalten werden.«
»Das ist doch Wahnsinn! Stell dir vor, die Leute wären gerade an den Bussen vorbeigelaufen, als die Bomben hochgegangen sind. Das hätte Tote gegeben.«
»Woher willst du wissen, dass es Bomben waren?«, fragte ich und kam mir selbst dämlich vor. Was hätte es sonst sein sollen, wenn zwei Busse gleichzeitig explodiert waren? Doch ich wollte es nicht wahrhaben, dass schon wieder Terror durch die Stadt gezogen war, wobei mich das überhaupt nicht wunderte, bei den ganzen Extremen: Rechte, Linke, Islamisten, Salafisten, Hooligans, Ostblockmafia, arabische Familienclans – scheinbar endlos war die Liste derer, die mir als Verursacher dieses Anschlags in den Sinn kamen.
»Dein Ernst?«
»Nein, natürlich nicht«, bestätigte ich kopfschüttelnd.
»Das Land geht vor die Hunde, sag ich dir.«
»Ach komm, wenn sich jeder mal etwas beruhigen und hinterfragen würde, ließe sich für die meisten Probleme eine Lösung finden«, antwortete ich mit meinem Optimismus, den einige für Naivität hielten, und wer weiß, vielleicht lagen sie damit auch richtig. Dennoch war ich nicht bereit, den Kopf in den Sand zu stecken.
»Ja, genau, Traumtänzer.« Philip sah mich mitleidig an. »Solange Männer die höchsten Positionen in den wichtigsten Regierungen dieser Welt besetzen, wird sich nichts daran ändern. Solange Macht, Geld, Religion und Testosteron der Antrieb sind, wird es immer schlimmer, glaub mir.« Natürlich lag er damit richtig. Ob es nun am Geschlecht lag, darüber konnte man streiten, aber ansonsten deckte sich das mit meiner Überzeugung: Die Politiker waren sich und den ihnen zugewandten Lobbyisten am nächsten, egal, was ihre eigenen Wähler dazu sagten. Aber ich hatte es längst aufgegeben, mich über diese Leute aufzuregen. Wie die meisten anderen meiner ostdeutschen Landsleute dachte ich, dass wir uns durch den Protest auf der Straße gegen die damalige Führung den Weg in die Freiheit erkämpft hatten, was im Großen und Ganzen ja auch so eingetroffen war. Doch niemand, den ich kannte, hatte damit gerechnet, dass uns der Kapitalismus mit seiner gnadenlosen Marktwirtschaft gesellschaftlich aushöhlen und an den Rand der Spaltung bringen würde. Auch wenn viele Freunde der wiedererstarkten Rechten Merkels Willkommensgeste von 2015 und den damit einhergegangenen Migrantenstrom dafür verantwortlich machten, wussten die meisten schon, dass die eigentlichen Spalter unseres reichen Landes in den Führungspositionen von Politik und Wirtschaft saßen. Davon jedenfalls war ich überzeugt, ohne mich diesbezüglich besonders zu engagieren oder gar dagegen anzukämpfen. Dafür war ich einfach nicht mehr der Typ. Ich mochte meinen Durchschnittsjob, fühlte mich in der 4-Zimmer-Wohnung in Wedding gemeinsam mit meiner überdurchschnittlich attraktiven Freundin wohl, kurzum: Mir gefiel mein Leben. Und dass man hin und wieder von Zweifeln belästigt wurde, war wohl normal und ging jedem so.
»Warten wir mal ab, was die gleich auf der Pressekonferenz dazu sagen.«
»Was schon? Die stochern im Dunkeln, werden versuchen, Panik in der Stadt zu verhindern, und wie üblich nichts ausschließen.«
Kapitel 3
Vor 15 Jahren
Es war einer dieser typischen Spätsommerabende auf unserer Veranda. Die schwüle Luft drückte und Bratwürste brutzelten neben den Steaks auf dem Rost. Jedes Mal, wenn mein Vater einen Schluck Bier darüber kippte, zischte und dampfte es wie verrückt und es roch so unglaublich lecker.
»Merk es dir, Lennard, erst das Bier gibt dem Grillfleisch den entscheidenden Kick«, sagte er immer wieder, als gehörte es zu seinem Vermächtnis und zählte zu den großen Errungenschaften des Universums.
»Okay, Paps, das mache ich«, erwiderte ich stets darauf und erntete dafür ein zufriedenes Lächeln von ihm. Früher hatte er oft gelacht, doch das hatte sich geändert, als meine Mutter vor einigen Jahren nach längerem Leiden einer Herzschwäche erlegen war. Wir vermissten sie sehr, doch ich versuchte, obwohl ich gerade mal zwölf Jahre alt war, ihm keine zusätzlichen Probleme zu bereiten. Deswegen strengte ich mich in der Schule an, versuchte, den üblichen Raufereien aus dem Wege zu gehen, und erledigte ohne zu Murren alles im Haushalt, was er mir auftrug.
Aber ich musste auch meine Grenzen austesten und eigene Erfahrungen sammeln. Das tat ich meist mit meinen Freunden Philip, Jonas und Jacqueline, die wir nur Jack nannten, da sie ihren Vornamen nicht mehr mochte, ihn vielmehr hasste, seitdem wir in der Schule den Film ›Der Schuh des Manitu‹ gesehen hatten. Wir besuchten alle dieselbe Klasse, wohnten nur ein paar Kilometer auseinander und verbrachten, wie jetzt in den Ferien, so gut wie jeden Tag gemeinsam.
»Hi, Herr Bruckmann«, riefen sie fast im Chor und ließen sich auf die Stühle neben mir fallen.
»Ach, da ist der Rest der Rasselbande ja«, begrüßte sie mein Vater und goss den nächsten Schluck Bier über das Fleisch. »Ihr habt Glück, es liegt genug für alle auf dem Grill.«
»Oh, klasse, Herr Bruckmann. Und wie das riecht«, sagte Jonas, dessen Lieblingsbeschäftigung Essen war, was man ihm auch ansah. Er griff nach einer Scheibe Brot. Die gute Laune von Jonas schien sich auf meinen Vater übertragen zu haben, denn er machte heute ausnahmsweise mal wieder einen zufriedenen Eindruck. Fast erinnerte es mich an damals. Es fehlte nur noch meine Mama, die mit einem, sich gefährlich neigendem Turm dampfender Waffeln aus der Küche kam, den sie einhändig auf einem Teller balancierte, wo er allerdings vom Sirup zusammengehalten und dadurch vom Umfallen abgehalten wurde. Auch meine Freunde hatten meine Mutter geliebt. Natürlich, warum hätte man diese herzensgute und meist gut gelaunte Frau auch nicht mögen sollen? Meine Freunde und Außenstehende bekamen es nicht mit, wenn sie sich wieder einmal stundenlang ins Schlafzimmer zurückgezogen, sowohl Tür als auch Fensterläden geschlossen hatte. An solchen Tagen war es damals für mich schon so gewesen, als würde sie nicht mehr da sein. Paps munterte mich dann immer damit auf, dass es Mama bald wieder besser ginge. Jack zupfte an meinem Ärmel und holte mich aus den Gedanken. Sie deutete zu meinem Vater, der uns der Reihe nach ansah.
»Und, was gedenkt eure Gang heute noch anzustellen?«
»Nichts, Paps«, sagte ich schnell, vielleicht etwas zu schnell.
»Nein, überhaupt nichts«, bestätigte Jack und warf mir einen verstohlenen Blick zu. Das machte sie ab und zu, doch heute fühlte es sich anders an. Es kribbelte plötzlich komisch in meinem Bauch. Natürlich wusste ich, was das bedeutete, doch ich versuchte, mir eindringlich einzureden, dass ich nur Hunger und dieses Gefühl auf gar keinen Fall mit den Rundungen zu tun hätte, die sich seit kurzer Zeit unter Jacks Klamotten abzeichneten. Schließlich waren wir vier die besten Freunde und ich hatte große Zweifel daran, dass es unsere Freundschaft aushalten würde, wenn Jack mit mir, Jonas oder Philip Sachen machen würde, die Mädchen und Jungs in unserem Alter nun mal ausprobierten. Nein, dazu dürfte es nie kommen.
»Wir wollen nur noch zu – ey, aua!« Philip konnte Jonas durch einen Tritt vor das Schienbein gerade noch rechtzeitig davon abhalten, unsere Pläne auszuposaunen.
»Paps, können wir die Petroleumlampe mitnehmen? Wir wollen unsere unterirdische Bude heute einweihen.« In den letzten Wochen hatten wir ein beachtliches Loch in den harten Waldboden gegraben und schon ein paar geeignete Sitzmöbel dort hintransportiert, die wir zu Hause aus den Schuppen und den Dachböden entwendet hatten. Heute wollten wir zumindest den Großteil der Nacht dort verbringen und dazu benötigten wir Licht.
»Ihr wisst schon, dass es seit Wochen nicht geregnet hat?«
»Ja, Herr Bruckmann«, erwiderte Philip, der meist unser Wortführer war. »Wir werden höllisch aufpassen und keinen Waldbrand auslösen.«
»Genau, Paps, außerdem fließt der Bach doch nur ein paar Meter neben der Bude.« Mein Vater nickte verständnisvoll und wandte sich wieder dem Essen zu. Wir vier tauschten verschwörerische Blicke aus, denn bevor wir unsere Bude einweihen würden, hatten wir noch etwas anderes vor.
***
Meine Augen klebten an Jack, die neben Philip vor mir und Jonas herlief, lachend und sich hin und wieder mit ihm stupsend. Sie benahm sich irgendwie komisch heute. Schon vorhin, als sie mir diesen seltsamen Blick zugeworfen hatte – und nun das übertrieben alberne Getue mit Philip. Eifersüchtig war ich nicht, jedenfalls nicht direkt, denn ich war mir supersicher, dass eine unausgesprochene Einigkeit zwischen uns bestand, dass niemand von uns jemals etwas mit Jack anfangen würde. Abgesehen davon dachte ich nicht einmal im Traum daran, dass sich irgendein Mädchen für mich entscheiden könnte, wenn der größere, kräftigere und deutlich älter wirkende Philip die Alternative wäre. Gegen Jonas würde ich mich wahrscheinlich durchsetzen können, redete ich mir damals ein, um mich selbst aufzubauen. Jonas schien meine Einschätzung zu teilen, denn wegen des Übergewichts litt sein Selbstbewusstsein doch arg und die anderen Jungs in der Schule, vor allem die älteren, machten es nicht besser, indem sie ihm immer mal wieder einen Spruch deswegen reindrückten. Was sie natürlich tunlichst unterließen, wenn ich und vor allem, wenn Philip in seiner Nähe waren.
»Findest du das gut?«, flüsterte er mir zu und deutete zu den beiden, die immer noch etwas herumblödelnd vor uns hergingen.
»Was meinst du?«, stellte ich mich dumm. Natürlich fand ich es nicht gut, aber mir war klar, dass es den Anfang vom Ende bedeutete, wenn wir daraus erstmal ein Thema machen würden. Was zwischen den beiden ablief, wenn ich es nicht mitbekam, war mir egal. Wenn wir es aber ansprächen, würde jeder den anderen anschreien, bis entweder Jack die Flucht antreten und die Gang verlassen würde oder sie richtig mit unserem Wortführer zusammenkäme, wodurch unser Team ebenfalls gesprengt wäre. Und ich wollte weder das eine noch das andere. Sie waren meine Freunde, meine Gang, und ich würde den Teufel tun, das aufs Spiel zu setzen.
»Na, dass die beiden so rummachen«, erklärte er überflüssigerweise. Bevor ich darauf reagieren konnte, warf uns Jack einen Blick über ihre Schulter zu.
»Wer zuerst da ist«, rief sie keck und lief los.
»Umpf«, hörte ich Jonas stöhnen, doch im nächsten Moment rannte er los, an mir und Philip vorbei, und heftete sich an Jacks Fersen. Philip sah ihnen hinterher und dann abschätzend zu mir. Wir konnten in etwa gleich schnell rennen, auf jeden Fall deutlich schneller als Jonas und Jack, und es waren noch dreihundert oder vierhundert Meter bis zu unserer selbstgebauten Unterkunft.
»Lauf schon«, sagte ich herausfordernd und spürte, wie meine Muskeln sich anspannten, bereit, ihm sofort nachzujagen.
»Komm schon, ich geb dir Vorsprung.«
»Pff«, grunzte ich und grinste ihn schräg an, sah aus den Augenwinkeln die beiden anderen, die gerade hinter der kleinen Anhöhe zwischen den Bäumen verschwanden. Lässig winkte ich ab. Philip reagierte darauf genauso, wie ich es erwartet hatte. Er lachte und schüttelte den Kopf. Jetzt oder nie, sagte ich mir und nutzte diesen kurzen Moment seiner Unachtsamkeit, wodurch ich einen Vorsprung von einigen Metern gewann, bis er begriff und ebenfalls startete.
»Du Hund!«, hörte ich ihn hinter mir rufen, während meine schnellen, kurzen Schritte vom weichen Waldboden abgefedert wurden und nur hin und wieder ein Knacken ertönte, wenn ich einen Zweig oder Ast erwischt hatte. Vor mir hörte ich Jack und Jonas lachen. Sie liefen fast nebeneinander und es war so gut wie ausgeschlossen, dass ich sie vor der Bude noch einholen würde. Was mir recht war, solange ich meinen dritten Platz nicht doch noch an Philip verlor, dessen Atem ich immer lauter hinter mir hören konnte.
»Jaaaa!«, rief Jonas triumphierend aus. Er hatte es geschafft, seinen Fuß einen Augenblick vor Jack auf die vor unserer Bude im Boden verlaufende Kiefernwurzel zu setzen, die als Ziellinie für unsere Wettrennen diente. Ich gönnte ihm diesen Sieg.
»Ich krieg dich!«, hörte ich Philip jetzt bedenklich nah an meinem Ohr, was mir den letzten Push gab. Ich machte drei, vier Sätze und lief als Dritter ein. Vor Erschöpfung schmiss ich mich keuchend auf den Boden. Im nächsten Moment warf sich Philip auf mich und direkt danach folgten Jack und Jonas. Ein paar Minuten dauerte die spielerische Rauferei, bis wir – vollkommen außer Atem und mit Laub behaftet – die Klappe hochzogen und nach unten stiegen. Durch ein paar Ritzen zwischen den Baumstämmen fiel Licht hinein, sodass wir nicht komplett im Dunkeln saßen, obwohl die Dämmerung bereits eingesetzt hatte. Wir hatten die Äste wie bei einem Floß mit Hanfseilen zusammengebunden, eine Plane darunter befestigt, sie dann über die Grube gelegt und das meiste mit Moos und Laub abgedeckt. So würde es drinnen auch dann trocken bleiben, wenn wir ein paar Regentage bekommen sollten.
»Wer hat die Hölzer?«, fragte Philip.
»Ich nicht«, sagte Jonas sofort und auch Jack verneinte.
»Leute, dass kann doch nicht –«, begann ich, doch das zischende Geräusch des Streichholzes, das Philip an der Schachtel entzündet hatte, ließ mich verstummen. »Idiot«, sagte ich nur, als ich sein Gesicht in dem Flackern sah.
»Macht euch mal locker«, sagte er kichernd und im nächsten Moment erhellte das Licht der Petroleumlampe das unterirdische Reich, in dem wir auf den mitgebrachten Hockern und übereinandergelegten Wolldecken saßen. Wir kramten unsere mitgebrachte Verpflegung aus den Rucksäcken und häuften Chips, Schokolade und Salzstangen in der Mitte zwischen uns auf, daneben platzierten wir Cola- und Wasserflaschen.
Lange dauerte es nicht, bis nur noch ein paar Chipskrümel übriggeblieben waren. An sich hätten die Knabbereien länger gehalten, doch wenn Jonas in der Nähe war, mussten wir anderen uns schon ranhalten, um zumindest einen Teil davon abzubekommen. Es faszinierte mich, wenn ich sah, welche Massen an Essen mein Freund verdrücken konnte. Andererseits war ich froh darüber, dass mich ein Sättigungsgefühl davon abhielt, so viel zu essen, dass ich auseinanderging wie ein Hefeteig.
Philip legte seine Jacke über die Lampe, sofort wurde es dunkel. Nur ganz schwach schien es rot durch den dicken Stoff der Jacke.
»Es ist stockfinster«, sagte er und nachdem wir seinem Blick nach oben gefolgt waren und ebenfalls erkannt hatten, dass wir zwischen den Ästen draußen nichts mehr sehen konnten, stimmten wir ihm murmelnd zu. Philip nickte, nahm die Jacke wieder von der Lampe, drehte stattdessen am Rädchen die Flamme und somit die Helligkeit herunter.
»Dann können wir ja loslegen«, flüsterte Jack, wobei sie uns nacheinander ansah, auf jedem unserer Gesichter einige Sekunden verharrend. Ich hielt den Augenkontakt nur einen Moment und erschrak fast, da das schwache Licht ihre Haut gespenstisch blass wirken ließ. Zum ersten Mal an diesem Abend durchlief mich ein seltsames, mir unbekanntes Gefühl, eher eine Vorahnung, die mir sagte, dass etwas Schlimmes passieren würde. Ich schüttelte mich von den anderen unbemerkt, stand auf und folgte ihnen aus der Höhle.
»Seid ihr bereit, Freunde?«, wollte Philip wissen. »Gut, dann los«, zischte er, nachdem wir zustimmend genickt hatten, und setzte sich Richtung Nordosten in Bewegung. Übertrieben leise folgten wir ihm, obwohl uns außer Hasen, Rehen oder einem durch die Wälder streifenden Luchs eh niemand hören würde. Jedenfalls noch nicht. Bald hingegen, an unserem Ziel, würden wir gut damit beraten sein, die Klappe zu halten und keinen Mucks zu machen. Ich lief als Letzter hinter den anderen her, bildete die Nachhut, so wie eigentlich immer. Nur Jack und Jonas tauschten hin und wieder die Positionen, wobei ich es heute durchaus begrüßte, dass Jack direkt vor mir durch das Dickicht schlich und ich somit ihren etwas runder gewordenen Po die ganze Zeit vor Augen hatte – sofern ich ihn wegen der Lichtverhältnisse noch erkennen konnte.
Kapitel 4
Heute
Obwohl sie auf direktem Weg zur Dienststelle gefahren und die Straße überraschend frei gewesen war, kam Isabell als eine der Letzten an und verpasste dadurch die Einweisung durch ihren Dienststellenleiter. Sie hatte gerade die Tür zum Besprechungsraum erreicht, da wurde sie nach innen geöffnet und dicht hintereinander hergehend strömten die Kolleginnen und Kollegen an ihr vorbei nach draußen, wobei niemand großartig Notiz von ihr nahm. Erst Paul Kellermann hob grüßend den Kopf und bedeutete ihr, ihm zu folgen.
»Na, ausgeschlafen?«, neckte er sie und fügte hinzu, dass er ihr alles unterwegs erklären würde. Isabell machte auf dem Absatz kehrt und ging neben ihm durch das Gebäude bis hinunter zur Tiefgarage, wo sie für sie etwas überraschend in einen Streifenwagen stiegen. In knappen Sätzen gab er wieder, was der Dienststellenleiter ihnen gerade aufgetragen hatte. Detailliert genug für Isabell, die grob mit dem Plan für ein derartiges Szenario vertraut gewesen war und insgeheim schon viel früher mit dem Eintreten eines solchen Falles gerechnet hatte.
Sie sollten eine ihnen zugewiesene Route auf- und abfahren und die Augen nach verdächtigen Dingen und Personen aufhalten, die im Zusammenhang mit den Explosionen stehen könnten. Alle Auffälligkeiten sollten dann an eine Einheit weitergegeben werden, die gerade noch von ganz oben zusammengestellt wurde. Nach wenigen Minuten hatten sie den Bezirk erreicht, in dem sie patrouillieren sollten, und befuhren so langsam, wie es der Verkehr zuließ, den rechten Fahrstreifen.
»Glaubst du auch nur ansatzweise, dass wir hier jemanden sehen, der noch mit dem Zünder der Bombe in der Hand durch die Gegend wetzt oder der ein Schild um den Hals trägt, auf dem er sich selbst der Tat bezichtigt?« Paul spuckte die Worte mehr aus, als sie zu sprechen. Falls ein Restzweifel daran bestanden hatte, ob er diesen Einsatz als sinnvoll erachtete – war er spätestens jetzt beseitigt. Bei freier Fahrt trennten sie etwa zehn Minuten Autofahrt oder dreißig Minuten schneller Fußweg vom Ort der Explosionen, doch hier war es wie immer. Die wenigen Passanten liefen unaufgeregt umher, die Vögel zwitscherten und auf einem angrenzenden Rasenplatz bolzten etwa fünf Jungs mit einem leuchtend gelben Ball, als ob es den Anschlag – die Faktenlage wies immer deutlicher darauf hin – vorhin gar nicht gegeben hätte.
»Na klar«, erwiderte Isabell ironisch, »und in seiner mitgeführten Aktentasche werden wir sämtliche Daten finden, mit deren Hilfe die Kollegen vom Staatsschutz alle noch inaktiven Terrorzellen ausheben können. Zudem werden wir beide mit der Ehrenmedaille des Bundeskriminalamts in Blech ausgezeichnet.« Langsam wandte sie den Kopf zu Paul und lächelte. »Komm schon, wir wissen doch beide, dass wir hier nur herumfahren, um Präsenz zu zeigen. Niemand erwartet von uns Drogenfahndern, dass wir auf Terroristenjagd gehen.«
»Jaah«, sagte er gedehnt, »deswegen müssen wir ja auch mit `nem Streifenwagen herumfahren. Das macht die ganze Tarnung zunichte.« Isabell lachte laut auf.
»Du meinst die Tarnung, die wir für unsere Undercover-Einsätze brauchen? Die, die wir zuletzt vor sagen wir mal fünf Jahren gemacht haben?« Sie dachte lächelnd an die alten Zeiten zurück, in denen sie direkt im Milieu recherchiert, sich über Kleindealer langsam an die dickeren Fische herangearbeitet und ein paar davon für längere Zeit hinter schwedischen Gardinen verschwinden lassen hatten. Das Lächeln verschwand jedoch so schnell, wie es auf ihren Lippen erschienen war, denn mit Spaß hatte diese Arbeit nur selten etwas zu tun gehabt. Im Gegenteil: Sie war von großem Leid und ausgeprägter Brutalität gezeichnet. Mehr als einmal war sie unfreiwillig Zeugin geworden, wie vermeintlich unzuverlässigen Dealern die Hand oder der Kiefer gebrochen wurde – als Warnung, die von den meisten verstanden worden war. Eingreifen können hätte sie nur unter Aufgabe ihrer Tarnung, was sie jedoch selbst in große, vielleicht sogar in Lebensgefahr gebracht hätte. So hatte Isabell nach drei zermürbenden, psychisch anstrengenden Jahren inkognito um den Wechsel in den regulären Dienst gebeten. Dass ihrem Wunsch entsprochen wurde, war nur Formsache, und so bildete sie seit dieser Zeit ein Team mit Paul, der kurz vor ihr aus dem Undercovereinsatz ausgeschieden war. Für beide war es beruhigend, als sie im Nachhinein feststellten, dass sie sich undercover mehrfach über den Weg gelaufen waren, ohne über die Tätigkeit des jeweils anderen Bescheid gewusst zu haben. Somit gab es zumindest in dieser Zeit kein Leck in ihrer Dienstelle, was die verdeckten Ermittlungen anging.
»Was hat die denn?«, riss er Isabell aus ihren Gedanken. Sie folgte seinem Blick und sah eine brünette, langhaarige, in ein beiges Sommerkleid gehüllte Frau, das deren sportliche Figur und perfekte Rundungen betonte. Was nicht zu dem eleganten Eindruck passte, war der Gang, mit dem sie den Gehweg entlang schwankte, als ob sie jeden Moment der Länge nach fallen würde. Isabells erster Impuls war, auszusteigen und der Schwankenden zu Hilfe zu kommen, doch Paul hielt sie davon ab, indem er seine Hand auf ihren Unterarm legte. Wieder folgte sie seinem Nicken, bis auch sie den Mann im Anzug erblickte, der sich gerade bei der Frau unterhakte und ihr damit offenbar den nötigen Halt gab. Sein Griff schien sehr stabil zu sein, denn augenblicklich straffte sich die Frau und das Schwanken war vorbei. Fast sah es aus, als wollte sie sich von ihm lösen, doch nach wenigen Schritten entspannte sie sich und sie gingen nebeneinander weiter. »Komisches Paar«, beantwortete Paul seine eigene Frage, wartete eine Lücke ab und fädelte wieder in den fließenden Verkehr ein.