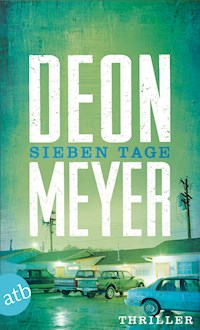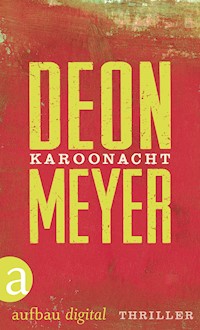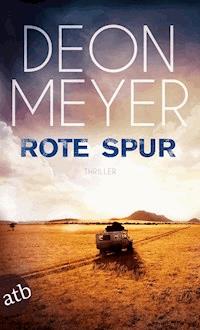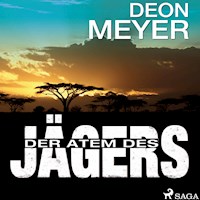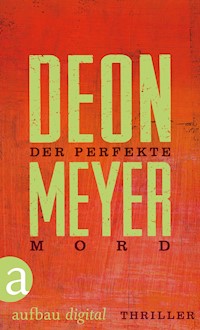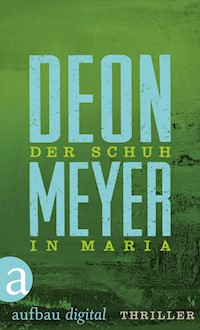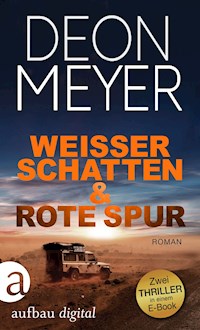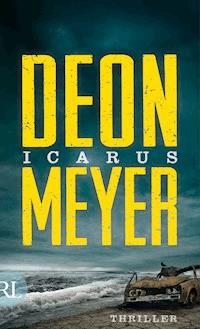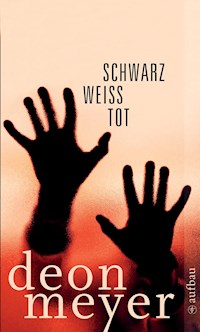
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Superintendent John October hat vor elf Jahren einen tödlichen Fehler begangen. Seitdem sitzt er abgeschoben im Archiv. Bis ein junges Mädchen auftaucht und behauptet, zu wissen, wer ein Ehepaar vor vielen Zeugen umgebracht hat, ohne selbst gesehen zu werden... Wie in seinen Romanen gelingt es Deon Meyer auch in seinen packenden Storys, einen tiefen Blick in das moderne Südafrika zu werfen. In sechs Geschichten führt uns Meyer in seinen Kosmos ein. Dem Bodyguard Lemmer begegnet der Leser hier genauso wie dem alkoholkranken Polizisten Griessel. In "Auszeit", schon beinahe einem Kurzroman, zeigt Deon Meyer, dass er nicht nur ein überragender Chronist der südafrikanischen Gesellschaft ist, sondern dass er auch mit Raum und Zeit zu spielen versteht. "Einer der besten Krimiautoren weltweit." Antje Deistler, WDR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über Deon Meyer
Deon Meyer, Jahrgang 1958, Rugby-Fan und Mozart-Liebhaber, ist der erfolgreichste Krimiautor in Südafrika. Er begann als Journalist zu schreiben und veröffentlichte 1994 seinen ersten Roman. Er lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Melkbosstrand.
Als Aufbau Taschenbuch liegen vor: »Der traurige Polizist«, »Tod vor Morgengrauen«, »Das Herz des Jägers« und »Der Atem des Jägers«. Im Verlag Rütten & Loening erschien zuletzt: »Weißer Schatten«.
Deon Meyer wurde bereits zweimal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.
Informationen zum Buch
Superintendent John October hat vor elf Jahren einen tödlichen Fehler begangen. Seitdem sitzt er abgeschoben im Archiv. Bis ein junges Mädchen auftaucht … Sie behauptet, zu wissen, wer ein Ehepaar vor vielen Zeugen umgebracht hat, ohne selbst gesehen zu werden.
Wie in seinen Romanen gelingt es Deon Meyer, auch mit seinen packenden »Storys« tiefe Einblicke in das moderne Südafrika zu gewähren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Deon Meyer
Schwarz. Weiß. Tot.
Storys
Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer
Inhaltsübersicht
Über Deon Meyer
Informationen zum Buch
Newsletter
Karoonacht
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Der perfekte Mord
Das Nostradamus-Dokument
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Verschwunden
Der Schuh in Maria
Auszeit
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Anhang
Zu den Geschichten
Karoonacht
Das Schwein von Okkie Wiehahn
Der perfekte Mord
Das Nostradamus-Dokument
Verschwunden
Der Schuh in Maria
Auszeit
Glossar mit Erklärungen der afrikaanssprachigen Wörter und anderer Begriffe
Impressum
Karoonacht(Karoonag)
1.
Sonntagmorgen, zwei Uhr. Das Jaulen eines Motors riss mich aus dem Schlaf, zu hochtourig, zu nahe, zu verzweifelt für dieses Dorf, diese Uhrzeit.
Das Knirschen der Räder auf dem frühmorgendlichen Reif, das hohe, dünne Quietschen verdreckter Bremsen auf der unbefestigten Straße vor dem Haus – schon sprang ich auf und griff unters Bett nach der Glock 37. In einem ersten Impuls wollte ich zur Hintertür hinausschlüpfen, um sie von hinten zu überraschen. Doch neben mir lag Emma in tiefem Schlaf, und sie zu schützen war jetzt das Allerwichtigste.
Hastige Schritte auf der vorderen Veranda. Ich rannte los, in den Flur, zur Haustür, wartete an die Wand gepresst.
»Lemmer!«, rief jemand von draußen und hämmerte gegen die Tür. »Ich bin’s, Willie!«
Willie Bruwer, Berufsjäger, Loxtons höflicher Schlachter. Klang ganz nach einem Notfall. Ich schloss die Tür auf, verbarg die Pistole hinter meinem Rücken und öffnete. Die Kälte schlüpfte herein wie ein ungebetener Gast.
»Farmüberfall!«, sagte Willie. »Wir brauchen dich!« Seine Haare waren zerzaust, er schien auch gerade aus dem Bett zu kommen. Vorne hielt er seine dicke Jacke mit beiden Händen fest zusammen.
»Wo?« Ich versuchte, mir die Erleichterung nicht anmerken zu lassen.
»Bontfontein. Die Familie von Lucien.«
Meine Erleichterung schlug in Empörung um, dann in Wut.
»Fahr schon mal los! Ich trommle noch mehr Leute zusammen.«
Ich wollte fragen, ob es Tote gegeben hatte, aber er rannte zu seinem Pick-up.
»Bin unterwegs!«, rief ich ihm nach, aber er hob nur die Hand, riss die Autotür auf. Als die Innenbeleuchtung ansprang, sah ich die Gewehre in der Fahrerkabine. Dann setzte auch ich mich in Bewegung.
Ich holte meine Kopflampe aus der Küche, nahm – ohne Emma zu wecken – ein paar Kleidungsstücke aus dem Schlafzimmerschrank und zog mich vor dem bullernden Aga-Kohleofen an. Hastig hinterließ ich Emma eine gekritzelte Nachricht, steckte die Glock in die Tasche meiner Cape-Storm-Jacke, griff nach dem Schlüssel, ging zur Vordertür raus und schloss hinter mir ab. Die schief hängenden Wellblechtüren quietschten in den uralten Angeln, als ich die Garage öffnete. All das hätte schon längst ersetzt werden müssen. Aber zuerst musste ich jetzt meinen neuen Ford-Pick-up abzahlen, denn die zarte, so unschuldig aussehende junge Frau in meinem Bett hatte den alten Isuzu zerlegt, in der Kurve vor Jakhalsdans. Emma le Roux, ehemals meine Klientin, jetzt meine Geliebte, war gottlob ohne eine Schramme aus dem Wrack geklettert.
Ich ließ den Ranger an, und der V6 erwachte bereitwillig zum Leben. Dann drehte ich die Heizung auf und fuhr los.
Nachdem ich das Dorf verlassen hatte, wölbte sich ein grandioser Sternenhimmel über mir. Doch ich gönnte dem Schauspiel nur einen kurzen Blick und bog dann in Richtung Fraserburg ab. Am Modderrivier war die Eisdecke über der Furt bereits gebrochen. Ich war nicht der Erste, der hier an jenem Morgen den Fluss durchquerte. Am anderen Ufer gab ich Gas. Ich befürchtete das Schlimmste, und ich war wütend. Ausgerechnet Lucien und Grethe!
Auch wenn ich mit den beiden nicht befreundet war, kannte ich ihre Geschichte, die man sich überall in der Bo-Karoo mit einer gewissen Selbstzufriedenheit erzählte. Der Zufall hatte die beiden vor zehn Jahren zusammengeführt. Grethe, eine Großstädterin aus Europa mit einem Magister in Literaturwissenschaft, war aus Berlin angereist, um ihre Freundin zu besuchen, die hier als Biologin Uferkaninchen erforschte. Lucien war auch gerade am Kap, und es ergab sich eine Mitfahrgelegenheit, in letzter Minute geregelt. Und so waren er und Grethe sich in einem klapprigen Land Cruiser zwischen Hexriviertal und Nuweveldbergen in gebrochenem Englisch nähergekommen. Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts ließ sich Grethe von der herrlichen Landschaft, den Menschen und ihrem naturverbundenen Leben bezaubern – und von der erwachenden Liebe eines aufrichtigen Mannes.
Sie waren im Distrikt nicht das einzige schöne Paar um die dreißig mit zwei süßen Kindern. Aber man betrachtete sie als Symbol, als Aushängeschild für die Vorzüge Loxtons und seiner Bewohner. Vor allem Grethe galt als der lebende Beweis dafür, dass diese trockene, gottverlassene Gegend gut genug war, um eine gebildete, weitgereiste Weltbürgerin wie sie anzulocken. Inzwischen sprach sie fließend Afrikaans, mit einem entzückenden Akzent. Sie konnte ein Schaf in sieben Minuten scheren und backte die leckersten Koeksisters weit und breit. Sie hatte das Leben hier vorbehaltlos akzeptiert, und dafür hatte Loxton sie mit offenen Armen empfangen.
Für mich verkörperte sie überdies die Hoffnung, auch eines Tages dazuzugehören. Ja, ich war erleichtert gewesen, als Willie vor meiner Tür gestanden hatte. Erstens, weil es keine Schatten aus der Vergangenheit waren, die mich heimsuchten, und zweitens, weil er sich an mich wandte, mich mit einbezog, denn schließlich galt ich hier noch immer als Außenseiter. Seit Emma mein Leben teilte, war es zwar etwas einfacher für mich geworden. Sie verkörperte eine gewisse Normalität und Beständigkeit und kompensierte mein ansonsten ungewöhnliches Verhalten, das mein Beruf mit sich brachte. Ich arbeitete als freiberuflicher Leibwächter, übte einmal pro Woche mit Handfeuerwaffen auf dem Schießstand von Loxton, trabte in der Dämmerung über die unbefestigten Straßen, war oft wochenlang fort und kehrte manchmal mit erkennbaren Verletzungen wieder zurück.
Erleichterung – zum ersten Mal konnte ich mich hier nützlich machen. Auch wenn das eine Verletzung von Lemmers erstem Gebot bedeutete: Du sollst dich nicht einmischen.
Hinter der Abzweigung nach Welgevonden sah ich bei hundertsechzig Sachen die Augen einer sprungbereiten Antilope vor mir am Straßenrand aufleuchten.
»Bleib stehen!«, flüsterte ich, denn ich hätte nicht rechtzeitig bremsen können.
Sie hörte auf mich, schlüpfte mit dem Kopf zuerst durch den Absperrzaun, als ich vorbeiraste, und verschwand mit einem Satz in der Nacht.
Kurz vor Juriesfontien ging ich wegen der scharfen Kurve vom Gas und beschleunigte beim Herausfahren wieder, als mir plötzlich zwei Pick-ups den Weg versperrten. Grelle Scheinwerfer blendeten mich.
Ich kämpfte mit der Servolenkung, trat voll auf die Bremse, kam inmitten einer Staubwolke zum Stehen und fluchte, denn die Glock steckte noch in meiner Jackentasche. Bevor ich sie ziehen konnte, stand schon ein Mann mit Jagdgewehr im Anschlag vor meinem Fenster.
Gleich darauf erkannte ich ihn und ließ die Hand sinken.
»Lemmer«, sagte Joe van Wyk junior ruhig, als ich die Scheibe herunterließ. Neben ihm stand Nicola van der Westhuizen. Junge Farmer, gewappnet gegen die Kälte, ernste Gesichter.
»Gibt’s was Neues, Joe?«
»Sie haben Grethes Vater«, sagte er. Sein Atem kondensierte in der eisigen Nachtluft zu weißen Wölkchen. »Wir blockieren die Straßen.«
Bevor ich weiterfragen konnte, unterbrach uns Nicola. »Da kommt noch jemand.«
Joe blickte an mir vorbei die Straße hinunter. Dann sagte er mit einer breiten Armbewegung: »Fahr einfach um uns herum! Sie erwarten dich auf Bontfontein.«
Ich nickte, ließ die Pick-ups links liegen und lenkte den Ranger wieder zurück auf die Straße.
Sie haben Grethes Vater.
Was hatte das zu bedeuten?
Zwei Fahrzeuge standen auf dem Hof von Bontfontein. Keine Polizei. Lampen erhellten den gepflegten Garten, den vom Raureif schneeweißen Rasen.
Ich stieg aus und ging über den Schieferplattenweg auf die Haustür zu. Etwas Goldenes, Metallisches glänzte auf dem Boden. Patronenhülsen. Zwölf, fünfzehn Stück. Ich bückte mich und hob eine auf. Kurz. Dick. 9x19 Luger. Seltsam. Ich richtete mich auf, als zwei Männer das Haus verließen. Tickey van Wyk und Martin Scholtz, beide mit einem Gewehr bewaffnet.
»Abend, Lemmer.« Sie schüttelten mir hastig die Hand. »Gut, dass du da bist. Wir fahren los, die Kreuzung in Grootfontein blockieren.« Martin deutete in Richtung Fraserburg, drehte sich um und eilte zu seinem Pick-up.
Neben der offenen Haustür sah ich die Einschusslöcher in der Wand. Kein großes Kaliber. Die regelmäßigen Einschläge einer automatischen Waffe. 9x19 Luger? Eine Maschinenpistole?
Ich ging hinein. Grethe saß auf dem Wohnzimmersofa, die beiden Kinder auf dem Schoß. Sie weinte, nahm mich kaum wahr. Weiter hinten am großen Esszimmertisch aus Oregon-Kiefer saß Lucien mit dem Funkgerät in der Hand vor einer großen Karte. Ich unterdrückte einen Seufzer der Erleichterung. Sie lebten!
Luciens Blick fiel auf mich. »Okay, Joe«, sagte er in das Funkgerät, »over and out.« Er erhob sich, begrüßte mich mit ausgestreckter Hand. »Lemmer.«
Ich ging auf ihn zu und nahm seine Rechte.
»Sie haben Grethes Vater«, sagte er, noch immer fassungslos und schockiert.
»Ich hab’s schon gehört.«
Lucien blickte mich schweigend an. Zunächst verstand ich seine Reaktion überhaupt nicht, bis ich seine erwartungsvolle Miene sah. Ich dachte an Joes Worte: Sie warten auf dich. Und an die von Martin Scholtz: Gut, dass du da bist. An Willie, der gesagt hatte: »Wir brauchen dich.« Das konnte nur eines bedeuten: Sie wollten, dass ich etwas unternahm. Sollte ich die Führung übernehmen? Ihnen Ratschläge erteilen? Oder hatten sie doch etwas über meine Vergangenheit herausgefunden – den Totschlag, die Gefängnisstrafe –, worüber nicht einmal Emma Bescheid wusste? Ich versuchte, in Luciens Gesicht zu lesen, sah aber nichts als Vertrauen. Vielleicht war es auch viel simpler. Eine bloße Assoziation mit privaten Sicherheitsdiensten.
Lass es nicht zu sehr an dich heran. Das sagte mir mein Instinkt. Das war mein Motto. Ich schluckte.
»Ihren Vater?«, fragte ich.
»Ja, er ist seit letzter Woche bei uns. Zu Besuch aus Deutschland.«
»Was ist passiert?«
»Ich … Wir haben schon geschlafen. Da habe ich ihn um Hilfe rufen hören. Sie müssen hier im Wohnzimmer gewesen sein. Als ich reinkam … Die Haustür stand offen, ich bin rausgerannt, da haben sie auf mich geschossen …«
»Automatische Waffen?«
»Ja. Woher weißt du das?«
»Die Patronenhülsen … Die Einschusslöcher …«
»Ach so. Ja, stimmt. Also bin ich zurückgerannt, um mein Gewehr zu holen, da, aus dem Waffenschrank im Arbeitszimmer. Als ich wieder rauskam, habe ich sie nur noch mit Vollgas wegfahren sehen. Ich glaube, es war ein Hummer, schwarz oder dunkelblau …«
»Ein Hummer?«
»Ja, du weißt schon … kein Militärfahrzeug, ein ziviles. Dann bin ich zur Scheune gerannt, aber sie hatten beim Pick-up und dem Double Cab die Zündkabel rausgerissen. Und da habe ich alle angefunkt …«
»Wann war das genau?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher … Mit den Ersten habe ich so kurz vor zwei Kontakt aufgenommen. Sie sperren die Straßen ab …« Er zeigte auf die Karte. »Hier, Fraserburg, Sakrivierpoort, Modderpoort, Beaufort. Nur hier, bei Carnavon, da könnte es schiefgehen. Wenn die sich auskennen, gibt es viele Ausweichmöglichkeiten …«
Ich sah auf meine Armbanduhr. Zwanzig nach zwei. Sie hatten einen Vorsprung von über einer halben Stunde. Aber noch immer war mir ein Rätsel, wieso jemand Grethes Vater entführen sollte. Ich stellte die Frage leise, um Grethe nicht aufzuregen.
Lucien antwortete: »Keine Ahnung.«
Ich sah jedoch, wie er seiner Frau einen Seitenblick zuwarf, nur eine kurze Augenbewegung. Ich wusste Bescheid. Er log. Ein Hummer? Maschinenpistolen? Eine Entführung? Nicht gerade der typische Farmüberfall.
»Lucien«, sagte ich ruhig. »Wo bleibt die Polizei?«
»Ich …«
»Ich muss es ihm sagen«, sagte Grethe von hinten auf Deutsch zu ihrem Mann.
Lucien sah sie voller Mitgefühl an. Endlich fragte er: »Willst du das wirklich?«
Grethe legte ihre Kinder sanft auf das Sofa und gesellte sich zu uns. Sie war eine attraktive Frau, aber die Nacht hatte ihren Tribut gefordert. Sie war verängstigt und müde, hatte rot verquollene Augen.
»Also«, sagte sie, klammerte sich an der Lehne eines Esszimmerstuhls fest, sah mich an und holte tief Luft. »Mein Vater war bei der Stasi«, begann sie mit hörbarem deutschen Akzent. Dann seufzte sie, als erleichtere sie das Geständnis. »Ministerium für Staatssicherheit, der Geheimdienst der ehemaligen DDR.«
»Ich weiß«, sagte ich.
»Aber er ist ausgeschieden, schon vor 1990«, warf Lucien verteidigend ein.
»Was hat er bei der Stasi gemacht?«, fragte ich.
»Ich … ich glaube, er hat für die HVA gearbeitet«, antwortete Grethe, und auf meine verständnislose Miene hin fügte sie hinzu: »Die Hauptverwaltung Aufklärung, der internationale Geheimdienst der Stasi.«
»Erzähl ihm von Rosenholz«, bat Lucien.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht genug darüber.«
»Grethe!«, sagte er fast flehentlich.
Sie biss sich auf die Unterlippe. »Mein Vater … Die Rosenholz-Akten … Es handelte sich um eine Liste von Namen ostdeutscher Agenten im Ausland. Nach dem Fall der Mauer ging diese Liste an die CIA. Alle dachten, es sei die einzige Kopie gewesen …«
»Aber das war sie nicht«, riet ich.
Sie schüttelte erneut den Kopf.
»Glaubt ihr, dass die Entführung etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat? Dass diese Leute es deswegen auf ihn abgesehen haben?«
»Ja«, sagten sie wie aus einem Mund.
Grethe ging zu einem schön gearbeiteten Oregon-Schrank, holte einen Stapel Fotos hervor und reichte mir eines. Es war hier auf der Farm aufgenommen worden, im sommerlich grünen Garten. Grethes Vater war ein älterer Herr knapp über sechzig mit glänzender Glatze und tiefen Furchen um den Mund. »Er heißt Jürgen«, sagte sie.
Ich blickte sie an. »Deswegen wollt ihr keine Polizei.«
»Kannst du dir vorstellen, was die Medien …« Lucien winkte ab, eine Geste der Verzweiflung.
»Du hast sie gesehen«, sagte ich zu Lucien.
»Ja. Sie waren zu dritt. Weiß. Groß.«
Ich versuchte, einen Zusammenhang zu erkennen, vorauszudenken. Wo wollten sie ihn hinbringen? Das war die große Frage.
Dann krächzte das Funkgerät. »Lucien, Lucien, bitte kommen!«
»Dries Wiese«, stellte Lucien fest und griff nach dem Mikrofon. »Hier ist Lucien. Was gibt’s, Dries?«
»Wir sind jetzt hinter Slingersfontein, auf der Straße nach Carnavon. Gerade eben ist ein Hummer aus Richtung Rietpoort gekommen, in einem Affenzahn, aber als er uns gesehen hat, hat er gedreht und ist wieder in eure Richtung gerast.«
Lucien sah mich an.
»Hast du ein Funkgerät für mein Bakkie?«, fragte ich. Er nickte.
»Und ein Gewehr«, fuhr ich fort. »Das größte, was du hast.«
2.
Ich stand vor dem Pick-up in der eisigen Kälte, allein. Die Scheinwerfer erhellten die schmale, zweispurige Straße zwischen Kalkbult und Dawidskolk. Über mir spannte sich die Milchstraße in einem schimmernden Bogen, hier unten im Staub verliefen die typischen breiten Spuren des Hummers.
Surrealistisch.
Denn ich jagte die Entführer eines alten, ehemaligen Stasi-Offiziers in der dunklen Weite der Bo-Karoo, mit einem geliehenen .270-er Jagdgewehr und einer Glock-Pistole.
Doch es war nicht die Unwirklichkeit der Situation, die mir Unbehagen bereitete, sondern dass ich hier inmitten der Ebene so weithin sichtbar stand wie ein Leuchtturm im Meer. Klar und deutlich hob sich meine Silhouette vor den Scheinwerfern ab. Sie konnten hundert Meter neben der Straße warten, das Fadenkreuz eines Zielfernrohrs über meinen Rücken wandern lassen …
Ich stieg wieder ein. Im Ranger war es warm, der V6 blubberte im Leerlauf. Ich griff nach dem Funkgerät. »Lucien, hier Lemmer, bitte kommen.«
Der junge Schaffarmer meldete sich sofort. Mit angespannter Stimme antwortete er: »Hier Lucien, Lemmer, bitte kommen.« Vor knapp einer Stunde hatten sie seinen Schwiegervater nach allen Regeln der Kunst aus seinem Bett auf Bontfontein geholt, drei Männer mit Maschinenpistolen und einem schwarzen Hummer.
»Sie sind hier entlanggefahren«, sagte ich.
»Okay«, antwortete er. »Warte mal …«
Ich vermutete, dass er auf der Karte nachsah und die verschiedenen Möglichkeiten erwog. Aber war ihm auch bewusst, was es bedeutete, dass sie hier durchgekommen waren? Sollte ich es ihm sagen? Wenn sie diese dunkle Seitenstraße benutzten, hatten sie GPS mit äußerst genauen Karten. Oder einen Führer, der die Gegend wie seine Westentasche kannte. Vielleicht auch ein Funkgerät, das auf unsere Frequenz eingestellt war und dazu jemanden, der Afrikaans verstand. Denn jeder ihrer bisherigen Schritte war präzise und professionell gewesen.
»Lemmer, hörst du mich?«
»Ich höre dich, Lucien, bitte kommen.«
»Wir blockieren jetzt alle großen Abzweigungen. Sie können nirgendwo die Straße verlassen. Folge einfach der Spur …«
Folge einfach der Spur. Der hatte leicht reden. Lemmers Erstes Allgemeines Arbeitsgesetz lautete: Mach alles selbst. Mit einer zusätzlichen Klausel, die besagte: Arbeite ausschließlich mit Profis, wenn es alleine nicht geht. Gegen beide Grundsätze verstieß ich gerade. Weil ich, der ich mein Leben lang ein runder Pflock im viereckigen Arsch der Welt gewesen war, zum ersten Mal akzeptiert werden, weil ich zum Loxton-Stamm gehören wollte.
»Mach ich«, antwortete ich und fuhr los. Einen Trost hatte ich: Die Männer im Hummer waren vermutlich nicht gerade scharf auf eine bewaffnete Auseinandersetzung. Denn sie wollten Grethes Vater lebendig. Sonst hätten sie ihn im Bett erschossen.
Ich fuhr durch ein offenes Viehgatter. Die Spur lag deutlich vor mir im Staub. Ich schaltete die Scheinwerfer aus und spähte hinaus in die Dunkelheit, auf der Suche nach Autoscheinwerfern, sah aber nichts. Ich schaltete das Abblendlicht wieder ein, hatte eine Eingebung und griff nach dem Funkgerät. »Lucien, sind die Gatter normalerweise geschlossen?«
»Ja, sind sie, das ist eine Privatstraße mit eingeschränkter Zufahrt, die Gatter sind immer geschlossen.«
Nicht heute Abend. Was bedeutete, dass die Leute im Hummer sie geöffnet, aber keine Zeit damit verschwendet hatten, sie wieder zu schließen. Sie hatten es eilig. Und sie hinterließen Wegzeichen.
»Danke«, sagte ich ins Funkgerät. Mein Herz schlug schneller und ich trat das Gaspedal durch. Ich konnte sie einholen. Ich würde sie kriegen.
Das erste Anzeichen dafür, dass sich der Abstand zwischen mir und dem Hummer verringerte, war Staub – zunächst fast unsichtbare, feine Schleier, wie geisterhafter Nebel hier und da. Dann wurden die Wolken dichter, so dass ich mir ganz sicher sein konnte und noch schneller fuhr, trotz der kurvigen, schmalen Farmstraße, der unebenen Fahrbahn.
Plötzlich: Bremsleuchten in der Nacht. Nur ein kurzes Aufblinken, so dass ich mir nicht sicher war, ob ich richtig gesehen hatte.
Ich trat das Gaspedal noch weiter durch, das Jagdfieber hatte mich gepackt.
Da! Schon wieder, für ein, zwei Sekunden! Ich bremste, hielt an, schaltete Scheinwerfer und Motor aus und ließ das Fenster herunter. Ich starrte in die Dunkelheit, steckte meinen Kopf hinaus, um zu lauschen.
Das rettete mir das Leben.
Die Kugel schlug in die Rückwand der Fahrerkabine ein. Ein Stern in der Windschutzscheibe, wo eben noch mein Kopf gewesen war. Dann krachte der Schuss durch die Nacht. Ich duckte mich, griff nach dem Gewehr, wollte die Tür aufreißen, dachte gerade noch rechtzeitig an die Innenbeleuchtung. Ich langte nach oben, schaltete das Licht aus, stieß die Tür auf, sprang hinaus, rannte ein paar Schritte und ließ mich fallen.
Mein neuer Bakkie hatte ein Loch. Ich stieß einen lauten Fluch aus.
Der Kerl aus dem Hummer schoss wieder. Die Kugel prallte an einem Stein neben mir ab und verschwand pfeifend in der Nacht.
Er konnte mich trotz der Dunkelheit sehen, er hatte ein Infrarot-Zielfernrohr oder ein Nachtsichtgerät. Ich musste Deckung suchen. Ich sprang auf und rannte im Zickzack los. Nach dem hellen Scheinwerferlicht des Pick-ups mussten sich meine Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen. Ich sah den schwarzen Schatten eines Steinhaufens, hörte noch einen Schuss krachen und hechtete hinter die Felsen. Mein keuchender Atem war das einzige Geräusch in der vollkommenen Stille der Karoo. Doch ich hatte den dünnen Blitz seines Mündungsfeuers gesehen, rechts von der Straße, ungefähr zweihundert Meter entfernt.
Sie konnten mich hier festnageln.
Eine Stimme in der Ferne, ein lauter Befehl.
Meine einzige Chance bestand darin, in ständiger Bewegung zu bleiben. Ich sprang auf, rannte los, schlug Haken, suchte die dunklen Schatten, in denen ich einen Augenblick innehielt, sprang wieder auf, den ganzen Körper angespannt, gestählt. Ich zwar zwanzig Meter weit gekommen, ehe mir bewusst wurde, dass er nicht mehr auf mich schoss. Wollte er mich zermürben?
Meine Augen hatten sich inzwischen etwas besser den Sichtverhältnissen angepasst. Ich sah eine Senke rechts von mir, einen kleinen Flusslauf, Dornenbüsche. Ich wandte mich dorthin, rannte zwischen den Zweigen hindurch, kam schneller voran. Er schoss immer noch nicht. Hatte er mich im Dunkeln verloren? Ich bemerkte einen Hügel links von mir, bog ab, rannte gebückt hinauf.
Dann sah ich sie. Vielleicht 250 Meter entfernt. Der Hummer stand mitten auf der Straße, mit eingeschalteten Scheinwerfern. Eine dunkle Gestalt rannte mit dem Rücken zu mir zum Fahrzeug, ein großes Scharfschützengewehr über der Schulter. Ich ging in die Knie, entsicherte die .270er, sah durch das Zielfernrohr und führte ein paar schnelle Berechnungen durch – kein Wind, das Gelände fiel um zehn Meter in seine Richtung ab, die Entfernung betrug 200 Meter. Ich zielte auf seinen Nacken und drückte ab. Ein Ruck durchfuhr ihn, er stürzte. Ich verlagerte das Fadenkreuz auf den Hummer. Das Vorderrad war am sichersten, ich konnte es mir nicht leisten, ein Risiko einzugehen.
Plötzlich fuhren sie los. Ich schoss daneben, zielte weiterhin auf den Hummer, aber sie fuhren zu schnell. Die Wahrscheinlichkeit, Grethes Vater zu treffen, war zu groß.
Ich sprang auf und rannte zu meinem Bakkie.
Einer weniger. Noch zwei übrig.
Als ich den Ford erreichte, hörte ich Lucien ängstlich rufen: »Lemmer, bist du da? Lemmer?«
Ich griff nach dem Funkgerät. »Hier Lemmer …«
»Funktioniert dein Funkgerät noch?«
»Ja, aber ich war draußen im Veld.«
Ich startete den Pick-up mit fiebriger Hast, schaltete das Licht ein, fuhr los, gab Gas.
»Alles in Ordnung?«
»Ja, alles in Ordnung, Lucien. Ich bin dicht hinter ihnen, melde mich später wieder!« Ich brauchte jetzt beide Hände am Steuer, fuhr so schnell, wie es die schmale Straße zuließ. Der Ranger vollführte Bocksprünge, mein neuer Ford mit dem Loch drin, aber dafür würden sie büßen. Ich umklammerte das Lenkrad, starrte in die Nacht, bis ich meinen Angreifer am Boden liegen sah. Zwanzig Meter vor ihm blieb ich stehen, so dass er im Licht meiner Scheinwerfer lag. Ich zog die Glock aus der Jackentasche, sprang raus und rannte mit der Pistole im Anschlag auf ihn zu, obwohl ich vermutete, dass er nicht mehr lebte.
Blonde Haare, schwarze Kleidung. Der Schuss hatte ihn drei Zentimeter unterhalb des Nackens in den Rücken getroffen, genau in die Mitte. Ich merkte mir die Einstellungen der .270-er und rollte ihn herum. Er war um die dreißig, glatt rasiert, seine Augen offen und leblos. Um die Brust gehängt trug er eine Maschinenpistole, eine tschechische Scorpion SA Vz61. Das erklärte die Luger-Hülsen auf Bontfontein. Neben ihm lag das Scharfschützengewehr, lang und schwarz, leichter Polymerkolben, großes Nachtsichtgerät. Ich hob es auf, warf einen raschen Blick darauf. Druganov SWD. Russisches Fabrikat. Dann rannte ich zu meinem Bakkie zurück.
Durch meine verrückte Raserei hätte ich beinahe die Gestalt überfahren, die in Fötushaltung auf der Straße lag.
Ich bog um eine scharfe Kurve, und da lag er vor mir, auf dem Mittelstreifen. Ich trat voll auf die Bremse, fühlte das Heck des Rangers herumdriften, sah, dass ich den Mann erwischen würde, riss das Steuer nach links, von der Straße herunter. Der Wagen prallte gegen ein Hindernis, ein dumpfer Schlag, Funken flogen durch die Nacht, und ich blieb stehen, die Scheinwerfer ausgeschaltet. Ich nahm die Pistole, sprang raus, warf mich auf den Boden und visierte die gedrungene Person an, die zusammengerollt dalag.
Totenstille.
Dann hörte ich ihn stöhnen, unverständliche Worte murmeln.
»Steh auf!«, befahl ich.
»Ich bin Jürgen!«, sagte die Gestalt auf Deutsch.
Grethes Vater? Ich glaubte ihm nicht. Das war eine Falle!
»Do you speak English?«
»Yes.«
Ich fragte ihn, wie Grethe und Lucien sich kennengelernt hatten. Er sagte: »Bitte! Ich bin angeschossen. Sie sind weg.«
»Nein«, erwiderte ich. »Sagen Sie es mir erst! Wie haben die beiden sich kennengelernt?«
»Grethe wollte ihre Freundin besuchen, Eva. Die mit dem Hasenprojekt.«
Das reichte mir. Ich kroch zu ihm hin, die Glock schussbereit. Als ich ihn erreichte, sah ich die Glatze im Sternenlicht glänzen. Er war es tatsächlich.
»Wo hat es Sie erwischt?«
»Am Oberschenkel. Ich blute.«
Ich richtete mich auf, steckte die Pistole in den Gürtel, hinten im Rücken, und fasste ihn an den Schultern. »Können Sie aufstehen?«
Er versuchte es, aber es fiel ihm sehr schwer. Ich zog ihn hoch und sah, wie sich sein altes Gesicht vor Schmerzen verzerrte. Ich bückte mich, lud ihn mir über die Schulter und trabte mühsam zum Bakkie. Auf der Beifahrerseite sah ich die tiefe Delle im Kotflügel, den langen Kratzer im silbernen Lack. Am liebsten hätte ich erneut geflucht. Der Pick-up hatte nicht mal zweitausend gelaufen! Ich öffnete die Beifahrertür, bugsierte Jürgen auf den Sitz und sah zum ersten Mal das Blut. Viel Blut.
»Ich sterbe«, sagte er.
»Nein«, entgegnete ich.
Ich knallte die Tür zu, rannte um den Wagen herum, tastete hinter dem Fahrersitz nach dem Erste-Hilfe-Beutel, riss ihn hervor. Ich stieg ein und schaltete die Innenbeleuchtung an.
Sein Bein sah böse aus. Er hatte nicht mehr viel Zeit. Ich öffnete den Reißverschluss des Beutels, nahm Watte und Stretchverband heraus und versuchte, die Blutung zu stillen. Nicht besonders erfolgreich. Ich sah in Jürgens Gesicht. Er war wachsbleich. »Mehr kann ich nicht für Sie tun, Jürgen. Legen Sie Ihre Hand hierhin und drücken Sie weiter drauf. Ich muss Sie ins Krankenhaus bringen.«
»Nein, bitte nicht!«, sagte er, während ich mich hinüberlehnte und ihn anschnallte.
»Eine Schlagader ist verletzt, wir haben keine andere Wahl!«
»Sie müssen sie aufhalten!«, bat er mit schwacher Stimme.
»Keine Zeit«, erwiderte ich, ließ den Motor an und fuhr los.
»Bitte!«, wiederholte er, fast flehentlich. »Sie müssen Sie aufhalten! Dreihundert Menschenleben …«
Ich fuhr mit fieberhafter Eile, griff nach dem Funkgerät. Lucien musste mir den kürzesten Weg nach Victoria-Wes beschreiben, zum nächstgelegenen Krankenhaus. Jürgen legte mir die Hand auf den Arm. »Wenn Sie sie nicht aufhalten, bedeutet das für dreihundert Menschen das Todesurteil!«
Ich blickte ihn an und fragte mich, ob er phantasierte.
»Die sind von der SWR«, erklärte er.
Plötzlich wurde ich hellhörig. Die SWR – der ehemalige Zentrale Nachrichtendienst, früher ein Zweig des KGB. Gefährliche Leute.
»Russen? Sind Sie sicher?«, fragte ich.
»Sie haben … die wollten die Georgier-Liste … hinter der waren sie her. Ich musste ihnen sagen, wo sie ist. Meine Enkel …«
Vor uns lag eine Kreuzung. Die unbefestigte Straße verbreiterte sich, und ein Schild wies zu einem Ort namens Visgat. Ich bremste, stoppte, sah ihn an. »Die Georgier-Liste?«, fragte ich, und mir dämmerte bereits einiges.
»Die Russen … sind letzte Woche in Georgien einmarschiert …«
»Ich weiß.«
»Die Liste … Darauf sind die Dissidenten aufgeführt …«
»Die Oppositionellen?«
»Ja, von früher. Ein Netzwerk, eine Widerstandsbewegung, dreihundertzwölf Mitglieder, die führenden Köpfe …«
»Und die SWR will sie ausräuchern?«
Er nickte. »Ich habe die Dokumente … aufbewahrt. Jetzt wissen die Russen, wo sie sind. Sie haben gedroht, Grethe, Lucien und die Kinder zu töten, wenn ich ihnen nicht verrate, wo sie sind …« Er schwitzte. Jedes Wort kostete ihn jetzt große Anstrengung. Er würde nicht mehr lange durchhalten.
Ich nahm das Funkgerät. »Lucien, bitte kommen, Lucien!«
Er meldete sich sofort. »Hier Lucien, Lemmer, bitte kommen.«
»Ich habe deinen Schwiegervater, er ist in Sicherheit, aber verletzt. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen, so schnell wie möglich. Ich brauche einen von euch …«
»Wo bist du jetzt?«
»Bei Visgat, an der breiten unbefestigten Straße.«
»Fahre in östlicher Richtung, es sind nur dreißig Kilometer bis nach Loxton, dann fährst du die …«
»Nein, hör zu, Lucien, du musst jemanden hierher schicken, der ihn abholt.«
»Wie bitte?«
»Ich muss den Hummer aufhalten, Lucien!«
»Nein, vergiss sie, Lemmer …«
Jürgen nahm mir das Mikrofon ab, mit zittriger, blutiger Hand. Er sprach Deutsch, kurz, barsch, die Befehle eines Stasi-Offiziers.
Stille im Äther. Dann sagte Lucien: »Fahr einfach weiter in Richtung Loxton! Ich schicke jemanden, der Papa holen kommt.«
3.
Um kurz nach vier Uhr morgens, fünfzehn Kilometer vor Loxton, sah ich die Lichter auf uns zukommen. Ich blickte zu Jürgen hinüber. Er hatte den Kopf gegen das Polster gelehnt, die Augen geschlossen, das Gesicht totenbleich. Seine rechte Hand, mit der er den provisorischen Druckverband auf der blutenden Beinwunde festhielt, zitterte leicht. Er sah jetzt nicht mehr wie ein gefährlicher Stasi-Offizier aus.
Ich blinkte das entgegenkommende Fahrzeug an und blieb am Straßenrand stehen.
Sie hielten neben mir an. Oom Joe van Wyk saß am Steuer, neben ihm Oom Ben Bruwer, die Schrotflinte zwischen den Knien.
»Hi, Lemmer, alter Junge, was guckst du so? Hast wohl nicht mit uns gerechnet?«, fragte Oom Joe, während er rasch ausstieg.
»Hat bestimmt gedacht, wir wären zu alt«, sagte Oom Ben. »Was soll’s, los, beeilt euch, der Mann sieht ja schlimm aus.«
Ich kam zur Besinnung, sprang aus dem Wagen, rannte auf die Beifahrerseite, riss die Tür auf, hob Jürgen heraus und trug ihn mühsam zum Isuzu Frontier von Oom Joe. Er hielt mir die hintere Tür auf.
»Schussverletzung«, bemerkte Oom Ben.
»Großes Kaliber«, fügte Oom Joe hinzu.
Sie kannten sich aus. Auf allen Gebieten.
»Druganov SWD«, sagte ich und lud Jürgen auf den Rücksitz. »Sieben Komma sechs zwei.«
»Ganz ordentlich«, sagte Oom Joe.
»Kenne ich nicht«, erwiderte Oom Ben. »Mir sind deutsche Waffen lieber.«
Jürgen öffnete die Augen. »Du musst sie aufhalten!«, flüsterte er flehentlich, auf Englisch.
»Das werde ich«, versprach ich und stieg aus.
»Aber warum willst du denn jetzt noch hinter diesen Idioten herjagen?«, fragte Oom Ben.
Ich hätte ihnen erzählen können, dass 300 georgische Widerständler vom russischen Auslandsnachrichtendienst ermordet werden würden, wenn ich den Hummer nicht aufhielt, aber ich hatte es zu eilig. Ich zeigte auf meinen Ford. In der Windschutzscheibe gähnte ein Loch, und der linke vordere Kotflügel hatte eine dicke Beule und hässliche Kratzer. »Deshalb«, sagte ich zu den beiden Grauhaarigen.
»O nein, Lemmer, dein nagelneuer Bakkie!«, seufzte Oom Joe.
»Noch keine zweitausend gelaufen, Oom.«
»Krieg sie, Bruder«, sagte Oom Ben. »Einem Mann sein Auto kaputtschießen – wer macht denn so was?« Dann sprangen sie in den Isuzu und Oom Joes Warnung: »Sei vorsichtig, Junge!«, ging halb im Lärm ihrer durchdrehenden Räder unter.
Ich kehrte zu meinem mitgenommenen Ranger zurück, und plötzlich wurde mir klar, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte, was ich als Nächstes unternehmen sollte. Der Hummer konnte sich überall in der Weite der Bo-Karoo befinden.
Doch dann hörte ich das frenetische Stimmengewirr aus dem Funkgerät …
Chaos im Äther, aufgeregte Rufe, Antworten. Ich erfuhr die Geschichte häppchenweise, während ich in Richtung Norden raste, wo es passiert war: Jan Wiese und Bob Meintjes standen bei Gansfontein auf der R308, als plötzlich der Hummer mit ausgeschalteten Scheinwerfern aus der Dunkelheit auftauchte. Sie hatten geschossen, die Russen hatten das Feuer mit ihren Maschinenpistolen beantwortet – und dann waren sie durchgebrochen in Richtung Carnavon. »Ich könnte schwören, dass ich sie irgendwo getroffen habe!«, behauptete Wiese.
»Seid ihr okay?«, fragte Lucien, der schon ruhiger klang, jetzt, wo sein Schwiegervater in Sicherheit war.
»Ja, uns geht’s gut, aber mein Toyota ist ordentlich durchlöchert«, antwortete der große Farmer.
»Jan, hier Lemmer«, fiel ich ihnen ins Wort. »Kannst du mich hören?«
»Ich höre dich.«
»Ich komme aus Richtung Loxton, ihr müsstet eigentlich meine Scheinwerfer sehen können.«
»Ich sehe dich.«
»Wie groß ist ihr Vorsprung?«
»Vier Minuten, vielleicht fünf … Aber ich sage dir, ich hab das Ding getroffen. Er hat gequalmt, als er an uns vorbeigefahren ist.«
»Dann schnappe ich sie mir«, sagte ich.
Ein Chor von Stimmen, wie aus einem Mund: »Schnapp sie dir!«
Die breite unbefestigte Straße dehnte sich vor mir aus, die letzten fünfzig Kilometer, ehe man die Teerstraße in Richtung Carnavon erreichte. Eine Strecke mit trügerischen Kurven. Die Russen wollten jetzt so schnell wie möglich weg von hier, sie hatten bekommen, was sie wollten, ein Wettrennen zwischen ihnen und mir. Aber ich musste sie vor der nächsten großen Abzweigung einholen, sonst waren sie weg, verschluckt von der Weite dieser Landschaft.
Doch warum nach Norden? Warum nicht in Richtung N1? Befürchteten sie, Lucien hätte nach dem langen Arm des Gesetzes gerufen? Blockaden auf den Hauptstraßen, Helikopter, eine groß angelegte Suchaktion? Schlauer wäre es gewesen, ein weiteres Fahrzeug irgendwo zu verstecken, den Hummer in einer Schlucht stehen zu lassen und in einem Farmerauto weiterzufahren.
Nein, am klügsten wäre es gewesen, die Straßen überhaupt