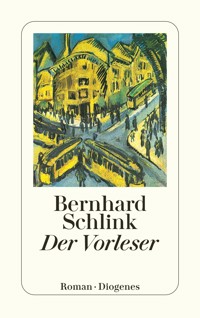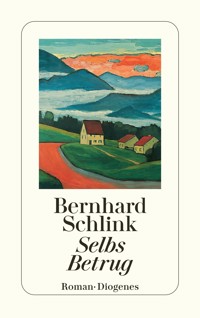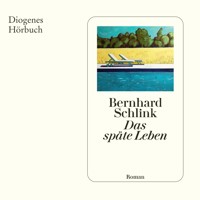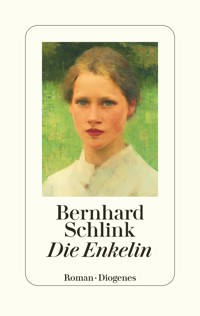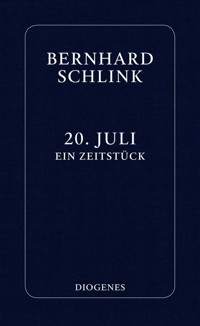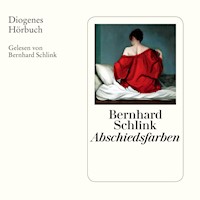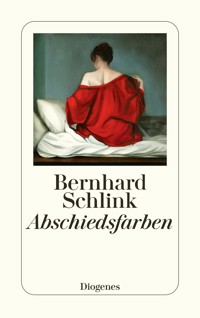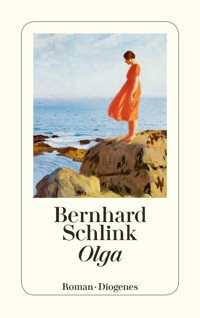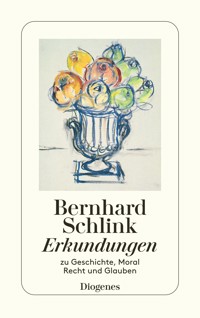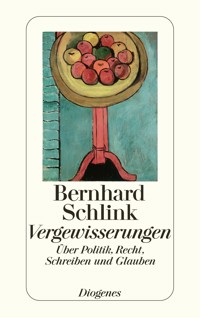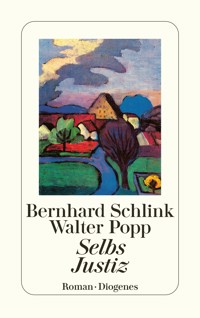
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Selb-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv Gerhard Selb, 68, wird von einem Chemiekonzern beauftragt, einem ›Hacker‹ das Handwerk zu legen, der das werkseigene Computersystem durcheinanderbringt. Bei der Lösung des Falles wird er mit seiner eigenen Vergangenheit als junger, schneidiger Nazi-Anwalt konfrontiert und findet für die Ahndung zweier Morde, deren argloses Werkzeug er war, eine eigenwillige Lösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bernhard Schlink
Walter Popp
Selbs Justiz
Roman
Die Erstausgabe erschien 1987
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Gabriele Münter,
›Dorf mit grauer Wolke‹,
1939 (Ausschnitt)
Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 21543 4 (29. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60051 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
ERSTER TEIL
1 Korten läßt bitten [9]
2 Im Blauen Salon [13]
3 Wie eine Ordensverleihung [18]
4 Turbo fängt eine Maus [23]
5 Bei Aristoteles, Schwarz, Mendelejew und Kekulé [26]
6 Ragoût fin im Ring mit Grünem [32]
7 Kleine Panne [37]
8 Ja, dann [45]
9 Der Wirtschaft ins Dekolleté gegriffen [48]
10 Erinnerungen an die blaue Adria [57]
11 Scheußliche Sache, das [61]
12 Bei den Käuzchen [68]
13 Interessieren Sie die Einzelheiten? [71]
14 Lange Leitung [76]
15 Bam bam, ba bam bam [81]
16 Wie das Wettrüsten [85]
17 Schämen Sie sich! [92]
18 Die Unsauberkeit der Welt [99]
19 Grüß Gott im Himmel wie auf Erden [102]
20 Ein schönes Paar [108]
21 Unser Seelchen [112]
[6] ZWEITER TEIL
1 Zum Glück mag Turbo Kaviar [117]
2 Am Auto war alles in Ordnung [122]
3 Ein silberner Christophorus [129]
4 Ich schwitzte alleine [134]
5 Ach Gott, was heißt schon gut [139]
6 Ästhetik und Moral [142]
7 Eine Rabenmutter [149]
8 Ein Blut für alle Tage [155]
9 Lange ratlos [160]
10 Fred hat Geburtstag [165]
11 Danke für den Tee [170]
12 Hase und Igel [173]
13 Schmeckt’s? [177]
14 Laufen wir ein paar Schritte [182]
15 Der Pförtner kannte mich noch [189]
16 Papas Herzenswunsch [196]
17 Im Gegenlicht [201]
18 Eine kleine Geschichte [205]
19 Energie und Ausdauer [211]
20 Nicht nur ein blöder Schürzenjäger [219]
21 Die betenden Hände [224]
22 Tee in der Loggia [230]
23 Hast du ein Taschentuch? [237]
24 Mit hochgezogenen Schultern [239]
[7] DRITTER TEIL
1 Ein Meilenstein in der Rechtsprechung [245]
2 Mit einem Knacken war das Bild da [250]
3 Do not disturb [254]
4 Kein gutes Haar an Sergej [263]
5 Wessen Maultaschen schmälzt er denn? [268]
6 Kartoffeln, Weißkohl und heiße Blutwurst [273]
7 Was ermittelst du jetzt eigentlich? [277]
8 Gehen Sie mal auf die Scheffelterrasse [282]
9 Da waren’s nur noch drei [285]
10 Haltet den Dieb [291]
11 Suite in h-Moll [295]
12 Sardinen aus Locarno [304]
13 Sehen Sie nicht, wie Sergej leidet? [307]
14 Matthäus 6, Vers 26 [311]
15 And the race is on [316]
16 Alles für die Karriere? [320]
17 Ich wußte, was ich zu tun hatte [325]
18 Alte Freunde wie du und ich [330]
19 Ein Päckchen aus Rio [335]
[9] ERSTER TEIL
1
Korten läßt bitten
Am Anfang habe ich ihn beneidet. Das war auf der Schule, auf dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Berlin. Ich trug Vaters Anzüge auf, hatte keine Freunde und kam nicht am Reck hoch. Er war Klassenbester, auch in Leibesübungen, wurde zu jedem Geburtstag eingeladen, und wenn die Lehrer ›Sie‹ zu ihm sagten, meinten sie es. Manchmal holte ihn der Chauffeur seines Vaters mit dem Mercedes ab. Mein Vater war bei der Reichsbahn und 1934 gerade von Karlsruhe nach Berlin versetzt worden.
Korten kann Ineffizienz nicht leiden. Er brachte mir Felgaufschwung und –umschwung bei. Ich bewunderte ihn. Er zeigte mir auch, wie man’s mit den Mädchen macht. Ich lief neben der Kleinen, die einen Stock tiefer wohnte und gegenüber vom Friedrich-Wilhelm ins ›Luisen‹ ging, blöde her und himmelte sie an. Korten küßte sie im Kino.
Wir sind Freunde geworden, haben zusammen studiert, er Nationalökonomie und ich Jura, und in der Villa am Wannsee ging ich ein und aus. Als seine Schwester Klara und ich heirateten, war er Trauzeuge und schenkte mir den [10] Schreibtisch, der heute noch in meinem Büro steht, schwere Eiche mit Schnitzwerk und Messingknäufen.
Ich arbeite heute selten dran. Mein Beruf hält mich auf Trab, und wenn ich abends noch kurz ins Büro schaue, türmen sich auf dem Schreibtisch keine Akten. Nur der Anrufbeantworter wartet und teilt mir im kleinen Fenster die Zahl der angekommenen Botschaften mit. Dann sitze ich vor der leeren Platte und spiele mit dem Bleistift und höre mir an, was ich tun und lassen, was ich in die Hand nehmen und wovon ich die Finger lassen soll. Ich verbrenne mir nicht gerne die Finger. Aber man kann sie sich auch in der Schublade eines Schreibtischs einklemmen, in die man lange nicht mehr geschaut hat.
Der Krieg war für mich nach fünf Wochen vorbei. Heimatschuß. Nach drei Monaten hatten sie mich wieder zusammengeflickt, und ich machte meinen Assessor. Als 1942 Korten bei den Rheinischen Chemiewerken in Ludwigshafen und ich bei der Staatsanwaltschaft in Heidelberg anfing und wir noch keine Wohnung hatten, teilten wir ein paar Wochen das Hotelzimmer. 1945 war mit meiner Karriere bei der Staatsanwaltschaft Schluß, und er verhalf mir zu den ersten Aufträgen im Wirtschaftsmilieu. Dann begann sein Aufstieg, er hatte wenig Zeit, und mit Klaras Tod hörten auch die Besuche zu Weihnachten und zum Geburtstag auf. Wir verkehren in verschiedenen Kreisen, und ich lese mehr über ihn, als ich von ihm höre. Manchmal begegnen wir uns im Konzert oder Theater und verstehen uns. Sind eben alte Freunde.
Dann… ich erinnere mich gut an den Morgen. Mir lag die Welt zu Füßen. Mein Rheuma ließ mich in Ruhe, mein [11] Kopf war klar, und im neuen blauen Anzug sah ich jung aus – fand ich jedenfalls. Der Wind trieb den vertrauten Chemiegestank nicht hierher nach Mannheim, sondern hinüber in die Pfalz. Beim Bäcker am Eck gab’s Schokoladenhörnchen, und ich frühstückte draußen auf dem Gehsteig in der Sonne. Eine junge Frau kam die Mollstraße entlang, kam näher und wurde hübscher, und ich stellte meine Einwegtasse auf das Schaufenstersims und ging hinter ihr her. Nach wenigen Schritten stand ich vor meinem Büro in der Augusta-Anlage.
Ich bin stolz auf mein Büro. In Tür und Schaufenster des ehemaligen Tabakladens habe ich Rauchglas setzen lassen und darauf in schlichten goldenen Lettern:
Gerhard Selb Private Ermittlungen
Auf dem Anrufbeantworter waren zwei Anrufe. Der Geschäftsführer von Goedecke brauchte einen Bericht. Ich hatte seinen Filialleiter des Betrugs überführt, der wollte es genau wissen und hatte seine Kündigung vor dem Arbeitsgericht angefochten. Mit der anderen Nachricht bat Frau Schlemihl von den Rheinischen Chemiewerken um Rückruf.
»Guten Morgen, Frau Schlemihl. Selb am Apparat. Sie wollen mich sprechen?«
»Guten Tag, Herr Doktor. Herr Generaldirektor Korten möchte Sie sehen.« Niemand außer Frau Schlemihl redet mich mit ›Herr Doktor‹ an. Seit ich nicht mehr Staatsanwalt bin, mache ich keinen Gebrauch von meinem Titel; [12] ein promovierter Privatdetektiv ist lächerlich. Aber als gute Chefsekretärin hat Frau Schlemihl nie vergessen, wie Korten mich ihr bei unserer ersten Begegnung Anfang der fünfziger Jahre vorgestellt hatte.
»Worum geht es?«
[13] 2
Im Blauen Salon
In Mannheim und Ludwigshafen leben wir unter den Augen der Rheinischen Chemiewerke. Im Jahre 1872, sieben Jahre nach der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik, wurden sie von den Chemikern Professor Demel und Kommerzienrat Entzen gegründet. Seitdem wächst das Werk und wächst und wächst. Heute nimmt es ein Drittel der bebauten Fläche Ludwigshafens ein und beschäftigt fast hunderttausend Arbeitnehmer. Zusammen mit dem Wind bestimmen die Produktionsrhythmen der RCW, ob und wo es in der Region nach Chlor, Schwefel oder Ammoniak riecht.
Das Kasino liegt außerhalb des Werkgeländes und hat seinen eigenen feinen Ruf. Neben dem großen Restaurant für das mittlere Management gibt es für die Direktoren einen Bereich mit mehreren Salons, die in den Farben gehalten sind, mit deren Synthese Demel und Entzen ihre ersten Erfolge errungen haben. Und eine Bar.
Da stand ich um eins noch. Man hatte mir schon am Empfang gesagt, daß der Herr Generaldirektor sich leider etwas verspäten würde. Ich bestellte den zweiten Aviateur.
»Campari, Grapefruitsaft, Champagner, je ein Drittel« – das rothaarige und sommersprossige Mädchen, das heute hinter der Bar aushalf, freute sich, etwas gelernt zu haben.
»Sie machen das wunderbar«, sagte ich. Sie sah mich [14] mitfühlend an. »Sie müssen auf Herrn Generaldirektor warten?«
Ich hatte schon schlechter gewartet, in Autos, Hauseingängen, Korridoren, Hotel- und Bahnhofshallen. Hier stand ich unter vergoldetem Stuck und einer Galerie von Ölportraits, unter denen eines Tages auch Kortens hängen würde.
»Mein lieber Selb«, kam er auf mich zu. Klein und drahtig, mit wachsamen blauen Augen, bürstig gestutztem grauen Haar und der ledernen braunen Haut, die von zuviel Sport in der Sonne kommt. Mit Richard von Weizsäcker, Yul Brynner und Herbert von Karajan in einer Combo könnte er aus dem geswingten Badenweiler Marsch einen Welthit machen.
»Tut mir leid, daß ich zu spät komme. Dir bekommt’s noch, das Rauchen und das Trinken?« Er warf einen zweifelnden Blick auf mein Päckchen Sweet Afton. »Bringen Sie mir ein Apollinaris! – Wie geht es dir?«
»Gut. Ich mache ein bißchen langsamer, darf ich wohl auch mit meinen achtundsechzig, nehme nicht mehr jeden Auftrag an, und in ein paar Wochen fahre ich in die Ägäis zum Segeln. Und du gibst das Ruder noch nicht aus den Händen?«
»Ich würde gerne. Aber ein, zwei Jahre dauert es noch, bis ein anderer mich ersetzen kann. Wir stecken in einer schwierigen Phase.«
»Muß ich verkaufen?« Ich dachte an meine zehn RCW-Aktien im Depot der Badischen Beamtenbank.
»Nein, mein lieber Selb«, lachte er. »Letztlich sind die schwierigen Phasen für uns stets ein Segen. Aber es gibt [15] trotzdem Dinge, die uns Sorgen machen, lang- und kurzfristig. Wegen eines kurzfristigen Problems wollte ich dich heute sehen und nachher mit Firner zusammenbringen. Du erinnerst dich an ihn?«
Ich erinnerte mich gut. Vor ein paar Jahren war Firner Direktor geworden, aber für mich blieb er Kortens alerter Assistent. »Trägt er noch die Harvard-Business-School-Krawatte?«
Korten antwortete nicht. Er schaute nachdenklich, als überlege er die Einführung der firmeneigenen Krawatte. Er nahm meinen Arm. »Laß uns in den Blauen Salon gehen, es ist angerichtet.«
Der Blaue Salon ist das Beste, was die RCW ihren Gästen bieten. Ein Jugendstilzimmer mit Tisch und Stühlen von van de Velde, einer Lampe von Mackintosh und an der Wand einer Industrielandschaft von Kokoschka. Es waren zwei Gedecke aufgelegt, und als wir uns setzten, brachte der Kellner einen Rohkostsalat.
»Ich bleibe bei meinem Apollinaris. Für dich habe ich einen Château de Sannes bestellt, du magst ihn doch. Und nach dem Salat einen Tafelspitz?«
Mein Lieblingsgericht. Wie nett von Korten, daran zu denken. Das Fleisch war zart, die Meerrettichsoße ohne lästige Mehlschwitze, dafür mit reichlich Sahne. Für Korten war der Lunch mit dem Rohkostsalat zu Ende. Während ich aß, kam er zur Sache.
»Ich werde mich mit Computern nicht mehr befreunden. Wenn ich die jungen Leute anschaue, die man uns heute von der Universität schickt, die keine Verantwortung tragen und keine Entscheidungen treffen können, sondern [16] immer das Orakel befragen müssen, dann denke ich an das Gedicht vom Zauberlehrling. Fast hat es mich gefreut, als man mir vom Ärger mit der Anlage erzählt hat. Wir haben eines der besten Management- und Betriebsinformationssysteme der Welt. Ich weiß zwar nicht, wer das wissen will, aber du kannst am Terminal erfahren, daß wir heute im Blauen Salon Tafelspitz und Rohkostsalat essen, welcher Mitarbeiter gerade auf unserem Tennisplatz trainiert, die intakten und kaputten Ehen zwischen Angehörigen unseres Konzerns, und in welchem Rhythmus welche Blumen in die Rabatten vor dem Kasino gepflanzt werden. Und natürlich verzeichnet der Computer alles, was Lohnbuchhaltung, Personalabteilung und so weiter früher in ihren Ordnern hatten.«
»Und was soll ich euch dabei helfen?«
»Geduld, mein lieber Selb. Man hat uns eines der sichersten Systeme versprochen. Das heißt Passwords, Zugangscodes, Datenschleusen, Doomsdayeffekte und was weiß ich. Erreicht werden soll mit alledem, daß niemand in unserem System herumpfuscht. Aber eben das ist passiert.«
»Mein lieber Korten…« Bei der Anrede mit dem Nachnamen, gewohnt seit der Schulzeit, haben wir es auch als Freunde belassen. Aber »mein lieber Selb« nervt mich, und er weiß das auch. »Mein lieber Korten, mich hat als Kind schon der Abakus überfordert. Und jetzt soll ich mit Schlüsselwörtern, Zugangscodes und Datendingsbums hantieren?«
»Nein, was computermäßig abzuklären ist, ist erledigt. Wenn ich Firner richtig verstehe, gibt es eine Liste mit [17] Leuten, die das Durcheinander in unserem System angerichtet haben können, und es geht nur darum, den Richtigen rauszufinden. Eben das sollst du tun. Ermitteln, beobachten, beschatten, die passenden Fragen stellen – wie immer.«
Ich wollte mehr wissen und weiterfragen, aber er wehrte ab.
»Ich weiß selbst nicht mehr, alles Nähere wird dir Firner berichten. Laß uns während des Mittagessens nicht nur über diese leidige Angelegenheit sprechen – wir haben in den Jahren seit Klaras Tod so selten Gelegenheit gehabt, miteinander zu reden.«
So redeten wir über die alten Zeiten. »Weißt du noch?« Ich mag die alten Zeiten nicht, habe sie weggepackt und zugedeckt. Ich hätte aufmerken sollen, als Korten von den Opfern sprach, die wir haben bringen und fordern müssen. Doch das fiel mir erst viel später ein.
Über die neuen Zeiten hatten wir uns wenig zu sagen. Daß sein Sohn Bundestagsabgeordneter geworden war, verblüffte mich nicht – schon früh hatte er sich altklug hervorgetan. Korten selbst schien ihn zu verachten, um so stolzer war er auf seine Enkelkinder. Marion war in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen worden, Ulrich hatte einen Preis von ›Jugend forscht‹ mit einer Arbeit über Primzahlzwillinge gewonnen. Ich hätte ihm von Turbo, meinem Kater, erzählen können und ließ es bleiben.
Ich trank den Mokka aus, und Korten hob die Tafel auf. Der Chef des Kasinos verabschiedete uns. Wir machten uns auf den Weg ins Werk.
[18] 3
Wie eine Ordensverleihung
Es waren nur ein paar Schritte. Das Kasino liegt gegenüber von Tor 1, im Schatten des Hauptverwaltungsgebäudes, das mit seiner zwanzigstöckigen Phantasielosigkeit nicht einmal die Skyline der Stadt beherrscht.
Der Direktorenlift hat nur Knöpfe für die Stockwerke 15 bis 20. Das Büro des Generaldirektors ist im 20. Stock, und mir gingen die Ohren zu. Im Vorzimmer überließ Korten mich Frau Schlemihl, die mich bei Firner anmeldete. Ein Händedruck, meine Hand in seinen beiden, statt »mein lieber Selb« ein »alter Freund« – dann war er weg. Frau Schlemihl, seit den fünfziger Jahren Kortens Sekretärin, hat für seinen Erfolg mit einem ungelebten Leben bezahlt, ist von gepflegter Verbrauchtheit, ißt Kuchen und trägt eine nie benutzte Brille am goldenen Kettchen um den Hals. Sie war beschäftigt. Ich stand am Fenster und blickte über ein Gewirr von Türmen, Hallen und Rohren auf den Handelshafen und das dunstblasse Mannheim. Ich mag Industrielandschaften und möchte nicht zwischen Industrieromantik und Waldidyll entscheiden müssen.
Frau Schlemihl riß mich aus meinen müßigen Betrachtungen. »Herr Doktor, darf ich Ihnen unsere Frau Buchendorff vorstellen? Sie leitet das Sekretariat von Herrn Direktor Firner.«
[19] Ich drehte mich um und stand einer großen, schlanken Frau um die Dreißig gegenüber. Sie hatte das dunkelblonde Haar hochgesteckt und damit ihrem mit den runden Backen und vollen Lippen jungen Gesicht den Ausdruck von Tüchtigkeit gegeben. An ihrer Seidenbluse fehlte der oberste Knopf, und der folgende war offen. Frau Schlemihl schaute mißbilligend.
»Guten Tag, Herr Doktor.« Frau Buchendorff gab mir die Hand und blickte mich mit ihren grünen Augen direkt an. Ihr Blick gefiel mir. Frauen sind erst dann schön, wenn sie mir in die Augen sehen. Es liegt darin ein Versprechen, auch wenn es nicht eingelöst und nicht einmal gegeben wird.
»Darf ich Sie zu Herrn Direktor Firner führen?« Sie ging vor mir durch die Tür, mit hübschem Schwung in Hüfte und Po. Schön, daß enge Röcke wieder Mode sind. Firners Büro lag im 19. Stock. Vor dem Fahrstuhl sagte ich zu ihr: »Lassen Sie uns die Treppe nehmen.«
»Sie sehen nicht aus, wie ich mir einen Privatdetektiv vorgestellt habe.«
Ich hatte diese Bemerkung schon oft gehört. Inzwischen weiß ich, wie Leute sich Privatdetektive vorstellen. Nicht nur jünger. »Sie sollten mich im Regenmantel sehen!«
»Ich meinte das positiv. Der im Trenchcoat hätte mit dem Dossier, das Ihnen Firner gleich geben wird, seine liebe Not gehabt.«
»Firner«, hatte sie gesagt. Ob sie was mit ihm hatte? »Sie wissen also, worum es geht.«
»Ich gehöre sogar zu den Verdächtigen. Im letzten Vierteljahr hat mir der Computer jeden Monat fünfhundert [20] Mark zuviel überwiesen. Und über mein Terminal hab ich Zugang zum System.«
»Haben Sie das Geld zurückzahlen müssen?«
»Ich bin kein Einzelfall. Betroffen sind 57 Kolleginnen, und die Firma überlegt noch, ob sie zurückfordert.«
In ihrem Vorzimmer drückte sie auf den Knopf der Sprechanlage. »Herr Direktor, Herr Selb ist da.«
Firner hatte zugenommen. Die Krawatte kam jetzt von Yves Saint Laurent. Immer noch waren Gang und Bewegungen flink und der Händedruck nicht fester. Auf seinem Schreibtisch lag ein dicker Ordner.
»Grüß Sie, Herr Selb. Schön, daß Sie sich der Sache annehmen. Wir dachten, es ist das beste, ein Dossier vorzubereiten, aus dem die Einzelheiten hervorgehen. Inzwischen sind wir sicher, daß es sich um gezielte Sabotageakte handelt. Den materiellen Schaden haben wir bislang zwar begrenzen können. Aber wir müssen ständig mit neuen Überraschungen rechnen und können uns auf keine Information verlassen.«
Ich blickte ihn fragend an.
»Fangen wir mit den Rhesusäffchen an. Unsere Fernschreiben werden über die Textverarbeitung erstellt und, wenn sie nicht dringend sind, im System gespeichert; sie gehen dann raus, wenn der günstige Nachttarif gilt. So verfahren wir auch mit unseren indischen Bestellungen; halbjährlich braucht unsere Forschungsabteilung rund hundert Rhesusäffchen, mit Exportlizenz des indischen Handelsministeriums. Statt über hundert ging vor zwei Wochen eine Bestellung über hunderttausend Äffchen raus. Zum Glück fanden die Inder das seltsam und fragten zurück.«
[21] Ich stellte mir hunderttausend Rhesusäffchen im Werk vor und grinste. Firner lächelte gequält.
»Ja, ja, das Ganze hat komische Aspekte. Auch das Durcheinander bei der Tennisplatzverteilung hat allerhand Heiterkeit ausgelöst. Wir müssen jetzt jedes Telex noch mal angucken, ehe es rausgeht.«
»Woher wissen Sie, daß es sich nicht um einen Tippfehler gehandelt hat?«
»Die Sekretärin, die den Telextext eingegeben hat, hat ihn wie üblich zur Korrektur und Paraphierung durch den Sachbearbeiter ausdrucken lassen. Der Ausdruck weist die richtige Zahl aus. Also wurde am Telex manipuliert, als es im Speicher in der Warteschlange war. Wir haben auch die übrigen Vorfälle, die im Dossier enthalten sind, untersucht und können Fehler bei der Programmierung oder Datenerfassung ausschließen.«
»Gut, das kann ich im Dossier lesen. Sagen Sie mir noch etwas zum Kreis der Verdächtigen.«
»Da sind wir konventionell vorgegangen. Von den Mitarbeitern, die eine Zugangsberechtigung oder -möglichkeit haben, haben wir alle ausgeschieden, die sich seit mehr als fünf Jahren bewährt haben. Da der erste Vorfall vor sieben Monaten passierte, entfallen alle, die seitdem eingestellt worden sind. Bei einigen Vorfällen ließ sich der Tag rekonstruieren, an dem ins System eingegriffen wurde, zum Beispiel bei dem Telex. Damit entfallen die an diesem Tag Abwesenden. Dann haben wir bei einem Teil der Terminals über einen gewissen Zeitraum alle Eingaben protokolliert und nichts gefunden. Und schließlich«, er lächelte selbstgefällig, »können wir wohl die Direktoren ausschließen.«
[22] »Wie viele sind übriggeblieben?« fragte ich.
»Rund hundert.«
»Da hab ich ja Jahre zu tun. Und was ist mit Hackern von draußen? Von so was liest man doch.«
»Das konnten wir in Zusammenarbeit mit der Post ausschließen. Sie sprechen von Jahren – wir sehen auch, daß der Fall nicht einfach ist. Trotzdem drängt die Zeit. Das Ganze ist nicht nur lästig; mit allem, was wir an Betriebs- und Produktionsgeheimnissen im Computer haben, ist es gefährlich. Es ist, wie wenn mitten in der Schlacht…« Firner ist Offizier der Reserve.
»Lassen wir die Schlachten«, unterbrach ich. »Wann wollen Sie den ersten Bericht?«
»Ich möchte Sie darum bitten, mich ständig auf dem laufenden zu halten. Sie können über die Zeit der Herren vom Werkschutz, vom Datenschutz, vom Rechenzentrum und von der Personalabteilung, deren Berichte Sie im Dossier finden, frei verfügen. Ich muß nicht sagen, daß wir um äußerste Diskretion bitten. Frau Buchendorff, ist der Ausweis für Herrn Selb fertig?« fragte er über die Sprechanlage.
Sie trat ein und überreichte Firner ein scheckkartengroßes Stück Plastik. Er kam um den Schreibtisch herum.
[23] 4
Turbo fängt eine Maus
Den Abend verbrachte ich über dem Dossier. Ein harter Brocken. Ich versuchte, in den Vorfällen eine Struktur zu erkennen, ein Leitmotiv für die Eingriffe in das System zu finden. Der oder die Täter hatten sich an der Lohnbuchhaltung zu schaffen gemacht. Sie hatten den Chefsekretärinnen, darunter Frau Buchendorff, über Monate fünfhundert Mark zuviel überweisen lassen, den Leichtlohngruppen das Feriengeld verdoppelt und alle Kontonummern von Lohn- und Gehaltsempfängern gelöscht, die mit 13 anfingen. Sie hatten sich in die interne Nachrichtenübermittlung eingemischt, vertrauliche Mitteilungen der Direktionsebene in die Presseabteilung geschleust und Jubiläen der Mitarbeiter unterdrückt, die die Abteilungsleiter zum Monatsanfang mitgeteilt bekommen. Das Programm zur Tennisplatzverteilung und -reservierung hatte alle Anfragen über den besonders begehrten Freitag bestätigt, so daß sich eines Freitags im Mai auf den 16 Tennisplätzen 1o8 Spieler einfanden. Dazu kam die Rhesusäffchengeschichte. Ich verstand Firners gequältes Lächeln. Der Schaden, ungefähr fünf Millionen, war für ein Unternehmen von der Größe der RCW zu verkraften. Aber wer immer ihn verursacht hatte, konnte im Management- und Betriebsinformationssystem der RCW spazierengehen.
[24] Draußen wurde es dunkel. Ich machte Licht, knipste den Schalter ein paarmal an und aus, erhielt dadurch aber, obwohl es binär war, keinen tieferen Einblick in das Wesen elektronischer Datenverarbeitung. Ich überlegte, ob unter meinen Freunden und Bekannten einer etwas von Computern verstand, und merkte, wie alt ich war. Da war ein Ornithologe, ein Chirurg, ein Schachgroßmeister, der eine und andere Jurist, alles betagte Herren, denen der Computer gerade so wie mir ein Buch mit sieben Siegeln war. Ich dachte darüber nach, was für ein Typ von Mensch es ist, der mit Computern umgehen kann und mag, und über den Täter meines Falls – mir war die Vorstellung von nur einem Täter selbstverständlich geworden.
Verspätete Schulbubenstreiche? Ein Spieler, ein Tüftler, ein Schalk, der die RCW in grandioser Weise auf den Arm nimmt? Oder ein Erpresser, ein kühler Kopf, der mit leichter Hand signalisiert, daß er auch zum großen Schlag fähig ist? Oder eine politische Aktion? Die Öffentlichkeit würde empfindlich reagieren, wenn dieses Ausmaß an Chaos in einem Betrieb, der mit hochgiftigen Stoffen umgeht, bekannt würde. Aber nein, der politische Aktionist hätte sich andere Vorfälle ausgedacht, und der Erpresser hätte schon längst zuschlagen können.
Ich machte das Fenster zu. Der Wind hatte gedreht.
Am nächsten Tag wollte ich als erstes mit Danckelmann reden, dem Chef des Werkschutzes. Danach hieß es, im Personalbüro die Akten der hundert Verdächtigen durchzusehen. Allerdings hatte ich wenig Hoffnung, den Spieler, den ich mir vorstellte, an seinen Personalakten zu erkennen. Beim Gedanken, hundert Verdächtige nach den [25] Regeln der Kunst überprüfen zu müssen, packte mich das schiere Entsetzen. Ich hoffte, daß meine Beauftragung die Runde machen, Vorfälle provozieren und dadurch den Kreis der Verdächtigen einschränken würde.
War kein doller Fall. Erst jetzt wurde mir bewußt, daß Korten mich gar nicht gefragt hatte, ob ich den Fall übernehmen wollte. Und daß ich ihm nicht gesagt hatte, ich würde mir das erst überlegen.
[26] 5
Bei Aristoteles, Schwarz, Mendelejew und Kekulé
Mit dem Sonderausweis fand ich für meinen Kadett leicht einen Parkplatz auf dem Werkgelände. Ein junger Werkschutzmann brachte mich zu seinem Chef.
Danckelmann stand es auf die Stirn geschrieben, daß er darunter litt, kein richtiger Polizist, geschweige denn ein richtiger Geheimdienstler zu sein. Das ist mit allen Werkschutzleuten dasselbe. Noch ehe ich ihm meine Fragen stellen konnte, hatte er mir erzählt, daß er bei der Bundeswehr nur aufgehört hatte, weil sie ihm zu lasch war.
»Ihr Bericht hat mich sehr beeindruckt«, sagte ich. »Sie deuten darin Ärger mit Kommunisten und Ökologen an?«
»Man kriegt die Burschen nur schwer zu fassen. Aber wer eins und eins zusammenzählt, weiß, was aus welcher Ecke kommt. Ich muß Ihnen auch sagen, ich verstehe nicht recht, warum man Sie von außen dazugeholt hat. Wir hätten das schon selber aufklären können.«
Sein Assistent kam ins Zimmer. Thomas, wie er mir vorgestellt wurde, wirkte kompetent, intelligent und effizient. Ich verstand, wieso Danckelmann sich als Chef des Werkschutzes behaupten konnte. »Haben Sie dem Bericht noch etwas hinzuzufügen, Herr Thomas?«
»Sie sollen wissen, daß wir das Feld nicht einfach Ihnen [27] überlassen werden. Niemand ist geeigneter als wir, den Täter zu fassen.«
»Und wie wollen Sie das machen?«
»Ich glaube nicht, Herr Selb, daß ich Ihnen das sagen möchte.«
»Doch, das wollen und das müssen Sie mir sagen. Zwingen Sie mich nicht, mich auf die Einzelheiten meines Auftrags und meiner Vollmacht zu berufen.« Mit solchen Leuten muß man förmlich werden.
Thomas wäre hartnäckig geblieben. Aber Danckelmann unterbrach: »Es hat schon seine Richtigkeit, Heinz. Firner hat heute früh angerufen und uns zu rückhaltloser Zusammenarbeit verpflichtet.«
Thomas gab sich einen Ruck. »Wir haben uns überlegt, mit Hilfe des Rechenzentrums einen Köder auszulegen und eine Falle zu bauen. Wir werden alle Systembenutzer über die Einrichtung einer neuen, streng vertraulichen und, das ist der springende Punkt, absolut sicheren Datei informieren. Diese Datei zur Aufnahme von besonders klassifizierten Daten läuft aber leer, sie existiert genaugenommen gar nicht, weil entsprechende Informationen nicht vorkommen werden. Es würde mich wundern, wenn die Ankündigung der absoluten Sicherheit den Täter nicht herausfordern würde, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich zur Datei Zugang zu verschaffen. Sobald sie angesprochen wird, verzeichnet der zentrale Rechner die Merkmale des Benutzers, und damit sollte der Fall erledigt sein.«
Das hörte sich einfach an. »Warum machen Sie das erst jetzt?«
»Die ganze Geschichte hat bis vor ein, zwei Wochen [28] noch niemanden interessiert. Und außerdem«, Thomas legte die Stirn in Falten, »wir vom Werkschutz sind nicht die ersten, die darüber informiert werden. Wissen Sie, man hält den Werkschutz immer noch für eine Ansammlung pensionierter oder, schlimmer noch, gefeuerter Polizeibeamter, die zwar den Schäferhund auf jemanden hetzen können, der über den Betriebszaun klettert, aber nichts im Kopf haben. Dabei sind wir heute Fachkräfte in allen Fragen betrieblicher Sicherheit, vom Objektschutz bis zum Personenschutz und eben auch bis zum Datenschutz. Wir richten gerade an der Fachhochschule Mannheim einen Studiengang ein, der zum Diplom-Sicherheitswart ausbilden wird. Die Amerikaner sind uns da, wie immer…«
»Voraus«, ergänzte ich. »Wann wird die Falle fertig sein?«
»Heute ist Donnerstag. Der Leiter des Rechenzentrums will die Sache am Wochenende selbst vorbereiten, und am Montagmorgen sollen die Benutzer informiert werden.«
Die Aussicht, den Fall schon am Montag abschließen zu können, war verlockend, auch wenn es dann nicht mein Erfolg wäre. Aber in einer Welt der Diplom-Sicherheitswarte hatte ich sowieso nichts verloren.
Ich wollte nicht gleich aufgeben und fragte: »In meinem Dossier habe ich eine Liste mit ungefähr hundert Verdächtigen gefunden. Hat der Werkschutz zum einen oder anderen noch Erkenntnisse, die nicht in den Bericht aufgenommen worden sind?«
»Gut, daß Sie darauf zu sprechen kommen, Herr Selb«, sagte Danckelmann. Er stemmte sich von seinem Schreibtischsessel hoch, und als er auf mich zukam, sah ich, daß er [29] hinkte. Er bemerkte meinen Blick. »Workuta. 1945 kam ich mit achtzehn in russische Gefangenschaft, 1955 zurück. Ohne den Alten aus Rhöndorf wär ich jetzt noch dort. Aber zu Ihrer Frage. In der Tat liegen uns über einige Verdächtige auch Erkenntnisse vor, die wir nicht in den Bericht nehmen wollten. Es gibt ein paar Politische, über die uns der Verfassungsschutz im Wege der Amtshilfe auf dem laufenden hält. Und ein paar mit Schwierigkeiten im Privatleben, Frauen, Schulden und so.«
Er nannte mir elf Namen. Als wir die durchgingen, merkte ich rasch, daß bei den sogenannten Politischen nur die üblichen Lappalien anlagen: im Studium ein falsches Flugblatt unterzeichnet, für eine falsche Gruppe kandidiert, auf der falschen Demo marschiert. Interessant war mir, daß auch Frau Buchendorff dabei war. Zusammen mit anderen Frauen hatte sie sich mit Handschellen am Zaun vor dem Haus des Familienministers angekettet.
»Worum ging es denn damals?« fragte ich Danckelmann.
»Das hat uns der Verfassungsschutz nicht mitgeteilt. Nach der Scheidung von ihrem Mann, der sie wohl in solche Sachen hineingetrieben hat, ist sie nie mehr auffällig geworden. Aber ich sage immer, wer einmal politisch war, bei dem kann’s von heute auf morgen wieder losgehen.«
Der Interessanteste fand sich auf der Liste der ›Lebensversager‹, wie Danckelmann sie nannte. Ein Chemiker, Franz Schneider, Mitte Vierzig, mehrfach geschieden und leidenschaftlicher Spieler. Man war auf ihn aufmerksam geworden, weil er beim Lohnbüro zu oft um Abschläge gebeten hatte.
»Wie sind Sie auf ihn gekommen?« fragte ich.
[30] »Das ist Standardprozedur. Sobald einer das dritte Mal Vorschuß verlangt, sehen wir ihn uns an.«
»Und was genau heißt das?«
»Das kann, wie in diesem Fall, bis zum Beschatten gehen. Wenn Sie wollen, können Sie mit Herrn Schmalz reden, der das damals gemacht hat.«
Ich ließ Schmalz ausrichten, daß ich ihn um zwölf Uhr zum Lunch im Kasino erwartete. Ich wollte noch sagen, daß ich vor dem Eingang am Ahorn auf ihn warten würde, aber Danckelmann winkte ab. »Lassen Sie mal, Schmalz ist einer unserer Besten. Der findet Sie schon.«
»Auf gute Zusammenarbeit«, sagte Thomas. »Sie nehmen mir nicht übel, daß ich ein bißchen empfindlich bin, wenn uns Sicherheitskompetenzen entzogen werden. Und Sie kommen von außen. Aber ich habe mich über das angenehme Gespräch gefreut, und«, er lachte entwaffnend, »unsere Erkenntnisse über Sie sind ausgezeichnet.«
Beim Verlassen des Backsteingebäudes, in dem der Werkschutz untergebracht war, verlor ich die Orientierung. Vielleicht hatte ich die falsche Treppe genommen. Ich stand in einem Hof, an dessen Längsseiten Einsatzfahrzeuge des Werkschutzes geparkt waren, blau lackiert, mit dem Firmenlogo auf den Türen, dem silbernen Benzolring und darin den Buchstaben RCW. Der Eingang an der Stirnseite war als Portal gestaltet, mit zwei Sandsteinsäulen und vier Sandsteinmedaillons, aus denen mich geschwärzt und traurig Aristoteles, Schwarz, Mendelejew und Kekulé ansahen. Anscheinend stand ich vor dem alten Hauptverwaltungsgebäude. Ich verließ den Hof und kam in einen weiteren, dessen Fassaden ganz von russischem Wein [31]
[32] 6
Ragoût fin im Ring mit Grünem
Als ich das Kasino betrat, sprach mich ein kleiner, dünner, blasser, schwarzhaariger Mann an. »Herr Selb?« lispelte er, »Schmalz der Name.«
Meine Einladung, einen Aperitif zu nehmen, lehnte er ab. »Danke, ich trinke keinen Alkohol.«
»Und wie wär’s mit einem Fruchtsaft?« Ich wollte auf meinen Aviateur nicht verzichten.
»Um ein Uhr geht die Arbeit weiter, möchte doch darum bitten, gleich… kann Ihnen eh nicht viel berichten.«
Die Antwort war elliptisch, aber ohne Zischlaute. Hatte er gelernt, Wörter mit s und z aus seinem Sprachschatz zu tilgen?
Die Dame am Empfang klingelte nach einer Bedienung, und das Mädchen, das neulich an der Direktorenbar ausgeholfen hatte, brachte uns im ersten Stock im großen Speisesaal an einen Fenstertisch.
»Sie wissen, womit ich das Essen am liebsten beginne?«
»Ich will mich gleich drum kümmern«, lächelte sie.
Beim Oberkellner bestellte Schmalz »ein Ragoût fin im Ring mit Grünem, bitte«. Mir war nach süß-saurem Schweinefleisch Szechuan. Schmalz guckte mich neidisch an. Auf die Suppe verzichteten wir beide aus unterschiedlichen Gründen.
[33] Beim Aviateur bat ich um das Ergebnis der Ermittlungen zu Schneider. Schmalz berichtete überaus präzise und unter Vermeidung jeden Zischlauts. Ein unglückseliger Mensch, dieser Schneider. Nach ziemlichem Eklat wegen einer Vorschußforderung hatte Schmalz ihn über einige Tage beschattet. Schneider spielte nicht nur in Bad Dürkheim, sondern auch in privaten Hinterzimmern und war entsprechend verstrickt. Als er auf Veranlassung seiner Spielgläubiger zusammengeschlagen wurde, ging Schmalz dazwischen und brachte den nicht ernsthaft verletzten, aber völlig verstörten Schneider nach Hause. Es war der rechte Zeitpunkt für ein Gespräch zwischen Schneider und dessen Vorgesetztem. Man traf ein Arrangement: Der in der Pharmaforschung unverzichtbare Schneider wurde für drei Monate aus dem Verkehr gezogen und in Kur geschickt, die einschlägigen Kreise wurden verpflichtet, Schneider keine Gelegenheit mehr zum Spielen zu geben. Der Werkschutz der RCW ließ den starken Arm spielen, den er im Mannheimer und Ludwigshafener Milieu hat.
»War vor drei Jahren, und danach war der Mann nicht mehr auffällig. Aber nach meiner Meinung bleibt der eine Bombe, die weitertickt.«
Das Essen war ausgezeichnet. Schmalz aß hastig. Er ließ kein Reiskorn auf dem Teller übrig – Pedanterie des Magenneurotikers. Ich fragte, was seiner Meinung nach mit dem passieren sollte, der hinter dem Computerschlamassel steckte.
»Werden ihn vor allem mal gründlich befragen. Und dann ihn richtig hinbiegen. Von ihm darf dem Werk keine [34] Gefahr mehr drohen. Vielleicht kann man den Mann gut brauchen, wird wohl ein Talent…«
Er suchte nach einem zischlautlosen Synonym für ›sein‹. Ich bot ihm eine Sweet Afton an.
»Nehme lieber meine eigenen«, sagte er und holte eine braune Plastikbox mit selbstgestopften Filterzigaretten aus der Tasche. »Macht immer meine Frau für mich, nicht mehr wie acht pro Tag.«
Wenn ich etwas hasse, sind es Selbstgestopfte. Sie liegen auf einer Ebene mit Schrankwänden, festinstallierten Wohnwagen und gehäkelten Kleidchen für das Klopapier auf der Heckablage des Sonntagsausflugsautos. Die Erwähnung der Frau erinnerte mich an die Hausmeisterwohnung mit dem Namensschild ›Schmalz‹.
»Sie haben einen kleinen Jungen?«
Er schaute mißtrauisch und gab die Frage mit einem »Wie meinen?« zurück. Ich erzählte von meinem Irrweg durch das alte Werk, von der verwunschenen Stimmung im weinberankten Hof und der Begegnung mit dem kleinen Jungen mit dem bunten Ball. Schmalz entspannte sich und bestätigte, daß in der Hausmeisterwohnung sein Vater wohnte.
»Der war auch bei der Truppe, kennt den General noch gut von früher. Nun guckt er im alten Werk nach dem Rechten. Am Morgen bringen wir ihm immer den Jungen, meine Frau arbeitet auch hier im Betrieb.«
Ich erfuhr, daß früher viele Werkschutzleute auf dem Gelände gewohnt hatten und Schmalz praktisch dort aufgewachsen war. Er hatte den Wiederaufbau des Werks miterlebt und kannte jeden Winkel. Ich fand die Vorstellung [35] eines Lebens zwischen Raffinerien, Reaktoren, Destillatoren, Turbinen, Silos und Kesselwagen bei aller Industrieromantik bedrückend.
»Haben Sie sich nie um einen Job außerhalb der RCW kümmern mögen?«
»Konnte ich meinem Vater nicht antun. Vater meint immer: Wir gehören hierher, der General wirft den Bettel ja auch nicht hin.«
Er sah auf die Uhr und sprang auf. »Kann leider nicht länger bleiben. Bin auf ein Uhr zum Personenschutz«, ein Wort, das er fast fehlerlos aussprach, »eingeteilt. Bedanke mich auch für die Einladung.«
Mein Nachmittag im Personalbüro war unergiebig. Um vier Uhr gestand ich mir ein, daß ich das Studium der Personalakten endgültig lassen konnte. Ich ging bei Frau Buchendorff vorbei, von der ich inzwischen wußte, daß sie Judith hieß, dreiunddreißig war, einen Hochschulabschluß in Deutsch und Englisch hatte und als Lehrerin nicht untergekommen war. Sie war seit vier Jahren bei RCW, zunächst im Archiv, dann in der PR-Abteilung, wo sie Firners Aufmerksamkeit erregt hatte. Sie wohnte in der Rathenaustraße.
»Bleiben Sie doch bitte sitzen«, sagte ich. Sie hörte auf, unter dem Schreibtisch mit den Füßen nach den Schuhen zu suchen, und bot mir einen Kaffee an. »Gerne, dann können wir auf gute Nachbarschaft trinken. Ich habe Ihre Personalakte gelesen und weiß jetzt fast alles über Sie, außer, wieviel Seidenblusen Sie besitzen.« Sie hatte wieder eine an, diesmal hochgeschlossen.
»Falls Sie am Samstag zum Empfang kommen, sehen Sie [36] die dritte. Haben Sie schon Ihre Einladung?« Sie schob mir eine Tasse hin und zündete eine Zigarette an.
»Was für ein Empfang?« Ich schielte nach ihren Beinen.
»Wir haben seit Montag eine Delegation aus China hier, und zum Abschluß wollen wir zeigen, daß nicht nur unsere Anlagen, sondern auch unsere Büfetts besser sind als bei den Franzosen. Firner meinte, Sie könnten bei der Gelegenheit zwanglos ein paar für Ihren Fall interessante Leute kennenlernen.«
»Werde ich auch Sie zwanglos kennenlernen können?«
Sie lachte. »Ich bin für die Chinesen da. Aber es gibt da eine Chinesin, bei der ich noch nicht verstanden habe, wofür sie zuständig ist. Vielleicht ist sie die Sicherheitsexpertin, die stellt man nicht vor, also eine Art Kollegin von Ihnen. Eine hübsche Frau.«
[37] 7
Kleine Panne
Am nächsten Tag stand die Luft über Mannheim und Ludwigshafen. Es war so schwül, daß mir ohne jede Bewegung die Kleider am Leib klebten. Die Fahrerei war stockend und hektisch, ich hätte für Kuppeln, Bremsen und Gasgeben drei Füße brauchen können. Auf der Konrad-Adenauer-Brücke war alles aus. Es hatte einen Auffahrunfall gegeben und nach dem einen gleich den nächsten. Ich stand zwanzig Minuten im Stau, sah dem Gegenverkehr und den Zügen zu und rauchte, um nicht zu ersticken.
Der Termin mit Schneider war um halb zehn. Der Pförtner am Tor 1 erklärte mir den Weg. »Das sind keine fünf Minuten. Gehen Sie geradeaus, und wenn Sie an den Rhein kommen, noch mal hundert Meter links. Die Labors sind in dem hellen Gebäude mit den großen Fenstern.«
Ich machte mich auf den Weg. Unten am Rhein sah ich den kleinen Jungen, der mir gestern begegnet war. Er hatte eine Schnur an sein Sandeimerchen gebunden und schöpfte damit Wasser aus dem Rhein. Das Wasser schüttete er in den Gully.
»Ich mache den Rhein leer«, rief er, als er mich sah und erkannte.
»Hoffentlich klappt’s.«
»Was machst du hier?«
[38] »Ich muß da vorne ins Labor.«
»Darf ich mit?«
Er schüttete sein Eimerchen aus und kam. Kinder machen sich oft an mich ran, ich weiß nicht, warum. Ich habe keine, und die meisten nerven mich.
»Komm schon«, sagte ich, und wir gingen zusammen auf das Haus mit den großen Fenstern zu.
Wir waren ungefähr fünfzig Meter entfernt, als aus dem Eingang ein paar Weißgewandete hasteten. Sie rannten das Rheinufer runter. Dann kamen mehr, nicht nur im weißen Kittel, sondern auch im Blaumann, und die Sekretärinnen in Rock und Bluse. Es war putzig anzuschauen, und ich verstand nicht, wie man bei dieser Schwüle rennen konnte.
»Guck mal, der winkt uns«, sagte der kleine Junge, und in der Tat, einer von den Weißkitteln fuchtelte mit den Armen und rief uns etwas zu, was ich nicht verstand. Aber ich mußte auch nicht mehr verstehen; offensichtlich galt es, sich so schnell wie möglich davonzumachen.
Die erste Explosion schüttete eine Kaskade von Glassplittern über die Straße. Ich griff nach der Hand des kleinen Jungen, aber der riß sich los. Einen Moment war ich wie gelähmt: Ich spürte keine Verletzung, hörte trotz des weiterklirrenden Glases eine große Stille, sah den Jungen rennen, auf den Glassplittern ausrutschen, sich noch einmal fangen, nach zwei schiefen Schritten endgültig fallen und, von seiner Bewegung vorangetrieben, sich überschlagen.
Dann kam die zweite Explosion, der Schrei des kleinen Jungen, der Schmerz im rechten Arm. Dem Knall folgte ein scharfes, gefährliches, bösartiges Zischen. Ein Geräusch, das mich in Panik versetzte.
[39] Den Sirenen, die in der Ferne einsetzten, verdanke ich, daß ich handeln konnte. Sie weckten die im Krieg eingeübten Reflexe des Flüchtens, Helfens, Schutzsuchens und -gebens.
Ich rannte auf den Jungen zu, zog ihn mit meiner linken Hand hoch, zerrte ihn in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Seine kleinen Füße konnten nicht Schritt halten, aber er strampelte und ließ nicht los. »Los, Bübchen, lauf, wir müssen hier weg, mach nicht schlapp.« Ehe wir um die Ecke bogen, sah ich zurück. Wo wir gestanden hatten, wuchs eine grüne Wolke in den bleigrauen Himmel.
Den Sanitätswagen, die vorbeirasten, winkte ich vergebens. An Tor 1 nahm sich der Pförtner unser an. Er kannte den kleinen Jungen, der sich blaß, verschrammt und verschreckt an meiner Hand festhielt.
»Richard, um Gottes willen, was ist denn mit dir passiert? Ich ruf gleich deinen Großvater.« Er ging zum Telefon. »Und für Sie hol ich am besten die Sanität. Das sieht böse aus.«
Ein Glassplitter hatte den Arm aufgerissen, und das Blut färbte den Ärmel der hellen Jacke rot. Mir war flau. »Haben Sie einen Schnaps?«
An die nächste halbe Stunde erinnere ich mich nur schwach. Richard wurde abgeholt. Sein Großvater, ein großer, breiter, schwerer Mann mit kahlem, hinten und an der Seite glattrasiertem Schädel und buschigem weißem Schnurrbart, nahm den Enkel mühelos auf den Arm. Die Polizei versuchte, in das Werk zu kommen und den Unfall zu untersuchen, wurde aber zurückgewiesen. Der Pförtner gab mir noch einen zweiten und einen dritten Schnaps. Als [40] die Sanitäter kamen, nahmen sie mich mit zum Werksarzt, der meinen Arm nähte und in eine Schlinge legte.
»Sie sollten noch ein bißchen im Nebenzimmer abliegen«, sagte der Arzt. »Raus kommen Sie jetzt nicht.«
»Wieso komme ich nicht raus?«
»Wir haben Smogalarm, und der gesamte Verkehr ist unterbunden.«
»Wie habe ich das zu verstehen? Sie haben Smogalarm und verbieten, das Zentrum des Smog zu verlassen?«
»Das verstehen Sie ganz falsch. Smog ist ein meteorologisches Gesamtereignis und kennt nicht Zentrum oder Peripherie.«
Ich hielt das für völligen Unsinn. Was es sonst auch für Smog geben mochte – ich hatte eine grüne Wolke gesehen, und die wuchs, und sie wuchs hier auf dem Werksgelände. Auf dem sollte ich bleiben? Ich wollte mit Firner reden.
In seinem Büro war ein Krisenstab eingerichtet worden.
Durch die Tür sah ich Polizisten in Grün, Feuerwehrleute in Blau, Chemiker in Weiß und einige graue Herren von der Direktion.
»Was ist eigentlich passiert?« fragte ich Frau Buchendorff.
»Wir hatten eine kleine Panne auf dem Gelände, nichts Ernstes. Nur haben die Behörden dummerweise Smogalarm ausgelöst, und das hat ziemliche Aufregung gegeben. Aber was ist mit Ihnen passiert?«
»Ich hab bei Ihrer kleinen Panne ein paar kleine Kratzer abbekommen.«
»Was hatten Sie denn dort… Ach, Sie waren auf dem Weg zu Schneider. Er ist übrigens heute gar nicht da.«
[41] »Bin ich der einzige Verletzte? Hat es Tote gegeben?«
»Aber wo denken Sie hin, Herr Selb. Ein paar Erste-Hilfe-Fälle, das ist alles. Können wir noch etwas für Sie tun?«
»Sie können mich hier rausschaffen.« Ich hatte keine Lust, mich zu Firner vorzukämpfen und mich mit »Grüß Sie, Herr Selb« begrüßen zu lassen.
Aus dem Büro kam ein Polizist mit diversen Rangabzeichen.