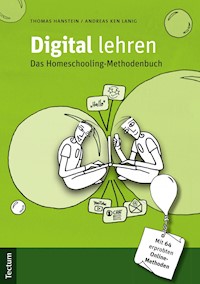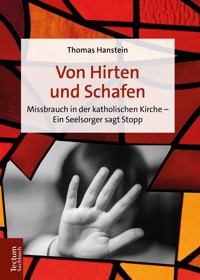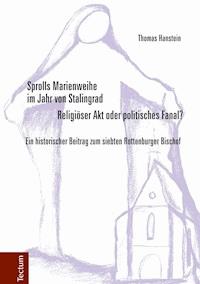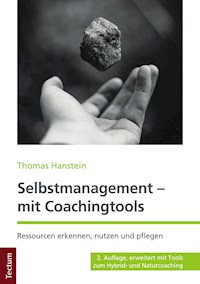
38,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Ratgeber wendet sich an Coachs und Klienten gleichermaßen: mit Tools aus der eigenen Coachingpraxis des Autors, Tipps zum weitergehenden Selbstcoaching oder auch zur Nachbereitung eines Coachingprozesses. Praktische Beispiele und anschauliche Visualisierungen empfohlener und weiterentwickelter Tools unterstützen methodisch und zielgerichtet das eigene Selbstmanagement. Die verbindende Klammer aller Einheiten liegt auf dem Ressourcenansatz. Die Neuauflage reflektiert die Veränderungen in der Coachinglandschaft mit der Corona-Pandemie. Es finden sich neuartige Coaching-Formate: virtuelles und hybrides Coaching sowie Naturcoaching. Farbige Motive authentischer Hybrid- und Naturcoachingprozesse ergänzen die bisherigen Visualisierungen und leiten den Leser methodisch zum Selbstcoaching an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thomas Hanstein
Selbstmanagement – mit Coachingtools
Thomas Hanstein
Selbstmanagement – mit Coachingtools
Ressourcen erkennen, nutzen und pflegen
Tectum Verlag
Thomas Hanstein
Selbstmanagement – mit Coachingtools
Ressourcen erkennen, nutzen und pflegen
2. Auflage, erweitert mit Tools zum Hybrid- und Naturcoaching
© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021
ePub 978-3-8288-7650-7
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4587-9 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: pixabay.com © StockSnap, © Antje Ebersbach und Autor
© Abbildung Rückseite: Autor
© Abbildungen im Innenteil: Abb. 1-26, 28: Thomas Hanstein und Abb. 27: Petra Wagner
© Autorenporträt: Angie Ehinger
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 Coaching – ein Etikett für alles und jeden?
Ursprung – sportliche Begleitung erobert die Wirtschaft
Was Coaching leisten kann – und was es nicht ist
2 Markteroberung – fester Bestandteil der Personalentwicklung
Vom Allrounder zur Fachdisziplin
Vom Business- zum Personal-Coaching
Vom Präsenz- zum Virtuellen Coaching
3 Neurowissenschaftliche Fundierung – Coaching mit Wurzeln und Profession
Klassische Pfade zum Unbewussten
Zwischenertrag: Praktische Implikationen für Coaching
Die Bedeutung (organisations-)theoretischer Ansätze
Fazit: Personenzentrierung statt Guru
4 Systemisches Coaching – vom Wissen um Organisationsprozesse
Ursprung und theoretische Grundlegung
Systemisch-lösungsorientiertes Coaching als integrativer Ansatz
Menschenbild, Grundhaltungen, Standards
Gesprächs- und Prozess-Struktur
5 Coaching praktisch – auf dem Weg zum Selbsterleben
Selbstkonzept und Kongruenz: Was wir sind und was wir sein können …
Archetypen und innere Landschaft: Ihreinneren Mitspieler einladen
Vom Verhalten zur Handlung: Nur Reaktion macht noch keinen Menschen
Embodiment: Warum Ihr Körper schneller als Ihr Geist ist
Ressourcen und innere Bilder: Ihre Innenwelt als Wegweiser achten lernen
Selbstregulation: Weil Selbstkontrolle zu ungesunder Verdrängung führt
6 Coachingtools – Werkzeuge für ganzheitliches Selbstmanagement
Vom Ziel zur Umsetzung – eine Einleitung: Warum der „Rubikon“ so steinig ist
Interventionen: Den Schatten durchbrechen und neu sehen lernen
Paradox intervenieren: Gezielte Durchkreuzung des Gewohnten
Mythologische Perspektiven: Die Macht des Archaischen in sich nutzen
Asketisches Zuhören: Vom Vorwurf zum Bedürfnis
Ankern: Nur wer Halt hat, strauchelt nicht
Konfliktgeometrie: Was dasKreisen aus spitzen Dreiecken machen kann
Märchenwelten: Auf Feen, Elfen und Schatten achten
Reframing: Neue Perspektive durch veränderten Kontext
Tetralemma: Weil es immer mehrere Möglichkeiten gibt
Übergangsbrücke: Altes zurücklassen, Leichtes mitnehmen
Skaliertes Bewerten: Die Dinge in eine Ordnung bringen
Innere Teamaufstellung: Wer helfen kann und wer nur stören will
Heldenreise: Von der Unbestechlichkeit des Weisen
Körperreise: Den Lieblingsort als Ressource mit sich führen
Identitätshaus: Tragende Säulen und gefährdete Bauteile
Systemaufstellung: Wie man sich Überblick verschafft
Komfortzonenarbeit: Vom Gewinn durch Herausforderungen
Ressourcenrad: Feste Speichen für bewegende Zeiten
Timeline: Zeit als Ordnungsprinzip zielgerichtet einsetzen
Wenn-Dann-Pläne: Die Kraft des Unbewussten nutzen
Ressourcenbaum: Kraftvoll gebaut von der Wurzel bis zur Krone
Motto-Ziele: Ihre innere Leitidee erkennen und umsetzen
Entwicklungsplan: Nur wer sich verändert, bleibt sich treu
Kraftort Natur: Ressourcen entdecken im Naturcoaching
Von der Lage- in die Handlungsorientierung
Die (eigentliche) Reise geht nach innen
Systemisch-lösungsorientiertes Reframing mit der Natur
Klassische Themen und Naturmetaphern
Exkurs: Den inneren Horizont schreibend wiederfinden (Petra Wagner)
Naturcoaching – virtuell und hybride
7 Fazit – Ressourcen erkennen, nutzen und pflegen
Anhang
Übersicht der Anhänge
Literatur
Abbildungen
Über den Autor
Vorwort
Neben dem äußeren Selbstmanagement gibt es das innere Selbstmanagement; hierunter verstehen wir den inneren Dialog, der mit den darauf aufbauenden äußeren Handlungen in Verbindung steht. Gallwey (2012) hat in seinem Buch „Das Innere Spiel“ mit Bezug zum Tennis die These aufgestellt, dass es neben dem äußeren Spiel, das für einen Beobachter sichtbar ist, noch ein inneres Spiel gibt. Dabei geht es um den Kontakt zum inneren Team, durch den der ‚Stein ins Rollen‘ – so das Coaching-Motto des Autors – gebracht werden soll. Dieser Zusammenhang von bewusster Wahrnehmung der Außenwelt und innerer Achtsamkeit zieht sich als Ansatz durch das ganze Buch.
Eine Besonderheit dieses Buches besteht darin, dass es sich gleichermaßen an sich selbst Coachende, Coaches und Coachees wendet. Den an einem Coaching interessierten Menschen bietet es einen Überblick bezüglich der Hintergründe, der theoretischen Fundierung und des praktischen Vorgehens von Coaching und schafft damit Transparenz für Menschen, die es in Erwägung ziehen, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, es in seinem Ablauf verstehen zu wollen bzw. dieses nachbereiten zu wollen. Für alle, die den nicht ganz einfachen Weg eines Selbstcoachings ausprobieren möchten, gibt die Publikation wichtige Hinweise, was dabei zu beachten ist. Schließlich bietet das Buch auch für Coaches methodische Anregungen und Anlässe, die eigene Praxis zu reflektieren. Mit den eigenen praktischen Fallbeispielen gelingt es dem Autor, die in den Tools vorgestellten Interventionen anschaulich zu machen.
Ein Schwerpunkt dieses Buches ist die Innenwelterkundung. Es ist insbesondere für alle wichtig, die das Buch als einen Weg zum Selbstcoaching nutzen möchten. Hier werden die zentralen Grundlagen zum Verständnis des eigenen Selbsterlebens gelegt. Wie aus der Salutogenese nach Aaron Antonovsky bekannt ist, strebt der Mensch nach Kohärenz. Persönliche Zufriedenheit entsteht, wenn eine Stimmigkeit zwischen Selbstkonzept, Selbstbild und sozialer Rolle existiert. Die Unzufriedenheit kann hingegen ein Indikator für den Wunsch nach Veränderung und Entwicklung und damit der Ausgangspunkt für ein (Selbst-)Coaching sein. Um die innere Landschaft besser zu verstehen, kann es hilfreich sein, etwas über sein inneres Team zu erfahren. Die Beschäftigung mit Archetypen ist dabei eine Möglichkeit des Zugangs zur Selbstbeobachtung und -analyse, die der Autor offeriert, um eigenes Verhalten im Coachingprozess zu reflektieren. Ein zweiter Weg ist das Embodiment, das sich mit der Wechselwirkung von Körpererfahrung, Emotion und Kognition beschäftigt. Über somatische Marker lässt sich etwas über das emotionale Erfahrungsgedächtnis erkunden. Auf diese Weise kann es gelingen, eine Brücke zwischen dem Verstand und dem Unterbewussten zu schlagen. Das Züricher Ressourcenmodell, auf das u. a. im (Selbst-)Coaching zurückgegriffen wird, versucht genau dies im Prozess der Selbstregulation.
Die Tools und Interventionen für ganzheitliches ressourcenorientiertes Selbstmanagement bieten zahlreiche Anregungen. Die Werkzeuge sind für den Autor deshalb so zentral, weil es mit ihrer Hilfe gelingen kann, Musterzustände, die sich als wenig hilfreich erwiesen haben, in Frage zu stellen. Genau dies meint er, wenn er von „intervenieren“ spricht. Mittels Interventionen gilt es „den Schatten (zu) durchbrechen und neu sehen (zu) lernen“. Auf die zentrale Bedeutung von Haltungen weist der Autor an verschieden Stellen hin und deshalb ist es für ihn auch konsequent, wenn er feststellt: „Der Klient ist nicht für die Tools da, sondern die Tools für den Klienten.“ Der Autor hat sich bewusst dafür entschieden, nur diejenigen Tools zu beschreiben und an Beispielen zu veranschaulichen, „die in der bisherigen Praxis des Autors von wiederkehrender Bedeutung waren“. Hier nicht den Versuch zu unternehmen, eine systematische Abhandlung aller möglichen Instrumente und Methoden zu offerieren – die ohnehin vermutlich unvollständig bleiben müsste –, sondern bewusst eine subjektive Auswahl zu treffen, ist eine Stärke des Buches. So gelingt es mit den eigenen erfahrungsgesättigten Beispielen zu überzeugen. Die beschriebenen Tools bauen aufeinander auf und zeichnen sich durch eine Systematik aus, die mit einer theoretischen Einführung beginnt, gefolgt von einem Szenario mit Hinweisen zum Selbstcoaching, einem Fallbeispiel und dessen Besprechung; den Abschluss bilden Überlegungen zum Transfer. Angereichert werden die einzelnen Interventionen durch handschriftliche farbige Abbildungen aus dem eigenen Coaching des Autors, welche zentrale Aspekte gut veranschaulichen.
Im abschließenden Kapitel zieht der Autor ein Fazit, in dem er die Kennzeichen seines ganzheitlichen und ressourcenorientierten Ansatzes resümiert. Dabei wendet er sich sowohl an Interessenten eines angeleiteten bzw. eines Selbstcoachings als auch an professionelle Coaches. Unabhängig davon, für welches Format die Entscheidung fällt, es geht immer um die Steigerung der Selbstmanagementkompetenz. Beide Formate werden in einem sich ergänzenden Verhältnis zueinander gesehen, so dass sich alternierende Phasen zur jeweiligen Vor- bzw. Nachbereitung aus Sicht des Autors anbieten. Vereint werden die unterschiedlichen Coachingaktivitäten in dem Ziel des (Wieder-)Erlebens von Kongruenz.
Mit der hier vorgelegten Publikation gelingt es dem Autor, zur Schärfung professioneller Formate beizutragen. Im Unterschied zu anderen Veröffentlichungen mit Ratgebercharakter, die sich nahezu ausschließlich mit Tools beschäftigen, stellt der Autor diese jeweils in ihren jeweiligen theoretischen Kontext. Das Buch eignet sich deshalb gut für alle, die einen Einstieg ins Thema Coaching suchen und auch an Hintergründen interessiert sind. Dem Autor geht es darum, Transparenz über die Ansätze und Vorgehensweisen eines systemisch-lösungsorientierten Coachings herzustellen, das auf einem humanistischen Menschenbild beruht. Die Beispiele aus den eigenen Coachingsitzungen vermitteln einen lebendigen Eindruck von der Praxis des Coachings. Mit der Verbindung von angeleitetem Coaching und Selbstcoaching wird ein innovativer Ansatz verfolgt, den es mit Interesse weiter zu verfolgen gilt.
In der nun erscheinenden 2. Auflage von „Selbstmanagement – mit Coachingtools“ ergänzt der Autor Coaching-Formate, die letztlich mit der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen haben: virtuelles und hybrides Coaching sowie Naturcoaching. Zu den bisherigen eigenen Visualisierungen der Tools sind – wieder farbige – Motive von authentischen Hybrid- und Naturcoachingprozessen hinzugetreten. Diese werden an Fallbeispielen reflektiert und stimmig in die Struktur der 1. Auflage eingebunden. Diese Fortschreibung spiegelt die aktuelle Dynamik in der Coaching-Szene und ist sehr zu begrüßen.
Ich wünsche auch der 2. Auflage dieses Buches eine breite Akzeptanz und eine experimentierfreudige Leserschaft unter Coaches und Klienten.
Jena, im Januar 2021
Prof. Dr. Erich Schäfer
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Einleitung
Der Coachinghype hält seit vielen Jahren an. Während in der professionellen Coachingszene deshalb mittlerweile viel Wert auf Qualitätssicherung und Standards gelegt wird, wird Coaching parallel für nahezu jedes Anliegen – und oft auch ungeachtet der Qualifizierung des Coachs – angeboten. Das Buch soll zum einen zur Schärfung professioneller Formate beitragen. Es verschafft in einem ersten Schritt einen knappen Überblick über Herkunft, Ausbreitung und neurowissenschaftliche Fundierung und will dem Leser1 die Grundlagen systemisch-lösungsorientierten Coachings näherbringen. Der theoretische Teil wurde, da es sich um einen Ratgeber handelt, bewusst bündig aufgebaut, zur Verortung des praktischen Teils ist diese systematische Einführung jedoch unverzichtbar. Zahlreiche Literaturhinweise bieten allerdings die Möglichkeit, die angesprochenen Aspekte weitergehend zu vertiefen. In einem zweiten Schritt – dem Hauptteil dieses Ratgebers – werden bewährte und innovative Tools an eigenen Beispielsitzungen aus dem Business wie dem Personal Coaching vorgestellt und für das Selbstcoaching erläutert. Bei komplexeren Einheiten finden sich Arbeitsblätter aus der Praxis zur eigenen Verwendung – als Coach wie im Selbstcoaching – im Anhang. Dem eiligen und rein praktisch orientierten Leser soll es aber auch ermöglicht werden, den Praxisteil ohne vorausgehende Theorie zu studieren. Deshalb findet sich über jeder praktischen Einheit ein Rückverweis auf die entsprechende Passage im ersten Teil. Die verbindende Klammer aller praktischen Beispiele liegt auf dem Ressourcenansatz: meiner Erfahrung (auch als Pädagoge und Vater), dass der Blick auf die Stärken stärkt – und (vermeintliche) Schwächen in den Hintergrund treten lässt.
Dieser Ratgeber wendet sich an Coachs und („meine“) Klienten2 gleichermaßen: Der ersten Gruppe sollen visualisierte Tools und Abläufe aus meiner bisherigen fünfjährigen Coachingpraxis – als Coach, Trainer und Berater für Organisationen und Unternehmen verschiedener Branchen sowie im öffentlichen Dienst3 – angeboten werden, die in eigene Kontexte hinein leicht zu adaptieren sind. Leitend war meine Erfahrung, da ich in den ersten Jahren in diesem – auch unübersichtlichen – Feld für einen übersichtlichen Ratgeber dankbar gewesen wäre. Der zweiten Gruppe kann das Handbuch zur Nachbereitung eines Coachingprozesses oder zum weitergehenden Selbstcoaching dienen. Vor allem richtet sich der Ratgeber an alle, die etablierte und hier weiterentwickelte Coachingtools für das eigene Selbstmangement nutzen wollen – auch ohne Coach. Farblich visualisierte Tools, die in ganz verschiedenen Situationen real angewandt und situativ erweitert wurden, stehen dafür in diesem Handbuch bereit.
Theoretische Hintergründe mit praktischen Einblicken überhaupt anschaulich verbinden zu können, setzte die Bereitschaft voraus, an geeigneten Stellen Fallbeispiele aus dem eigenen Coaching einbauen zu können. Wo dies geschieht, ist durch Anonymisierung und, wo nötig, auch Verfremdung der Schutz jedes Klienten gewahrt. Ich danke jeder einzelnen Person nicht nur herzlich für diese Einwilligung, sondern vor allem dafür, mich als Coach Teil haben zu lassen an diesen persönlichen Erfahrungen – aber oft auch an beeindruckenden Wegen aus der Krise heraus, hin zu je eigenen und bis dahin ungeahnten Lösungswegen.4
Dem Buch stelle ich ebenso meinen herzlichen Dank an Frau Sarah Bellersheim und Herrn Thomas Wasmer voran, die den Ratgeber – als meine mittlerweile dritte Monographie im Tectum Verlag – wieder in das Programm aufgenommen und die Entstehung umsichtig und gewissenhaft begleitet haben. Ebenso herzlich danke ich meiner Kollegin Angelika Zink für ihre frohe Bereitschaft, die folgenden Seiten sorgfältig Korrektur zu lesen.
Zur zweiten Auflage
Als im September 2020 „Selbstmanagement mit Coachingtools“ im Coaching-Report unter den „Top 10“ der deutschsprachigen Coachingliteratur auf Platz 1 landete (vgl. Rauen, 2020, S. 64), wurde ich von Coach-Kollegen darin bestärkt, an eine zweite, überarbeitete Auflage zu gehen. Die Basiskapitel wurden aufgrund der Einschätzungen zur Aktualität grundsätzlich im Duktus der 1. Auflage belassen. Übertragungen der Tools ins Onlinecoaching hätten den Rahmen gesprengt – dieser Schritt ist für eine evtl. folgende Publikation geplant. Erweiterungen und Ergänzungen erfuhr das Buch mit der 2. Auflage vor allem im praktischen Teil – und hier vertieft und neu bebildert zum Naturcoaching (Kap. „Kraftort Natur“). Denn während dies im Jahr 2018 noch als „neuer Trend“ bezeichnet werden konnte, zeigt die heutige Fülle an Büchern zum Naturcoaching, wie etabliert, aber v. a. wie unübersichtlich und wie schwer rückführbar auf den jeweiligen Coachingansatz diese Sparte mittlerweile geworden ist. Deshalb soll hier Naturcoaching in das systemisch-lösungsorientierte Coaching eingebunden werden.
Ebenso war vor zwei Jahren eine Entwicklung in vollem Gang, die mit „Vom Präsenz- zum Virtuellen Coaching“ überschrieben wurde (vgl. unter Kap. 2). Die damals skizzierten Linien und beschriebenen technischen Formate sind grundsätzlich auch weiterhin zutreffend. Allerdings ist – auch – durch die Corona-Krise eine Beschleunigung eingetreten, die nach hybriden Formaten verlangt. Dies wird – mit einem anschaulichen Beispiel – ebenfalls im Kontext Naturcoaching dargestellt und visualisiert.
Der mit der 1. Auflage gewählte Ansatz, die wesentlichsten theoretischen Grundlinien für die Tools im praktischen Teil im ersten Drittel zu skizzieren, wurde beibehalten. Auch wenn mancher Verweis durch den geringen zur Verfügung stehenden Umfang sparsam gehalten werden musste, soll auf diese Verschränkung von Theorie (Kap. 1–5) und ausgedehntem Praxisteil (Kap. 6, 7 sowie Anhang) nicht verzichtet werden. Wenn man sich damit auch auf eventuelle Verkürzungen in der Darstellung und Durchdringungstiefe einlassen musste, konnte so jedes einzelne Tool an seine theoretischen Hintergründe rückgebunden werden. Die Verweise finden sich durchgängig mit Hinweispfeilen im Fließtext gekennzeichnet. Dieser Aufbau wurde vielfach positiv rückgemeldet und war als Eigenheit des Buches offensichtlich bereits in der 1. Auflage erkennbar.
Es war wieder wunderbar zu erleben, wie agil Frau Sarah Bellersheim vom Tectum Verlag das Projekt erneut in Angriff genommen hat. Dafür meinen herzlichen Dank! Last not least hat meine Kollegin Petra Wagner die überarbeitete Neuauflage mit einem Exkurs zum intuitiven Schreiben (im Anschluss an ein Naturcoaching) inhaltlich bereichert. Ein ganz besonderer Dank gilt deshalb auch ihr! Und wie immer freue ich mich natürlich auf konstruktive Rückmeldungen aus der „Szene“.
Thomas Hanstein
1 Zur besseren Lesbarkeit wird durchgehend die männliche Form verwendet. An den entsprechenden Stellen sind immer alle entsprechenden Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht, gemeint.
2 Der Coach ist der Coachende, wobei keine weibliche Form existiert. Der „Gecoachte“ wird als Coachee bezeichnet oder – wie hier durchgehend – als Klient.
3 Schwerpunkte vgl. unter https//:www.coaching-hanstein.de.
4 Weitere Rückmeldungen finden sich – anonymisiert – unter: https://www.coaching-hanstein.de/klientenbewertungen.html.
1 Coaching – ein Etikett für alles und jeden?
Ursprung – sportliche Begleitung erobert die Wirtschaft
Im Sport, insbesondere im Fußball, wird seit vielen Jahren wie selbstverständlich vom Coach und Coaching – synonym zum Trainer und Training5 – gesprochen, ohne dass diese Bezeichnung näher definiert oder gar hinterfragt wird. Was mit der Verwendung des „Coachs“ aber thematisch mitzuschwingen scheint und was eine – zumindest implizite – Spur hinsichtlich der Intention sportlichen Coachings legen kann, ist die Ebene des „mentalen“ Trainings, der ganzheitlichen Einstimmung auf ein Spiel – bzw. dessen mentale Nachbereitung. So kann die schleichende „Platzeroberung“ durch das Thema Coaching auch als Bewusstseinserweiterung dahingehend verstanden werden, dass Fußball mehr als Technik und Teamgeist ist – und was, darüber hinaus, das Besondere und Eigene am Coaching ist. Über den Sport hat sich das Thema in die Wellness-Branche hin ausgeweitet. Durch die nahezu inflationäre Verwendung des Begriffs in diesem Bereich – in etlichen Büchern zur Lebensberatung oder in diversen Fernsehsendungen und auch Spielfilmen zu sehen – kann sich der Eindruck aufdrängen, beim Coaching handle es sich um eine „softe“ Variante der Lebensbegleitung. So sei bereits zu Beginn festgestellt, dass sich „Coaching (…) im deutschsprachigen Raum aus der Begleitung von Führungskräften heraus entwickelt“ hat (Berninger-Schäfer, 2011, S. 11). Wenn auch die terminologische Herkunft im Sport gesehen werden kann, von dem der Begriff in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Wirtschaft überschwappte, gehört Coaching ab dieser Zeit originär in den Bereich der Führungskräftebegleitung (und -entwicklung), weshalb Elke Berninger-Schäfer in der „Qualitätssicherung von Führungstätigkeit (…) nach wie vor das „hauptsächliche Ziel von Coaching“ (ebd.) sieht. In den letzten 30 Jahren hat sich Coaching permanent weiterentwickelt und ausdifferenziert, so dass es, nach Regina Mahlmann, „über die Zielrichtung und über das Verständnis von Einzel- und auch Gruppen-Coaching“ mittlerweile „einen allgemeinen Nenner“ (Mahlmann, 2009, S. 12) gibt. Mahlmann begründet dies mit einem Blick auf grundlegende Ansätze, deren „Definitionen tatsächlich wenig differieren“ (ebd.) würden. So wird Coaching – in diesem Überblick – von Astrid Schreyögg zum Beispiel als „Förderung beruflicher Selbstgestaltungspotenziale“ (nach Schreyögg, 1995) definiert, von Horst Rückle als „Prozess zur Entwicklung der Persönlichkeit und (…) rollen-spezifischer Fähigkeiten“ (nach Rückle, 2000) verstanden, oder von Thomas Holterbernd und Bernd Kochanek als „Unterstützung der Persönlichkeitsbildung in Arbeitszusammenhängen“ (nach Holterbernd/Kochanek, 1999).
So diese Beobachtung von Mahlmann – bei der exemplarischen Nennung von Definitionen – zutrifft, hat die von Berninger-Schäfer konstatierte „Tendenz zur Professionalisierung und Qualitätssicherung“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 13) im Bereich Coaching ab dem Jahr 2000, verstärkt nochmals ab 2004, daran entscheidenden Anteil. In Beiträgen vor dieser Zeit nämlich lassen sich noch Beschreibungen finden, die heute kaum mehr en vogue sein dürften. So schrieb dieselbe, oben zitierte Autorin vor 20 Jahren zum Beispiel von Coaching als „problemorientierter Beratungsform“ (Schreyögg, 1995, zitiert nach Mahlmann, 2009, S. 12). Die in den letzten Jahren ausgebaute Verbandsarbeit, v. a. durch den Deutschen Bundesverband Coaching – als führender Verband im Bereich Business-Coaching und Leadership im deutschsprachigen Raum – hat sich die Qualitätssicherung zur grundlegenden Aufgabe gemacht. So will der DBVC „gewährleisten, dass eine Dynamisierung des Coaching-Feldes durch eine hervorragende und damit anerkannte Qualitätsweiterentwicklung unterlegt wird. Das Festsetzen, Leben und Weiterentwickeln von Standards soll den beteiligten Gruppen eine größere Sicherheit bezüglich der theoretischen Durchdringung und der praktischen Anwendung von Coaching geben. Die wissenschaftliche Fundierung der Arbeit soll Innovationen fördern, die auch in die Ausbildung anerkannter Coachs münden“ (http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/unser-selbstverstaendnis.html).
Die Begriffsbestimmung, die der Deutsche Bundesverband Coaching vornimmt, spiegelt sprachlich die zurückgelegte inhaltliche Weiterentwicklung im professionellen Coaching wider und verweist auf Qualitätsstandards, die immer mit verbindlichen sprachlichen Normierungen beginnen. So wird Coaching heute als „professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs- und Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen und Organisationen“ verstanden. Als Zielsetzung von Coaching nennt der DBVC „die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen“ (http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html). Neben die Begleitung von Führungskräften trat damit auch die Unterstützung von Fachkräften. Hieran wird deutlich, wie sich Coaching in den letzten Jahrzehnten und Jahren auch „bezüglich Zielgruppen, Anlässen und Settings weiter ausdifferenziert“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 11) und zu einer eigenen und professionellen Fachdisziplin entwickelt hat, welche „die Förderung der Selbstreflexion und -wahrnehmung und die selbstgesteuerte Erweiterung (…) der Möglichkeiten des Klienten bzgl. Wahrnehmung, Erleben und Verhalten“ (http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html) als Schwerpunkt hat.
Was Coaching leisten kann – und was es nicht ist
Damit wird bereits deutlich, dass vieles als „Coaching“ bezeichnet wird, hinter dem sich ganz andere Ideen, Formate und Konzepte befinden. Auf Grundlage des einführend Dargelegten können grundlegende Koordinaten für professionelles Coaching bestimmt werden: Erstens, dass der Fokus auf einer ziel- und lösungsorientierten Bearbeitung liegt. Zweitens, dass konkrete Anliegen in – drittens – berufsbezogenen Kontexten den Ausgangspunkt bilden. Und viertens, dass mit dem Coaching die Entwicklung von Kompetenzen verbunden ist (vgl. Berninger-Schäfer, 2011, S. 21–26). Mit dem zuletzt aufgeführten Aspekt ist zugleich eine grundlegende Spannung benannt, da der Klient (als arbeitender Mensch) nicht von seinem Menschsein im Ganzen trennbar ist. Zugleich ist er in seinem beruflichen Handeln in (ein) System(e) und Rollen eingebunden. Insofern ist es konsequent, Coaching als ganzheitlichen Prozess zu betrachten, denn „es werden kognitive, emotionale, beziehungsmäßige, körperliche und ethische Aspekte berücksichtigt“ (ebd., S. 24). Entscheidend scheint in der Zielsetzung folglich die Priorität zu sein: Vordergründig ein berufliches Anliegen, welches in seiner Lösung eine Veränderung des Verhaltens, der Haltung, letztlich vielleicht sogar – partiell – der Persönlichkeit des Klienten zum Resultat hat, lässt sich im Coaching (gültiger bearbeiten als ein rein auf die Persönlichkeit – und unabhängig vom konkreten Kontext – formuliertes Anliegen. Insofern zeigen diese Eckdaten bereits erste notwendige Grenzziehungen gegenüber anderen Begleitungsmöglichkeiten auf.
Definition bedeutet – schon von der Wortbedeutung her – das inhaltliche Festlegen von Grenzen. Diese Abgrenzungen dienen sowohl dem Selbstverständnis wie auch einer notwendigen Klarstellung der Rollen und der Zielrichtung. Gleichzeitig sind derartige Grenzziehungen kultur- und systemabhängig, was Björn Migge mit einem Vergleich zwischen der amerikanischen und deutschen Coaching-Landschaft beschreibt: „Ein amerikanischer Coach wäre eher (…) geneigt, (…) konkrete Tipps zu geben (…). Ein deutscher Coach bemüht sich eher (…), indirekt vorzugehen und die (…) Absichten seiner Klienten mit diesen gemeinsam aufzudecken“ (Migge, 2009, S. 74). Jedoch erscheint die hier gezogene Konsequenz einer sinnvollen Abgrenzung nicht zwingend nachvollziehbar, „einmal von Coaching, ein anderes Mal von Beratung“ zu sprechen, mit der Begründung, „jedem Geschmack gerecht zu werden“ (ebd.). Eine – möglichst kultur- und systemrelevante – Grenzziehung gegenüber anderen Formen der Begleitung und Beratung scheint zudem nötig, weil sie an Zielsetzungen und letztlich auch Qualitätsstandards konkretisierbar ist. Die Begründung von Migge verweist aber zugleich auf die Bandbreite der Erwartungen entsprechend des Kontextes und der „Firmenphilosophie“ – und damit des jeweiligen Auftraggebers. So versteht Elke Berninger Schäfer – und mit ihr die Karlsruher Schule – professionelles Coaching in einem „klar definiert(en) und von (…) ähnlichen Beratungsformen abgegrenzt(en)“ Coachingkonzept (Berninger-Schäfer, 2011, S. 30). Diese Abgrenzungen zeigen sie gegenüber der Expertenberatung – mit dem Fokus „Empfehlung zu weiteren Vorgehensweisen“ und der zur Verfügung Stellung von spezifischem Expertenwissen durch eine „inhaltliche Fachexpertise“ (ebd., S. 27) –, dem Training – mit dem Schwerpunkt bestimmter Übungen zur Erreichung eines Zieles sowie, im beruflichen Kontext, der „Erweiterung fachlicher Kompetenzen“ (ebd.) –, dem Mentoring – als Möglichkeit der Begleitung durch eine berufserfahrenere Person mit dem Ziel der Partizipation an dessen Erfahrung –, der Supervison – als Form der Reflexion des eigenen Verhaltens in persönlichen und beruflichen Beziehungszusammenhängen6 –, sowie der Psychotherapie – als therapeutische Behandlungsmöglichkeit von, hier, Patienten – auf (vgl. ebd., S. 26–28). Zusätzlich führt Björn Migge die Mediation – „als allparteiliche und ergebnisoffene Vermittlung“ – sowie die philosophische Lebensberatung – mit dem Blick auf „Werte (…) Prinzipien und Handlungen“ – (Migge, 2009, S. 78) zur Unterscheidung an.
Da Coaching von der Handlung lebt, bewähren sich diese – wenn auch wesentlichen – Grenzziehungen nicht in der theoretischen Setzung, sondern im praktischen Vollzug. Analog zur oben angedeuteten inhaltlichen Ausdifferenzierung in den letzten Jahrzehnten und Jahren, existieren in der Coachingpraxis mehrere komplementäre, entsprechend den Anforderungen kreierte Settings. Eine qualitativ hochwertige und verantwortungsvolle Reflexion der eigenen Zielrichtung, Rolle und Aufgabe im Coaching scheint umso wichtiger, je mehr solcher Komplementärformen sich anbieten. Wie eben angedeutet, brechen beispielhaft immer wieder neu Diskussionen darüber auf, ob Coaching sich (auch) als Beratung verstehen darf. Der DBVC führt diesen Aspekt auch aktuell wie selbstverständlich in seiner Coachingdefinition an, wenn er von einer „ergebnis- und lösungsorientierte(n) Beratungsform“ oder einem „auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte(m) Beratungsprozess“ spricht. Gleichzeitig wird auf die inhaltliche Mehrperspektivität verwiesen, da sich Coaching als „Kombination aus individueller Unterstützung zur Bewältigung verschiedener Anliegen und persönlicher Beratung“ (http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html) verstehe. Letztlich wäre eine rein terminologische Klärung für die Praxis wenig effektiv, wie in den bestehenden Kombinationsmöglichkeiten von Coaching – mit Training, Mentoring, Supervison, Psychotherapie (vgl. Berninger-Schäfer, 2011, S. 28–30) oder auch Seelsorge (vgl. Hanstein, 2017) – ebenfalls nur Varianten formal benannt sein können. Der Gefahr, dass die „Übergänge fließend“ (Migge, 2009, S. 78) und die jeweiligen Begleitungsformen „gemischt werden“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 30), kann letztlich nicht durch die Definition – die nur den Anfang bilden kann – begegnet werden, sondern durch verinnerlichte Grundhaltungen und einer hinreichenden Klarheit bezüglich Aufgabe und Rolle. Auf dieser Basis kann sich dann im Idealfall – hier im Blick auf die Komplementärberatung – ein „oszillierendes Geschehen“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 30) einstellen. Eine, wenn nicht die entscheidende Grundhaltung7 und damit ein grundlegendes Qualitätskriterium im Coaching definiert zugleich – und im praktischen Zweifelsfall – die Grenzziehung gegenüber sich ähnelnden Formen der Begleitung: die Askese. Sie wird im Prozessgeschehen an der „Zurückhaltung des Coachs im Formulieren eigener Hypothesen und dem Erteilen von Ratschlägen“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 36) erkennbar. Diese Haltung beachtend, erscheint es auch nicht zwingend problematisch, von Beratung zu sprechen, zumal diese Erwartung im Business-Bereich explizit oder unausgesprochen oft mitschwingt. Qualitativ messbar wird Coaching dann daran, ob es dem Klienten im Prozess möglich war, „eigene Lösungen zu entwickeln“. Denn der Coach „ermöglicht das Erkennen von Problemursachen und dient daher zur Identifikation und Lösung der zum Problem führenden Prozesse“ (http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html).
5 Vgl. z. B. „Wer ist der beste Coach aller Zeiten?“, in: https://de.fifa.com/news/y=2011/m=1/news=wer-ist-der-beste-coach-aller-zeiten-1363660.html.
6 Vgl. die exemplarische Unterscheidung im Kap. „Die Bedeutung (organisations-)theoretischer Ansätze“.
7 Vgl. zu grundlegenden Haltungen im Coaching Kap. „Menschenbild, Grundhaltungen, Standards“.
2 Markteroberung – fester Bestandteil der Personalentwicklung
Vom Allrounder zur Fachdisziplin
Auch wenn im Zuge der 30-jährigen Coaching-Entwicklung der ursprüngliche berufliche Kontext sowie die originäre Zielsetzung – „Steigerung und (…) Erhalt der Leistungsfähigkeit“ sowie „Verbesserung der beruflichen Situation und das Gestalten von Rollen unter anspruchsvollen Bedingungen“ (http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html) – grundsätzlich beibehalten werden konnte, zeigt sich nach Regina Mahlmann eine klar Unterscheidung in zwei Kategorien. Neben der Weiterentwicklung als einer Kategorie wird hier Konfliktuelles als ein weiterer, umfänglicher Bereich angeführt (Mahlmann, 2009, S. 14–16). Diese Beobachtung wird auch durch die neuere Literatur bestätigt (vgl. z. B. Schreyögg, 2003, S. 340 ff)8. Mahlmann differenziert diese Kategorie wiederum in die Bereiche der individuellen Belastungen – mit den zwei Brennpunkten der persönlichen oder systemischen Faktoren –, beruflicher Deformationen – als einer bereits eingetretenen Auswirkung gering ausgeprägter Work-Life-Balance –, Distress im Arbeitsalltag, Burn-out und Mobbing (vgl. Mahlmann, 2009, S. 14.15). Bei aller Wertschätzung gegenüber den Erfahrungen der Autorin als Coach wird in dieser Aufzählung zweierlei deutlich: Wiederum die notwendige Abgrenzung und entsprechende Weitervermittlung – v. a., wenn sich bereits psychische Auffälligkeiten zeigen bzw. der Klient davon berichtet –, wie auch eine augenfällige Expansion des Themas Coaching im Gesundheits- und Life-Bereich in den letzten Jahren. So erfreulich es ist, dass das Thema Gesundheitsschutz im beruflichen Bereich – nicht nur im öffentlichen Dienst – im Kontext Führungscoaching und Personalentwicklung seinen – festen – Platz gefunden hat, so irritierend erscheint der Boom im Bereich Life-Coaching. Aufgrund dieser Tendenz, die sich in der Flut an Literatur widerspiegelt – lt. Berninger-Schäfer 2014 existieren mehr als fünfzig Publikationen in diesem Feld (Berninger-Schäfer, 2014) – soll dieser Bereich des „Coaching für alle und alles“ (ebd. 2011, S. 39), wenn hiermit auch benannt, in der weiteren Darstellung bewusst unberücksichtigt bleiben.
Entwicklung von Coaching (nach: Berninger-Schäfer 2011, S. 12–14)9
70er Jahre
80er Jahre
90er Jahre
2000
ab 2000
Ursprung USA
USA
Kontext Führung/Sport
Kontext Nachwuchskräfteentwicklung
D
D
Topmanagement
feste Größe in FK-Entwicklung
weitergehende Professionalisierung
externe Institute
Berücksichtigung in Personalentwicklung
Formatbildung
Qualitätsstandards für Ausbildung/Coaching
aber auch:
Forschungsarbeiten
populäre Ausweitung
Container-Begriff
eigenes Fachgebiet
Mittlerweile hat sich Coaching – aus der anfänglich reinen Beratung von Führungskräften heraus – auf verschiedene Bereiche hin ausgedehnt, v. a. auf das Mittlere Management. Vor diesem Hintergrund kann die eben genannte Auflistung von Mahlmann auch inhaltlich um ein Vielfaches erweitert werden (vgl. Berninger-Schäfer, 2011, S. 31). In diesem breiten Spektrum kann die Kategorisierung in die Bereiche Organisationsstruktur, Interaktion, Verhalten und Persönlichkeit (vgl. ebd., S. 34) eine hilfreiche Orientierung im „Coaching-Dschungel“ bieten. Auf wissenschaftlicher Ebene bieten eine Reihe von Hochschulen und Universitäten bereits Abschlüsse im Coaching an. Neben der soliden Profession existieren bislang Abschluss- und Forschungsarbeiten zu verschiedenen Fragestellungen innerhalb des Coaching-Feldes. Sehr vielversprechend sind aktuell besonders die zu erwartenden weiteren Untersuchungen zur Frage der Wirksamkeit von Coaching.
Vom Business- zum Personal-Coaching
Wenngleich – nach dem Feld des Sports – das Arbeitsleben als genuiner Bereich für Coaching angesehen wird, so wird durch die ins Coaching eingebrachten Themen auf der Schnittstelle von beruflichen Erwartungen und Fragen der eigenen Persönlichkeit auch deutlich, dass sich die Bereiche nicht künstlich trennen lassen. Eine Person, die sich auf eine Leistungsstelle bewerben will oder die bereits eine Führungsaufgabe angenommen hat, bringt – besonders in der Phase des Onboarding – auch Fragen und Anliegen oder zumindest implizit persönliche Aspekte in das Coaching mit ein, die sie als Mensch betreffen. Dies ist auch speziell dann der Fall, wenn das eigene Selbstbild10 durch berufliche Situationen in Frage gestellt worden ist, z. B. durch eine Kündigung oder durch Mobbing. Wenn der Klient z. B. als Anliegen formuliert, seine Bewerbung möglichst gut und risikofrei im Coaching vorzubereiten, sich im Gespräch aber zeigt, dass er durch die erlebte berufliche Situation auch auf der persönlichen Ebene gerade eine Krise durchlebt, ist es wenig sinnhaft und zielführend, dieses Selbsterleben zu übergehen. Schwerwiegende, emotional besetzte Erlebnisse im Beruf lösen folglich auch eine Anfrage an das eigene Selbst aus, da sie innerlich mit individuellen Werten und Glaubenssätzen, Loyalität, Abgrenzung und Bestätigung verwoben sind. Üblicherweise wird diese persönliche Ebene bei einem Auftrag zum Business-Coaching vom Arbeitsgeber grundsätzlich mitbedacht, es kann aber auch vorkommen, dass sich das Thema ganz auf den persönlichen Kontext verschiebt. Eventuell müssten dann Format, Ziel und Auftrag formal nachjustiert werden.
Während sich die Terminologie Business-Coaching relativ fest etabliert hat und auch eine entsprechende Ausbildung voraussetzt – wenn auch bezüglich Dauer und Qualität zuweilen nicht vergleichbar –, ist der Begriff des Personal-Coaching unbestimmter. Er wird gelegentlich frei – da ungeschützt – auch ohne qualifizierte Ausbildung verwendet. Ebenso findet sich diese Bezeichnung synonym zu Personal Training – was, wie oben differenziert, nach der hier zugrunde liegenden Definition von Coaching ein anderes Format darstellt. Insofern sollten vor einer Auftragsvergabe neben der Qualität auch das jeweilige Verständnis von Coaching und der fachwissenschaftlicheHintergrund in die Entscheidung mit eingebunden werden. Was zum persönlichen Anteil im Business-Coaching ausgeführt worden ist, lässt sich andersherum auch vom Personal-Coaching her bestimmen, wenn die persönlichen Anliegen auf berufliche Fragestellungen hin angewandt werden. An diesem Punkt wäre es letztlich entscheidend, dass ein Personal Coach auch über hinreichende organisationstheoretische Kenntnisse verfügt.
Ein entscheidendes Argument für Coaching in beiden Dimensionen – Business oder Personal – kann in der Wertneutralität gesehen werden. Anders als z. B. Physiotherapie oder Seelsorge11 geht Coaching nicht bewertend vor. Die subjektive Wahrheit des Klienten ist der Maßstab des Begleitungsprozesses. Auch aufgrund der hohen Reputation im Business-Bereich (und wohl auch durch die dreistelligen Stundensätze) gilt Coaching als nicht „pathologisiert“. Dabei spielt es offensichtlich keine Rolle, ob dieselben Themen wie „auf der Coach“ bearbeitet werden. Zu einem Coach zu gehen, bedeutet, Begleitung nicht nötig zu haben, weil man ein „Problem hat“, sondern sich Coaching zu „gönnen“. Auch wenn dies so manche Zeitgenossen stören mag (die mit zum Teil längeren und akademischeren Ausbildungen ein deutlich geringeres Honorar, z. B. für eine psychotherapeutische Begleitung gegenüber der Privatversicherung, abrechnen können), spiegelt dies auch deutlich den Ansatz und die Haltung im Coaching wider. Erstens: Keine weitere Bedeutung auf das Problem zu legen, sondern es als Hinweis darauf zu sehen, dass die aktuelle Situation den Zugriff auf die Ressourcen des Klienten schlichtweg überlagert. Und zweitens: Dass sich im Coaching Beratung im Sinne eines Rat Erteilens verbietet, weil der Coach davon ausgeht, dass der Klient der Experte seines eigenen Systems ist.
Vom Präsenz- zum Virtuellen Coaching
Um in eine Begleitung gehen zu können, bedarf es zweierlei: Eines Raumes und einer Zeit für- bzw. miteinander. Klassischerweise wird dazu ein „realer“ Ort vereinbart. Was im Personal Coaching auch ohne Weiteres so weiterlaufen könnte,12 hat sich im Business-Bereich aufgrund diverser Veränderungen, die ebenfalls mit diesen Komponenten Raum und Zeit verbunden sind, mehr oder weniger als Herausforderung gestellt. Online Meetings und Konferenzen sind heutzutage Standard, zumindest in Häusern mit mehreren Standorten, ebenso Home-Office und Formate für virtuelle Fortbildungsseminare. Und dennoch konstatiert Harald Geißler, Pädagoge und einer der deutschen Pioniere in der Erforschung neuer Räume für Beratung und Coaching: „Es scheint nach wie vor eine unhinterfragbare Selbstverständlichkeit zu sein, dass Coaching face-to-face durchgeführt werden muss.“ Gleichzeitig prognostiziert er dieser „Normalität“, dass sie „langsam ihrem Ende entgehen“ (zitiert nach: Berninger-Schäfer, 2018, S. 6)13 geht.
Hinter dieser Aussage stehen zehnjährigen Beobachtungen und eigene Studien: Geißler hat bereits vor vielen Jahren dazu aufgerufen, Organisationsberatung und -lernen sowie Coaching in die innovativen Entwicklungen des I-Learnings zu integrieren bzw. von diesen zu profitieren. Denn erste Ergebnisse zur Wirksamkeit von „Präsenz“- und online-Veranstaltungen ließen eine Steigerung der Effizienz – auch gegenüber herkömmlichen und erprobten Formaten – erkennen. Als Vorteile lagen damit auf der Hand: die Zeit- und Kostenersparnis, v. a. aufgrund der wegfallenden Anreisezeit, aber auch aufgrund evtl. anzumietender Räumlichkeiten; die – bei mittlerweile ausgeklügelten Programmen – automatische Dokumentation der Sitzungen; damit die Möglichkeit einer zielführenden Vor- und Nachbereitung der einzelnen Coachings, für Klient und Coach gleichermaßen (vgl. Geißler/Wegener/Hasenbein, 2013; Geißler/Metz, 2012; https://www.virtuelles-coaching.com). Für den Coach bieten die virtuellen Plattformen zudem den automatischen Zugriff auf alle – darin verfügbaren – Tools. Auch Elke Berninger-Schäfer unterstützt diesen Weg als Vorreiterin. Ausgehend von Online-Seminaren in ihrer Ausbildung von Coaches und Erfahrungen mit Blended Learning hat die Psychologin und Gründerin14 der „Kollegialen Coachingkonferenz“ (KCK) – als Methode des Coachings einer Person durch eine feststehende Gruppe – ebenfalls vor fast zehn Jahren einen ersten Versuch unternommen, dieses Format virtuell zu unterlegen. Nicht nur diese Form existiert mittlerweile – neben der klassischen KCK – virtuell, sondern diese innovativen Schritte sind fortgewachsen in eine ausgereifte Online-Plattform, die „CAI World“. Denn Berninger-Schäfer ist sich sicher: „Zu einem professionellen Online-Coaching gehört die Multimedialität. Der Coach muss klienten- und situationsabhängig zwischen verschiedenen Medien wählen können und dies muss ad hoc in datenge-sicherten, virtuellen Räumen geschehen“ (Interview aus: Coaching Magazin, 1/2018, S. 20). Ihr Ansatz, verwirklicht mit CAI, lautet dabei: „Coaching meets IT” (vgl. Berninger-Schäfer, 2018, S. 9). Insbesondere junge Menschen erwarten, dass sie im Bedarfsfall zeitnah einen für sie passenden Coach finden. Berninger-Schäfer spricht an dieser Stelle vom „Coach on demand“. Mit diesen Trends werden die herkömmlichen Formate – Zeitabsprachen und Termine über mehrere Wochen voneinander entfernt sowie einzelne Coachingsitzungen mit bis zu mehreren Stunden – deutlich herausgefordert. Vor allem nimmt Virtuelles Coaching die Veränderungen in der Kommunikationskultur ernst. Dieser Aspekt weist aber zugleich auch auf neue Kompetenzen beim Coach hin: Grundlegend ist eine ausgeprägte Sensibilität sowohl für die kognitive wie die emotional-physiologische Wahrnehmung, besonders wenn von beiden Personen nur die Gesichter erkennbar sind.
Bereits an der bislang nicht einheitlichen Verwendung der Begrifflichkeiten – online, virtuell, Präsenz, face-to-face, 2D – lässt sich erkennen, dass diese Entwicklung im Fluss ist. Inwieweit Virtuelles Coaching im Einzelfall15 genutzt werden wird, kann jedoch nicht in erster Linie mit der Präferenz des Coaches für oder gegen die eine oder andere Form beantwortet werden. Letztentscheidend sind die Bedürfnisse – und damit eben auch die zeitlichen Möglichkeiten – des jeweiligen Klienten. Virtuelles Coaching bietet die Möglichkeit kurzfristiger Sitzungen und ist in einer schnelllebigen Zeit eine probate Ergänzung sogenannten face-to-face-Coachings, also klassischer Treffen an „realen“, physischen Orten. Eine vollständige Ersetzung scheint weder in der Forschung beabsichtigt zu sein, noch in der Begleitung sinnvoll. Mit der Möglichkeit Virtuellen Coachings ist aber die Grundlage geschaffen, synchron wie asynchron zu coachen. Um diese mehrdimensionale Form des Coachings leisten zu können, scheint – ggf. noch mehr als im klassischen Setting – die disziplinierte Bindung an den Prozessablauf besonders wichtig. Diese ist, anders als im herkömmlichen Coaching durch den Coach selbst, im Virtuellen Coaching durch die hinterlegten Formate sichergestellt. Besonders interessant im Kontext dieses Ratgebers zum Selbstcoaching scheint der von CAI entwickelte „solution finder“ zu sein, der sich aufgrund seiner Aufmachung besonders für jüngere Klienten eignet. Mit diesem Instrument wurde Virtuelles Coaching als Mischung von Selbst- und kollegialem Coaching weiterentwickelt. Anstelle der persönlichen Anleitung durch den Coach wird der Klient hierbei mit einem leicht verständlichen Leitfaden durch den Coachingprozess geführt. An geeigneten Stellen können Kollegen oder Freunde des Klienten eingeladen werden, sich am Prozess zu beteiligen und den Klienten beim Lösungsbrainstorming zu unterstützen (vgl. https://www.cai-world.com/cai-solution-finder).
Die Entwicklung „vom Präsenz- zum Virtuellen Coaching“ hat sich – spätestens mit der Corona-Pandemie – weiter fortgesetzt. Kreative hybride Formate wurden entdeckt (vgl. beispielhaft Kap. „Kraftort Natur“), erprobt und entstehen kontinuierlich weiter.
8 (Mittlerweile in der 7. Auflage, 2012; vgl. auch das aktuelle „Porträt“ zur Autorin, 2017.)
9 Vgl. ergänzend Martens-Schmid, 2016.
10 Vgl. Kap. „Selbstkonzept und Kongruenz“.
11 Dies gilt zumindest in ihrer klassischen Form, vgl. Hanstein, 2017.
12 Anm.: Es sei denn – und hier zeigt sich eine erste Einschränkung bzw. ein erster Vorteil gegenüber klassischen Formaten – Coach und Klient wohnen weit voneinander entfernt.
13 Vgl. auch das Interview zum Thema mit Ebermann, 2018.
14 (gemeinsam mit Thomas E. Berg)
15 Ebenso die Fragestellung nach sich anbietenden Feldern, z. B. im Kontext Schule, vgl. Hanstein, 2017.
3 Neurowissenschaftliche Fundierung – Coaching mit Wurzeln und Profession
Klassische Pfade zum Unbewussten
Die Wirksamkeit professionellen Coachings basiert u. a. auf der Berücksichtigung unbewusster Anteile der menschlichen Psyche. Hierfür stehen die verschiedensten Methoden aus unterschiedlichen psychologischen Schulen zur Verfügung. Der Neurobiologe Gerhard Roth, der im Zuge der Professionalisierung im Coaching einen Forschungsschwerpunkt auf die Wirksamkeitsforschung gelegt hat, konstatiert: „Die meisten Coaches gehen eklektisch vor und kombinieren verschiedene Methoden (…) Ziel dabei ist, die Wirksamkeit und Effizienz zu erhöhen, indem der Klient ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Beratungsangebot erhält (Roth/Ryba, 2017, S. 51). Insofern sieht er als „zentrale Herausforderung“ für wirksames Coaching die „effektive Integration (…) auf Basis einer kohärenten Theorie“ an (ebd.). Die Ansätze, die Roth gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Alica Ryba differenziert, betten sie in das Vier-Ebenen-Modell der Persönlichkeit ein. Nach diesem Modell werden hirnphysiologisch vier Ebenen unterschieden:
• Die kognitiv-sprachliche Ebene ist im so genannten Neocortex (sechsschichtige Großhirnrinde) angesiedelt. Der Schwerpunkt liegt auf rationalen Erwägungen. Dieser Bereich setzt nicht vor dem dritten Lebensjahr ein.
• Die obere limbische Ebene hat ihren Sitz in den limbischen Arealen der Großhirnrinde und gibt die Kernpersönlichkeit des Menschen zu erkennen. Nach Roth und Ryba beginnt die Ausbildung dieser Ebene erst mit dem vierten Lebensjahr. Ihre Entwicklung hält bis zum frühen Erwachsenenalter an.
• Die mittlere limbische Ebene ist in der Amygdala (Mandelkern) beheimatet. Hier liegt die emotionale Prägung als (unbewusste) Basis der Persönlichkeit eines Menschen. Diese Ebene wird durch basale Bindungserfahrungen in den ersten drei Lebensjahren konstituiert.
• Die untere limbische Ebene bildet die „limbisch-vegetative Grundachse“ (ebd., S. 53) und verantwortet somit die grundlegenden biologischen und affektiven Funktionen. Persönlichkeitstypische affektive Verhaltensweisen werden hier ebenso gesteuert wie das Temperament eines Menschen.
Da die kognitiv-sprachliche und die obere limbische Ebene bewusst zu erreichen sind, ist es in einer Begleitung relativ leicht möglich, diese Bereiche zu stimulieren. Jedoch zeigt sich die Arbeit auf der Ebene von Vernunft und Verstand auch als wenig nachhaltig. Bereits mit der ersten funktionalen Ebene des limbischen Systems – der oberen Ebene – sind sozial-emotionale Interventionen notwendig, um auch nur „etwas nachhaltiger“ (ebd.) in der Wirksamkeit zu sein. Anders im unbewussten Bereich: „Langfristig am nachhaltigsten“ bewerten Roth und Ryba die mittlere und untere limbische Ebene, wobei bei der erstgenannten „starke emotionale Einwirkungen“ wichtig seien; bei der zweitgenannten Ebene muss jedoch beachtet werden, dass es sich um „genetische oder epigenetisch-vorgeburtliche Einflüsse“ (ebd.) handelt. (vgl. ebd., S. 50–54) Da aber Änderungen in Haltung und Verhalten in diesem Bereich maximal nachhaltig sind, ist konsequenter Weise eine gewisse Zurückhaltung bezüglich der eigenen Erwartungen und der Nutzbarmachung dieser Ebene im Rahmen eines Coachings angezeigt.
Während die Ratio den Menschen in die Lage versetzt, sachliche Einzelheiten zu erfassen, diese zu analysieren und über tiefgreifende Zusammenhänge zu reflektieren, färben die Areale im limbischen System Wahrnehmungen emotional ein. Da die Fähigkeit zur Versprachlichung entwicklungs- und auch stammesgeschichtlich jünger ist, wird Wahrgenommenes auch erst – unbewusst und dualistisch (angenehm oder unangenehm bzw. Bedrohung oder Chance) – bewertet, bevor es verstandesgemäß – durch die Verbindung der Ratio mit dem deklarativen Gedächtnis – buchstäblich ins Wort genommen werden kann (der Begriff „Nach-Denken“ ist für diesen Ablauf übrigens äußerst zutreffend). Nicht unbedeutend für die Beratung ist auch, dass im limbischen System das Belohnungszentrum angesiedelt ist. Da Bewusstsein bzw. -werden ebenfalls über Emotionen erfolgt, existiert zudem eine direkte Verbindung zum vegetativen Nervensystem. Schlussfolgernd bedeutet dies: Die Entscheidung fällt im limbischen System, es ist „das erste beim Entstehen unserer Wünsche und Zielvorstellungen … (und) das letzte bei der Entscheidung darüber, ob das, was Vernunft und Verstand als Ratschläge erteilen … emotional akzeptabel ist oder nicht“ (ebd., vgl. Roth, 2003; Roth/Ryba, 2016).
Diese Betrachtungen nehmen Roth und Ryba zur Basis, wesentliche klassische Ansätze auf die Nutzung im – und die Wirksamkeit von – Coaching zu übertragen.
Dem →psychoanalytischen