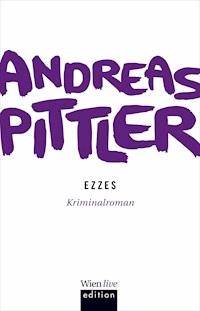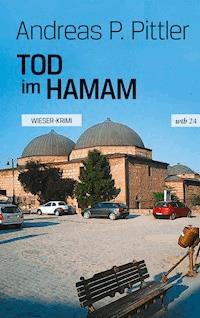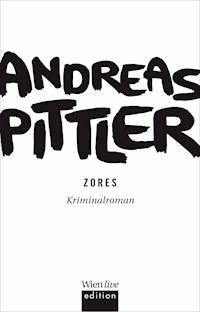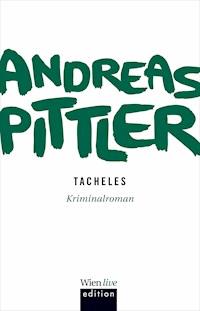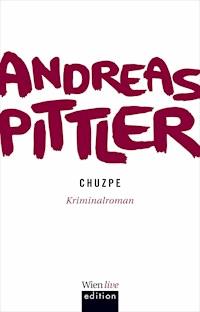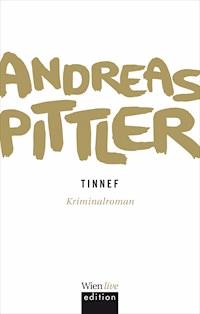Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Balkan-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Balkan-Krimi im Wieser Verlag! Am helllichten Tag wird Mladen Slovac entführt. Ein brisanter Fall, denn Slovac ist ein überaus bekannter und angesehener Schriftsteller. Doch eines ist er nicht: reich. Eine klassische Erpressung scheint damit auszuscheiden. Da Slovac jugoslawischer Herkunft ist, mutmaßen die Ermittler bald, dass es sich um ein politisches Verbrechen handelt, denn Serben, Kroaten, Muslime, sie alle hätten Gründe, dem streitbaren Dichter zu Leibe zu rücken. Da der Polizei die Sache ob politischer Interventionen und journalistischen Drucks zu heiß ist, überträgt sie den Fall Spürnase Henry Drake, der sich gemeinsam mit der von ihm angebeteten Andrina aufmacht, das kriminalistische Rätsel zu lösen. Zwischen Slibowitz und Cevapcici versucht Drake, britische Contenance zu bewahren, denn nur zu schnell erwächst aus einer kalten Spur heiße Action.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PITTLER • SERBISCHE BOHNEN
ANDREAS P. PITTLER
Serbische Bohnen
Henry Drakes dritter FallRoman
Die Herausgabe dieses Buches erfolgtemit freundlicher Unterstützung der Stadt Wien.Die alte Rechtschreibung wurde beibehalten.
wtb 21
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12
Tel. + 43(0)463 37036, Fax + 43(0)463 37635
www.wieser-verlag.com
Copyright © dieser Ausgabe 2015 bei Wieser Verlag GmbH,
Klagenfurt/Celovec
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Josef G. Pichler
ISBN 978-3-99047-025-1
I.
1999, Wien, innere Stadt. Mit lautem Sirenengeheul bog der Rettungswagen links ab, raste durch die Seitengasse und schliff sich vor einem Gründerzeithaus ein. Zwei Weißkittel sprangen aus dem Automobil und hasteten durch den Eingang. Fingerknöchel krachten an eine Wohnungstür. Verschlafen schlurfte die Hausbesorgerin ins Vorzimmer. »Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich komm’ ja schon. Wo brennt’s denn?« Sie öffnete und starrte in die abgehetzten Gesichter der beiden Sanitäter.
»Wo wohnt Slovac?« fragte der ältere. »Zweiter Stock, Tür acht«, gab die Concierge zurück, »worum tut es sich denn handeln?« Doch die beiden hatten sich schon abgewandt und erklommen bereits die Stiegen. »Verdacht auf Herzinfarkt«, rief der jüngere noch über die Schulter, dann entschwand auch er dem Gesichtsfeld der Frau. Diese trat aus ihrer Wohnung in den Flur und starrte durch das Stiegenhaus nach oben. Leise vernahm sie abermaliges Klopfen. Eine Tür wurde geöffnet, Stimmengemurmel hob an, doch konnte die Frau nicht verstehen, was da oben gesprochen wurde. Einen Moment lang dachte sie daran, selbst in den 2. Stock zu gehen, um sich vor Ort vom Gang der Dinge in Kenntnis zu setzen, doch wollte sie nicht aufdringlich oder gar neugierig erscheinen. Also lehnte sie sich an das Geländer und wartete. Keine fünf Minuten später keuchten die Rettungsmänner wieder die Stiegen abwärts. Nur die Bahre war nun nicht mehr leer. Auf ihr lag der bewußtlose Slovac, ein Mann von rund 75 Jahren mit weißgrauer Löwenmähne. Aus seiner Nase ragte ein dünner Schlauch, der zu einem Fläschchen führte, das seitlich oberhalb des Körpers an eine Stange gehängt war. Die Hausmeisterin konnte freilich nicht sagen, ob Slovac eine Transfusion bekam, künstlich ernährt oder beatmet wurde. In jedem Fall aber wußten die Rotkreuze, was sie taten, dachte sie und erinnerte sich daran, derlei schon oft im Fernsehen gesehen zu haben. Einer plötzlichen Eingebung folgend bemühte sie sich um Information. Schließlich mußte man doch bei eventuellen Fragen der übrigen Hausbewohner kompetent sein: »Wohin bringen Sie denn den armen Herrn Slovac, meine Herren?«
»Allgemeines Unfall«, preßte der jüngere unter Anstrengung hervor. Und schon verluden die beiden den Patienten in den Wagen, sprangen auf ihre Sitze, und die Sirene heulte abermals auf. Die Hausbesorgerin, die den Sanitätern auf den Gehsteig gefolgt war, sah der Ambulanz sinnend nach. Wie schnell es doch manchmal gehen konnte. Gestern abend noch war Slovac, wie immer mit seiner dicken Zigarre im Mund, auf dem Weg in seine Wohnung an ihr vorübergegangen, hatte sie jovial begrüßt und sich nach dem werten Befinden erkundigt, wie er das immer zu tun pflegte. Und wie immer hatte sie über ihren schlimmen Rücken geklagt. Was hatte er noch darauf erwidert? Sie solle sich darüber keine grauen Haare wachsen lassen: »Nur nicht aufregen«, hatte er gemeint, »da kriegt man nur den Herzzickzack davon.« Welche Prophetie lag doch in diesem Satz, dachte sie und fühlte instinktiv ihren Puls.
Nachdem sie zu der Überzeugung gekommen war, daß bei ihr alles in Ordnung war, fiel ihr die Frau von Slovac ein: »Mein Gott, die Ärmste. Wie wird sich die jetzt sorgen und ängstigen«, dachte die Hausmeisterin und beschloß, nun doch in den zweiten Stock zu gehen, um sich bei Frau Slovac zu erkundigen, ob sie irgendeiner Hilfe bedürfe. Bei dieser Gelegenheit konnte man natürlich auch gleich volle Klarheit über den Hergang der Ereignisse gewinnen, ein wenig rumstöbern und sich auch sonst allumfassend kundig machen. Schließlich war es der Wissensvorsprung, der einem erst zum wirklichen Meister des Hauses machte. Doch derlei Gedanken gestand sich die Concierge nicht ein. Sie überzeugte sich selbst von ihrer humanitären Mission und schleppte ihren müden Körper in das zweite Stockwerk. Sie verschnaufte einen Augenblick, um dann gegen die Wohnungstür der Familie Slovac zu pochen.
II.
Oberst Milus hatte sein Team zum üblichen Morgenbriefing versammelt. »Na, was haben wir denn heute wieder Schönes«, leitete er seine allseits bekannte Rede zur Einteilung seiner Leute ein. Dann machte er eine schöpferische Pause und blätterte dabei geräuschvoll in dem vor ihm liegenden Aktenberg. »Ein mutmaßlicher Lustmord in der Straße des 1. Mai«, sagte er dann und blickte in die Runde. »Pichler? Sie sind doch geeignet für eine solch delikate Aufgabe?« Der angesprochene Beamte richtete sich auf, doch Milus winkte müde ab: »Oder doch nicht, zum Schluß waren Sie’s ja glatt selbst.« Allgemeines Gelächter, Pichler sank wieder in sich zusammen. Die Blicke des Obersts wanderten weiterhin durch den Raum, wie bei einem Lehrer, der einen Delinquenten für eine Prüfung sucht. Bei der dunkelhäutigen Grete Habib blieben sie stehen. Von Habib wußte Milus nur, daß sie zu den sogenannten Ausländern der zweiten Generation gehörte, die aber schon längst die Staatsbürgerschaft besaßen, weshalb es Habib auch möglich gewesen war, in den Polizeidienst einzutreten: »Und, trauen Sie sich den Fall zu, Habib«, fragte Milus in strengem Ton. Diese ignorierte Pichlers giftige Blicke und nickte nur. Milus war zufrieden und legte ein Schriftstück rechts neben dem Stoß ab. Er kramte weiter.
Auf dieselbe Art wurde er noch einen mutmaßlichen Raubmord, eine angebliche Erpressung, mehrere Diebstähle und einen Widerstand gegen die Staatsgewalt los, bis er schließlich nur noch einen einzigen Akt in Händen hielt. »Und nun«, sagte er, die darauffolgende Pause wieder gehörig dehnend, »zum heikelsten Thema des heutigen Tages.« Wieder Pause. »Der Fall Slovac.«
»Der Schriftsteller oder der Filmemacher?« platzte es aus Habib heraus, was Milus mit einer anerkennenden Augenbraue quittierte.
»Der Schriftsteller«, sagte er langsam, »in der Tat, der Schriftsteller.« Einen Moment wirkte Milus abwesend, als schien er sich an irgendetwas zu erinnern, wurde dann aber schnell wieder sachlich. »Der Schriftsteller also. Mladen Slovac. Jawohl, genau der. Er wurde heute in den frühen Morgenstunden aus seiner Wohnung entführt, wie es scheint. Die Gangster waren als Sanitäter verkleidet und haben ihn mit einem Rettungswagen abgeholt. Sie wirkten, wie die Hausbesorgerin zu Protokoll gegeben hat, total professionell. Sie sei auch gar nicht argwöhnisch gewesen, bis zu jenem Zeitpunkt, da sie Frau Slovac fragen wollte, ob man ihr irgendwie behilflich sein könne. Da habe sie die Frau des Opfers bewußtlos am Boden gefunden. Aus dem Bericht der Slovac wissen wir, daß die vermeintlichen Rettungsmänner ihren Mann betäubt und sie selbst niedergeschlagen haben. Ob sie oder ihr Sohn, der Filmemacher«, dabei ruhte Milus’ Blick wieder auf Habib, »erpreßt werden, ist bislang noch nicht klar. Slovac ist in jedem Fall eine Figur mit hohem Prestige, und in der Tat hat sich unser aller Gottsöberster, der Herr Innenminister, schon persönlich erkundigt, ob wir auch mit voller Kraft an diesem Fall arbeiten. Ich brauche also dringend Freiwillige, denn man erwartet Ergebnisse. Nach Möglichkeit noch heute. Also?«
Die Abteilung starrte betreten zu Boden. Einmal mehr herrschte das Motto »Uns kann er ja wohl nicht meinen« vor. Und Milus bereute, zuerst vorschnell Habib mit der Leiche im Vergnügungsviertel der Stadt betraut zu haben. Wer würde schon einen Schriftsteller entführen, dessen Reputation zwar zweifelsfrei die beste war, der aber kaum über enorme Geldmittel verfügte, zumal Autoren in dieser Stadt, ja in diesem Land, überhaupt erst dann zu Ruhm und Reichtum gelangten, wenn man sie einsargte. Milus ärgerte sich. Diese Kulturfritzen! Die befehdeten sich doch ohnehin andauernd. Wie zum Kuckuck sollte man wissen, wer aller es auf so einen abgesehen haben konnte. Der Kreis der Verdächtigen, wie es so schön hieß, war in diesem Fall doch fast grenzenlos. Und welchen seiner Beamten sollte er in die Untiefen der hiesigen Kultur schicken, vor allem, wenn man den Ausbildungsstand der Polizei in Betracht zog. Mit Schaudern erinnerte er sich daran, daß ihn Pichler bei seinem Dienstantritt als »Oberst Englisch« angesprochen hatte, in der irrigen Annahme, der Hinweis auf die Fremdsprachenkenntnisse sei ein Namensschild.
Nein, dachte Milus, während die ganze Truppe vor ihm auf seine Entscheidung wartete, für diese Angelegenheit brauchte es einen Profi. »Gut«, sagte er und legte auch das letzte Schriftstück ab, »Slovac ist Chefsache, meine Herren«, dann sah er wieder zu Habib und verbeugte sich leicht, »und Dame. Das wär’s. Frisch ans Werk.« Er stand auf und ging in sein Büro, nicht weiter auf das Gemurmel hinter ihm achtend. Er schloß die Tür und griff zum Telefon. Er tippte eine Zahlenkombination in die Tasten und wartete. Es läutete mehrmals, dann hob jemand ab.
»Linda? Hallöchen, der olle Milus am Apparillo. Ist Andrina da? Na fein, dann sei doch so nett und gib sie mir mal. Ja, du bekommst dafür auch wieder ein Überraschungsei, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Ja, du darfst auch meine Mütze aufsetzen. Den Knüppel? Du weißt doch, den haben nur Beamte im Streifendienst. Ich habe keinen … was? Na hör mal, so war das nicht gemeint, was heißt hier … natürlich habe ich einen Knü…, ich verstehe nicht, was das soll. Linda, ich bin in Eile, gib mir jetzt Andrina, okay? … Hallo? … Hallo? Hallo! Andrina? Na, Gott sei Dank, Linda ist heute wieder in Form, was?«
Andrina war gewohnt, daß sich Oberst Milus in heiklen Fällen an sie wandte, und daher war sie nicht sonderlich erstaunt, als sie in knappen Sätzen über die Lage informiert wurde.
»Und du willst, daß ich mich darum kümmere, wenn ich dich richtig verstehe?«
»Das wäre ganz außerordentlich klasse, wenn du es einrichten könntest, mir altem Brummbären mal wieder aus der Patsche zu helfen.«
Andrina strich in ihrem Filofax das geplante Treffen mit ihrer Mutter aus: »Ich bin in einer halben Stunde im Präsidium. Stell schon mal Kaffee zu. Und damit meine ich Kaffee.«
»Selbstverfreilich«, beeilte sich Milus um Entgegenkommen.
»Gut, also bis gleich. Wir sehen uns.«
Andrina hängte ein. Milus legte den Hörer zurück auf die Gabel und fingerte einen Dartpfeil aus seiner Schreibtischschublade. Ansatzlos donnerte er ihn in Richtung des obligaten Porträts des Staatsoberhauptes, wo er im Nasenbereich eindrang und zuckend steckenblieb. »Na bitte«, dachte Milus, »25 Punkte.«
Andrina fläzte sich lässig auf die im Büro des Obersten befindliche Sitzgarnitur. Ihr langes blondes Haar kontrastierte mit der pechschwarzen Lederjacke, unter der sich ein weißes T-Shirt mit einem Konterfei von Donald Duck befand. Dunkelblaue Jeans verhüllten Andrinas schier nicht enden wollende Beine, die schließlich doch durch knallrote High Heels abgeschlossen wurden. Milus wußte, daß diese Aufmachung für Andrina nachgerade dezent war, und doch kam er ins Schwitzen, als seine Blicke den Körper der Schauspielerin abwärts wanderten. Instinktiv lockerte sich der Oberst die Krawatte und öffnete den obersten Hemdknopf. Er wußte, er mußte irgendetwas sagen, um nicht als sabbernder Dösbaddel dazustehen.
»Cognac?«
Andrina legte den Kopf schief und starrte Milus durchdringend an.
»Ach ja, richtig, du trinkst ja nicht. Merkwürdige Unsitte. Na ja«, er räusperte sich, »wie auch immer. Du hast hoffentlich nichts dagegen, daß ich …, ich meine, daß ich einen zwitschere?«
»Wenn du’s nötig hast. Ist dein Problem.«
»Ist es wohl«, Milus bemühte sich um eine schöpferische Pause, während er sich ein Glas vollschenkte, »apropos Problem«, sagte er dann. Andrina legte die Ausgabe der Zeitschrift »Freund und Helfer« beiseite und zog eine Augenbraue hoch: »Slovac.«
»Genau.«
Milus setzte sich Andrina gegenüber und breitete seine Papiere aus.
»Die Lage ist ein wenig kompliziert. Der Innenminister tobt, selbst der Bundeskanzler hat schon interveniert. Höchstgeschwindigkeit ist angesagt. Unser Problem ist jetzt, daß es nicht den geringsten Anhaltspunkt gibt, wer hinter der ganzen Sache stecken könnte. Nicht den geringsten.«
Andrina überprüfte ihre schreiend rot lackierten Fingernägel. Nach einer kurzen Weile suchte sie Blickkontakt zu Milus: »Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, diese Causa ist eine politische?«
Milus blinzelte unsicher. Andrina fuhr fort: »Ich sehe das so. Slovac ist, wenn er auch schon seit einem halben Jahrhundert hier lebt, eigentlich Jugoslawe. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, was sich da unten seit acht Jahren abspielt, und Slovac hat einen bei allen Streitparteien sehr unpopulären Standpunkt eingenommen. Den der Vernunft.«
»Was willst du damit sagen«, fragte Milus, der nicht wußte, worauf Andrina mit dieser Einleitung hinauswollte.
»Nun ja, so ziemlich alle Fraktionen, seien es nun die Kroaten, die Großserben oder auch die Muslime, alle haben einigen Grund, Slovac aus dem Verkehr zu ziehen, hindert er sie doch mit seinen beständigen Mahnungen daran, ihr schmutziges kleines Spielchen in Ruhe weiterzuspielen. Du brauchst dir nur einmal durchzulesen, was Slovac in den letzten Jahren über Tuđman, Milošević und Izetbegović geschrieben hat. Wenig schmeichelhaft, kann ich dir sagen. Und so mancher Fanatiker erblickt im Tun von Slovac ganz sicher Hochverrat, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ah«, kam Milus die Erleuchtung, »du meinst, da steckt so etwas wie Terrorismus dahinter, IRA, RAF und so? Verstehe.« Er lächelte breit.
»Muß nicht sein«, bremste Andrina den Enthusiasmus des Obersten, »genausogut kann irgendein Geheimdienst dahinterstecken. Die Kroaten, wenn sie sonst schon nichts haben, aber das haben sie. Bei den Serben wiederum würde es mich nicht wundern, wenn sie die UDBA-Leute übernommen hätten, und die Bos…«
»UDBA«, hakte Milus nach, »also doch Terrorismus.«
»Wie man’s nimmt. Die UDBA war der Geheimdienst von Jugoslawien, als noch der selige Tito der Boß war. In jeder westlichen und wahrscheinlich auch östlichen Botschaft gab es den einen oder anderen Kultur- oder Handelsattaché, der realiter Agent war. Und 1991 wurden die alle brotlos. Ich denke, das macht sie käuflich.«
»Internationale Verwicklungen, hmm? Dritter Mann und so? Gefällt mir gar nicht. Vor allem jetzt nicht, wo sich die NATO jeden Moment anschickt, Belgrad wegen dieser Albaner-Sache da zu bombardieren«, brummte Milus vor sich hin. Er sah Andrina fragend an: »Glaubst du nicht, daß das eine Nummer zu groß ist für meine Abteilung? Sollte da nicht das staatspolizeiliche Büro …, ich meine, so etwas ist doch eigentlich deren Kaffee. Wozu sind die sonst da? Wird ihnen nichts schaden, wenn sie einmal was anderes tun, als kurdischen Hungerstreikern Schnitzelsemmeln unter die Nase zu halten.«
Andrina putzte sich einen Fussel von der Jacke: »Ich würde es einmal so sagen. Bei einer solchen Sache kann man sich mordsmäßig Meriten verdienen, man kann aber auch ordentlich eins auf die Nase bekommen.«
»I see«, demonstrierte Milus seine Weltgewandtheit. Er nahm einen tiefen Schluck aus dem Cognacglas. »Was also würdest du an meiner Stelle tun?«
»Auf jeden Fall nichts Voreiliges. Zuwarten. Den Minister hinhalten. Und meine Fühler ausstrecken. Es gibt viele Jugoslawen in dieser Stadt. Die treffen sich in einschlägigen Lokalen, da kann man sich ein bißchen umhören. Informationen sammeln. Danach kann man immer noch zu dem Schluß kommen, die Sache ist einem zu heiß.«
»Wie stellst du dir das vor. Ich kann ja kaum in so einen Balkan-Burger reinmarschieren, meine Hundemarke vorzeigen und erwarten, daß die wegen mir singen wie die Lerchen.«
Andrinas Gesichtsausdruck formte sich zu einem Fragezeichen.
»Na, bei unseren Fremdengesetzen denken die bei Polizei doch sofort an Einwanderungsbehörde und so, die türmen, noch bevor ich bis drei gezählt habe.«
»Ich dachte, daran scheitern Polizisten ohnehin.«
»Wahnsinnig witzig. Nein, ehrlich. Aus denen bekommt ein Bulle unter Garantie nichts raus. Und ich muß dir sagen, das versteh’ ich sogar. Ich würd’ mir auch nichts sagen. Nicht, wenn man mich andauernd so schikaniert. Ist kein Honiglecken hier, wenn man keine Staatsbürgerschaft hat.«
»Aber der Innenminister ist doch ohnehin ganz okay, oder nicht?«
»Na ja«, wagte sich Milus auf unsicheres Terrain vor, »die geltenden Gesetze stammen ja noch von seinem Vorgänger, und der war so ein Ausländer der zweiten Generation, die sind ja meist die Schlimmsten – mit wenigen Ausnahmen.« Dabei dachte er an Habib. Ob er bei der wohl Chancen hätte? Milus seufzte – und schenkte sich nach.
»Dein Problem ist also«, faßte Andrina zusammen, »daß du glaubst, auf wenig Kooperationsbereitschaft zu stoßen, wenn du da quasi offiziell auftauchst.«
»Erstens dieses, und zweitens kenn’ ich mich da ja gar nicht aus unter denen. Stell’ dir vor, ich erzähl’ irgendeinem von denen, um ihn ein wenig aufzuwärmen, von meinem herrlichen Adriaurlaub anno 1961, und plötzlich scheuert der mir eine, weil er aus Belgrad ist. Alles schon vorgekommen. Nein, da braucht’s jemand mit Fingerspitzengefühl.«
»Ich weiß, worauf du hinauswillst«, fiel ihm Andrina ins Wort, »du denkst an unseren Piratenkapitän. Habe ich recht?«
Milus nickte knapp.
»Und du glaubst, der meistert die Lage?«
»Das wollt’ ich eben von dir wissen. Schließlich hast du ihn unter deine Fittiche genommen.«
»Tja«, meinte Andrina gedehnt, »es kann ja nichts schaden, ihn mal zu fragen. Soviel ich weiß, hat er ohnehin nichts zu tun, seit er aus Irland zurückgekommen ist.«
Milus wurde neugierig: »Ah, er war in Irland?«
»Ja, ursprünglich hat er bei seinen Vorfahren vorbeigeschaut, um sich ein wenig in seinem Ruhm zu sonnen, und dann ist er in irgendeine Geschichte reingeschlittert, die ihn nach Belfast gebracht hat.«
»Na bitte, die Terroristen«, sagte Milus bestimmt, »ich wußte, wir kommen da noch drauf.«
Andrina lächelte milde: »Wie auch immer, jedenfalls hat er die Sache heil überstanden, was mich offen gestanden erstaunt, und ist jetzt seit zwei Wochen wieder hier.«
»Da ist ihm doch sicher ohnehin schon langweilig, oder?« Andrina stand auf und machte einige Dehnübungen. »Was weiß ich, find’s heraus, würd’ ich sagen.«
»Ich weiß nicht«, gab sich Milus skeptisch, »ob das klug wäre, wenn ich ihn kontaktiere. Ich meine, wir kennen uns doch kaum, praktisch.«
Milus’ Blicke durchbohrten Andrina.
»Nein, du denkst doch nicht ernsthaft, daß ich …, doch, verdammt noch mal, das tust du, was?«
Milus nickte knapp: »Bitte, Drinchen, du siehst, der alte Schweinebär sitzt schwer in der Patsche. Und wenn der englische Windhund deine Stimme vernimmt, dann sagt der unter Garantie zu allem Ja und Amen.«
»Erklärst du mir einmal, weshalb ich überhaupt mit dir Umgang pflege? Ich bin ja praktisch deine Privatfeuerwehr, ich …«
»Damit dir niemand in die Quere kommt, wenn du deinen Extravaganzen nachgehst? Nein, sorry, vergiß es. Wie wär’s, wenn ich sage, du hast eine Schwäche für Idioten?«
»Das trifft’s wahrscheinlich eher«, meinte Andrina frostig, der die Anspielung auf ihr Privatleben wenig behagt hatte. Als ob sie jemals den Schutz von Milus und seinen Leuten gebraucht hätte. »Solche Bemerkungen übrigens«, sagte sie denn auch bestimmt, »kannst du dir schlicht und ergreifend sparen, verstanden?«
Milus senkte artig den Kopf: »Wenn du mir den Drake anrufst, dann sag’ ich so etwas nie, nie, nie wieder. Großes Indianerehrenwort.«
»Eigentlich sollte ich dir stattdessen den Arsch versohlen, und das weißt du verdammt genau.«
»Ho, ho, ho, du sprichst mit einer Amtsperson. Einen anderen Ton bitte.«
»Ach, ich soll Drake also doch nicht anrufen?«
»Jeden Ton, den du willst, jeden«, sagte Milus eilfertig, »hier steht der Apparat. Zu deiner Verfügung.«
Immer noch mürrisch stakste Andrina zum Schreibtisch und beförderte den Hörer aus der Gabel.
III.
Henry Drake saß in seinem Büro und war schwer beschäftigt. Seine Kiefer mahlten verkrampft, sodaß er mehrmals Gefahr lief, sich die Zunge, die er immer wieder zwischen die Zähne zu schieben versuchte, abzubeißen. In höchster Konzentration widmete er sich einer Arbeit, bei der höchste Präzision angesagt war. Die linke Hand führte zitternd eine kleine Schere an die rechte. Drake zögerte. Der Schweiß perlte ihm über die Stirn. Jetzt nur nicht nachlassen, dachte er sich. Vorsichtig näherte er die Schere weiter an ihr Ziel. »Jetzt oder nie«, murmelte Drake halblaut und wagte den entscheidenden Schritt. Ein vernehmliches Zipp hallte durch den Raum, und ein weiteres Stück Fingernagel flutschte über den Schreibtisch. Drake hielt die rechte Hand von seinem Körper weg und betrachtete sein Werk. Er war zufrieden: »Na bitte, nur noch drei.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!