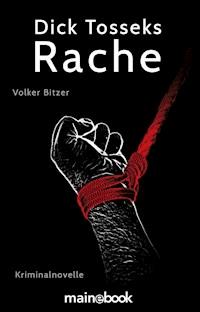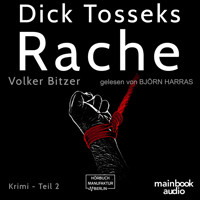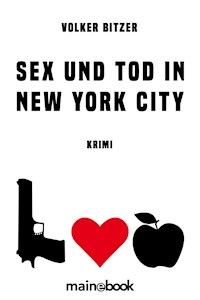
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sam Drickson will endlich in Rente gehen. Aber sein letzter Fall wird für den Mordspezialisten des New York City Police Department zum Albtraum: Mitglieder der feinen Gesellschaft werden live im Darknet hingerichtet. Während Sam verzweifelt versucht, den Mörder zu finden, wittert der New-York-Times-Journalist Benjamin Huntler die Geschichte seines Lebens. Doch dann werden die Hintergründe zu den Morden aufgedeckt. Und nichts ist mehr so, wie es scheint. Mit viel schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang hetzt Volker Bitzer seine Figuren auf der Suche nach Wahrheit und Liebe durch den Big Apple. Die Stadt, die niemals schläft, bildet die atemberaubende Kulisse für eine Kriminalgeschichte, bei der man sich nie sicher sein kann, wer gut und wer böse ist. Bis einem auf den letzten Seiten der Atem stockt. .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Bitzer
Sex und Tod in New York City
Krimi
eISBN 978-3-948987-11-4
Copyright © 2021 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung: Olaf Tischer
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Das Buch
Sam Drickson will endlich in Rente gehen. Aber sein letzter Fall wird für den Mordspezialisten des New York City Police Departement zum Albtraum: Mitglieder der feinen Gesellschaft werden live im Darknet hingerichtet.
Während Sam verzweifelt versucht, den Mörder zu finden, wittert der New-York-Times-Journalist Benjamin Huntler die Geschichte seines Lebens. Doch dann werden die Hintergründe zu den Morden aufgedeckt. Und nichts ist mehr so, wie es scheint.
Mit viel schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang hetzt Volker Bitzer seine Figuren auf der Suche nach Wahrheit und Liebe durch den Big Apple. Die Stadt, die niemals schläft, bildet die atemberaubende Kulisse für eine Kriminalgeschichte, bei der man sich nie sicher sein kann, wer gut und wer böse ist. Bis einem auf den letzten Seiten der Atem stockt.
Der Autor
Volker Bitzer wurde 1968 in Bremen geboren. Er lebt und arbeitet in Hamburg.
Im mainbook Verlag erschien bereits Bitzers dreiteiliger Krimi „Die Dick-Tossek-Verschwörung“. Das Buch besteht aus den Krimi noir-Novellen „Sind Sie ein Freund von Dick Tossek?“, „Dick Tosseks Rache“ und „Auge um Auge mit Dick Tossek“. Alle drei Teile gibt es auch einzeln als E-Book und als Hörbuch. Weitere Veröffentlichungen von Bitzer sind die Kurzgeschichten „Das bunte Mädchen“ (im Rahmen der Anthologie „Mordsmütter“) und „Der Schlaganfall“ (im Rahmen der Anthologie „Die Letzte macht das Licht aus“).
Inhalt
Abschied von Jimmy Kimmel
Die Friseurin mit der Möhre
Was sieht er, was wir nicht sehen?
An der Schwelle zum Tod
Au-Au-Zu-Zu
Der feine Unterschied
Den Führerschein bitte
Dricksons Dilemma
Der erste Dienstag im Monat
Die böse Zahl
Terry Richels Verwandlung
Willkommen in der Welt der Reichen
Ein Name auf einem Abflussrohr
Taten und Untaten
Nummer Vier
Wie ist die Lage?
Nur ein Kuss – und deutlich mehr
Faule Eier zum Frühstück
Die Katastrophe
Animalische Anziehungskraft
Das Leben danach
Nebel, Nebel, nichts als Nebel
Die Besucherin
Ein Geist bringt Früchte
Darauf einen Sekt
Feuer legen und nackt baden …
Die Idylle und der Schrecken
Das Ende einer Theorie
Gute Nachrichten
Die Conners
Das Kindheitstrauma
Was man wirklich sieht
Franks langer Leseabend
Der verlorene Sohn
Die DNA des Mörders
Die Vorteile von Mord und Totschlag
Woodward, Bernstein … Huntler
Eine kostenlose legale Droge
Das Kondom im Bierglas
Und sie lebten glücklich …
Eine ruhige Minute in der dunkelsten Stunde
Die Spur führt zur Karottenstraße
Geschenke für die Polizei
Ein unbeschreibliches Verbrechen
73 Dollar
Nachwort
Abschied von Jimmy Kimmel
Tessa McKinnock zögerte. Das war ungewöhnlich. Denn Tessa war eine sehr entschlossene Person. Doch jetzt wusste sie nicht, was sie tun sollte. Erst blickte sie auf ihren Nachbarn Daniel Prosnaski. Dann auf das Paket, das Prosnaski für sie angenommen hatte und das auf einem Beistelltisch in seinem Wohnzimmer lag. Dann wieder auf Prosnaski. Aber der Sechsundachtzigjährige war keine Hilfe bei der Entscheidungsfindung der jungen Frau. Er war der Grund, warum sie zögerte. Prosnaski saß vor dem Fernseher und rührte sich nicht. Seine Hände hatte er über seinem dicken Bauch gefaltet. Wie immer, wenn er um diese Zeit vor dem Fernseher saß. Und wie immer lief Jimmy Kimmel Live. Daniel Prosnaski hatte noch nie eine Folge von Kimmel verpasst. Es war seine Lieblingsshow.
Der Rentner war ein netter Kerl, bei allen im Haus beliebt. Als der Paketbote am Nachmittag geklingelt und gefragt hatte, ob der alte Herr ein Päckchen für seine abwesende Nachbarin annehmen könnte, hatte er ja gesagt. Der Bote hatte eine Notiz für Tessa McKinnock hinterlassen, die auf demselben Stockwerk gegenüber von Prosnaski wohnte. Jetzt stand sie neben ihm. Prosnaskis Tür hatte einen Spaltbreit offen gestanden. Tessa hatte geklopft und gerufen. Ein sehr lauter Fernseher – vielleicht hatte der alte Mann sie nicht gehört. Schließlich hatte sie die Wohnung betreten und ihn angesprochen. Doch er hatte nicht geantwortet.
Tessa unternahm einen zweiten Versuch: „Dan, geht es dir gut?“
Daniel Prosnaski reagierte nicht.
Daniel Prosnaski war tot.
Die Friseurin mit der Möhre
Unruhig rutschte Zacharias Preston auf dem Barhocker hin und her und fixierte sein Gegenüber. „Okay, rück’ schon raus mit der Sprache: Wie stellst du’s an?“
„So jedenfalls nicht, Zac“, entgegnete ihm sein Arbeitskollege Benjamin Huntler und zeigte mit dem Finger auf ihn.
„Was meinst du?“ Zac verzog das Gesicht. „Ich hab’ doch noch gar nichts getan. Wie kann ich da was falsch gemacht haben?“
„Du hibbelst rum wie ein Schuljunge. So wird das nie was. Du musst cooler werden.“
Zacs Mundwinkel wanderten nach unten. Er sackte auf dem Barhocker zusammen und pustete wie ein ermatteter Langstreckenläufer.
„Hey, Sportsfreund, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Wir fangen doch gerade erst an. Das ist die erste Station.“ Aufmunternd klopfte Ben Zac auf die Schulter. „Mach’ dich locker. Wenn du verkrampft bist, sieht das jeder. Versuch’ mal, so etwas wie selbstbewusste Gelassenheit auszustrahlen.“
Der Gefrustete quälte sich ein Lächeln ins Gesicht. „Du hast gut reden. Wahrscheinlich kannst du dich gar nicht daran erinnern, wann du das letzte Mal alleine geschlafen hast.“
„Alleine schlafen?“ Ben sah Zac an, als hätte dieser zwei Worte aneinandergereiht, von deren Kombinationsmöglichkeit er noch nie etwas gehört hatte.
„Mach’ dich ruhig lustig über mich. Ich verdiene es nicht besser.“ Zac wirkte ernsthaft frustriert.
„Schluss mit dem Gequatsche! Her mit den verdammten Fakten: Wie machst du es, Ben?“ Terry Richels hatte seinen Kollegen die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Nun riss ihm der Geduldsfaden. Seine Augen funkelten aus seinem vollbärtigen Gesicht. Er streckte Ben seine rechte Hand entgegen, in der sich eine Bierflasche befand. Ben missachtete das ihm angebotene Getränk und sagte: „Als erstes solltest du diese Klitoris-Raspel aus dem Gesicht bekommen. So hässlich kannst du gar nicht sein, dass du dich dahinter verstecken musst. Und mit dieser Hipster-Attitüde kriegst du mittlerweile nicht mal mehr eine notgeile betrunkene Friseurin flachgelegt. Total out.“
Zac feixte. Er war erleichtert, dass nicht mehr er, sondern nunmehr Terry das Ziel von Bens Spott war. Die drei Journalisten hatten das Jacob’s Pickles an der Upper West Side als Startpunkt für ihren Nachtausflug gewählt. Das Restaurant mit seiner gut ausgestatteten Bar und seinen riesigen Essensportionen war ein beliebter Treffpunkt für junge und junggebliebene Stadtabenteurer – stets so voll, dass die Servicekräfte sich mit Speisen und Getränken laut rufend ihren Weg durch die Massen bahnen mussten, um an die Tische zu gelangen. „Und als nächstes sollte man wissen, wo man sich befindet und sich dort entsprechend verhalten“, fuhr Ben fort. „Hier werden einige ausgezeichnete Biere vom Fass ausgeschenkt. Da bestellt man kein Flaschenbier.“
Terry wirkte betroffen. Er stellte die Bierflasche auf den Tresen, wo bereits seine eigene stand. Nun würde er wie ein Alkoholiker erscheinen, der ohne seine doppelte Dosis nicht in die Gänge kam. Außerdem hatte er ohnehin die falsche Bestellung aufgegeben und war bei Ben in Ungnade gefallen. Das war kein guter Anfang. Er und Zac wollten an diesem Abend vom großen Meister lernen. Dass Ben seine Lektion auf die harte Tour durchziehen würde, war nicht vorauszusehen. Doch Terry hatte keine Lust auf die Opferrolle. „Okay, du Supermann, dass Zac und ich Nachhilfe in Sachen Frauen brauchen, ist leider kein Geheimnis. Aber jetzt mal zu dir: Was sind eigentlich deine Schwächen?“
Wie aus der Pistole geschossen antwortete Ben: „Ich bin ein Zyniker. Daher bin ich nur einer sehr begrenzten Zahl von Menschen sympathisch. Außerdem sage ich zu gerne die Wahrheit – besonders Vorgesetzten. Man könnte sagen, dass ich ein Problem mit Autorität habe. Deswegen werde ich auch nie eine Führungsposition erhalten – weder bei unserer altehrwürdigen New York Times noch bei irgendeiner anderen Zeitung. Ich kann einfach zu schlecht schleimen und buckeln.“
„Für mich klingt das nach ‘ner verdammten Ausrede dafür, dass du es nie zu etwas Höherem bringen wirst.“
Terry hatte die verbalen Nackenschläge, die Ben ihm beigebracht hatte, noch nicht überwunden und wollte dessen Geständnis nutzen, um weiter in die Offensive zu kommen. Wortgefechte waren ein beliebter Zeitvertreib der drei Freunde, die ansonsten unterschiedlicher nicht hätten sein können.
„Ausrede?“ Ben schob die Unterlippe nach vorne und gab sich Mühe, dabei möglichst gelangweilt auszusehen. Dann stellte er sich kerzengerade hin und legte seine rechte Hand auf sein Herz. „Ich stehe dazu, dass ich es zu nichts Höherem bringen werde. Mir reicht es völlig, für Millionen von Lesern die Geschichten dieser großartigen Stadt aufzuschreiben und meinen Nerd-Kollegen aus der Tech-Redaktion Nachhilfe im Frauen-Aufreißen zu geben“, schwor er mit gespieltem Pathos.
„Okay, dann weiter damit“, forderte Zac. „Was sollte dieser Chauvi-Spruch mit den notgeilen Friseurinnen?“
Ben setzte einen traurigen Blick auf. „Also jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Herr Kollege. Die Wahrscheinlichkeiten dafür, Frauen aus bestimmten Berufsgruppen ins Bett zu bekommen, muss man natürlich kennen, um nicht – wie hast du es genannt? – alleine zu schlafen.“
„Ach, dann bist du gar kein Chauvi, sondern ein Frauenversteher“, befand Terry und lachte. Zac stimmte ein.
Beide hatten Spaß daran, endlich mal Oberwasser auf diesem für sie so schwierigen Diskussionsgebiet zu bekommen. Doch es war nur ein sehr kurzer Triumph, den Ben ihnen gönnte.
„Völlig richtig“, bestätigte er mit ernster Miene. „Frauen zu verstehen und zu respektieren, ist die wichtigste Voraussetzung, um bei ihnen zum Zug zu kommen.“
Seine Freunde wirkten ratlos. „Okay, ich geb’s auf: Was hat es mit den notgeilen Friseurinnen auf sich?“, wollte Terry schließlich wissen.
„Diese Damen gehören zu einer besonders interessanten Spezies“, dozierte Ben. Er nahm einen Schluck aus dem Bierglas, das ihm der Kellner seines Vertrauens zwischenzeitlich in die Hand gedrückt hatte. Diese dramaturgische Pause erzielte genau die Wirkung, die er sich erhofft hatte: Terrys und Zacs Blicke klebten an seinen Lippen. „Friseurinnen arbeiten hart. Sie sind den ganzen Tag auf den Beinen und werden dabei ständig von gutangezogenen, schönen, wohlriechenden Männern umschwirrt, mit denen sie nie Sex haben können“, erläuterte er.
Terry und Zac schauten sich fragend an. „Von ihren schwulen Kollegen“, löste Ben das Rätsel.
„Du meinst also, eine Friseurin arbeitet wie ein Esel, dem ständig eine Möhre vor die Nase gehalten wird?“, erkundigte sich Zac.
Nachdenklich rieb Ben sich das Kinn. „Na ja, dieses Bild ist zwar nicht exklusiv für diese Berufsgruppe entworfen worden. Aber bezogen auf unser Thema hast du mit dem Möhrengleichnis eindeutig ins Schwarze getroffen, mein Freund.“ Alle drei lachten.
„Sind Friseurinnen also leicht ins Bett zu kriegen? Und wenn ja, woran erkenne ich eine Friseurin?“, bohrte Zac nach.
„Friseurinnen sind eine seltene Gattung im Nachtleben“, erklärte Ben. „Weil sie fast den ganzen Tag im Stehen arbeiten und dafür auch noch schlecht bezahlt werden, gehen sie selten aus. Sie sind abends müde und haben nur ein geringes Spaßbudget. Wenn man also eine Friseurin identifiziert, darf man keine Zeit verlieren: Man muss sie schnell zu einem Drink einladen, den sie meistens dankend annimmt, und ihr seine starke Schulter anbieten.“
„Aber was sagt man dann? Wie kriegt man sie ins Bett?“ Terry hatte Blut geleckt. Jetzt wollte er es genau wissen.
Ben grinste. „Man sagt nichts.“
„Nichts?“ Terry war verwirrt. „Wie soll man eine Frau ins Bett kriegen, ohne mit ihr zu reden?“
„Sie redet. Du schweigst“, antwortete Ben. „Friseurinnen quatschen den ganzen Tag mit ihren Kunden. Lass’ sie kommen. Das gilt übrigens auch für fast alle anderen Frauen. Nur Dummköpfe labern Frauen voll. Kluge Männer hören zu. So kommt man zum Ziel.“
„Aber gar nichts zu sagen, funktioniert doch nicht. Dann gilt man als mundfauler Langweiler“, behauptete Zac.
Ben sah ihm tief in die Augen. „Stell Fragen.“
„Was für Fragen?“, hakte Zac nach.
„Tatsächlich ist das gar nicht so wichtig“, erklärte Ben. „Hauptsache, du fragst sie was. Frauen lieben Männer, die sich für sie interessieren. Und Interesse signalisiert man, indem man etwas fragt. Du bist Journalist, verdammt noch mal. Es ist dein Job, anderen Leuten Fragen zu stellen. Warum sollte dir das bei Frauen nicht gelingen?“
„Wir sind Nerds, Ben. Wir sind in der verdammten Tech-Redaktion. Wir schreiben über Computerspiele, Smartphones und Internet-Router. Wir kriegen den ganzen Kram in die Redaktion geschickt – zusammen mit seeeehr laaaangen PR-Texten von den Herstellern. Das ist nicht besonders investigativ. Du schreibst die coolen Geschichten über Mord und Totschlag und all das andere Zeugs, das in New York passiert. Du musst viel mehr rumtelefonieren als wir, um deine Geschichten zu bekommen. Du bist trainiert. Das ist unfair“, verteidigte Terry seinen Kollegen und sich selbst.
Enttäuscht schüttelte Ben den Kopf. „Ich merke schon: Das wird heute Abend ein ganz schön harter Ritt …“
„Oh Mann, …“, unterbrach Zac ihn und setzte zu einer umfassenden Erklärung an.
„… aber wenn es einfach wäre, hättet ihr mich ja nicht gefragt“, schloss Ben seinen Vortrag.
Grölend prosteten die drei Freunde sich zu.
Was sieht er, was wir nicht sehen?
Das Manhattan Psychiatric Center war ein hässlicher Ort. Siebzehn Stockwerke verspachtelte Tristesse. Das Krankenhaus lag im Osten der Stadt auf Ward Island, einer Insel zwischen Harlem River und East River auf Höhe der 108. Straße.
Ein junger, dünner Mann saß dort im Schneidersitz in einem verglasten Raum. Er war nackt. Sein Blick schien in die Ferne zu schweifen. Doch da war nichts, das er hätte sehen können. Neben ihm lag eine große, mit Pistazien gefüllte Tüte. Von Zeit zu Zeit nahm der Mann eine Pistazie, befreite sie langsam und sorgfältig von ihrer Schale und warf sie nach vorne auf die vor ihm befindliche Glasscheibe. Nach einigen Minuten beschleunigte er sein Tempo. Schließlich griff er immer schneller in die Tüte, bis er den gesamten Prozess mit größter Präzision in atemberaubender Geschwindigkeit vollführte. Die anfängliche Leere in seinem Gesicht wich dabei einer immer größer werdenden Wut.
„Was tut er da?“ Die Psychiaterin Patricia Darvids blickte stirnrunzelnd auf den jungen Patienten.
„Er bewirft sich selbst mit Pistazien“, erklärte ihr Kollege Darren Blirth, der neben ihr stand.
„Wie meinst du das?“, fragte Darvids.
Blirth zeigte auf die Glaswand. „Er sieht sein Spiegelbild in der Scheibe.“
An der Schwelle zum Tod
Wo hatte sie bloß die Schere hingelegt? Tessa McKinnock wühlte in ihren Küchenschubladen. Immer wieder blickte sie währenddessen auf das Paket, das sie hinter sich auf dem Tisch abgestellt hatte – als wäre es etwas Kostbares, das ihr jemand stehlen könnte.
Zuvor hatte die junge Frau das Paket von Daniel Prosnaskis Beistelltisch genommen, sein Apartment verlassen und dessen Tür geschlossen. Jetzt öffnete sie es mit der Schere, die sie schließlich gefunden hatte, und entnahm den Inhalt:
Eine Pistole der Marke Glock mit Schalldämpfer und vollem Magazin.
Ein Schlüssel.
Ein Zettel, auf dem ein Code und eine Adresse notiert waren.
Sie inspizierte die Waffe und warf einen kurzen Blick auf den Schlüssel. Dann nahm sie den Zettel, prägte sich den Code und die Adresse ein, entzündete ein Streichholz und verbrannte das Papier.
Sie blickte auf die Uhr.
Es war spät – aber nicht zu spät.
Tessa McKinnock verstaute die Waffe, den Schlüssel und dünne Fingerhandschuhe in einem kleinen Rucksack. Dann schulterte sie ihr Fahrrad, das sie stets in der Wohnung an einem Wandträger aufbewahrte, und verließ das Haus. Die Adresse auf dem Zettel war an der Upper East Side. Ihr Apartment war in einem der alten Backsteingebäude an der 82. Straße im Westen der Stadt. Von dort fuhr sie Richtung Osten bis zum Central Park, den sie einen Block weiter südlich durchquerte. Sie fuhr sehr schnell. Ein schwarzes Fahrrad, schwarze Kleidung, eine schwarze Sturmhaube, ein schwarzer Fahrradhelm: Tessa McKinnock war unsichtbar – ein rasender Schatten in der Nacht. Um an ihr Ziel auf der anderen Seite des Parks zu gelangen, benötigte sie nur wenige Minuten.
Jetzt stand sie vor dem Haus an der 78. Straße zwischen Park Avenue und Lexington Avenue. Sie zog die Handschuhe an, gab den Sicherheitscode an der Haustür ein, gelangte so ins Gebäude und bewegte sich schnell und lautlos durch das Treppenhaus bis zum Apartment am Ende des Flurs im zweiten Stock. Die junge Frau hielt ihr Ohr an die Wohnungstür. Alles war ruhig. Sie nahm den Schlüssel aus dem Rucksack, öffnete die Tür und betrat das Apartment. Es war stockfinster, die Vorhänge waren zugezogen. Um ihren Augen die Möglichkeit zu geben, ihr ein Bild von dem Raum zu liefern, verharrte Tessa eine Minute an der Tür. Dann zog sie die Waffe aus dem Rucksack.
Schräg links von ihr befand sich eine weitere Tür, durch deren schmalen Spalt ein wenig Licht aus dem Raum, der sich dahinter befand, zu erkennen war.
Es waren Schritte aus dem Raum zu hören.
Tessa McKinnock war nicht alleine in dem Apartment.
Sie kniete sich auf ihr rechtes Bein. Ihr linkes Bein winkelte sie an, sodass sie ihren linken Ellenbogen darauf ablegen konnte. Mit der linken Hand stabilisierte sie das Handgelenk ihrer rechten Hand, in der sie die Waffe hielt. Sie zielte auf die Tür.
Die Schritte wurden lauter, kamen näher zur Tür, die jetzt geöffnet wurde.
Ein Mann stand in dem Raum kurz vor der Türschwelle – vom grellen Licht der Deckenstrahler angeleuchtet. Er hatte sich ein Badetuch um den Körper gewickelt. Einige Strähnen seines nassen Haares bildeten ein komisches Muster auf seiner Stirn.
Tessa McKinnock atmete tief ein und langsam wieder aus.
Dann hielt sie die Luft an und feuerte.
Drei Schüsse, kurz hintereinander.
Das erste Geschoss durchschlug die Stirn des Mannes. Die Kugel durchpflügte sein Gehirn und trat hinten – leicht unterhalb der Schädeldecke – wieder aus.
Das zweite Projektil durchtrennte die Halsschlagader des Mannes.
Die dritte Kugel traf ihn im Bauch.
Die Schützin würdigte den Toten keines Blickes. Sie richtete sich auf und verstaute die Waffe wieder in dem kleinen Rucksack. So lautlos und zügig, wie sie das Apartment betreten hatte, verließ sie es auch wieder.
Auf ihrem Weg nach Hause machte die junge Frau einen kleinen Schlenker und legte einen Zwischenstopp am größten See des Central Parks ein, dem Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Sie warf die Waffe und den Apartmentschlüssel ins Wasser.
Wenig später stand sie schon wieder vor ihrer Wohnungstür.
Dort lag ein weiteres Paket für sie.
Au-Au-Zu-Zu
Manche Abende entwickeln sich anders als geplant. Ben, Zac und Terry waren im Jacob’s Pickles hängengeblieben. Der ständige Zulauf attraktiver Frauen und die vielen Biersorten, die es zu probieren galt, hatten ihnen keine andere Wahl gelassen. Von Bens Vorgabe, nur die Fassbiere zu trinken, waren sie längst großzügig abgewichen. So war es schon nach Mitternacht, als Ben das Gesprächsthema Nummer eins wieder aufnahm und grundsätzlich wurde: „Okay, Freunde“, sagte er mit immer noch erstaunlich fester Stimme. „Was sind die entscheidenden Faktoren, um bei Frauen Erfolge zu feiern?“
„Wenn wir daff wüssssten, wär’n wir nich’ tzo verzffeiflt“, lallte Terry.
Auch Zac war der Genuss der zahlreichen alkoholischen Getränke deutlich anzumerken. „Erleuchte uns!“, flehte er und sank vor seinem Kollegen auf die Knie.
Ben nahm die pathetische Geste auf und reichte Zac die Hand. „Erhebe dich, mein Freund“, entgegnete er. „Heute begibst du dich auf einen Weg, an dessen Ende dein bestes Stück wohlig in einer dunklen Höhle zucken wird.“
„Yee-haw!“, jubelte Terry. „Ennlich kommm wir tzurr Sacheee.“
Ohne auf seine Begeisterung einzugehen, erklärte Ben: „Der Mensch begehrt, was er sieht.“ Er zeigte auf Zac. „Was siehst du, Terry?“
Terry schwankte einmal von links nach rechts und fixierte seinen Kollegen, so gut es eben ging. Zac trug ein verwaschenes Madonna T-Shirt von ihrer Confessions-Tour aus dem Jahr 2006. Auf der Vorderseite prangte ein Bild der Sängerin, die in einem pinkfarbenen Nichts mit gesenktem Blick ins Mikrofon hauchte. Dazu hatte Zac eine dunkelgraue enge Jeans an, von der Terry und Ben wussten, dass er sie seit drei Wochen nicht mehr ausgezogen hatte. Neongrüne Sneaker rundeten sein Outfit ab. Seinem freundlichen aber blassen Gesicht sah man an, dass es nachts häufiger dem Schein eines Computerbildschirms als tagsüber dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Jetzt grinste er, als wollte er einen guten Eindruck machen. „Ich seeehe ein’ zzziemlich bsoffnen netten Keeerl, plonner Wuschlkoff, kraue Auugn, Anfng Dreisssich, deer heude leieidaaa wiedaa wichsssen mussss“, brabbelte Terry und klopfte sich auf die Schenkel.
„Und warum muss er wichsen?“, fragte Ben mit ernster Stimme und zeigte dabei immer noch auf Zac, der jetzt nicht mehr grinste, sondern mit betrübter Miene die Begründung seines Todesurteils erwartete. Doch Terry konnte nicht antworten. Er lachte pausenlos. Stark nach vorne gebeugt hielt er sich dabei mit der linken Hand den Bauch. Mit der rechten stützte er sich auf einem Barhocker ab. „Er muss wichsen, weil er das erste Au missachtet hat“, beantwortete Ben seine eigene Frage.
„Das erste was?“, riefen Zac und Terry, der schlagartig aufgehört hatte zu lachen, fast gleichzeitig.
Beide starrten ihren Kollegen mit offenen Mündern an – eine Situation, die Ben sichtlich genoss. Er machte eine kleine Pause, bevor er seinen Satz wiederholte: „Das erste Au.“ Eine weitere Pause folgte. „Es steht für das Aussehen“, klärte Ben auf. „Frauen verbringen viel Zeit damit, sich hübsch zu machen. Und sie geben einen Haufen Geld dafür aus. Make-up, Schmuck, Klamotten, Schuhe … Das alles reißt tiefe Löcher ins Portemonnaie. Wenn die Damen dann losziehen und ein ungepflegter Typ im Madonna-T-Shirt sie anspricht, hat der arme Kerl keine Chance. Du musst dir mehr Mühe geben, mein Freund.“
Zac fühlte sich gekränkt. Terry lachte wieder, was Zacs Laune weiter in den Keller trieb. „Denkst du, dass du besser rüberkommst, Besoffski?“, brüllte er. Terry blickte schnell an sich herunter und wieder auf zu Zac. Diese ruckartige Kopfbewegung überforderte seinen durch den Alkohol stark beeinträchtigten Gleichgewichtssinn. Er schwankte und war kurz davor umzufallen. Gerade noch konnte er sich wieder an seinem Barhocker festhalten. Mit seinem schwarzen Rauschebart, den zusammengewachsenen Augenbrauen und seinen ungepflegten Fingernägeln wirkte er wie ein torkelnder Werwolf. Sein Brusthaar quoll aus seinem Poloshirt hervor.
„Du brauchst ‘ne Pause“, rief Ben ihm zu.
„I’ binn top-füüt!“, lallte Terry zurück.
Dann rutschte er mit der Hand vom Barhocker ab und schlug lang auf den Boden.
Blitzschnell reagierten seine Freunde und halfen ihm auf.
„Oggay, oggay, vleich brau’ i’ do’ ei’ kleies Päussschen“, nuschelte er in seinen Bart, während er sich an seinen Kollegen festhielt. Ben und Zac hakten sich links und rechts bei Terry ein und bugsierten ihn die Treppe runter zu den Toiletten. Dort angekommen, stolperte er in die nächste freie Kabine und umarmte die Kloschüssel. Seine Freunde hielten vor der Tür Wache, denn zum Verriegeln hatte Terry keine Zeit. Nach einer Weile hörten die Würgegeräusche auf. Terry trat ans Waschbecken, drehte den Hahn auf und hielt seinen Kopf unter das kalte Wasser. Fast eine ganze Minute verweilte er so, während Ben und Zac ihm kopfschüttelnd zusahen. Schließlich richtete er sich wieder auf und verkündete voller Überzeugung: „Weiter geht’s, Männer!“
Zweifelnd musterte Zac den Betrunkenen. „Lass’ es langsam angehen, Kumpel.“
„Is’ klar“, entgegnete Terry und wirkte dabei tatsächlich deutlich aufgeräumter. Ohne fremde Hilfe schaffte er den Weg zurück an die Bar, wo er sich ein weiteres Bier bestellte.
„Also das mit dem ersten Au habt ihr verstanden, oder?“, fragte Ben wenig später. Zac und Terry nickten. „Dann kommen wir jetzt zum zweiten Au.“ Seine Freunde hingen wieder an seinen Lippen. „Es steht für das Auftreten.“ Ben legte einen strengen Blick auf. Schuldbewusst sahen Zac und Terry zu Boden.
„Okay, ich merke schon, dass ich da nicht länger drauf eingehen muss. Dann kommen wir sofort zum ersten Zu“, fuhr Ben fort.
„Ha, jetzt weiß ich was!“ Zac streckte seinen rechten Zeigefinger empor. Erwartungsvoll staunte Terry ihn an. „Es steht fürs Zuhören, richtig?“
Anerkennend nickte Ben. „Danke, Zac. Zum ersten Mal heute Abend habe ich den Eindruck, auf einer sinnvollen Mission zu sein.“ Alle drei lachten. „Damit sind wir schon bei der Schlussfrage: Wofür steht das zweite Zu?“ Er blickte in ratlose Gesichter und kostete dies einen Augenblick aus, bevor er die Lösung lieferte: „Das zweite Zu steht fürs Zuschlagen.“ Zac und Terry wirkten verwirrt.
„Ich soll die Frau schlagen?“, erkundigte sich Terry und sah dabei ernsthaft verstört aus.
Ben schüttelte den Kopf. „Natürlich nicht. Das zweite Zu ist bildlich gemeint. Es steht für das große Finale, für den entscheidenden Schritt. Es ist die anspruchsvollste Silbe im Vierklang Au-Au-Zu-Zu. Es ist hohe Kunst, zum richtigen Zeitpunkt in die Offensive zu gehen und das Maximum aus dem Treffen herauszuholen.“
„Sex!“, frohlockte Terry mit leuchtenden Augen und reckte die Faust in den Himmel.
„Nicht unbedingt“, belehrte ihn Ben.
Terry zwirbelte an seiner buschigen Augenbraue. „Komisch, bis eben dachte ich noch, das ist es, wovon wir die ganze Zeit reden.“
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: