
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Zwei Herzen im Kampf gegen übermächtige Schatten** Mit Marco an ihrer Seite ist Anna bereit ihr Erbe als Thronfolgerin einer magischen, fremden Welt anzutreten. Doch die beiden wähnen ihre Liebe und ihr Reich in einer trügerischen Sicherheit. Sie müssen erkennen, dass niemand seiner wahren Bestimmung entkommen kann und auf jedes noch so helle Licht ein Schatten folgt. Nun steht Anna ihr schwerster Kampf bevor und er fordert das höchste Opfer, das ein Herz bringen kann... Lass dich von Alexandra Carol in eine magische Welt entführen, in der Licht und Dunkelheit nah beieinander liegen! Eine starke Frau, die für ihre Freiheit und ihr Volk kämpft. Ein mächtiger Magier, der das Land zu vernichten droht. Und eine Liebe, die die finstersten Schatten bezwingt. //Alle Bände der magischen Fantasy-Reihe »Shadow of Light«: -- Shadow of Light: Lunajas Gabe (die kostenlose Vorgeschichte) -- Shadow of Light 1: Verschollene Prinzessin -- Shadow of Light 2: Königliche Bedrohung -- Shadow of Light 3: Gefährliche Krone//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alexandra Carol
Shadow of Light 3: Gefährliche Krone
**Zwei Herzen im Kampf gegen übermächtige Schatten**Mit Marco an ihrer Seite ist Anna bereit ihr Erbe als Thronfolgerin einer magischen, fremden Welt anzutreten. Doch die beiden wähnen ihre Liebe und ihr Reich in einer trügerischen Sicherheit. Sie müssen erkennen, dass niemand seiner wahren Bestimmung entkommen kann und auf jedes noch so helle Licht ein Schatten folgt. Nun steht Anna ihr schwerster Kampf bevor und er fordert das höchste Opfer, dass ein Herz bringen kann …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© Nadine Malzkorn
Alexandra Carol lebt mit ihrer Familie (dazu gehören auch die Vierbeiner) in einer kleinen Gemeinde im Sauerland. Schon seit der Schulzeit ist die Leidenschaft zur Schreiberei stets ein Teil von ihr gewesen, auch wenn es lange Zeit nur bei dem Traum vom Autorendasein blieb. Die Geschichten, die sie gern mit ihren Lesern teilen möchte, handeln von Romantik und der großen Liebe.
Königin Naliessa
Anna
»Die nächste links.«
Ich konzentrierte mich auf die Straße vor mir und versuchte schnell genug zu fahren, damit wir nicht schon wieder hier mitten in der Stadt von einem anderen Wagen überholt wurden. Aber bei dem Kommando stieg ich abrupt auf die Bremse. »Das geht nicht! Das ist eine Einbahnstraße!«, wetterte ich und starrte auf das blaue Schild mit der deutlichen weißen Schrift.
»Herrgott«, schimpfte mein Fahrlehrer, während hinter uns schon alles hupte. »Ich sagte links!«
Oh! Ja! Da bemerkte auch ich endlich, dass die Einbahnstraße rechts abging. Noch nie war ich sonderlich gut darin gewesen, rechts und links voneinander zu unterscheiden. Bei den Fahrstunden machte sich das nun leider ganz deutlich bemerkbar.
Voller Reue, mit knallrotem Kopf, setzte ich den Blinker links und bog ab, nachdem uns mindestens drei Autos überholt hatten. Das mit dem Anfahren und Schalten klappte doch wenigstens schon ganz gut.
»Die nächste Straße auf drei Uhr«, zog er mich nun auf.
Sehr witzig! Na ja, zumindest funktionierte es – fast ohne nachzudenken, setzte ich den Blinker rechts. Der Parkplatz des Bankhauptgebäudes war zum Glück so gut wie leer. Es bereitete mir keinerlei Schwierigkeiten, eine Lücke zu finden, die groß genug für meine Fahrkünste war. Erleichtert drehte ich den Zündschlüssel.
Mein Fahrlehrer öffnete die Tür und betrachtete den weißen Streifen, der rechts von uns mindestens eineinhalb Meter entfernt die Parklücke markierte.
»Na ja«, brummte er. »Das mit dem Parken üben wir dann beim nächsten Mal.«
Ich wusste, er meinte auch das übernächste Mal. Ganz sicher. Mein Magen war schon ganz flau bei dem Gedanken daran.
»Okay, dann also bis Dienstag«, erwiderte ich kleinlaut und bedankte mich auch noch brav dafür, dass er mich hatte hierhin fahren lassen. Dann stieg ich aus und zog den Reißverschluss meiner olivgrünen Daunenjacke bis ganz nach oben. Meine Nase versteckte ich hinter dem Kragen. Es war schon März, aber in diesen Tagen war der Winter noch einmal mit Macht über uns hereingebrochen – mit viel Schnee und eisigem Wind. Wahrscheinlich war es die Retourkutsche für den herrlich warmen Herbst, den wir in dieser Welt im letzten Jahr erlebt hatten.
Ich stapfte mit gewisser Neugierde auf den gläsernen Eingang des Bankgebäudes zu.
In den letzten Wochen und Monaten hatte ich viel über Domino erfahren, wie er lebte, wie er war. Dabei hatte ich auch eine ganze Reihe der Späher kennengelernt, die in der Burg von Naradon ein- und ausgingen. Besonders Denido, einer von Dominos besten Freunden und vor allem mittlerweile Kajas Ein und Alles. Sie waren ein schönes Paar. Die Kriegerin und der Späher. Und sie erinnerten mich sehr an mich selbst.
Domino war den Spähern so ähnlich, es konnte nicht sein, dass die Geschichte von der traurigen Königin, die mir Karas am Fluss ihrer Tränen erzählt hatte, nur ein Mythos war. Vielleicht stimmten die Legenden und einer seiner Vorfahren war einer von ihnen gewesen. Wenn ich etwas darüber erfahren würde, dann aus dem magischen Buch. Es war gerade mal zwei Monate her, dass Marco und ich es zum ersten Mal zu Gesicht bekommen hatten. In der Welt des Lichts nannten wir es das Buch der Bücher und hier eher das allwissende oder das magische Buch, in dem die Geschichten all unserer Könige geschrieben standen.
Damals hatten wir es wieder ordentlich in dem Schließfach verstaut, in dem es mein Vater schon vor meiner Geburt für mich hinterlassen hatte, damit ich es bekam, wenn ich volljährig war. Zu meiner Erbschaft zählte außerdem eine Menge Geld, das er für mich angelegt hatte. Und in dem Schließfach hatten wir sogar einen Brief gefunden, der an mich gerichtet war, sowie einige Seiten seines Tagebuchs, das er an manchen Tagen nur in dieser Welt verfasst hatte.
Als wir an meinem achtzehnten Geburtstag hier gewesen waren, hatten wir nur unsere eigene Geschichte gelesen und waren zu der Erkenntnis gekommen, dass wir von Anfang an füreinander bestimmt gewesen waren.
Der Fairness halber hatte ich bei meiner Bank auch Marco und seinem Vater eine Vollmacht für mein Schließfach erteilt. So hatten auch sie uneingeschränkten Zugang ebenso wie ich zu ihrem Buch der Fürsten.
Obwohl mich ein wenig das schlechte Gewissen plagte, weil ich schon einige Tausender von dem Nachlass meines Vaters verbraucht hatte, ging ich zielstrebig zu meinem Sachbearbeiter, der mich trotzdem nach wie vor mit überschwänglicher Freundlichkeit begrüßte.
Das Erste, was ich von dem Geld bezahlt hatte, war eine neue Couchgarnitur für Mama gewesen und ein Wäschetrockner. Auch wenn sie sich mit Händen und Füßen zu wehren versucht und gemeint hatte, die Wäsche würde viel besser riechen, wenn sie an der Luft trocknete. Bei unserem Meter-mal-Meter-Balkon, der dazu noch zur Straße hinausragte, hielt ich das allerdings für eine ganz blöde Ausrede.
Natürlich bezahlte ich auch gerade meine Fahrschule mit dem Geld, und bei meinem Talent konnte das teuer werden.
Über ein Auto dachte ich schon allein deshalb noch nicht nach, auch wenn Marco mir ständig von niedlichen, kleinen Zweisitzern vorschwärmte, die gut zu mir passen würden. Allerdings fuhr auch er jetzt während der Winterzeit nicht seinen roten Porsche, sondern einen wuchtigen schwarzen Geländewagen, bei dem einen das Gefühl nicht losließ, dass er jeden Kleinwagen einfach überrollen könnte.
Mein Sachbearbeiter brachte den Metallkasten aus meinem Schließfach in einen kleinen Raum, den ich beliebig hinter ihm abschließen konnte, was ich auch tat, sobald er die Tür hinter sich ins Schloss gezogen hatte. Ich setzte mich auf den einzigen Stuhl im Raum vor den Tisch und entledigte mich mühsam im Sitzen meiner dicken Jacke. Dann kramte ich den kleinen Schlüssel aus meiner Jeans, öffnete den Kasten und zog das Buch heraus.
Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass alle Geschichten unserer Könige von Jahrhunderten in dieses Buch passen sollten.
Und doch war es so. Die erste Geschichte handelte von einer jungen Königin namens Naliessa im achtzehnten Jahrhundert. Ihre Eltern waren beide an der Grippe gestorben, als sie sechzehn Jahre alt gewesen war. Und die wahre Geschichte war tatsächlich so, wie die Legende sie erzählte. Sie verliebte sich in einen Späher, in den Anblick seiner Augen, in alles, was ihn ausmachte. Etwa ein halbes Jahr verbrachte sie mit ihm in der Gegend, wo heute Karanot lag, ganz in der Nähe des Flusses … Nur das Ende war ein wenig anders als in der Geschichte, die Karas damals zu berichten wusste.
Ich las:
Es stand fest. Sie musste zurück nach Naradon, um den Fürsten zu heiraten, dem sie versprochen war. Den Gedanken daran ertrugen sie beide nicht. Sie liebten sich sehr, sie konnten einander nicht verlassen.
Oben am Rand der Klippen standen sie sich gegenüber, genau dort, wo unten der reißende Fluss tobte. Sein kalter Blick war rasend vor Wut, bei dem Gedanken, Naliessa zu verlieren. Dabei wollte sie nichts lieber als bei ihm bleiben. Sie wusste, sie müsste gehen, denn erst, wenn sie tot wäre, würde man aufhören, nach ihr oder nach ihm zu suchen. Sie würden ihn töten, damit Naliessa endlich ihren Platz als Königin einnahm – an der Seite eines Mannes, der ihrer würdig war.
»Wenn ich durch deinen Blick den Tod fände, wäre dies ein Ende, das ich ersehne.« Ihre Worte waren flehend. Ihrem Geliebten war gar nicht mehr klar, was ihn wütender machte. War es ihr Wunsch zu sterben? War es ihre Sorge um ihn? All seine Beherrschung war dahin. Sein eiskalter Blick traf sie. Traf sie schonungslos. Sie krümmte sich, sank erst auf die Knie, dann ging sie ganz zu Boden. In nur wenigen Sekunden war ihr Körper zu tiefstem Eis gefroren. Und doch hatte sie ihm in die Augen gesehen, bis zuletzt. Nicht erschrocken, nicht so, wie wenn jemand kurz davor ist zu sterben. Nicht mit weit aufgerissenen Augen, angstverzerrtem Gesicht. Nein, sie sah dankbar aus. Voller Liebe zu ihm. Wie viele waren durch seinen Blick schon gestorben? Und nun sie. Sein Leben.
Sie lag im Gras, so friedlich. So schön. Auch wenn er ihren Anblick kaum ertrug, wusste er, er hatte das einzig Richtige getan. Er hatte sie erlöst, und nun wollte er nur noch eines. Selbst Erlösung finden.
Doch sie war nicht tot. Es war, wie wenn eine Narkose langsam wirkte. Wenn man noch hören konnte und fühlen, aber nichts mehr bewegen.
Kalte Tränen berührten ihr Gesicht, als sie da lag. »Wir werden zusammen sein auf ewig, Liebste, süße Naliessa. Im Jenseits werden unsere Seelen niemals getrennt sein. Deine Schönheit, deinen makellosen Körper, das Jadegrün deiner Augen, all das präge ich mir ein, damit ich es nicht vergesse.«
Sie wollte sagen, dass sie lebte, wollte es hinausschreien: Ich bin nicht tot. Ich sehe dich und ich höre dir zu, Liebster. Aber ihre Augen starrten wie die einer Toten geradeaus.
Wie vielen Leichen hatte er schon ins Gesicht gesehen, in das vom Eis erstarrte Entsetzen ihrer Augen, bevor er mit einer einzigen, leichten Bewegung seiner Hand ihre Körper in Tausende Splitter zerspringen ließ? Doch in Naliessas Augen war kein Entsetzen, kein Schmerz. Nur diese unendliche Dankbarkeit.
Ein sanfter Kuss strich über ihre kalten Lippen. Dann hörte sie, wie er zum Rande der Klippen ging. Sie wollte schreien, sie wollte sich winden, aufspringen, wenigstens eine Hand bewegen. Aber es ging nicht.
Ihr Herz war gefroren, und doch zog es sich schmerzhaft zusammen, als sie mit anhören musste, wie die Luft ihn umschloss und mit willigem Zischen in die Tiefe gleiten ließ. Die Wucht des Aufpralls auf einem der Felsen verdrängte mit einem merkwürdig würgenden Laut den letzten Atem aus seiner Lunge. Sie hörte das entsetzliche Krachen der Knochen, das peitschende Wasser an den Klippen und wie sein Körper die Oberfläche durchbrach, als würde sich eine Hand auftun und ihn mit gewaltiger Macht umschließen. Die reißende Strömung trug ihren Geliebten davon, bis nur noch die tosenden Wellen zu hören waren, endlos, gleichmütig … als hätten sie niemandem etwas getan.
Es dauerte lange, bis das Eis in ihrem Körper nachließ, bis sie sich bewegen und mühsam an den Abgrund kriechen konnte. Nun war sie in der Lage, ihm zu folgen. Endlich. Doch als sie in die Tiefe blickte, hielt sie irgendetwas zurück. Plötzlich wusste sie, dass sie nicht alles von ihm zerstören durfte, dass ein Teil von ihm weiterleben musste. Sie durfte nicht sterben, auch wenn so vieles in ihr bereits gestorben war. Das Leben, das Lachen, das alles hatte er mit sich in den Fluss genommen.
Den Fluss, den man heute Den Fluss ihrer Tränen nannte. Eisige Schauder liefen mir über den Rücken. Fast so, wie damals, als ich zum ersten Mal von der Geschichte gehört hatte, von denen die meisten glaubten, sie sei nur eine Legende.
In Solest kehrte Naliessa zurück nach Naradon. Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr heiratete sie den Fürsten, den sie nicht liebte.
Der Grund, weshalb sie sich nicht selbst getötet hatte, war, dass sie bereits geahnt hatte, das Kind ihres Geliebten unter dem Herzen zu tragen. Auch wenn ihre Liebe verloren war, so wünschte sie sich nichts sehnlicher, als sein Kind in den Armen zu halten. Den Teil von ihm, der ihr immer bleiben würde.
In der Welt der Unwissenden wurde sie Lehrerin, der es streng untersagt war zu heiraten. Natürlich kannte sie ihren Ehemann aus Solest auch hier, dafür hatten ihre Eltern früh gesorgt. Und auch hier bekam sie einen Sohn.
Ich fragte mich ernsthaft, ob sie den Späher auch in dieser Welt gekannt hatte, doch leider fand ich nichts darüber. Hier stand nur geschrieben, dass sie sein Kind vor dem Fürsten geheim hielt und floh, um es in einem Kloster zu gebären. So oft sie konnte, besuchte sie den Kleinen.
In Solest litt der neue König darunter, dass seine Frau ihn nicht liebte. Er versuchte dennoch alles, um sie glücklich zu machen. Erst als ihr Sohn vier Jahre alt war, erkannte er, dass es nicht sein eigenes Kind war. Der Junge hatte Kräfte in seinen blauen Augen, die zerstörerischer nicht sein konnten. Nun war der König gekränkter denn je. Sein ganzes Leben war ein Betrug. Und so brachte er den vermeintlichen Sohn zu einem See, um ihn zu ertränken. Das Kind aber vereiste das Wasser zu einer Eisscholle, auf die es sich rettete, bis seine Mutter zur Hilfe kam. Ihr Gemahl hätte ohnehin keine Chance gegen ihre königlichen Kräfte gehabt. Doch anders als in Karas’ Erzählung tötete sie ihn dort nicht mit einem Schwerthieb. Stattdessen ritt sie mit ihm zu den leuchtenden Mauern Solests, so nahe, dass nur sie es gerade überleben konnte, aber doch so weit, dass der König von ihrem Licht erfasst wurde und auf immer und ewig verschwand.
Es stimmte also. Die Kräfte des Spähers mussten sich von Generation zu Generation weitervererbt haben. Und bei Domino war sogar die Kraft des Vereisens wieder durchgeschlagen.
Allerdings galten die Späher als grausam und gewissenlos, und beim Lesen von Naliessas Geschichte war ich mehr als einmal erschaudert. Dabei wusste ich es inzwischen besser. Sie waren nur weitaus unempfindlicher, was körperliche Schmerzen anbelangte. Alle anderen Gefühle erlebten sie genauso intensiv wie wir. In manchen Situationen wahrscheinlich noch intensiver. Und sie wurden von den Menschen nicht akzeptiert – wegen ihrer Andersartigkeit. Ihre Gabe, aus der Entfernung von mehreren hundert Metern eine Maus erkennen zu können, und vor allem die Fähigkeit, mit ihren Augen Gegenstände einzufrieren, machte den Leuten Angst. Doch die Zeiten, in denen sie gewissenlos umhergestreift waren, geplündert und gemordet hatten, waren längst Geschichte.
Zu denen, die ihre zerstörerische Kraft mit ängstlichem Argwohn betrachteten, hatte ich mich anfangs auch gezählt. Aber ich war inzwischen sicher, sie hatten sich sehr gut unter Kontrolle. Trotzdem kam es ab und an vor, dass sich Späher aus der Wut oder irgendeinem anderen starken Gefühl heraus vergaßen. So wie Domino, als er gespürt hatte, wie eifersüchtig er geworden war, weil ich auf meine Vertrauten nichts hatte kommen lassen. Vor allem Madras war für ihn ein rotes Tuch. Aber auch Karas, weil er unsere Verbindung nicht guthieß.
Da ich schon mal hier war, blätterte ich die Seiten weiter bis zu meiner eigenen Geschichte. Bei einigen Zeilen schmunzelte ich, bei anderen rang ich wieder mit den Tränen. Den Tränen, die längst vergossen waren. Noch immer endete das Buch an der Stelle, als Domino und ich als Sieger aus der Höhle des dunklen Zauberers gekommen waren und uns vor allen anderen geküsst hatten. Ich lächelte verträumt bei dem Gedanken daran.
Am liebsten hätte ich den Stift aus dem Metallkasten genommen und weitergeschrieben. Denn unsere Geschichte war seit jenem Moment so unendlich perfekt, dass es schade war, sie hier nicht noch einmal nachlesen zu können. Ich schlug das Buch zu und lehnte mich im Stuhl zurück. Vor meinem inneren Auge tanzten die ersten Schneeflocken durch die Luft. Ich dachte an die Reise nach Naradon und wie freundlich wir empfangen worden waren. Und am Tag nach unserer Ankunft hatte Domino mir endlich seinen Lieblingsplatz zeigen können. Einen See, der zugefroren in allen Farben des Regenbogens leuchtete. Er war genauso schön gewesen, wie ich ihn zuvor in meiner Vision gesehen hatte.
Noch immer waren wir in Naradon und ich wünschte mir, dieser Winter möge niemals enden.
Allerdings traute Karas noch immer keinem von ihnen und schwieg, weil er wusste, dass Domino zuhören konnte. Madras schien das egal zu sein. Wann immer er konnte, bombardierte er mich mit zweideutigen Bemerkungen und Sticheleien. Durch die Blume ließ er erkennen, wie wenig er mich verstand, und zog mich regelrecht damit auf, dass ich trotz der engen Beziehung zu Domino noch keinen offiziellen Heiratsantrag bekommen hatte. Ich fragte mich, wann er endlich die Hoffnung aufgab, mich für sich zu gewinnen.
Aber ich war nach wie vor gut darin, das alles zu ignorieren.
Anfang vom Ende
Anna
Ich wollte das Buch schon zuklappen, ließ dabei aber die folgenden noch unbeschriebenen Blätter bedächtig über meinen Daumen gleiten. Erst war ich nicht sicher, doch dann entdeckte ich, dass zwischen den leeren Seiten noch eine einzige bedruckt war. Nur ein paar Zeilen standen hier geschrieben:
Es war Samstag. Die Sonne schien und streckte ihre Strahlen direkt durchs Fenster in Annas Gesicht. Sie erwachte davon.
Wochenende! Es war erst kurz nach acht. Wie immer war sie viel zu früh aufgewacht, obwohl sie erst um drei Uhr nachts nach Hause gekommen war.
Sie stand auf, kochte sich zunächst einen sehr starken Kaffee und nahm die Tasse dann mit ins Bad.
Gerade als sie sich nach einer ausgiebigen Dusche abtrocknen wollte, hörte sie den Klingelton ihres Handys. Wer konnte das sein um diese Zeit? Grübelnd wickelte sie sich notdürftig in den Stoff und verließ den Raum.
Zu spät.
Ohne nachzusehen, wer angerufen hatte, ging sie zurück ins Bad. Falls es wichtig gewesen war, würde derjenige sich noch einmal melden oder vielleicht einfach eine Nachricht schreiben.
… mehr nicht. Eine ganz normale Alltagsszene. Was sollte daran wichtig sein?
Ich las die Zeilen mehrmals. Es hörte sich nicht danach an, dass ich zu Hause wach geworden war, zumindest nicht bei Mama. Samstags schon gar nicht. An jedem Wochenende war ich bei Marco. Was sollte sich daran wohl ändern?
Okay. Das Buch berichtete also von einem Samstag bei Marco. Wobei … dort brachte Ingrid den Kaffee, nachdem ich ihn telefonisch bestellt hatte. Hm. Vielleicht würden wir irgendwann eine Kaffeemaschine anschaffen. Warum eigentlich nicht? Oder … vielleicht würden wir sogar eine gemeinsame Wohnung haben. Schöner Gedanke.
Aber … warum zum Teufel stand das da? Weshalb so weit nach dem Ende unserer Geschichte? Sollte das heißen, unsere Geschichte war noch nicht zu Ende? Der Schatten war besiegt! Was sollte noch Wichtiges passieren, wofür es sich lohnte, im Buch der Bücher zu erscheinen?
Eines stand fest. Diesen Samstagmorgen, den das Buch beschrieb, würde es irgendwann in meinem Leben geben. Fragte sich bloß, wo Marco dann sein würde.
Wütend schlug ich das Buch zu und verstaute es hektisch wieder in dem Metallkasten. Auf einmal hasste ich mich dafür, es überhaupt aufgeschlagen zu haben. Es gab keinen Grund, darüber nachzudenken, was mich noch Übles erwarten könnte. Wir hatten es geschafft! Alles war gut. Wir wären fast gestorben dafür! Es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Das redete ich mir wenigstens ein.
Kurzerhand beschloss ich Marco gar nicht erst zu erzählen, dass ich hier gewesen war. Ohnehin war er viel misstrauischer als ich. Er war so überaus vernünftig, dachte immer schon an die Zukunft, wenn ich noch den Tag auf mich zukommen ließ. Er war der, der stets an Morgen dachte, während für mich nur das Jetzt zählte. Und im Moment war er sorglos und glücklich so wie ich.
Ich verschloss den Kasten, stand auf und drückte den Knopf, womit ich den Anzugträger rief, der ihn wieder fortbringen würde. Den Stuhl rückte ich sorgfältig unter den Tisch und nahm meine Jacke von der Lehne. Ungeduldig ging ich in dem kleinen, schmalen Raum auf und ab und kuschelte mich in meine Jacke – vorsorglich für die Kälte da draußen. Die Tür schloss ich erst auf, als es klopfte, den Kasten hatte ich dabei schon unterm Arm und drückte ihn dem Mann gleich darauf in die Hände.
»Ganz schön schwer.« Offenbar wollte er Witze machen, doch mir war gerade nicht danach und so erwiderte ich nichts darauf.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte er prompt und klang auch noch besorgt dabei.
Schnell legte ich ein freundliches Lächeln auf. »Ja, aber natürlich«, antwortete ich. »Ich darf nur bei der Kälte gar nicht an den Heimweg denken.« Was Besseres fiel mir nicht ein, meine beinahe beleidigte Miene zu rechtfertigen.
»Soll ich Ihnen ein Taxi rufen?«
»Nein. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Trotzdem danke.«
Er begleitete mich noch ein Stück, und ich versuchte das Lächeln nicht zu vergessen.
»Also, dann, bis bald«, verabschiedete er sich endlich.
»Auf Wiedersehen«, sagte ich höflich. Ich hatte nicht vor bald wiederzukommen. Dann schritt ich durch die gläserne Drehtür nach draußen. Ich atmete die kalte Luft tief ein und machte mich auf den Weg zum nahe gelegenen Busbahnhof. Die Nummer 47 hielt gerade an. Mit gezückter Fahrkarte stieg ich ein und setzte mich ans Fenster.
Das laute Treiben um mich herum verstummte in mir. Längst war mir klar, dass meine heutige Entdeckung schwer zu verdrängen war. Einerseits hatte sie sich schon an meiner Neugierde zu schaffen gemacht, andererseits an der Angst davor, mein Leben könnte sich ein weiteres Mal ändern, egal in welche Richtung. Alles war perfekt, so, wie es jetzt war. Nichts wollte ich daran ändern.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich fast vergaß, den Knopf zu drücken, damit der Bus an der nächsten Haltestelle hielt. Erst als die Durchsage »Schümannstraße« kam, schrak ich hoch und stolperte beinahe über die Frau, die neben mir saß. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass sie sich dort hingesetzt hatte.
Als ich vor Kälte schnatternd in unsere Straße einbog, erkannte ich schon von Weitem den fetten Geländewagen vor dem Haus. Wie es aussah, wartete Marco bereits auf mich. Heute war Freitag, er war da, um mich abzuholen. Ich ging einen Schritt schneller und … lächelte. Die irrsinnige Vorfreude auf das Wochenende war immer noch dieselbe wie schon vor Monaten.
Mama erlaubte es nicht, dass ich die ganze Woche bei Marco blieb. Schon seit Langem plagte sie oft genug der Eindruck, ich würde bald ganz zu Marco ziehen. Und auch wenn ich im Januar achtzehn geworden war, beließ ich es bei dieser Regelung – aus Rücksicht auf sie.
Auf dem Weg durchs Treppenhaus nach oben entledigte ich mich schon mal meiner dicken Jacke. Sie würde nur stören, wenn ich mich in Marcos Arme warf. Zitternd vor Kälte, vielleicht auch vor Ungeduld, schloss ich die Wohnungstür auf und stürmte hinein. Die Jacke warf ich in die Ecke unter der Garderobe und lauschte, aus welcher Richtung die geliebte Samtstimme kam.
Mama und Marco saßen sich beim Kaffee an unserem kleinen Küchentisch gegenüber. Hier passten sowieso nur zwei Stühle hin, mir blieb also gar nichts anderes übrig, als mich auf seinen Schoß zu setzen.
Seine Augen strahlten, als ich den Raum betrat. »Wie war die Fahrstunde?«, fragte er.
»Ganz gut«, log ich munter, gab meiner Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Wange, ohne Marco aus den Augen zu lassen.
Einladend rückte er seinen Stuhl zurück und breitete die Arme nach mir aus. Schnell ließ ich mich auf seinem Schoß nieder und fiel ihm um den Hals. Ganz zärtlich küsste er mich.
Es störte mich schon längst nicht mehr, dass Mama dabei im selben Raum war, und sie hatte damit ebenso wenig ein Problem. Hier in dieser Welt war es so leicht für uns. Alle waren einverstanden mit dem, was wir füreinander empfanden. Meine Mutter war froh, dass ich endlich begann zu leben, mich zu freuen, wenn es auch nur die Freude auf das heiß ersehnte Wochenende war. Sie sagte, ich sei so erwachsen geworden in letzter Zeit. Von meinen nächtlichen Abenteuern ahnte sie nichts und so schob sie es allein darauf, dass ich Marco kennengelernt hatte.
»Du warst ganz schön lange unterwegs«, meinte Mama und trank ihren Kaffee. Klar, dass ihr das auffiel. Diese Kleinigkeiten in meinem Leben entgingen ihr nie.
»Der Lienkämper hat mich in der Stadt rausgelassen. Ich musste noch mit dem Bus nach Hause fahren«, rechtfertigte ich mich.
»Willst du auch einen Kaffee?«, fragte sie, ohne weiter darauf einzugehen.
»Nö.« Ich stand auf und nahm mir ein Glas Wasser. Dann setzte ich mich schnell wieder auf Marcos Knie. Seine Hand strich über meinen Rücken. »Was machen wir bei dem Mistwetter?«, fragte ich ihn.
»Wie wär’s mit Schlittenfahren«, kam Mama ihm grinsend zuvor.
Draußen vor dem Fenster tobte ein Schneesturm und ich zog die Nase kraus. »Ganz sicher nicht«, entgegnete ich.
»Ich hatte eigentlich nichts Bestimmtes vor«, meinte Marco. »Wenn du aber eine Idee hast, immer raus damit.«
»Nein«, sagte ich und lächelte ihn an. Der Gedanke daran einfach nur allein mit ihm zu Hause zu bleiben, war aufregender als alles, was ich mir vorstellen konnte. Zudem waren seine Eltern verreist. Ein Wellnessurlaub in Südtirol. Seit seinem Herzinfarkt ließ Karl Sander es ruhiger angehen, verreiste lieber mit seiner Frau, als sich zu allerlei Anlässen in der ganzen Welt einladen zu lassen, um seine Firmen zu repräsentieren.
Marco hatte noch nichts Richtiges im Auge, was seine berufliche Zukunft anging. Bisher belegte er nur einen Fernkurs nach dem anderen. Spanisch, Französisch, und im Moment versuchte er sich in Chinesisch. In China liege die wirtschaftliche Zukunft, meinte er.
Meinetwegen, dachte ich. Schließlich hatte ich noch ein Jahr Zeit bis zum Abitur. Was danach kam, würden wir dann sehen.
Ich wartete noch, bis er den letzten Schluck Kaffee ausgetrunken hatte, dann stand ich auf.
»Wollen wir?« Meine Tasche fürs Wochenende hatte ich schon am Morgen gepackt, sie wartete im Flur auf mich.
»Los, Marco«, spornte Mama ihn an. »Anna kann es nicht erwarten …« Dann räusperte sie sich und machte den Eindruck, als wollte sie noch etwas sagen, was sich nicht gehörte.
»Mama!«, rief ich entrüstet und sie grinste, womit sie ihre schmutzigen Gedanken bestätigte. Ich hatte also recht gehabt. Okay, sie hatte recht gehabt. Ich konnte es nicht erwarten, endlich mit Marco allein zu sein.
***
»Hast du denn Lust, morgen ins Flickflack zu gehen?«, fragte er während der Fahrt.
»Hast du Lust?«, stellte ich die Gegenfrage.
»Warum nicht. Sven hat mich angerufen, er und Luisa werden ebenfalls da sein.«
»Stimmt, Luisa hat mich auch gefragt.«
»Also?«
»Weiß nicht.«
»Ich finde, du solltest deine beste Freundin nicht nur wegen mir vernachlässigen.«
»Nur wegen dir. Das tu ich doch gar nicht«, entgegnete ich trotzig.
»Also … gehen wir nicht.«
»Doch! Doch lass uns hingehen.«
»Aber du willst doch gar nicht.«
»Wer sagt das denn?«, kam es nun richtig trotzig von mir.
Er lachte leise und spöttisch. »Also willst du doch«, setzte er noch oben drauf.
»Ja, sag ich doch die ganze Zeit.«
»Schön.«
»Schön.«
Er verlor nie die Beherrschung … oder zumindest so gut wie nie. Mich auf die Palme zu bringen war dagegen so einfach. Auch wenn es nur um so eine unbedeutende Frage ging …
Eingeschnappt starrte ich aus dem Fenster. Wir bogen schon in die Auffahrt des Gutshauses. Dabei legte er seine Hand in meine. »Ich liebe dich«, sagte er und ich spürte, dass er mich kurz musterte.
»Lieb dich auch«, gab ich etwas unterkühlt zurück, ohne ihn dabei anzusehen.
Er parkte den Wagen direkt in der riesigen Garage und beugte sich zu mir rüber, um meine Tür zu öffnen. Ich beachtete ihn immer noch nicht und war auch fest entschlossen noch ein bisschen zu schmollen, doch er zog mein Kinn sanft in seine Richtung und ich wusste, wenn ich ihn ansah, würde nichts daraus.
Und richtig. Die ganze Kraft seiner viel zu hellen Türkisaugen strahlte mit voller Wucht auf mich ein. Sein Gesicht war genau vor meinem, ich konnte seinen Atem spüren und er roch so gut.
Auf einmal fiel mir das Buch ein und welche Fragen es in mir aufgewühlt hatte. Schlagartig wollte ich nicht mehr beleidigt sein, erst recht nicht wegen so einer Lappalie. Wer wusste schon, was uns noch erwartete?
»Tut mir leid«, flüsterte ich.
»Nein, mir tut es leid.« Seine Lippen schmiegten sich unwiderstehlich an meine.
Ich schlang die Arme um ihn, und anstatt den Kuss so heftig zu erwidern, wie es in solchen Momenten meine Art war, hielt ich ihn nur ganz fest und legte meinen Kopf über seine Schulter. Ich wollte ihn nicht verlieren und ich hatte auf einmal wieder furchtbar Angst davor. »Habe ich dir heute schon gesagt, wie sehr ich dich liebe?«, flüsterte ich.
»Heute noch nicht direkt, dafür aber in der letzten Nacht.«
Ich lächelte und erinnerte mich. Mitten in einem leidenschaftlichen Kuss war ich wach geworden.
Wir stiegen aus dem Auto und rannten das letzte Stück bis zum Gutshaus. Der Schneesturm fegte dicke Flocken durch die Luft und legte sie zum Schmelzen auf unser Haar.
***
In Marcos Wohnung angekommen ging ich ins Bad und ein Blick in den Spiegel verriet mir, dass ich aussah wie eine nasse Katze. Meine langen rotbraunen Haare, die leider weder ganz glatt noch ganz lockig waren, hingen tropfend und zerzaust hinunter. Beim Betrachten meines Gesichtes war ich heilfroh nicht geschminkt zu sein, den Kajal hätte ich jetzt sonst sicher überall. Das Schönste an mir waren, wie ich fand, die großen dunkelgrünen Augen in einem leider viel zu blassen Gesicht.
Marco hingegen sah wieder aus wie ein Model. Er stand hinter mir in den Türrahmen gelehnt, sein perfekt gestylter dunkler Wuschelkopf war ebenso völlig nass, was allerdings ganz und gar nichts an der Tatsache änderte, dass er immer noch atemberaubend schön war. Er blickte mich an, als wäre ich das Schönste, was er je gesehen hatte.
»Ich bestelle uns etwas zum Abendessen«, meinte er und ging ans Telefon.
»Hallo, Ingrid … Ja, stimmt, furchtbares Wetter«, hörte ich ihn reden, während ich meine Haare mit einem Handtuch trocknete. »Ja, genau, Abendessen für Anna und mich. Etwa in einer Stunde … Gut, bringen Sie es bitte zum Pool. Danke!«
»Super Idee!«, rief ich ihm zu.
Im Dachgeschoss des Gutshauses gab es einen Swimmingpool. Das gläserne Dach darüber konnte im Sommer weit geöffnet werden. Aber auch jetzt im Winter kam man sich vor wie unter freiem Himmel.
Ich ging ins Schlafzimmer und zog meinen Bikini aus einer Schublade im Kleiderschrank. Marco kam mit schnellen Schritten hinter mir her und schnappte ihn mir aus der Hand. »Glaubst du, den brauchst du?«, grinste er und hielt ihn hoch.
»Sicher brauche ich den«, gab ich zurück und versuchte dranzukommen. Ohne Erfolg, er streckte den Arm nach oben aus und ich war viel zu klein, meine Mühe vergebens.
»Es ist niemand im Haus. Du brauchst ihn nicht.«
»Und was ist mit dem Personal?«, entgegnete ich.
»Es wird eine Weile dauern, bis Ingrid hier ist. Außerdem ist sie sehr diskret.«
»Du willst doch nicht wirklich nackt baden?«, tat ich scheinheilig.
»Doch«, nickte er. »Und eigentlich wollte ich …« Er warf meinen Bikini in die Ecke, packte mich und warf mich aufs Bett.
»Herr Sander!«, rief ich empört. »Sie werden doch wohl nicht handgreiflich werden?«
Und er legte das schiefe, verschmitzte Lächeln auf, von dem ich nicht genug kriegte. Dann beugte er sich über mich und öffnete die Knöpfe meiner Jeans. Ganz sanft streifte er sie herunter, mit den Handflächen an meiner Haut. Dann schob er meinen dicken Strickpulli und das T-Shirt, das ich noch darunter trug, etwas hoch und küsste zärtlich meinen Bauch und die Senke neben den Hüftknochen. Ich richtete mich auf und zog den Rest freiwillig aus. Dann begann ich damit, ihn seiner Klamotten zu entledigen und zu küssen, wo ich seine goldschimmernde Haut freilegte. Meine Hände glitten über seinen makellosen Körper. Nie würde ich genug davon bekommen können, ihn zu berühren, seine geschmeidigen Bewegungen anzusehen und zu fühlen.
Seine weichen Lippen streichelten mich. Das Blut schoss durch meine Adern und mein Atem überschlug sich fast. Der Boden schien sich wieder zu drehen, mein Kopf schwirrte und ich gierte nach mehr.
Doch er stand auf, hob mich mit Leichtigkeit auf seine Arme und trug mich aus dem Zimmer.
»Was machst du denn?«, protestierte ich, aber er lächelte mich nur schief an, öffnete mit mir auf den Armen die Tür und trug mich die Treppen hinauf bis ins Dachgeschoss zum Pool …
»Das wagst du nicht!«, rief ich noch und dann … warf er mich hinein.
Das Wasser war warm wie in einer Badewanne. Na warte, dachte ich. Wasser war mein Element und dazu noch war ich ziemlich gut durchtrainiert, wodurch es mir ohne Weiteres gelingen würde, für einige Minuten die Luft anzuhalten. Bewegungslos ließ ich mich zu Boden sinken. Um es ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen, ließ ich ein wenig Atem entweichen, damit oben ein paar hübsche Luftblasen an die Oberfläche dringen konnten. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war Marco bei mir, zog mich hektisch nach oben und drehte mich dabei zu sich um.
Ich grinste ihn schalkhaft an und half ihm dabei aufzutauchen. Sein Gesicht verriet mir jetzt schon, dass er das alles andere als komisch fand. An der Oberfläche japste ich nach Luft und lachte laut. Doch er packte mich ziemlich unsanft bei den Schultern.
»Mach das nie wieder!«, fuhr er mich wütend an und seine Augen blitzten mir eiskalt entgegen.
»Hast du dich erschrocken?«, fragte ich spöttisch.
Er funkelte mich weiter zornig an, wandte sich ab und zog sich aus dem Wasser. Mit einem Zug schwamm ich zum Rand, stützte mich daran ab und legte den Kopf seitlich auf meinen Oberarm. Ich beobachtete ihn, wie er einen Bademantel vom Haken riss, ihn überzog und aus der Tür verschwand. Er war stinksauer, eindeutig. Und diesmal war er es, der die Beherrschung verlor. Einerseits betrachtete ich das momentan wie einen kleinen Sieg, andererseits tat es mir wahnsinnig leid, weil ich wusste, wenn er so reagierte, war er tief verletzt.
Schnell stieg ich ebenfalls aus dem Wasser, schnappte im Vorbeigehen ein Badelaken und band es mir auf dem Weg nach unten um. Vorsichtig öffnete ich die Tür zu seiner Wohnung, trat langsam ein und schloss sie auch ebenso leise wieder. Einer der wuchtigen Esszimmerstühle lag mitten im Raum auf der Seite. Ich ging ein Stück weiter und blickte durch die offene Tür zum Schlafzimmer. Marco stand am Fenster und starrte hinaus.
»Es tut mir leid«, sagte ich leise und reuevoll, schon als ich auf ihn zuging. »Ehrlich.«
»Mach das nie wieder«, knurrte er erneut und mit immer noch tiefer, wütender Stimme, ohne sich umzudrehen.
Ich ging näher heran und legte die Arme um ihn.
Abrupt ergriff er meine Handgelenke, wandte sich mit unbeschreiblich schneller, geschmeidiger Bewegung zu mir um und beförderte mich aufs Bett. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von meinem entfernt, wie versteinert, wütend, und seine Augen funkelten eiskalt … und atemberaubend schön. Mir stockte der Atem, und ja, ich hatte Angst. Nicht die Angst dieser Welt. Doch ich wusste, wären wir nun in Solest, könnte ich schon tot sein. Erst in den letzten Monaten war ich mir dieser Tatsache bewusst geworden. Erst seit ich ihn, seit ich die Späher besser kannte.
Auf einmal veränderte sich sein Gesicht. Sein Kopf sank neben meinem ins Kissen, seine Hände lockerten den Griff an meinen Handgelenken.
»Anna, ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas zustieße. Verstehst du das?« Er klang nur noch verletzt, nicht mehr wütend. Dennoch wagte ich es nicht, mich zu bewegen.
»Ja«, flüsterte ich, immer noch mit stockendem Atem.
»Ich liebe dich mehr als alles andere«, sagte er. Und als er sein Gesicht jetzt wieder über meines hob, war da kein Zorn mehr, da war Schmerz. Seine Augen waren tief und warm und sie durchdrangen mich, als wollten sie meine Seele berühren.
Ich überwand die wenigen Zentimeter, die meinen Mund von seinem trennten, und küsste ihn, ohne die Augen zu schließen. Endlich gab er meine Handgelenke frei. Endlich konnte ich ihn berühren, schlang einen Arm um ihn, mit der anderen Hand griff ich in seine Haare. Langsam schloss ich die Augen, küsste ihn wieder leidenschaftlicher. Genau in diesem Moment löste er seine Lippen sanft von meinen und ließ sich neben mir auf den Rücken fallen. »Es tut mir leid, Anna«, seufzte er leise.
Ich zog einen Flunsch und starrte die stuckverzierte Decke über mir an. »Mir tut es leid«, erwiderte ich dann.
»Das sagtest du schon.«
Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie er die Hände auf sein Gesicht legte.
Ich drehte mich auf die Seite, wagte es aber nicht, ihn anzufassen. »Es tut mir wirklich leid«, versuchte ich es noch einmal. »Es war nicht fair, so zu tun, als ob …« Ich wagte es nicht auszusprechen, was ihn ohnehin schon so in Rage gebracht hatte.
Aufgebracht schüttelte er den Kopf. Dann sah er mich wieder an. »Nein, nein, du verstehst nicht«, rang er um Worte. Er atmete tief durch, blickte wieder nach oben und redete ganz ruhig weiter: »Ich habe gesehen … Ich sah die Angst in deinem Gesicht. Du hattest Angst vor mir. Ich hätte nicht so reagieren dürfen.«
»Du hattest allen Grund dazu. Wenn du das mit mir gemacht hättest, dann …«
Als er mich ansah mit seinen Wunderaugen und dazu noch lächelte, verschlug es mir ganz einfach die Sprache.
»Du wärst wutentbrannt auf mich losgegangen«, meinte er.
»Genau.«
»Und wenn schon. Was könntest du mir schon tun?«
»Du könntest mir auch nichts tun«, entgegnete ich leise.
»Nicht in dieser Welt.«
»So leicht bin ich nicht …«
»Nein. Stimmt ja«, unterbrach er mich spöttisch. »Niemand kann eine Königin töten. Außer einem König wie mir. Welch ein Hohn.«
Mir fiel ein, was Königin Naliessa zu ihrem Geliebten gesagt hatte. »Wenn ich durch deinen Blick den Tod fände, wäre dies ein Ende, das ich ersehne«, zitierte ich ganz spontan.
Sein Gesicht schoss zu mir herum. »Wo hast du das her?«
»Das sagte die …«
»Ich weiß, wer das sagte. Sie war meine Ur-Ur-Ur-Großmutter, oder so was. Wo hast du es her?«
»Die Legende erzählt das.«
»Mit genau diesen Worten?«, fragte er ungläubig.
»Ich habe es aus dem Buch der Bücher«, gestand ich. Mehr müsste ich ja nicht erzählen.
»Du warst noch mal da?«
»Ich wollte wissen, ob die Geschichte stimmt.«
»Du hättest mich fragen können, ich weiß, dass sie stimmt.«
Darauf erwiderte ich nichts weiter. Er wusste gar nicht, wie sehr ich mir inzwischen wünschte, seinem Rat gefolgt zu sein.
»Trotzdem«, meinte er dann und stützte den Kopf auf seine Hand, mit der anderen strich er mir zärtlich die nassen Haare über die Schulter zurück. »Versprich mir, dass du dir niemals mehr meinetwegen den Tod wünschst. Du hast einmal dein Leben aufs Spiel gesetzt, zweimal, wenn man es genau nimmt. Versprich mir, dass das nie wieder passiert.«
Einen Moment lang sah ich ihn nur an und obwohl seine Augen mir den Verstand zu rauben drohten, antwortete ich ehrlich und aufrichtig. »Das kann ich nicht.«
Es klopfte an der Tür.
»Was gibt’s?«, rief er.
»Ich habe das Essen serviert!«, erklang Ingrids Stimme vom Flur.
»Danke, Ingrid. Sie können gehen!« Er ließ mich nicht aus den Augen. »Komm, lass uns raufgehen«, bestimmte er.
Bevor ich ihm folgte, schnappte ich mir meinen Bikini und zog ihn an.
Oben angekommen betrachtete ich den hübsch gedeckten Tisch. Es gab nichts, das kalt werden konnte.
»Ich schwimme erst ein paar Runden«, sagte ich und sprang kopfüber ins Wasser, tauchte bis zum anderen Ende, stieß mich noch mal ab, tauchte zurück bis zur Mitte, wo Marco inzwischen stand. Ganz dicht vor ihm ließ ich mich an die Oberfläche gleiten. Ich spürte, wie seine Hände sanft und doch fest über meinen Körper strichen, wobei ich gar nicht bemerkt hatte, dass ich mein Bikinioberteil im Nu wieder losgeworden war. Erst als seine Hände meine Brüste berührten, war mir klar, was jetzt folgte. Und obwohl ich mich so sehr bemühte nicht wieder die Beherrschung zu verlieren, sondern mich zu ergeben, so, wie er es liebte, war ich bald wieder in einem Rausch, in den ich ihn mit hineinzog, als gäbe es nur noch dieses eine Mal.
***
Lunaja
Wir waren erst spät eingeschlafen und begannen den Tag in Solest so vertraut, wie wir ihn in der Welt der Unwissenden beendet hatten.
Im Moment ließ er mich vergessen. Ich dachte nicht mehr darüber nach, wie die sinnlosen Zeilen im Buch der Bücher mich zum Grübeln gebracht hatten. Auch nicht an Marcos Überreaktion wegen meines dummen, misslungenen Versuchs, ihn reinzulegen. Und ich dachte auch nicht daran, wie merkwürdig schnell er es darauf hatte beruhen lassen, als ich seinen Wunsch abgelehnt hatte, ihm mein Versprechen zu geben.
Erst als die Sonnenstrahlen warm durchs Fenster auf uns herabschienen, begann ich wieder damit, die Realität wahrzunehmen.
Hier in Solest war das Wetter von Tag zu Tag besser geworden. Der viele Schnee verabschiedete sich unaufhaltsam in Form von kleinen Rinnsalen hinab in die Täler, wo sie in reißenden Fluten durchs Land tobten. Meiner Rückkehr nach Kariada stand nichts mehr im Weg. Auch wenn ich nicht allein, nicht ohne Domino gehen müsste, so hatte ich es doch längst beschlossen. Es stand immer noch ein offenes Gespräch mit Karas aus, das sicher nie erfolgen würde, solange Domino in der Nähe war. Außerdem wussten in Kariada weder Esra etwas von Domino und mir noch der Hofrat, dessen Vertrauen ich ohnehin schon überstrapaziert hatte.
»Ich lasse dich nur ungern ziehen«, lächelte Domino, und im ersten Moment dachte ich, er könne meine Gedanken lesen. »Aber es ist Zeit, nach unten zu gehen. Man erwartet uns sicher schon.«
Ich seufzte erleichtert. An Abschied mochte ich nicht denken, so vorübergehend er auch diesmal sein würde.
»Du hast recht«, bestätigte ich und setzte mich auf. »Was machen wir nach dem Essen?«
»Fragst du der Höflichkeit halber?«, schmunzelte er.
»Nein. Wieso?«, entgegnete ich scheinheilig.
»Gut. Dann schlage ich vor, du ziehst deine verflucht enge Lederhose an und wir üben im Hof Schwertkampf.«
»Das ist eine wunderbare Idee«, gab ich grinsend zurück.
Schon seit Wochen machten wir das. Ich liebte es, mich im Kampf zu üben. Und er tat mir den Gefallen, Tag für Tag.
Zu Hause in Kariada war Karas mein Lehrer gewesen. Aber erstens war er ja im Moment nicht sonderlich gut auf mich zu sprechen und zweitens waren meine königlichen Kräfte für ihn zu heftig geworden.
Bevor ich durch die Tür verschwand, gab ich Domino einen Luftkuss. Schnell schritt ich die wenigen Meter bis zu unserem geheimen Durchgang, machte mich frisch und schlüpfte in eines der halbwegs bequemen langen Kleider, diesmal ein ganz hochgeschlossenes in hellem Beige. Dann kämmte ich noch meine Haare, bis sie in sanften Wellen über die Mitte meines Rückens fielen und im Licht der Sonnenstrahlen rötlich glänzten, bevor ich eilig mein Zimmer verließ.
Ich rannte den Gang entlang bis zu der hölzernen Treppe, die in einem Halbkreis nach unten führte. Dort schwang ich mich seitlich auf das dicke, glatt geschliffene Geländer und ließ mich in die Tiefe gleiten. Schließlich war ich spät dran, aus dem Tafelsaal drangen bereits Stimmen. Mit herrlicher Geschwindigkeit sauste ich hinunter. Allerdings sah ich erst zu spät, wie mit anmutigen Schritten Fürstin Medina die Stufen hinunterstieg. Abzubremsen war mir leider nicht mehr möglich. Kurz überlegte ich noch, wie ich ausweichen könnte, aber dann war es auch schon geschehen, ich stieß mit den Beinen gegen sie.
Ich sah, wie sie strauchelte, das Gleichgewicht verlor und … stürzte. Es waren nur zwei oder drei Stufen. Mich dagegen hebelte der Aufprall von dem Geländer und ich flog … mit der Gewissheit im Hinterkopf, auf den Füßen landen zu können. Solche akrobatischen Übungen waren kein Problem für mich. Doch unten an der Treppe war gerade Madras auf dem Weg zum Tafelsaal und in Sachen Auffangen fiel seine Wahl offenbar auf mich. Mit voller Wucht prallte ich gegen ihn, stand aber tatsächlich … und er hielt mich. Ziemlich erschrocken starrte ich zu ihm auf. Er lächelte sanft und seine goldenen Augen musterten mich mit tiefer Zärtlichkeit. Unfassbar! Und … viel zu nah! Er überschritt eindeutig eine Grenze. Obwohl er wusste, wie Domino und ich zueinander standen. Sofort störte mich seine Nähe und ich trat abrupt einen Schritt zurück, senkte den Blick, der sicher alles andere als freundlich war.
Zu unseren Füßen lag Medina wie ein Käfer auf dem Rücken. Kein Wunder, trug sie doch dieses wuchtige Kleid, unter dem sich zweifellos ein viel zu eng verschnürtes Korsett befand, das sie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkte.
Madras reichte ihr die Hände und zog sie hoch. Sie richtete ein wenig ihre kunstvoll hochgesteckten blonden Haare und ihr böser Blick sprach Bände. An ihrer Schönheit änderte das jedoch nichts. Sie sah wie immer anmutig und perfekt zurechtgemacht aus. Offenbar war sie aber in ihrer Würde gekränkt und entsprechend wütend sah sie mich nun an.
»Entschuldigung«, brachte ich halbwegs ernsthaft über die Lippen, hätte jedoch am liebsten laut losgelacht.
In diesem Moment kam Domino die Treppen herunter. Er rannte. Nein, besser gesagt, er schwebte uns in elegant geschmeidiger Bewegung entgegen. Seine Augen starrten Madras beinahe feindselig entgegen und ich vergewisserte mich mit einem Blick zu dem Fürsten, ob er schon zu frieren begann. Doch Madras sah dem König ausdruckslos ins Gesicht, ohne Angst und offensichtlich auch, ohne angegriffen zu werden.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Domino beherrscht, als er die letzte Stufe hinuntergestiegen war.
Medina fuhr zu ihm herum und warf ihm theatralisch die Arme entgegen, legte die Hände gegen seine Brust, als wäre ihr Retter aus dem Nichts aufgetaucht. »Das hat sie mit Absicht getan«, zischte sie.
»Nein!«, wollte ich gerade loswettern, aber Domino richtete eine Handfläche gegen mich, um mich aufzuhalten.
»Sicher nicht, Medina. Sie ist nur ein bisschen … stürmisch.« Bei dem letzten Wort lächelte er und zwinkerte mir zu. Dann nahm er Medinas Hände von seiner Brust und ließ sie los.
Sie war gekränkt, nun erst recht. »Du musst es ja wissen«, fuhr sie ihn an.
»Sag jetzt nichts, was du später bereuen würdest«, drohte er ihr.
Sie funkelten sich böse an. Mal wieder wurmte mich die Tatsache, dass Medina immun gegen Dominos Eisblick war. Ansonsten hätte sich ihre Nase mit Sicherheit rot gefärbt.
Zumindest bis Madras sich einmischte. »Würdet Ihr mich zu Tisch begleiten, meine Liebe?« Er machte eine angedeutete Verbeugung vor Medina, hielt ihr dann den Arm hin und lächelte charmant. Wirklich charmant. Als sie seufzend, aber sichtlich geschmeichelt einwilligte und uns den Rücken zuwandte, blickte Madras noch mal grinsend zurück. Diesmal zwinkerte er mir zu.
»Hast du es extra gemacht?«, fragte Domino grinsend, sobald die beiden außer Reichweite waren.
»Nein«, entgegnete ich entrüstet. Würde ich doch nie tun! Ich lachte. »Ehrlich nicht. Aber hast du gesehen, wie sie dalag?«
»Du bist unmöglich.«
»Sie ist unmöglich. Kein Mensch kann sich in diesen Kleidern normal bewegen.«
»Sie macht sich halt gern schön.« Er grinste noch immer, was ich nun allerdings nicht mehr besonders witzig fand. »Sie hat eben nicht diese natürliche Schönheit, das Temperament, die Leidenschaft.« Liebevoll sah er mich an … hocherhobenen Hauptes und mit so viel Wärme in seinen eiskalten Augen, dass es mir wieder die Sprache verschlug.
Am liebsten wäre mir gewesen, ich hätte die Arme um seinen Hals legen können. Nur leider schickte sich das ja nicht, solange wir nicht wenigstens verlobt waren.
»Darf ich Euch zu Tisch begleiten, Königin Lunaja?«, fragte er.
»Wohin du willst«, antwortete ich.
König und Königin
Lunaja
Es kam selten vor, dass wir gemeinsam den Tafelsaal betraten. Doch wenn wir es machten, wurden wir misstrauisch beobachtet, so wie jetzt. Vor allem von Karas und natürlich von denen, die nicht genau wussten, ob die Gerüchte um uns wirklich stimmten. Aber auch von denen, die es wussten und hofften, dass vor allem ich meinen Ruf nicht vollends aufs Spiel setzte.
Domino brachte mich zu meinem Platz und setzte sich wie immer schräg gegenüber von mir.
»Das Wetter wird zusehends besser, Lunaja«, begann Karas mit mir zu reden. »Wann, denkst du, können wir nach Kariada zurückkehren?« Es war eine Frage, deren Antwort längst gegeben war. Er wusste ganz genau, dass uns nichts mehr davon abhielt. Nichts außer mir selbst.
»Morgen«, antwortete ich bestimmt, als wäre es selbstverständlich. Ich wollte ihm nicht die Möglichkeit geben, an meiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln, weil ich unsere Rückkehr hinauszögerte.
»Gut, dann also morgen«, sagte er sichtlich verblüfft.
Ich blickte ihm selbstbewusst entgegen und gab ihm mit aufrechter Kopfhaltung zu verstehen, dass es an mir nichts auszusetzen gab. Auch die anderen betrachtete ich. Mir entging dabei nicht das zufriedene Lächeln in Medinas entzückendem Gesicht. Ihre dunklen Augen blitzten und wanderten scheinbar zufällig zu Domino hinüber.
Domino starrte mich an. Der Ausdruck in seinem Gesicht war nicht zu deuten. Vielleicht fassungslos, nicht aber erstaunt. Er wusste, ich würde allein gehen, darüber hatten wir gesprochen. Nur der Zeitpunkt war unklar gewesen – bis jetzt.
Plötzlich stand er auf, nahm das Tuch von seinem Schoß und warf es auf den Teller. Mit schnellen Schritten kam er zu mir herum, griff nach meiner Hand und zog mich hinter sich her. Alle starrten uns an. Er machte unser offenes Geheimnis damit so deutlich wie noch nie. Weil der Stuhl noch im Weg war, hatte ich Mühe, nicht zu stolpern, und rannte dann beinahe, um ihm überhaupt folgen zu können. Ich wagte es nicht, etwas zu sagen. Ein Wortgefecht vor den anderen war genau das, was uns gerade noch fehlte.
Auf direktem Wege ging er mit mir zu seinen Gemächern, öffnete die Tür und befahl den Zofen die Räume zu verlassen. Im Nu waren wir allein.
Ich blieb mitten im Raum stehen, hatte Angst, er könnte wieder wütend sein. Nicht solche Angst, dass er mir etwas antun könnte, nur die vor einem Streit.
Die ganze Zeit hatte er mich nicht angesehen, und als er sich mir nun zuwandte, begriff ich, dass er alles andere als wütend war. Da war ein unbeschreiblicher Schmerz in seinen Augen. Ich zögerte nicht länger, sondern ging zu ihm und legte die Arme um seinen Hals, den Kopf an seine Brust.
»Ich will nicht, dass du gehst«, flüsterte er.
»Es ist ja nicht für lange. Und ich komme wieder. Oder du kommst in ein paar Wochen nach. Kaja freut sich auch, wenn ihr kommt, vorausgesetzt, du bringst Denido mit.« Lächelnd blickte ich zu ihm auf.
»Ich liebe dich«, sagte er. Dann nahm er meine Hände und ging vor mir in die Knie.
Entgeistert sah ich zu ihm nieder.
»Heirate mich, Lunaja.« Er sprach meinen Namen mit Sorgfalt aus. »Heirate mich, bevor du nach Kariada zurückkehrst.«
»Domino. Nichts täte ich lieber als das«, antwortete ich und hockte mich vor ihn. Ich nahm seinen Kopf in beide Hände, ehe ich weitersprach. »Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Aber ich muss erst zu Hause reinen Tisch machen. Ich muss Esra erklären, was passiert ist. Sie würde mir nie verzeihen, wenn ich verheiratet nach Hause käme. Und den Hofrat muss ich davon überzeugen, dass der Schatten besiegt ist. Ich kann dich nicht vorher heiraten.« Wäre ich wirklich ehrlich gewesen, war das nicht der einzige Grund. Immer noch fühlte ich mich zu jung, wenn ich auch wusste, dass er der Einzige war, den ich wollte. Für immer … bei Tag und bei Nacht.
»Du hast recht«, sagte er. »Es ist selten genug, dass du so vernünftig bist. Also werde ich dich erst wieder fragen, wenn alles geklärt ist.« Er nahm meine Hände, stand wieder auf und zog mich mit sich hoch. »Am liebsten würde ich das Frühstück auslassen«, meinte er und grinste schief. »Mein Auftritt gerade eben war wahrscheinlich nicht besonders klug.«
»Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig«, sagte ich, obwohl mir selbst nicht wohl war bei dem Gedanken, einfach wieder nach unten zu gehen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. »Immerhin sind wir die Herrscher. Das muss doch mal zu irgendwas gut sein.«
»Schön wär’s«, pflichtete Domino mir bei, deutete dabei jedoch auf die Tür. »Ich denke mir irgendwas aus.« Damit ging er voran. »Komm schon«, forderte er mich grinsend auf. »Mir wird schon die passende Ausrede einfallen.«
Nun, die fiel ihm nicht ein. Mir auch nicht. Stattdessen betraten wir nacheinander den Tafelsaal und gingen zurück an unsere Plätze. Alle Anwesenden waren sehr diskret und taten so, als wäre nichts Besonderes vorgefallen.
Alle außer Karas. »Und?«, fragte er und blickte mich herausfordernd dabei an. »Bleibt es dabei, dass wir morgen aufbrechen?«
»Natürlich. Denkst du, ich habe es mir anders überlegt?«
Daraufhin machte er eine abwehrende Geste mit seinen Händen, als hätte er überhaupt nichts gesagt. Was ich ihm auch geraten haben wollte, denn sein Verhalten nervte mich mehr, als ich gerade in Worte fassen wollte. Diese wären sicher nicht besonders nett ausgefallen. Dann setzte ich mich und nahm mir endlich etwas zu essen.
***
Als wir alle fertig waren, rannte ich hinauf in mein Zimmer, um mich so schnell wie möglich umzuziehen. Das weite weiße Hemd stopfte ich sorgfältig in die enge naturbraune Lederhose und gegen die Kälte zog ich meinen Wollumhang über. In die Fellstiefel schlüpfte ich erst auf dem Weg nach draußen.
Ich hüpfte noch, den einen Fuß nur fast im Stiefel, als Medina schon wieder meinen Weg kreuzte. Diesmal kam sie mir entgegen und blieb nun vor mir stehen. Herablassend sah sie mich an. Sie fand meinen Aufzug offensichtlich mehr als lächerlich. Das wusste ich längst und es störte mich nicht im Geringsten. Die meisten verstanden es nicht, dass ich mich nicht gern wie eine Dame kleidete. Mein Verhalten war auch nicht gerade damenhaft, und jetzt im Moment erst recht nicht. Meinen Stiefel hatte ich endlich an und richtete mich auf.
»Was gibt’s?«, fragte ich forsch.
»Nun ja«, antwortete sie naserümpfend. »Ihr seid nicht gerade eine Königin, wie man sie sich vorstellt.«
»Nein.« Da hatte sie recht. Na und?
Sie hob den Kopf noch etwas höher. »Ich bin sicher, Domino erkennt auch bald, dass Ihr viel zu … männlich seid, um eine angemessene Ehefrau abzugeben.«
»Was Ihr nicht sagt«, erwiderte ich beherrscht. Was wollte sie von mir?
»Domino mag Frauen, die ihm ergeben sind«, meinte sie ruhig und lächelnd.
Nun wurde ich hellhörig, hob den Kopf, schob das Kinn vor. Ich wusste sehr gut, wie recht sie hatte. Wieso war sie so gut informiert?
»Was wollt Ihr damit sagen?«, gab ich ihr noch eine Chance.
»Nun. Es ist doch offensichtlich. Jeder Mann wünscht sich eine Frau, keinen Soldaten.«
»So. Und Ihr seid eine Frau«, sagte ich zynisch. »Eine Frau, die sich jeder Mann wünscht. Jeder, außer Domino.« Ich genoss die letzten Worte.
»Er …«, begann sie, doch dann blickte sie über mich hinweg und blieb still.
»Seid ihr wieder zusammengestoßen?«, erklang Dominos Stimme hinter mir.
Doch weder sie noch ich antworteten darauf. Stattdessen betrachteten wir uns feindselig, bis Domino neben mir stand.
»Gut, ich will offen reden«, begann er nun und ich sah kurz zu ihm auf. Nichts in seinem Gesicht deutete darauf hin, dass er Witze machen wollte, so, wie er Medina jetzt betrachtete. »Du solltest dir deinen hübschen Kopf nicht darüber zerbrechen, welche Art Frau ich bevorzuge, denn das geht dich nichts an.«
»Sehr wohl geht es mich etwas an. Du hast mir immerhin vor einiger Zeit ein Versprechen gegeben«, entgegnete sie gereizt. Und mit einem kurzen Blick zu mir fügte sie von oben herab noch hinzu: »Das darf sie doch sicher wissen.«
Meine Handfläche kribbelte. Mich überkam das seltene Bedürfnis, sie in ihrem Gesicht landen zu lassen. Im Geiste stellte ich mir schon vor, wie sie wieder auf dem Rücken lag und ihre Frisur zu retten versuchte.
»Nein, Medina«, gab Domino trocken zurück. »Mein Vater hat es deinem Vater versprochen. Und ja, Lunaja weiß davon.«
Wütend warf sie den Kopf in den Nacken und ging an uns vorbei.
Domino hielt mir den Arm hin. »Wollen wir?«
Ich hakte mich unter und bald darauf schritten wir durch das alte hölzerne Tor nach draußen auf den riesigen Burghof. Niemand außer uns war hier. Den ganzen Winter über hatte hier Totenstille geherrscht. Jetzt, da der Frühling eingekehrt war, hörte man die Vögel aufgeregt zwitschern. Ich ging einige Schritte von Domino weg, dann drehte ich mich um und zog mein Schwert. »Also. Lasst uns anfangen, mein König«, forderte ich ihn heraus.
Er verneigte sich tief vor mir, stand etwa fünf Meter entfernt.
Es war nicht fair, aber mit schnell gesprungenen Drehungen war ich im Nu bei ihm. Die Spitze meiner Klinge deutete auf seine Brust. »Ihr habt zu viel Vertrauen«, schalt ich ihn neckisch.
Sein Blick wanderte für den Bruchteil einer Sekunde zum Griff meines Schwertes. Im selben Moment wurde der dermaßen kalt, dass ich das Gefühl hatte, meine Handfläche könnte vereist werden. Schnell warf ich es weg.
»Und Ihr solltet nicht zögern, wenn Ihr mit einem Späher kämpft«, antwortete er spöttisch.
Ich hielt meine Hand.
»Tut es sehr weh?«, fragte er ernsthaft besorgt.
»Nein.« Ohne ihn aus den Augen zu lassen, hob ich meine Waffe wieder auf und schleuderte sie ihm entgegen.
Er wehrte meinen Angriff ab. »Ein faires Gefecht ab jetzt?«, grinste er.
»Ja«, entgegnete ich knapp.
»Kein Eis, keine Vorausschau«, hakte er noch mal nach.
»Ich habe vorhin nichts vorausgesehen. Ich war nur schnell genug«, sagte ich wahrheitsgemäß.
»Hast du den Zusammenstoß heute Morgen auch nicht vorausgesehen?«, fragte er neckend.
»Ich habe es wirklich nicht extra gemacht«, beharrte ich.
Unsere Schwerter schlugen gegeneinander. Gekreuzt verweilten sie einen Moment.
»Ich meinte den Zusammenstoß mit Madras«, berichtigte er. Fast eindringlich sah er mich dabei an, aber ich stieß ihn zurück.
»Was meinst du denn damit?«, rief ich gereizt.
»Nun. Vielleicht hast du gesehen, dass er dich auffangen wird?«
»Sicher nicht«, zischte ich. »Lieber hätte ich mich auf Medina gestürzt.«
»Ist das so?« Wieder lag sein Schwert mit meinem gekreuzt. Wieder sah er mir in die Augen, diesmal höhnisch.
»Aber da wir gerade beim Thema sind«, knurrte ich und versuchte ihm dabei einen Stoß zu versetzen. Diesmal stemmte er sich jedoch dagegen und unsere Schwerter schlugen nochmals auf und verharrten abermals gekreuzt. Herausfordernd sah ich ihn an. »Bist du sicher, der Fürstin kein Versprechen gegeben zu haben?« Er zog fragend eine der formvollendeten Augenbrauen hoch und ich fuhr fort: »Sie weiß ziemlich gut über dich Bescheid.«
»Sie weiß gar nichts.«
»Ach nein?«
»Nein.«
»Zumindest nicht in dieser Welt?«, fragte ich diesmal neckend.
»Genau«, antwortete er und musterte mich mit sturem Ausdruck, der aber schnell in ein schelmisches Grinsen wechselte. »Eifersüchtig?«
»Habe ich einen Grund dazu?«
»Nein. Habe ich denn einen Grund dazu?«
»Eifersüchtig zu sein?«, fragte ich entgeistert und er nickte.
»Nein«, antwortete ich leise und lächelnd. »Ich werde immer nur dich lieben.«
Danach setzten wir das Training fort. Trotzdem lag eine seltsame Spannung in der Luft. Wir waren beide gereizter als sonst. Vielleicht lag es daran, dass es sicher das letzte Training vor meiner Abreise war. Möglicherweise war es aber auch einfach nur meine Schuld, weil mir immer und immer wieder das Buch der Bücher einfiel.
Ich überlegte sogar ihm davon zu erzählen, um mein Gewissen zu erleichtern. Doch die Angst vor seiner Reaktion war stärker.
***
Anna
Als ich an diesem Morgen erwachte und langsam die Augen aufschlug, schlief Marco noch. Sein wunderschönes Gesicht strahlte Ruhe und Zufriedenheit aus. Eine Ruhe, die ich schon seit gestern nicht mehr richtig fand. Immer klarer wurde mir, dass ich meine Angst nicht verdrängen konnte. Immer klarer wurde mir, dass wir noch nicht am Ziel unserer Träume angelangt waren. Immer deutlicher wurde mir bewusst, dass ich auch deshalb abgelehnt hatte ihn zu heiraten. Zu unklar erschien mir, was uns die Zukunft noch bringen könnte. Als er seine herrlichen hellen Türkisaugen öffnete und mich durch die langen Wimpern musterte, lächelte ich wehmütig.
»Du siehst traurig aus«, stellte er fest.
»Nein«, log ich. Ich will dich nicht verlieren.
»Was ist es dann?«, fragte er sanft und strich mit allen Fingern einer Hand über meine Wange.
»Ich habe gerade daran gedacht, dass wir nur noch eine gemeinsame Nacht verbringen werden.«
»Nur fürs Erste, in einigen Wochen komme ich nach«, tröstete er mich.
Hoffentlich, dachte ich, nickte aber. »Ja, ich weiß.« Ich seufzte. »Vielleicht sollten wir doch vorher heiraten«, sagte ich nach einem Moment.
Er lächelte sanft. »Nein, du hattest recht damit, dass du in Kariada erst noch einiges zu klären hast.«
Ich verzog schmollend den Mund.
»Hast du auf einmal Angst, uns könnte noch was dazwischenkommen?«, grinste er unbeschwert.
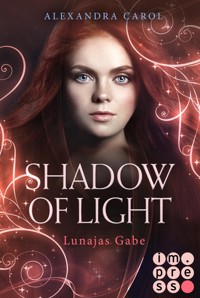

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










