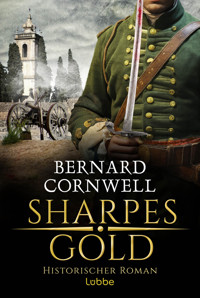9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Endlich gibt es sie auch auf Deutsch: Bernard Cornwells Erzählung Sharpes Scharmützel, in der sein Held Richard Sharpe 1812 ein spanisches Fort verteidigen muss, das von französischen Soldaten attackiert wird. Als Bonus für alle Fans der Sharpe-Serie erzählt Bernard Cornwell im 2. Teil des Buches viel Wissenswertes über die Entstehung der Sharpe-Romane und gibt dabei eine Menge Hintergrundinformationen preis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
EINFÜHRUNG
SHARPES ABENTEUER
KUCHEN UND ALE
Titel
EINFÜHRUNG
SHARPES SCHARMÜTZEL
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Bernard Cornwell
SHARPESABENTEUER
Aus dem Englischen vonRainer Schumacher und Dietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2002, 2006 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Story« und
»Sharp e’s Skirmish«
Published by arrangement with
Marco Vigevani & Associati Agenzia Letteraria,
on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5900-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
EINFÜHRUNG
Sharpes Abenteuer wurde ursprünglich für eine Buchhandelskette in Großbritannien geschrieben, die den Käufern von Sharpes Zorn eine kostenlose Beilage geben wollte. Wie immer kam diese Anfrage reichlich spät, und der Text, den ich daraufhin verfasst habe, entstand in aller Eile. Diese Version hier ist viel länger. Auch habe ich noch einen wesentlich kürzeren Essay mit dem Titel Kuchen und Ale hinzugefügt, weil darin einige der finsteren Ursprünge von Sharpe erklärt werden.
Ich schreibe das hier an einem kühlen Sommertag in Cape Cod. Trotzdem ist mir warm ums Herz, denn ein neuer Sharpe-Roman ist eingetroffen. Nun, eigentlich ist es ein alter Sharpe, aber in toller, neuer Aufmachung. Er liegt auf meinem Schreibtisch, und ich starre ihn voller Staunen an. L’Aigle de Sharpe heißt er, Sharpes Trophäe. Der allererste Roman ist gerade in Frankreich veröffentlicht worden, und ich bin vollkommen baff. »Découvrez Richard Sharpe, le meilleur ennemi de Napoléon« steht auf dem Klappentext, und das würde ich mit meinem lausigen Französisch mit »Entdecken Sie Sharpe, Napoleons größten Feind« übersetzen. Ich bezweifle zwar, dass allzu viele Franzosen diese Entdeckung machen wollen, aber ich fühle mich geschmeichelt, dass so viele Menschen im Laufe der Jahre Interesse an Sharpe entwickelt haben. Dieses Buch soll nun einige der häufigsten Fragen beantworten, die mir über die Serie gestellt werden. Und davon wiederum ist die häufigste, ob es noch weitere Sharpe-Romane geben wird. Wenn Sie die Antwort wissen wollen, dann lesen Sie weiter.
SHARPES ABENTEUER
Ich werde oft gefragt, wo Sharpe hergekommen ist, ob ich ihn einer realen Person nachempfunden habe, deren Memoiren ich gefunden habe, oder ob er vielleicht auf einem meiner Freunde basiert. In Wahrheit trifft jedoch keines von beidem zu. Richard Sharpe ist meinen Träumen entsprungen, und ich habe schon mit ihm gelebt, lange bevor er auf Papier erschienen ist.
Ich habe zum ersten Mal über ihn geschrieben, als ich in Belfast gelebt habe, allerdings hieß er da noch nicht Sharpe. Das war 1978, und ich durfte mich mit dem Titel eines Nachrichtenchefs der BBC in Nordirland schmücken. Ich mochte Belfast. Ja, Ende der Siebziger wurde es von sektiererischer Gewalt zerrissen, überall patrouillierten Soldaten, und Bomben waren nichts Ungewöhnliches. Aber Belfast war auch humorvoll, intim und freundlich. Und ich habe auch gern Fernsehen gemacht, doch ich wollte schon immer Schriftsteller werden, und nachdem ich C. S. Forresters wunderbare Hornblower-Romane gelesen hatte, wollte ich eine Serie lesen, die für Wellingtons Armee das Gleiche tat, was Forrester für Nelsons Navy getan hatte. Nach dieser nicht existierenden Serie habe ich bestimmt zwanzig Jahre lang gesucht, und dann, an einem verregneten Wintertag in Belfast, habe ich beschlossen, selbst eine zu schreiben. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich getippt habe, während der Regen an mein Fenster prasselte und graue Wolken über dieser seltsam faszinierenden Stadt hingen. Wie der Dichter schreibt: »Oh, die Ziegel, sie bluten, und der Regen, er weint. Und der feuchte Lagan-Nebel schläfert sie ein, diese Stadt. Zur Hölle mit der Zukunft. Lebt in der Vergangenheit. Möge der Herr Belfast gnädig sein.«
Belfast war in jedem Fall gut zu mir, aber meine Hoffnung, dort zu einem Schriftsteller zu werden, hat sich rasch zerschlagen. Dieser erste Versuch, einen Roman über die Napoleonischen Kriege zu schreiben, war schon vorbei, bevor ich überhaupt richtig damit begonnen hatte. Das einzige Erinnerungsstück an diesen ersten, gescheiterten Versuch ist ein hübsches BBC-Notizbuch, in dem ich meine Recherchen aufgeschrieben habe und das ich auch heute noch benutze.
Aber warum gefielen mir Geschichten mit militärhistorischem Hintergrund überhaupt so sehr? Das fing in meiner Kindheit an. 2005 hat die Literaturzeitschrift Granta eine Anthologie zusammengestellt, bei der Schriftsteller über ihre Erfahrungen mit Adoption schreiben sollten, und mich gebeten, auch einen Beitrag zu verfassen. Meine erste Reaktion war, Nein zu sagen, denn meine Kindheitserinnerungen waren nicht allzu glücklich, doch dann, kurz bevor ich meine Absage abschicken konnte, begann ich zu tippen. Ich habe knapp neunzig Minuten gebraucht, um Kuchen und Ale zu schreiben, und als ich damit fertig war, habe ich wütend die Zähne gefletscht. Trotzdem habe ich den Text Granta geschickt, allerdings mit der Maßgabe, die mir zustehende Bezahlung einem wohltätigen Zweck zu spenden. Der Text wurde anschließend auch noch in der New York Times und dem Daily Telegraph publiziert und in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt, und am Schluss ist eine beachtliche Spendensumme zusammengekommen. Ich habe dieses Essay dem Buch als Anhang hinzugefügt, deshalb möchte ich nicht allzu viel davon hier wiederholen. Ich will lediglich auch hier noch mal erwähnen, dass meine Adoptiveltern einer religiösen Gruppe angehörten, die man die Peculiar People nannte – laut Blunts Wörterbuch der Sekten, Häresien, kirchlichen Parteien und religiösen Denkschulen eine »Sekte von äußerst ignoranten Menschen«. Das ist ein Urteil, dem ich durchaus zustimmen kann, auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig herablassend klingt. Andererseits ist Blunts Wörterbuch eine hervorragende Klolektüre.
Die Peculiar People, also die Seltsamen Leute, missbilligten viele Dinge. Auf ihrer Liste verbotener Früchte standen auch solche Sachen wie der Militärdienst, und als Reaktion auf all diese Verbote entwickelte ich ein großes Interesse an allem Militärischen (zum Glück für mich missbilligten sie auch Wein, Weib und Gesang). So wurde ich zu einem Spezialisten für Militärgeschichte, weil die gottesfürchtigen Menschen, die mich adoptiert hatten, das mit Stirnrunzeln betrachteten.
Und dieses Interesse dauert bis heute an. 1979, als ich 35 war, träumte ich noch immer insgeheim davon, eine »Hornblower-an-Land-Serie« zu schreiben, doch mein erster Versuch war gescheitert, und ich bezweifle, dass ich es noch einmal versucht hätte, wäre da nicht plötzlich eine blonde Frau in die Hotellobby gekommen, als ich in Edinburgh auf einem Filmdreh war. Es war eine Amerikanerin mit Namen Judy, und Amors Pfeil traf mich mit der Genauigkeit von Daniel Hagmans Baker Rifle. Aus allen möglichen Gründen konnte Judy jedoch nicht von den Staaten nach Nordirland ziehen. Also beschloss ich, meinen Job beim Fernsehen aufzugeben und meinerseits in die USA zu gehen. Das Problem mit diesem Plan war nur, dass die US-Regierung mir eine Arbeitserlaubnis verweigerte. Also versprach ich Judy in meinem Hochmut, mir fortan meinen Lebensunterhalt als Schriftsteller zu verdienen.
Zurückblickend erkenne auch ich, wie dumm das alles war. Genau genommen war ich nämlich schlicht ein illegaler Einwanderer in einem winzigen Apartment in New Jersey mit einer Schreibmaschine auf einem Tisch, der lediglich aus einer Sperrholzplatte auf zwei Holzböcken bestand. Und das Einzige, was ich tun wollte, war, diese Hornblower-an-Land-Serie zu schreiben, und so machte ich mich wieder an die Arbeit. Doch im Gegensatz zu der Zeit in Belfast, als ich es zum ersten Mal versucht hatte, war meine Situation hier verzweifelt. Sollte Sharpe versagen – oder genauer gesagt: sollte ich versagen –, dann drohte auch die Beziehung zu meiner wahren Liebe vor die Wand zu fahren. Mit dem wenigen Geld, das ich hatte, konnte ich in New Jersey nicht lange überleben. Schnelligkeit war oberstes Gebot, und Sharpes Trophäe wurde in aller Eile verfasst. Bis dahin hatte ich noch nie ein Buch geschrieben (mein erster Versuch war nicht über das erste Kapitel hinausgekommen, zählt deshalb also nicht), und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich das bewerkstelligen sollte. Natürlich wusste ich, dass ich einen Helden brauchte, aber ich hatte mir noch nicht einmal ansatzweise Gedanken darüber gemacht, was das für ein Mensch sein sollte. So musste er sich beim Schreiben entwickeln. Was ich jedoch wusste, war, dass er ein Rifleman sein würde, denn die Baker Rifle, das erste richtige Gewehr, war eine Besonderheit von Wellingtons Armee, und damit hätte er dann einen Vorteil gegenüber dem Feind. Und ich wusste auch, dass er ein Offizier sein würde, allerdings einer, den man aus den Mannschaftsdienstgraden befördert hatte, was zu allerlei Problemen in seiner eigenen Armee führen würde. Und er hatte Wellington einmal das Leben gerettet, was ihm natürlich ebenfalls einen Vorteil verschaffte. Doch abgesehen davon war Sharpe ein Mysterium für mich, als ich mit der Arbeit an Sharpes Trophäe begann.
Zu Beginn des Buches habe ich ihn als groß gewachsen und mit schwarzen Haaren beschrieben, was auch vollkommen in Ordnung war, bis Sean Bean auf der Bildfläche erschien. Danach habe ich versucht, seine Haarfarbe nie mehr zu erwähnen. Ich gab ihm eine vernarbte Wange, obwohl ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern kann, auf welcher Wange sich die Narbe befand, und ich nehme an, das hat sich von einem Buch zum anderen geändert. Was ich ihm am Anfang jedoch nicht gab, war ein Name, denn ich suchte nach etwas, das genauso besonders und einprägsam war wie Hornblower.
Die Tage vergingen, und immer mehr Seiten stapelten sich auf meinem Schreibtisch, doch mein Held hieß noch immer Lieutenant XXX. Ich legte Namenslisten an, aber keiner davon funktionierte. Schließlich beschloss ich, ihm wenigstens einen provisorischen zu geben, um mir die Arbeit zu erleichtern. Ich nannte meinen Rifleman Richard Sharpe als Hommage an den großen Rugbyspieler Richard Sharp, und ich ging davon aus, dass sich dieser Name wieder ändern würde. Aber natürlich blieb der Name hängen. Nach ein, zwei Tagen war mein Held einfach nur noch Sharpe für mich, und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Patrick Harper zu benennen war deutlich leichter. In Belfast hatte ich einen Freund mit Namen Charlie Harper, und der wiederum hatte einen Sohn mit Namen Patrick. Das Problem war nur, dass die Familie Harper nicht allzu gut auf die Briten zu sprechen war – und dazu hatten sie auch allen Grund –, und ich hatte Angst, dass sie etwas dagegen haben würden, wenn ich einen Soldaten der britischen Armee nach ihrem Sohn benannte. Ich bat sie um Erlaubnis, und sie haben sie mir gegeben, und seitdem marschiert Harper neben Sharpe.
Nach ungefähr sechs Monaten war das Buch fertig. Ich erinnere mich noch daran, wie ich den Papierstapel angestarrt und mich gefragt habe, was zum Teufel ich jetzt tun sollte. Natürlich brauchte ich einen Verleger, und zufälligerweise hatte ein Literaturagent meine Wohnung in London gekauft. Also schickte ich ihm das Manuskript. Seine Antwort kam mehr oder weniger sofort: »Niemand interessiert sich für die britische Armee.«
Damit schien das Schicksal meiner wahren Liebe besiegelt zu sein, doch dann hatte ich einfach Glück. Ich lernte einen anderen Londoner Literaturagenten kennen, der gerade in New York war, und binnen einer Woche hatte Sharpes Trophäe einen Verleger und ich einen Vertrag über sechs weitere Bücher.
Ein Vierteljahrhundert später habe ich noch immer denselben Agenten, denselben Verlag und dieselbe Frau, und die ganze Zeit über habe ich Sharpes Trophäe nicht mehr gelesen. Doch vor gar nicht allzu langer Zeit hat mir ein Leser von seiner ersten Reaktion auf dieses Buch erzählt.
»Ich dachte, es wäre wie jedes andere Buch auch«, sagte er, »doch als Sharpe Berry tötete, da wusste ich, dass es anders war. Andere Helden hätten das nie getan. Andere Helden haben Skrupel, Sharpe nicht.«
Ah! Sharpe war also von Anfang an ein Schurke. Berry war ein anderer britischer Offizier, der Sharpe gegen sich aufgebracht hat, und das ist nicht klug. Also hat Sharpe ihn eines Nachts in die Ecke getrieben und erledigt.
Berry plapperte wieder. Er flehte, bettelte, schüttelte den Kopf, ließ seinen Säbel fallen und faltete die Hände, als wolle er zu Sharpe beten. Der Rifleman starrte nach unten. Er erinnerte sich an einen seltsamen Satz, den er bei einer Prozession im fernen Indien gehört hatte. Ein Kaplan mit weißer Stola hatte irgendeinen Unsinn vor sich hin gemurmelt. Sharpe hatte eigentlich gar nicht richtig zugehört, doch ein Satz hatte sich ihm eingeprägt. Es war ein Satz aus einem Gebetbuch, und an den erinnerte er sich nun, als er sich fragte, ob er wirklich einen Mann dafür töten sollte, dass er seine Frau vergewaltigt hatte. »Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden.« Sharpe hatte darüber nachgedacht, den Mann seinen Säbel aufheben und um sein Leben kämpfen zu lassen. Doch dann dachte er an die Qual im Blick des Mädchens, und der Gedanke daran, wie sie in ihrem Blut auf dem Laken gelegen hatte, ließ ihn sich mit beiden Händen auf dem Knauf seines Säbels nach vorn lehnen, als wäre er müde und wolle sich ausruhen.
Das Plappern wurde fast zu einem Schrei, der Körper zuckte, die Klinge drang durch Haut und Fleisch und in Berrys Hals, und der Lieutenant starb.
Vieles an dieser Szene ist vertraut, doch wenn ich sie heute noch mal schreiben würde, dann würde ich Sharpe nicht mehr zögern lassen. Der Mann hatte sich an seiner Frau vergangen. Da gab es kein Zögern mehr. Doch auch hier zeigt Sharpe schon die Wut, die ihn den größten Teil seines Lebens über angetrieben hat. Es ist die Wut einer unglücklichen Kindheit, die Wut eines Mannes, der gezwungen war, sich alles zu erkämpfen, was andere einfach so bekamen. Und diese Wut unterscheidet ihn auch von dem stets gerechten und ehrenhaften Hornblower. Sharpe ist ein Schurke, und er ist gefährlich, aber er steht auf unserer Seite. Auch ist mir beim erneuten Lesen dieser Zeilen aufgefallen, dass Religion hier eine Rolle spielt, und das überrascht mich nicht. Meine ganze Kindheit habe ich im Sumpf der Religion gesteckt, und bis heute ist es mir nicht gelungen, ihren Gestank abzuwaschen. Doch Sharpe teilt zumindest eine Eigenschaft mit Hornblower. Beide mögen sie keine Pfaffen, und so überrascht es auch nicht, dass er die Worte des Kaplans bei der Prozession als »irgendeinen Unsinn« bezeichnet.
Am Schluss von Sharpes Trophäe sagt Sir Arthur Wellesley: »Gentlemen, ich gebe Ihnen Sharpes Trophäe.« Damit begann die Tradition, jedes Buch mit den Worten des Titels zu beenden. Lediglich Waterloo und Trafalgar bilden hier eine Ausnahme. Das wäre einfach zu klobig gewesen, fast genauso klobig wie der Säbel, den Sharpe im ersten Buch trägt, und den er seitdem nicht mehr abgelegt hat.
»So einen Säbel könnte er nie tragen«, hat mir ein Experte erklärt, nachdem Sharpes Trophäe 1981 veröffentlicht worden ist. Dieser Säbel war ein Pallasch, eine schwere Reiterwaffe, ein wahres Biest von einer Klinge, schlecht ausbalanciert und uneffektiv, aber mir gefiel die Vorstellung, dass Sharpe ein solches Schlachtermesser führte. Immerhin musste er sich von anderen unterscheiden, und deshalb trägt er im Gegensatz zu anderen Offizieren auch noch immer sein Gewehr, und dazu will er eine effektive Nahkampfwaffe. Als Rifle-Offizier müsste Sharpe eigentlich einen leichten Säbel tragen, der mehr Rangabzeichen als Waffe ist, doch mir war klar, dass Sharpe eine echte Waffe brauchte, mit der er schweren Schaden anrichten konnte. Aber hatte ich mich im ersten Buch geirrt? Hatte ich Sharpe eine Waffe gegeben, über die er ständig hätte stolpern müssen?
Just in diesem Augenblick schrieb mir ein Freund aus London, dass sein örtlicher Antiquitätenhändler einen Pallasch zum Verkauf anbot, und er fragte mich, ob ich ihn haben wolle. Ich konnte ihn mir zwar nicht leisten, aber ich beschloss, ihn trotzdem zu kaufen, und als der Säbel schließlich in New Jersey ankam, schnallte ich ihn mir um und trug ihn ein, zwei Tage. So fand ich zu meiner großen Erleichterung heraus, dass der Experte sich geirrt hatte. In einem Begleitschreiben hatte der Antiquitätenhändler mir versichert, dass die Klinge bei Waterloo getragen worden sei, und ich bilde mir gerne ein, dass das auch stimmt. In jedem Fall ist die Klinge in den Kampf geführt worden, denn die Spitze ist beidseitig geschliffen. Normalerweise war die Spitze nämlich nur einseitig geschliffen wie der Rest der Klinge auch. Unglücklicherweise neigte sie so jedoch dazu, an Rippen abzurutschen, weshalb man der kämpfenden Truppe gestattete, sie beidseitig zu schleifen. Jetzt hängt der Säbel über dem Kamin in meinem Arbeitszimmer, und Sharpe behielt seinen schweren Pallasch und führte ihn auch im zweiten Buch in den Kampf: Sharpes Gold.
Sharpe stocherte verzweifelt nach den Augen, doch El Catolico wich schlicht zur Seite aus und stach mit dem Rapier tief zu. Er zielte auf den Unterleib, und Sharpe hatte nur noch eine verzweifelte, verrückte Idee. Er ließ das Rapier auf sich zukommen, stieß das rechte Bein nach vorn und ließ El Catolicos Klinge tief und schmerzhaft in sein Fleisch eindringen, sodass er sie nicht mehr herausbekam. Dann drückte Sharpe El Catolico die eigene Waffe an die Kehle. »Ein Schlachtermesser, ja?«, knurrte er.
Wenn ich das jetzt so lese, sechsundzwanzig Jahre, nachdem es geschrieben worden ist, habe ich das Gefühl, als sei diese verzweifelte, verrückte Idee allein meinem Hirn entsprungen. Ich hatte Sharpe in einen Kampf geführt, den er nicht gewinnen konnte, und ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn da wieder rausholen sollte. Heute kommt mir die Vorstellung jedoch einfach nur noch dumm vor, dass Sharpe freiwillig eine Fleischwunde ertragen und so riskieren würde, Wundbrand zu bekommen, denn das bedeutete in der damaligen Zeit häufig Verkrüppelung oder gar den Tod. Aber damals lernte ich mein Handwerk noch, und vielleicht hat die Fülle dessen, was ich in dem Roman beschrieben habe, ja meine Naivität verdeckt.
Dann bewegte sich der Hügel. Das Geräusch kam nicht durch die Luft, sondern durch den Boden. Es war, als würde der Felsen selbst stöhnen, und die gesamte Kathedrale verschwand in Staub, Rauch und blutroten Flammen. Und durch die Flammen hindurch sahen die Männer große Steine und Balken, die wie Federn durch die Luft flogen. Dann traf die Schockwelle die französischen Kanoniere wie der Schlag eines Riesen, und ein heißer Wind folgte dem Geräusch. Es war, als erbebe die ganze Stadt im Donner, und einen Augenblick lang bekamen die Menschen einen Vorgeschmack auf das Ende der Welt.
Die Kathedrale verschwand, verwandelte sich in ein Flammenmeer. Die Burg löste sich vom Fels, und Steinblöcke regneten wie Bauklötze herab. Der gesamte Norden der Stadt wurde von der Explosion verschlungen. Am Südhang wurden die Dächer abgedeckt, und die Bäckerei brach über den Öfen zusammen. In einem davon hatte sich Sharpe versteckt, schnappte taub nach Luft und drohte, an dem dichten Staub zu ersticken. Das Mädchen packte ihn, betete um ihre Seele, und die Druckwelle raste vorbei wie der Atem der Apokalypse.
Das ist eine stark gekürzte Version der Zerstörung von Almeida. Die Festungsstadt, die einen der Wege nach Portugal bewachte, steht jedoch auch heute noch, und Besucher können über die beeindruckenden Mauern wandern, die sie umgeben. Und hoch oben in der Stadt, neben einem Friedhof im Schatten großer Zypressen, liegen die Ruinen der mittelalterlichen Burg, die im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Grundmauern zerstört wurde. Diese Zerstörung ist eine Folge der Explosion vom 27. August 1810. In der Stadt, die zu diesem Zeitpunkt von britischen und portugiesischen Truppen verteidigt wurde, lagerte Munition in der Krypta der Kathedrale neben der Burg, und aus irgendeinem Grund – bis heute weiß niemand warum – ist dieses improvisierte Magazin in die Luft geflogen. Doch mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich um einen Unfall, vermutlich verursacht durch ein undichtes Pulverfass, das man aus der Kathedrale geholt hatte. Pulver rieselte heraus, und ein französischer Zufallstreffer hat die so entstandene Lunte dann entzündet. Die Explosion war eine Katastrophe für die Briten. Die Garnison von Almeida war gezwungen, sich zu ergeben. Der offensichtliche Handlungsstrang war natürlich, dass Sharpe alles in seiner Macht Stehende tun würde, um diese Explosion zu verhindern, doch insgeheim wusste ich auch von Anfang an, dass er sie schlussendlich verursachen würde. Er würde Almeida in die Luft jagen, auch wenn das einen massiven Rückschlag für Wellingtons Bemühungen bedeutete und schier unendliches Leid und Tod über die Bevölkerung brachte. Sharpe glich Hornblower immer weniger. Er erwies sich als gnadenlos und ohne Skrupel, aber natürlich würde er Almeida nur in die Katastrophe führen, weil er weiß, dass die Alternative schlimmer wäre.
Mit Sharpes Gold begann auch eine bedauernswerte Tradition der Sharpe-Romane. Die Stadt kommunizierte mit der weit entfernten britischen Front über ein Signalsystem, das ursprünglich von der Admiralität entwickelt worden war. Blockadeschiffe vor der französischen Küste suchten manchmal Zuflucht in Torbay, und es war von außerordentlicher Wichtigkeit, dass Informationen von dort so schnell wie möglich zur Admiralität am heutigen Trafalgar Square gelangten. Ein ähnliches Signalsystem, das mit Schweinsblasen funktionierte, die man einem Mast aufzog, wurde in Portugal entwickelt und von Seeleuten bedient. In Sharpes Gold ist der dafür verantwortliche Offizier in Almeida ein außergewöhnlich junger Midshipman. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihm einen Nachnamen gegeben zu haben, aber offensichtlich war er ein äußerst freundlicher und enthusiastischer Teenager von etwa fünfzehn Jahren.
Die Kanonenkugel, vierundzwanzig Pfund Eisen, streifte die Saling nur. Der Signalmast war stabil gebaut, doch als das französische Geschoss abprallte, riss es ihn aus dem Sockel wie einen Baum im Sturm. Der Junge, der sich an einem Seil festhielt, wurde schreiend durch die Luft gewirbelt, bis ein weiteres Tau sich um seinen Hals schlang und ihm schrecklich den Kopf von den Schultern trennte. Sein Blut spritzte auf die vier Männer, und der Mast knallte auf die Mauer …
Eine junge Frau, die für meinen Verlag arbeitete, protestierte gegen diese Passage und sagte, es sei ja so traurig, dass solch ein vielversprechender junger Mann sterben musste. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, solch adrette Jüngelchen nur einzuführen, um sie im Laufe des Buches umzubringen. Das ging so weiter, bis in Sharpes Trafalgar ein netter, junger Mann mit Namen Midshipman Collier in der Schlacht von Trafalgar sterben sollte. Als Judy, meine Frau, ihm im Manuskript zum ersten Mal begegnete (sie liest alle meine Manuskripte), da erklärte sie, sie könne nicht weiterlesen, denn sie wisse ja, dass Collier sterben würde. Einfach um sie eines Besseren zu belehren, änderte ich den Schluss, und Collier überlebte als einziger Junge bisher einen Sharpe-Roman.
Die Zerstörung von Almeida war Teil des »Kriegs der Festungen«, der blutigen Belagerungen und Schlachten bei Elvas, Almeida, Ciudad Rodrigo und Badajoz. Diese vier Festungen bewachen die beiden Hauptstraßen, die von Spanien nach Portugal führen, und wer auch immer diese vier Festungen hält, kontrolliert den Krieg auf der Iberischen Halbinsel. Solange die Franzosen diese Festungen hielten (und Almeida ergab sich ihnen einen Tag nach der Explosion), konnten sie weiter versuchen, Portugal zu erobern und Wellington so in die Defensive zu zwingen. Wenn Wellington den Krieg nach Spanien tragen wollte, musste er diese Festungen erobern, und die Geschichte der Belagerung von Badajoz 1812 ist eine der großen Geschichten dieses Krieges. Und es war die Geschichte, die ich ursprünglich schon im ersten Sharpe-Roman hatte erzählen wollen, doch ich hatte das Gefühl, dem als Anfänger nicht gewachsen zu sein.
Stattdessen begann ich mit Sharpes Geschichte im Jahre 1809. Die Geschichte von Badajoz mit all ihren Schrecken und Heldentaten kommt erst im dritten Buch, Sharpes Rivalen. In diesem Buch wird auch der zutiefst böse Sergeant Obadiah Hakeswill eingeführt. Ich habe keine Ahnung, wo er hergekommen ist. Eines Tages – ich fuhr gerade irgendwohin – kam mir der Name einfach in den Sinn. Hakeswill. Das ist ein wunderbarer Schurkenname, und Hakeswill war in der Tat furchtbar. Ich schrieb:
Alles an Obadiah Hakeswill war schamlos und widerwärtig, so sehr sogar, dass man es schon wieder faszinierend nennen konnte. Sein Leib war riesig, doch jeder, der den fetten Bauch für ein Zeichen von Schwäche hielt, wurde von den Armen und Beinen zerquetscht, die von ungeheurer Kraft waren. Hakeswill war ungelenk außer auf dem Exerzierplatz, aber selbst wenn er marschierte, hatte man den Eindruck, dass er sich gleich in eine knurrende, schlurfende Bestie verwandeln würde, halb Mensch, halb Tier. Seine Haut war gelblich, ein Andenken an die Fieberinseln, und sein Haar war blond mit grauen Strähnen. Dünn lag es auf seinem vernarbten Schädel und fiel ihm strähnig bis zum übel verunstalteten Hals.
Dann kam der unvergleichliche Pete Postlethwaite, der Obadiah in der Fernsehserie spielte, und ich vergaß diese Beschreibung sofort wieder. Wann immer ich fortan an Hakeswill dachte, sah ich Pete Postlethwaite vor meinem geistigen Auge. Es war ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Schauspieler eine Figur verbessern kann. Aber warum war Hakeswills Hals »übel verunstaltet«? Weil man ihn schon einmal zum Tod am Galgen verurteilt hatte, und er hatte die Hinrichtung überlebt.
Ich erinnere mich daran, wie ich kurz innegehalten habe, nachdem ich das geschrieben hatte. Würde mir das jemand abnehmen? Übertrieb ich es hier nicht nur mit Obadiahs Hals, sondern auch mit seiner Glaubwürdigkeit? Fast hätte ich es wieder rausgestrichen, denn ich fürchtete mich vor den Leserbriefen, doch irgendwie passte es zu Obadiah, dass er sogar den Galgen überlebt hatte, und so ließ ich es drin. Dann, Monate später, fand ich heraus, dass das Royal College of Surgeons eine Liste darüber geführt hatte, wie viele Verurteilte die Ärzte nach ihrer mutmaßlichen Hinrichtung hatten behandeln müssen. Der Grund dafür war einfach: Die Leiche eines Hingerichteten war wertvoll – zunächst einmal für seine (oder ihre) Familie, die den Toten einfach nur beerdigen wollte, aber auch für die Männer, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Leichen für Anatomiestudien zu verkaufen. (Wenn Sie mehr über diesen makabren Handel erfahren wollen, empfehle ich Ihnen Sara Wises faszinierendes Buch The Italian Boy.)
In London Tyburn (was heute Marble Arch ist) gab es keine reguläre Polizei, und oft kam es zu unschicklichen Streitigkeiten zwischen den beiden Interessengruppen. Beide wollten den Gehängten so schnell wie möglich in die Finger bekommen, und als Folge davon wurde manchmal jemand losgeschnitten, bevor er wirklich tot war (damals wurde den Delinquenten noch nicht das Genick gebrochen, sie wurden schlichtweg stranguliert). Wenn die Leichenfledderer ihn bekamen, dann ging es so schnell wie möglich zum nächstgelegenen Hospital, und es war nicht ungewöhnlich, dass die vermeintliche Leiche plötzlich wiederauferstand und die Ärzte ihn behandeln mussten, statt ihn zu sezieren. Hatte jemand seine Hinrichtung auf diese Art überlebt, wurde er auch nicht wieder zum Schafott gebracht, sondern zumeist nach New South Wales geschickt.
Also war Obadiahs Geschichte keineswegs ungewöhnlich, sondern im Gegenteil eher Alltag. Allerdings blieb ihm das Exil in Australien erspart. Irgendwann reagierten die Behörden dann und verlegten die Hinrichtungen vom unkontrollierbaren Tyburn nach Old Bailey, und im Eröffnungskapitel meines Romans Galgendieb beschreibe ich eine Hinrichtung im Jahre 1817. Ich nehme an, dass Sharpe wie jeder Londoner öfter Zeuge solcher Hinrichtungen geworden ist. Schließlich ist er in einer rauen Umwelt aufgewachsen.
Sharpes Rivalen