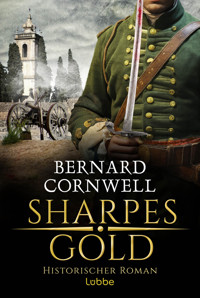9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Richard Sharpe wird Zeuge eines Massakers an einem britischen Außenposten - verantwortlich ist ein englischer Offizier, der zur verfeindeten Marathen-Konföderation übergelaufen ist. Sharpe begibt sich auf die Jagd nach dem Verräter.
Dabei muss er tief ins Feindesland vordringen und wird bald selbst zum Gejagten. Sein Weg führt ihn zu dem kleinen Dorf Assaye, wo die englische Armee sich einer gewaltigen indischen Übermacht stellen muss. Unter den Reihen des Feindes ist auch der Überläufer. Sharpe wittert die Chance, ihn ein für alle Mal zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Weitere Informationen finden Sie aufwww.bernardcornwell.net
Bernard Cornwell
SHARPES SIEG
1803Richard Sharpe und die Schlachtvon Assaye
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
© 1998 by Bernard Cornwell
Titel der Originalausgabe: »Sharpe’s Triumph«
Originalverlag: HarperCollinsPublishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Anja Arendt
Textredaktion: Rainer Delfs
Prüfung der militärhistorischen Details:
Historisches Uniformarchiv Alfred Umhey
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0045-8
luebbe.de
lesejury.de
»Sharpes Sieg« ist Joel Gardnergewidmet,der mich nach Ahmadnagar und Assayebegleitet hat.
KAPITEL 1
Es war nicht Sergeant Richard Sharpes Schuld. Er hatte nicht das Kommando. Sharpe war der jüngste von einem Dutzend Männern, einschließlich eines Majors, eines Subadars – eines eingeborenen Kompanieführers – und zwei eingeborenen Unteroffizieren, dennoch fühlte er sich verantwortlich. Er fühlte sich verantwortlich, ärgerlich, erhitzt, bitter und voller Furcht. Blut war auf seinem Gesicht verkrustet, über das unzählige Fliegen krochen. Sogar in seinen offenen Mund krochen Fliegen.
Aber er wagte sich nicht zu rühren.
Die feuchtheiße Luft stank nach Blut und verfaulten Eiern, der typische Geruch von Pulverrauch. Als Letztes konnte er sich daran erinnern, dass er seinen Tornister und die Patronentasche in die glühende Asche eines Feuers geworfen hatte, und jetzt explodierte die Munition aus der Patronentasche. Bei jeder Pulverexplosion schossen Funken und Asche in die heiße Luft. Ein paar der Männer lachten bei dem Anblick. Sie blieben stehen und schauten hin, stocherten mit ihren Musketen in den Leichen und gingen dann weiter.
Sharpe lag still. Eine Fliege kroch über seine Augen, und er zwang sich, absolut reglos zu bleiben. Auf seinem Gesicht war Blut, auch in seinem rechten Ohr hatte sich Blut gesammelt, das jetzt trocknete. Er blinzelte, befürchtete, dass die Killer die winzige Bewegung bemerken würden, doch keiner nahm Notiz davon.
Chasalgaon. Dort war er. Chasalgaon, eine armselige Festung an der Grenze von Haidarabad, und weil der Maharadscha von Haidarabad ein britischer Verbündeter war, lag die Festung mit hundert Sepoys der East India Company und fünfzig Söldnerreitern aus Maisur in Garnison. Als Sharpe dort eingetroffen war, waren die Hälfte der Sepoys und alle Reiter außerhalb auf Patrouille gewesen.
Sharpe war von Seringapatam gekommen, mit einem Sonderkommando von sechs Privates und einem Lederbeutel voller Rupien, und war von Major Crosby, dem Kommandanten von Chasalgaon, begrüßt worden.
Der Major erwies sich als plumper, rotgesichtiger, reizbarer Mann, der die Hitze verabscheute und Chasalgaon hasste. Er hatte sich auf seinen Segeltuchstuhl plumpsen lassen und Sharpes Befehle entfaltet. Er las sie, stieß einen Grunzlaut aus und las alles noch einmal.
»Warum, zur Hölle, hat man Sie geschickt?«, fragte er schließlich.
»Weil man keinen anderen hatte, Sir.«
Crosby blickte mit gerunzelter Stirn auf den Befehl. »Warum kein Offizier?«
»Es standen keine Offiziere zur Verfügung, Sir.«
»Verdammt verantwortungsvoller Job für einen Sergeant, finden Sie nicht auch?«
»Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir«, sagte Sharpe mit ausdrucksloser Miene und starrte ein paar Zoll über den Kopf des Majors hinweg auf das blassgelbe Segeltuch des Zelts.
»Das will ich Ihnen verdammt noch mal geraten haben«, sagte Crosby und legte die Befehle auf einen Stapel Papier auf seinem Feldtisch. »Und Sie sehen verdammt jung aus, um Sergeant zu sein.«
»Ich wurde spät geboren, Sir«, erwiderte Sharpe. Er war sechsundzwanzig oder glaubte, es zu sein, und die meisten Sergeants waren viel älter.
Crosby, der argwöhnte, veralbert zu werden, sah zu Sharpe auf, doch das Gesicht des Sergeants verriet nicht, dass er sich über ihn lustig machte. Ein gut aussehender Mann, dachte Crosby mürrisch. Vermutlich hatten sich die bibbis von Seringapatam für ihn aus ihren Saris geschält, und Crosby, dessen Frau vor zehn Jahren am Fieber gestorben war und der sich jede Donnerstagnacht mit einer Dorfhure für zwei Rupien tröstete, verspürte eine Spur von Neid.
»Und wie, zum Teufel, wollen Sie die Munition zurück nach Seringapatam bekommen?«, wollte er wissen.
»Mit Ochsenkarren, Sir.« Sharpe hatte seine Art, wenig hilfreiche Offiziere anzusprechen, perfektioniert. Er gab ihnen präzise Antworten, verzichtete auf Unnötiges und klang stets zuversichtlich.
»Womit wollen Sie das schaffen? Mit Versprechungen?«
»Mit Geld, Sir.« Sharpe klopfte auf die Provianttasche, in der der Beutel mit Rupien verstaut war.
»Mein Gott, man vertraut Ihnen Geld an?«
Sharpe entschied sich, diese Frage nicht zu beantworten, sondern nur gelassen auf die Zeltwand zu schauen.
Chasalgaon ist kein glücklicher Ort, sagte er sich. Es war eine kleine Festung, erbaut auf einer Klippe an einem Fluss, dessen Ufer von den Wassern des Monsuns hätten überflutet sein sollen, doch er war dieses Jahr ausgeblieben, und das Land war grausam trocken.
Die Festung hatte keinen Graben ringsum, nur einen Wall aus Kakteen mit einem Dutzend hölzerner Plattformen. Innerhalb des Walls befand sich ein Exerzierplatz, wo ein entrindeter Baumstamm als Flaggenmast diente, und der Paradeplatz war von drei Kasernengebäuden umgeben, deren Dächer mit Palmenblättern bedeckt waren, einem Küchengebäude, Zelten für die Offiziere und einem steinernen Magazin, in dem die Munition der Garnison lagerte. Die Sepoys hatten ihre Angehörigen im Fort, und so war es von Frauen und Kindern überlaufen, doch Sharpe hatte festgestellt, wie verdrossen sie wirkten.
Crosby war anscheinend einer dieser boshaften Offiziere, die nur glücklich waren, wenn es allen ringsum erbärmlich ging.
»Ich nehme an, Sie erwarten, dass ich Ihnen die Ochsenkarren besorge?«, sagte Crosby empört.
»Dafür werde ich selbst sorgen, Sir.«
»Sie sprechen Marathi, wie?«, schnaubte Crosby. »Sie sind ein Sergeant, Bankier und Übersetzer, wie?«
»Ich habe einen Übersetzer mitgebracht, Sir«, sagte Sharpe. Womit er ein bisschen übertrieb, denn Davi Lal war erst dreizehn, ein Straßenbengel aus Seringapatam. Er war ein gerissenes, schelmisches Kind, das von Sharpe beim Stehlen in einem Küchengebäude erwischt worden war. Nachdem er dem Jungen ein paar Ohrfeigen gegeben hatte, um ihm Respekt vor dem Besitz Seiner britannischen Majestät beizubringen, hatte Sharpe ihn zu Lalis Haus gebracht, um ihm ein ordentliches Essen zu geben, und Lali hatte mit dem Jungen gesprochen und erfahren, dass seine Eltern tot waren, dass es keine Verwandten gab, von denen er wusste, und dass er sich mehr oder wenig ehrlich durchs Leben schlug. Er war auch verlaust.
»Du musst ihn loswerden«, hatte sie Sharpe geraten, doch er hatte in Davi Lal etwas gesehen, das ihn an seine Kindheit erinnert hatte, und ihn runter zum Kaveri-Fluss geschleppt, wo er ihn anständig abgeschrubbt hatte. Danach war Davi Lal Sharpes Botenjunge geworden. Er hatte gelernt, Koppel und Stiefel zu putzen und seine eigene Version von Englisch zu sprechen, die, weil sie von den niedrigen Rängen kam, die Engländer und die kultivierten Inder leicht schockieren konnte.
»Sie werden drei Karren benötigen«, sagte Crosby.
»Jawohl, Sir«, erwiderte Sharpe. »Danke, Sir.« Er hatte genau gewusst, wie viele Karren er brauchen würde, doch er wusste ebenso, dass es dumm wäre, dieses Wissen bei einem Offizier wie Crosby preiszugeben.
»Dann suchen Sie Ihre verdammten Karren«, blaffte Crosby, »und lassen Sie mich wissen, wann Sie zum Aufladen bereit sind.«
»Sehr gut, Sir. Danke, Sir.« Sharpe stand still, machte eine Kehrtwendung und marschierte aus dem Zelt, um sich auf die Suche nach Davi Lal und den sechs Privates, einfachen Soldaten der königlichen Armee, zu machen, die im Schatten eines der Kasernengebäude warteten.
»Wir werden zu Mittag essen«, sagte Sharpe, »und am Nachmittag einige Karren beschaffen.«
»Was gibt es zum Essen?«, erkundigte sich Private Atkins.
»Was immer Davi aus dem Küchenbau klauen kann«, sagte Sharpe. »Aber seid schnell damit, klar? Ich will morgen früh aus diesem verdammten Fort verschwinden.«
Ihr Job war es, achtzigtausend Musketenpatronen zu holen, die aus dem Arsenal der East India Company in Madras gestohlen worden waren. Die Patronen waren von der besten Qualität, die man in Indien bekommen konnte, und die Diebe wussten genau, wer ihnen den höchsten Preis für die Munition bezahlen würde.
Die Fürsten der Marathen-Konföderation waren ständig im Krieg gegeneinander oder überfielen die benachbarten Staaten, aber jetzt, im Sommer 1803, drohte eine Invasion von britischen Streitkräften. Die Bedrohung der Invasion hatte zwei der größten Marathen-Herrscher dazu gebracht, eine Allianz zu schließen, die jetzt ihre Truppen zusammenzog, um die Briten zurückzuschlagen, und diese Fürsten hatten den Dieben für die Patronen eine Riesensumme in Gold versprochen. Doch einer der Diebe, der geholfen hatte in das Arsenal in Madras einzubrechen, hatte sich geweigert, seinen Bruder in die Bande aufzunehmen und mit ihm den Profit zu teilen, und so hatte der Bruder die Bande an die Spione der Company verraten.
Zwei Wochen später war die Karawane, die die Patronen durch Indien transportierte, nicht weit von Chasalgaon von Company-Sepoys aus dem Hinterhalt überfallen worden. Die Diebe waren getötet worden oder geflüchtet, und die wiedereroberte Munition war zur sicheren Verwahrung in das kleine Magazin des Forts gebracht worden. Jetzt sollten die achtzigtausend Patronen zum Arsenal in Seringapatam gebracht werden – ein dreitägiger Marsch nach Süden – wo sie an die britischen Truppen ausgegeben werden sollten, die sich auf den Krieg gegen die Marathen vorbereiteten.
Ein einfacher Job, und Sharpe, der die letzten vier Jahre als Sergeant im Arsenal von Seringapatam verbracht hatte, war die Verantwortung übertragen worden.
Makulatur, verdorbene Ware, dachte Sharpe, während seine Männer auf einem Feuer aus Ochsendung in einem Kessel Flusswasser kochten. Das war der Schlüssel für die nächsten paar Tage – die Ware war verdorben. Niemand in Seringapatam würde der Behauptung widersprechen, dass, zum Beispiel, siebentausend Patronen in der hohen Luftfeuchtigkeit unbrauchbar geworden waren. Sharpe nahm an, dass er die siebentausend Patronen an Vakil Hussein verkaufen konnte, solange er natürlich von achtzigtausend ausgehen konnte. Major Crosby hatte nichts von dieser Zahl gesagt, aber als Sharpe das gerade dachte, tauchte der Major mit Zweispitz und Degen aus seinem Zelt auf.
»Achtung, aufstehen!«, raunte Sharpe scharf seinen Jungs zu, als der Major sich näherte.
»Ich dachte, Sie besorgen Ochsenkarren?«, blaffte Crosby Sharpe an.
»Erst kommt das Essen, Sir.«
»Ihr Essen, hoffe ich, nicht unseres, oder? Wir bekommen hier keine Verpflegung, um die Soldaten des Königs zu füttern, Sergeant.« Major Crosby stand im Dienst der East India Company, und obwohl er einen roten Uniformrock wie die Armee des Königs trug, gab es wenig Liebe zwischen den beiden Streitkräften.
»Unser Essen, Sir«, sagte Sharpe und wies auf den Kessel, in dem jetzt Reis und Ziegenfleisch, beides aus Crosbys Lager gestohlen, gekocht wurden. »Das hatten wir mitgebracht, Sir.«
Ein Havildar, ein eingeborener Sergeant, rief vom Tor und versuchte, Crosby auf sich aufmerksam zu machen, doch der Major ignorierte den Ruf.
»Ich vergaß, eine Sache zu erwähnen, Sergeant«, sagte er zu Sharpe.
»Sir?«
Crosby wirkte einen Moment verlegen, dann erinnerte er sich daran, dass er nur mit einem Sergeant sprach. »Einige der Patronen sind unbrauchbar geworden. Verdorben von der Luftfeuchtigkeit.«
»Ich bedaure, das zu hören, Sir«, sagte Sharpe mit unbewegtem Gesicht.
»So musste ich sie zerstören«, sagte Crosby. »Sechs oder siebentausend, wie ich mich erinnere.«
»Das ist normaler Schwund, Sir, der immer wieder vorkommt.«
»Genau.« Crosby schaffte es nicht zu verbergen, dass er erleichtert war, weil Sharpe seine Geschichte so leicht akzeptierte. »So ist es leider.« Dann drehte er sich zum Tor. »Havildar?«
»Company-Soldaten nähern sich, Sahib!«
»Wo ist Captain Leonard?«, fragte Crosby. »Ich denke, der ist der Offizier vom Dienst?«
»Hier, Sir, hier bin ich.« Ein großer, schlaksiger Captain eilte aus einem Zelt und stolperte über ein Halteseil, fing sich und rückte seinen Hut zurecht, während er zum Tor eilte.
Sharpe musste rennen, um Crosby einzuholen, der ebenfalls zum Tor rannte. »Sie geben mir eine Bescheinigung, Sir?«
»Eine Bescheinigung? Wofür sollte ich Ihnen eine Bescheinigung geben?«
»Die Schadensmeldung, Sir«, sagte Sharpe respektvoll. »Ich werde für die Patronen geradestehen müssen.«
»Später«, sagte Crosby, »später.«
»Jawohl, Sir«, erwiderte Sharpe, und er dachte: Leck mich, du verdammter Bastard!
Captain Leonard stieg auf die Plattform neben dem Tor, und Crosby gesellte sich zu ihm. Der Major nahm ein Fernrohr aus der Rocktasche.
Die Plattform bot einen Blick über den kleinen Fluss, der in der Regenzeit angeschwollen sein sollte, doch das Ausbleiben des Monsuns hatte nur ein dünnes Rinnsal zwischen den grauen Felsen gelassen.
Jenseits des fast trockenen Flussbettes, vor dem Horizont hinter einem Hain, konnte Crosby rot berockte Soldaten sehen, die von einem europäischen Offizier auf einem Rappen geführt wurden, und sein erster Gedanke war, dass es Captain Roberts sein musste, der von der Patrouille zurückkehrte, doch Roberts ritt einen Schecken. Außerdem hatte er nur fünfzig Sepoys mitgenommen, und dieser Reiter führte eine fast doppelt so große Kompanie.
»Öffnet das Tor!«, befahl Crosby und fragte sich, wer, zum Teufel, der Mann auf dem Rappen sein mochte. Vermutlich war es Captain Sullivan von der Garnison bei Milladar, einer anderen Grenzfestung wie Chasalgaon. Aber was trieb Sullivan hier? Vielleicht ließ er einige neue Rekruten marschieren, um die jungen Burschen abzuhärten – nicht, dass die mageren kleinen Bastarde Weichlinge waren –, aber es war unhöflich von Sullivan, Crosby sein Kommen nicht anzukündigen.
»Jemadar«, rief Crosby, »lassen Sie die Wache antreten!«
»Sahib, die Wache antreten lassen!«, wiederholte der Jemadar den Befehl. Andere Sepoys öffneten das Tor.
Er wird hier essen wollen, dachte Crosby verdrossen und fragte sich, was zum Mittagessen gekocht wurde. Ziegenfleisch vermutlich, mit Reis. Nun, Sullivan würde einfach mit dem zähen Fleisch vorliebnehmen müssen. Das ist der Preis dafür, dass er sich nicht angemeldet hat. Und wenn er erwartet, dass ich seine Sepoys ebenso beköstige, hat er sich geschnitten. Chasalgaons Köche hatten keine Besucher erwartet und würden nicht genug Verpflegung für hundert weitere hungrige Sepoys haben.
»Ist das Sullivan?«, fragte er Leonard und reichte dem Captain das Fernrohr.
Leonard spähte lange zu den nahenden Reitern.
»Ich habe Sullivan nie kennengelernt«, sagte er schließlich, »und deshalb kann ich das nicht sagen.«
Crosby riss ihm fast das Fernrohr aus der Hand.
»Lassen Sie für den Bastard Salut schießen, wenn er eintrifft«, befahl er, »und sagen Sie ihm, dass er mir beim Essen Gesellschaft leisten kann.« Er überlegte kurz. »Sie meinetwegen auch«, fügte er widerwillig hinzu.
Dann kehrte Crosby zu seinem Zelt zurück. Er hielt es für besser, Leonard den Fremden willkommen heißen zu lassen, anstatt sich selbst darum zu kümmern. Verdammter Sullivan, der ihn nicht vorgewarnt hatte! Dennoch konnte die Sache auch eine gute Seite haben, denn Sullivan brachte vielleicht Neuigkeiten. Der große, gut aussehende Sergeant aus Seringapatam hätte Crosby zweifellos die jüngsten Gerüchte aus Maisur erzählen können, doch es müsste ein kalter Tag in der Hölle sein, bevor Crosby einen Sergeant nach Neuigkeiten fragen würde. Aber ohne Zweifel veränderte sich etwas in der Gesamtlage, denn es war neun Wochen her, seit Crosby zum letzten Mal einen Marathen-Plünderer gesehen hatte, und das war äußerst sonderbar.
Die Festung Chasalgaon hatte den Zweck, Stoßtrupps aus dem Fürstentum von Haidarabads reichem Territorium fernzuhalten, und Crosby bildete sich ein, seine Sache gut gemacht zu haben. Trotzdem fand er die Abwesenheit sämtlicher feindlichen Marodeure merkwürdig. Was führten die Bastarde im Schilde?
Crosby setzte sich an seinen Tisch und rief nach seinem Schreiber. Er würde dem verdammten Munitions-Sergeant eine Bescheinigung schreiben lassen, in der er den Verlust von siebentausend Patronen mit einem Leck im Steindach von Chasalgaons Magazin erklären würde. Er würde gewiss nicht zugeben, dass er die Munition an einen Händler verkauft hatte.
Sharpe sagte zu seinen Männern: »Der Dreckskerl hat die verschwundenen Patronen an irgendeinen heidnischen Bastard verscherbelt.«
»Genau das wollten Sie auch tun, Sergeant«, meinte Private Phillips.
»Es hat dich verdammt nicht zu interessieren, was ich tun wollte«, sagte Sharpe. »Ist das Essen noch nicht fertig?«
»In fünf Minuten«, versprach Davi Lal.
»Das könnte ein Kamel ja schneller machen«, grollte Sharpe. Dann nahm er seinen Tornister und die Provianttasche. »Ich geh mal pinkeln.«
»Er geht nie irgendwohin, ohne diesen verdammten Tornister mitzunehmen«, bemerkte Atkins.
»Er will nicht, dass ihm jemand sein Ersatzhemd klaut«, mutmaßte Phillips.
»Da ist mehr als ein Hemd drin. Darin versteckt er etwas.« Atkins drehte sich um. »He, Stachelschwein!« Sie alle nannten Davi Lal »Stachelschwein«, weil seine Haare wie Stachel aufragten; ganz gleich, wie fettig oder wie kurz geschnitten es war, es sträubte sich wie Stacheln. »Was versteckt Sharpie in seinem Tornister?«
Davi Lal lachte, dann wandte er sich wieder dem Kessel zu.
Draußen beim Tor begrüßte Captain Leonard die Besucher. Die Wache präsentierte die Waffen, als der Offizier die Sepoys durch das Tor führte.
Der Besucher erwiderte den Gruß, indem er an die Krempe seines Zweispitzes tippte, der sein Gesicht beschattete. Er war ein ungewöhnlich großer Mann, und seine Steigbügel waren so tief geschnallt, dass er zu groß für sein Pferd wirkte. Es war ein altes Schlachtross mit räudigem Fell, doch das war nichts Ungewöhnliches, denn gute Pferde waren ein Luxus in Indien, und die meisten Kompanieoffiziere ritten betagte Klepper.
»Willkommen in Chasalgaon, Sir«, sagte Leonard. Er war sich nicht sicher, ob er den Fremden mit »Sir« ansprechen sollte, denn der Mann trug kein sichtbares Rangabzeichen auf seiner roten Jacke, doch sein Verhalten war das eines ranghohen Offiziers, und er reagierte auf Leonards Begrüßung mit lordhafter Nonchalance. »Sie sind eingeladen, mit uns zu speisen, Sir«, fügte Leonard hinzu und folgte eilig dem Reiter, der seine Reitpeitsche von seinem Koppel gezogen hatte und jetzt seine Sepoys auf den Paradeplatz führte.
Er zügelte sein Pferd unter dem Flaggenmast, an dem in der windstillen Luft die britische Fahne hing, dann wartete er, bis sich seine Kompanie rot berockter Sepoys in zwei Einheiten trennte, die in sich in zwei Gliedern links und rechts des Flaggenmastes aufstellten.
Crosby beobachtete es aus seinem Zelt. Es war ein zackiger Auftritt, fand er.
»Halt!«, befahl der fremde Offizier, als seine Kompanie mitten im Fort war. Die Sepoys hielten an. »Linksum! Musketen absetzen! Guten Morgen!« Schließlich blickte er auf Captain Leonard hinab. »Sind Sie Crosby?«
»Nein, Sir. Ich bin Captain Leonard, Sir. Und Sie sind …?«
Der große Mann ignorierte die Frage. Er blickte sich mit finsterer Miene in der Festung Chasalgaon um, als missbillige er alles, was er sah.
Was, zur Hölle, soll das?, dachte Leonard. Eine Überraschungsinspektion?
»Soll ich Ihr Pferd tränken lassen, Sir?«, fragte Leonard.
»Alles zu seiner Zeit, Captain«, sagte der geheimnisvolle Offizier, drehte sich in seinem Sattel um und bellte den Befehl: »Bajonett aufpflanzen!«
Die Sepoys zogen ihre Siebzehn-Zoll-Klingen und befestigten sie über der Mündung ihrer Musketen.
»Ich möchte einem befreundeten Engländer einen richtigen Salut bieten«, erklärte der große Mann Leonard. »Sie sind Engländer, nicht wahr?«
»Jawohl, Sir.«
»Zu viele verdammte Schotten in der Kompanie«, grollte der große Mann. »Haben Sie das je bemerkt, Leonard? Jede Menge Kroppzeug, aber keine Engländer. Überhaupt keine Engländer.« Er hob die Stimme. »Kompanie! Musketen aufnehmen! Legt an!«
Die Sepoys nahmen die Gewehre an die Schulter, und Leonard sah viel zu spät, dass sie auf die Soldaten der Garnison zielten.
»Nein!«, krächzte er, denn er konnte nicht glauben, was er da sah.
»Feuer!«, rief der Offizier, und im nächsten Augenblick war der Paradeplatz von Musketenschüssen erfüllt, und das Grauen kam über die nichts ahnende Garnison.
»Jagt sie jetzt!«, rief der große Offizier durch den wallenden Rauch. »Jagt sie! Schnell, schnell, schnell!« Er trieb sein Pferd zu Captain Leonard und schlug fast lässig mit seinem Säbel zu, riss die Klinge aus dem Nacken des Captains, wo sie Sehnen, Muskeln und Fleisch zerschmettert hatte.
»Jagt sie! Jagt sie!«, rief der Offizier, als Leonard fiel. Er zog eine Pistole aus seinem Sattelfutteral und preschte auf die Offizierszelte zu. Seine Männer stießen Kriegsschreie aus und eilten durch die kleine Festung, um jeden Sepoy von Chasalgaons Garnison niederzumachen. Es war ihnen befohlen worden, erst die Männer zu töten, dann die Frauen und Kinder.
Crosby hatte in einer Mischung aus Entsetzen und Ungläubigkeit auf die Szene gestarrt, und jetzt begann er mit zitternden Händen eine seiner Pistolen zu laden, doch plötzlich verdunkelte sich der Eingang seines Zelts, und er sah, dass der große Offizier von seinem Pferd gestiegen war.
»Sind Sie Crosby?«, fragte der Offizier.
Crosby konnte kein Wort hervorbringen. Seine Hände zitterten, und Schweiß lief über sein Gesicht.
»Sind Sie Crosby?«, wiederholte der große Mann gereizt.
»Ja«, schaffte Crosby hervorzustoßen. »Und wer, zum Teufel, sind Sie?«
»Dodd«, sagte der große Mann. »Major William Dodd, zu Ihren Diensten.« Und Dodd hob seine Pistole und richtete sie auf Crosbys Gesicht.
»Nein!«, schrie Crosby.
Dodd lächelte. »Ich nehme an, Sie übergeben mir die Festung, Crosby?«
»Der Teufel soll Sie holen!«
»Sie saufen zu viel, Major«, sagte Dodd. »Die ganze Kompanie weiß, dass Sie ein Säufer sind. War keine große Gegenwehr, wie?« Er drückte ab, und Crosbys Kopf ruckte in einem Schwall von Blut zurück, der auf die Zeltwand spritzte. »Schade, dass Sie Engländer sind«, sagte Dodd. »Ich hätte viel lieber einen Schotten erschossen.«
Der sterbende Major stieß einen schrecklichen, gurgelnden Laut aus, dann zuckte sein Körper unkontrolliert und lag schließlich still.
»Lobet den Herrn, reißt die Fahne runter, und sucht die Soldkasse«, murmelte Dodd. Dann trat er über die Leiche des Majors hinweg, um nachzusehen, ob die Kasse unter dem Bett war, wie er annahm. »Subadar!«, wandte er sich an einen einheimischen Kompanieführer.
»Sahib?«
»Zwei Mann her zum Bewachen der Soldkasse!«
»Sahib!«
Major Dodd eilte zurück zum Paradeplatz, wo eine kleine Gruppe britischer Rotröcke Widerstand leistete. Er wollte sicherstellen, dass seine Sepoys sich darum kümmerten, doch ein eingeborener Sergeant hatte Dodds Befehle erwartet und führte bereits eine Gruppe gegen das halbe Dutzend Briten.
»Setzt die Klingen ein«, ermunterte Dodd sie. »Hart zustoßen! Dreht sie rein! So ist’s richtig! Passt auf eure linke Seite auf. Links!« Seine Stimme klang alarmiert, denn ein großer Sergeant war plötzlich hinter dem Küchengebäude aufgetaucht, ein Weißer mit Muskete und Bajonett, doch einer der Sepoys hatte selbst noch eine geladene Muskete und fuhr herum, zielte und feuerte, und Dodd sah einen neuen Sprühregen von Blut im Sonnenschein.
Der Sergeant war in den Kopf getroffen worden. Er verharrte jäh, seine Miene war überrascht, als ihm die Muskete aus den Händen fiel und Blut über sein Gesicht strömte. Dann schlug er rücklings hin und blieb reglos liegen.
»Sucht nach dem Rest der Bastarde!«, befahl Dodd. Er wusste, dass noch viele Männer der Garnison in den Kasernengebäuden versteckt sein mussten. Einige der Männer waren über den Kakteenwall entkommen, doch sie würden von den Marathen-Reitern gejagt und niedergemacht werden, die Dodds Verbündete waren und sich jetzt auf beiden Seiten der Festung verteilt hatten. »Sucht gut!« Er selbst sah sich die Pferde der Offiziere der Garnison an und stellte fest, das eines etwas besser als sein eigenes war. Diesem legte er seinen Sattel auf, führte es in den Sonnenschein und band es am Flaggenmast an.
Eine Frau rannte an ihm vorbei, flüchtete schreiend vor den rot berockten Killern, aber ein Sepoy holte sie ein, brachte sie zu Fall, und ein anderer riss ihr den Sari herab. Dodd wollte die Männer schon von der Frau weg befehlen, doch dann sagte er sich, dass sie den Feind gut geschlagen hatten und die Männer ihren Spaß haben konnten.
»Subadar?«, rief er.
»Sahib?«, meldete sich der eingeborene Kompanieführer.
»Eine Gruppe, um sicherzustellen, dass alle tot sind. Eine andere, um die Waffenkammer zu öffnen. Und da sind ein paar Pferde im Stall. Such dir selbst eins aus. Die anderen werden wir zu Pohlmann mitnehmen. Und – gut gemacht, Gopal.«
»Danke, Sahib«, sagte Subadar Gopal.
Dodd wischt das Blut von seinem Säbel und lud dann seine Pistole.
Einer der Verwundeten versuchte, sich am Boden aufzurichten. Dodd ging zu ihm, beobachtete einen Moment seine schwachen Bemühungen und schoss ihm dann eine Kugel in den Kopf. Der Mann zuckte ein paar Mal im Todeskampf und lag dann still. Major Dodd starrte finster auf das Blut, das auf seine Stiefel gespritzt war, doch dann spuckte er darauf und wischte es ab.
Sharpe beobachtete den großen Killer aus dem Augenwinkel. Er fühlte sich verantwortlich, ärgerlich, erhitzt, bitter und ängstlich. Das Blut war aus seiner Schädelwunde gesickert. Er war benommen und hatte Kopfschmerzen, doch er lebte. In seinem Mund waren Fliegen. Und dann begann seine Munition zu explodieren, und der große Offizier fuhr herum, rechnete mit Gefahr, und ein paar Männer lachten über den Anblick von Asche, die bei jedem kleinen Knall von Pulver in die Luft wirbelte.
Sharpe wagte es nicht, sich zu bewegen. Er lauschte den Schreien von Frauen und dem Weinen von Kindern. Dann hörte er Hufschlag und wartete, bis einige Reiter in Sicht kamen. Es waren Inder, alles wild aussehende Kerle mit Säbeln, Luntenschlossmusketen, Speeren, Lanzen und sogar Pfeil und Bogen. Sie glitten aus ihren Sättel und schlossen sich der Jagd nach Beute an.
Sharpe blieb wie ein Toter liegen. Das sich verkrustende Blut war dick auf seinem Gesicht. Der Treffer der Musketenkugel hatte ihn betäubt, und so erinnerte er sich nicht, dass er auf seine eigene Muskete zu Boden gefallen war, aber er spürte, dass die Verletzung nicht tödlich war. Die Wunde war nicht mal tief. Sein Kopf schmerzte, und die Gesichtshaut war angespannt mit verkrustetem Blut, doch er wusste, dass Kopfwunden stets stark bluten. Er versuchte, flach zu atmen, ließ den Mund offen und würgte nicht, als eine Fliege über seine Zunge kroch, und dann konnte er Tabak, Arrak, Leder und Schweiß riechen.
Ein Mann mit einem Furcht erregend gekrümmten Messer und rostiger Klinge beugte sich über ihn, und Sharpe befürchtete, er wolle ihm die Kehle durchschneiden, doch stattdessen begann er, die Taschen von Sharpes Uniform aufzuschlitzen. Er fand den großen Schlüssel, der Seringapatams Hauptmagazin geöffnet hatte, ein Schlüssel, den Sharpe auf dem Basar hatte kopieren lassen, sodass er nicht stets das Formular im Wachzimmer der Waffenkammer hatte ausfüllen müssen. Der Mann, der ihn durchsuchte, warf den Schlüssel fort, schlitzte eine andere Tasche auf, fand nichts von Wert und widmete sich dann einer anderen Leiche. Sharpe starrte durch Lidspalten zur Sonne empor.
Irgendwo in der Nähe stöhnte ein Sepoy der Garnison, und fast sofort wurde er mit dem Bajonett getötet. Sharpe hörte das röchelnde Ausatmen, als der Mann starb, und das saugende Geräusch, mit dem der Mörder die Klinge wieder aus dem Körper zog.
Es war alles so schnell geschehen! Und Sharpe fühlte sich verantwortlich, obwohl er wusste, dass es nicht seine Schuld war. Nicht er hatte die Killer in die Festung gelassen, doch er hatte ein paar Sekunden gezögert, seinen Tornister und die Patronentasche ins Feuer zu werfen, und jetzt machte er sich Vorwürfe, weil er diese paar Sekunden genutzt haben könnte, um seine sechs Männer zu retten. Doch die meisten waren bereits tot oder im Sterben gewesen, als Sharpe erkannt hatte, dass es ein Massaker geben würde.
Sharpe hatte seine Blase an der Rückwand des Küchenbaus erleichtert, als eine Musketenkugel durch die Wand aus Rohrmatten geschlagen war. Ein, zwei Sekunden hatte er nur ungläubig dagestanden und konnte kaum die Schüsse und Schreie glauben, die seine Ohren wahrnahmen. Er hatte sich nicht mal die Zeit genommen, seine Hose zuzuknöpfen, sondern war einfach herumgefahren, hatte das niedergebrannte Lagerfeuer gesehen und seinen Tornister hineingeworfen. Als er dann seine Muskete gespannt hatte und dorthin zurückgerannt war, wo seine Männer auf das Mittagessen warteten, war der Kampf fast vorüber gewesen. Die Musketenkugel hatte seinen Kopf zurückgerissen, und plötzlich hatte sein Schädel heftig geschmerzt, und als Nächstes hatte er erst wieder wahrgenommen, dass er mit verkrustetem Blut auf dem Gesicht am Boden gelegen hatte und Fliegen in seinen Mund gekrochen waren.
Aber vielleicht hätte er seine Männer dem Tod entreißen können. Er quälte sich mit dem Gedanken, dass er Davi Lal und ein paar der Privates hätte retten und vielleicht den Kakteenwall überqueren und zwischen die Bäume hätte flüchten können, doch Davi Lal und alle sechs Privates waren tot, und Sharpe konnte die Killer lachen hören, als sie die Munition aus dem kleinen Magazin schleppten.
»Subadar!«, rief der große Offizier. »Reiß die verdammte Fahne vom Mast, und zwar sofort!«
Sharpe konnte nicht verhindern, dass er wieder blinzeln musste. Zum Glück bemerkte es niemand. Dann schloss er die Augen, weil die Sonne ihn blendete, und er hätte vor Zorn, Frustration und Hass fast geheult. Sechs Männer und Davi Lal tot, und er, Sharpe, hatte verdammt nichts tun können, um ihnen zu helfen. Er fragte sich, wer der große Offizier war. Dann hörte er aus einem Ruf die Antwort heraus.
»Major Dodd, Sahib?«
»Subadar?«
»Alles ist verladen, Sahib.«
»Dann lasst uns verschwinden, bevor die Patrouille zurückkehrt. Gut gemacht, Subadar! Sag den Männern, dass sie eine Belohnung bekommen.«
Sharpe lauschte, als die Räuber die Festung verließen. Wer, zum Teufel, waren sie? Major Dodd hatte die Uniform der East India Company getragen, ebenso all seine Männer, aber sie waren bestimmt keine Soldaten der Company. Sie waren Killer, nichts anderes, Bastarde aus der Hölle, und sie hatten in Chasalgaon mörderisch gewütet.
Sharpe bezweifelte, dass sie bei ihrem hinterhältigen Angriff einen einzigen Mann verloren hatten, doch er blieb still liegen, während die Geräusche ihres Abzugs verklangen. Ein Baby schrie, eine Frau schluchzte, und immer noch wartete Sharpe, bis er schließlich überzeugt war, dass Major Dodd und seine Männer fort waren. Erst dann wälzte er sich auf die Seite.
In der Festung stank es nach Blut, um das die Fliegen schwärmten. Sharpe stöhnte und richtete sich auf die Knie. Reis und Ziegenfleisch waren in dem Kessel verbrannt. Er stand auf und trat ihn von dem Dreibein.
»Bastarde«, fluchte er flüsternd. Er sah den überraschten Ausdruck auf Davi Lals Gesicht und hätte am liebsten um den Jungen geweint.
Eine halb nackte Frau, die aus dem Mund blutete, sah Sharpe inmitten der blutigen Leichen stehen, und sie zerrte schreiend ihr Kind in die Kasernenbaracke. Sharpe ignorierte sie. Seine Muskete war weg. Sämtliche Waffen waren verschwunden.
»Bastarde!«, schrie er in die heiße Luft, und dann trat er nach einem Hund, der an Phillips’ Leiche schnüffelte.
Der Geruch von Blut, Pulver und verbranntem Reis hing schwer in der Luft und ließ ihn würgen. Er ging in das Küchengebäude und fand einen Krug mit Wasser. Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, klatschte er sich Wasser ins Gesicht und wischte das Blut fort. Er feuchtete ein Tuch an und zuckte zusammen, als er die Streifschusswunde auf seinem Schädel säuberte. Plötzlich übermannten ihn das Grauen und der Schmerz, und er fiel auf die Knie und unterdrückte ein Schluchzen.
»Verdammte Verbrecher!« Wieder und wieder fluchte er, hilflos und wütend. Dann erinnerte er sich an seinen Tornister. Und so richtete er sich wieder auf und ging in den Sonnenschein hinaus.
Die Asche des Feuers war noch heiß, und das verkohlte Segeltuch seines Tornisters und das Leder der Patronentasche glühten rot, als er einen Stock fand und in der glühenden Asche stocherte. Er fand das, was er im Feuer zu verbergen versucht hatte: die Rupien für das Mieten der Karren, dann die Rubine und Smaragde, Diamanten und Perlen, die Saphire und das Gold. Er holte einen Reissack aus dem Küchengebäude, schüttete den Reis auf den Boden und füllte den Sack mit seinem Schatz. Es war eine Riesensumme, und er hatte sie vor vier Jahren am Wassertor in Seringapatam einem König abgenommen. Sharpe hatte Tippu Sultan niedergeschossen und von seinen Leichnam die Kriegsbeute an sich genommen.
Jetzt kniete er, den Sack mit dem Schatz an seinen Körper gepresst, im Gestank von Chasalgaon und fühlte sich schuldig. Er hatte ein Massaker überlebt, es jedoch nicht verhindern können. Zorn mischte sich mit seinem Schuldgefühl, dann wurde ihm klar, dass er seine Pflicht tun musste. Er musste alle anderen finden, die überlebt hatten, und ihnen helfen, und dann musste er seine Rache planen.
Seine Rache an einem Mann namens Dodd.
Major John Stokes war Ingenieur, und wenn je ein Mann glücklich mit seinem Beruf war, dann der Major. Nichts bereitete ihm mehr Spaß, als knifflige Dinge zu machen, ob es nun die Verbesserung einer Lafette, das Anlegen eines Gartens oder, wie im Augenblick, die Reparatur einer Uhr war, die dem Radscha von Maisur gehörte.
Der Radscha war ein junger Mann, fast noch ein Junge, und er verdankte seinen Thron den britischen Truppen, die den Usurpator, Tippu Sultan, besiegt hatten. Als Resultat waren die Beziehungen zwischen dem Palast und Seringapatams kleiner britischer Garnison gut.
Major Stokes hatte in einem der Vorzimmer des Palastes eine Uhr gefunden und ihre erschreckende Ungenauigkeit bemerkt. Aus diesem Grund hatte er sie in die Waffenkammer mitgenommen und baute sie jetzt glücklich auseinander.
»Sie ist nicht gekennzeichnet, und ich nehme an, sie ist das Werk eines örtlichen Uhrmachers«, sagte er zu seinem Besucher. »Aber bestimmt hatte ein Franzose dabei Einfluss. Sehen Sie das Hemmungsrad? Typische französische Arbeit ist das.«
Der Besucher spähte in das Gewirr der Zahnräder. »Wusste gar nicht, dass die Franzmänner das Zeug zum Uhrmacher haben, Sir«, sagte er.
»Oh, das haben sie tatsächlich!«, sagte Stokes tadelnd. »Sie machen sehr feine Uhren! Ausgezeichnete. Denken Sie an Lépine! Denken Sie an Berthoud! Und wie können Sie Montandon außer Acht lassen? Und Breguet!« Der Major schüttelte in stummem Tadel über die Unkenntnis seines Besuchers den Kopf und spähte dann auf den bedauernswerten Zeitmesser des Radschas. »Etwas Rost auf der Hauptfeder, wie ich sehe. So was geht nicht. Liegt am weichen Metall, nehme ich an. Ich habe diese fantastisch dekorative Arbeit bemerkt, aber die Mechanik bei dieser Uhr ist Schund. Sehen Sie sich diese Hauptfeder an. Eine Schande!«
»Schockierend, Sir, schockierend.« Sergeant Obadiah Hakeswill konnte keine Hauptfeder von einem Pendel unterscheiden, und es interessierte ihn auch nicht im Geringsten, doch er brauchte Informationen von Major Stokes, und so war es angezeigt, Interesse zu heucheln.
»Sie schlug neun, wenn sie erst acht hätte schlagen sollen«, sagte der Major und stieß einen Finger in die Innereien der Uhr, »oder vielleicht schlug sie acht, wenn es schon neun war, ich kann mich nicht genau erinnern. Eins bis sieben klappt großartig, doch gegen acht kommen die Macken.« Der Major, verantwortlich für Seringapatams Waffenkammer, war ein korpulenter, fröhlicher Mann mit vorzeitig ergrautem Haar. »Verstehen Sie was von Uhren, Sergeant?«
»Das kann ich nicht behaupten, Sir. Ich bin ein einfacher Soldat, Sir, für den die Sonne die Uhr ist.« Im Gesicht des Sergeants zuckte es. Das krampfhafte Zucken verzerrte sein Gesicht alle paar Sekunden.
»Sie haben nach Sharpe gefragt«, sagte Major Stokes und spähte in die Uhr. »Du meine Güte. Dieser Typ hier hat die Achsenlager aus Holz gemacht. Herr im Himmel. Aus Holz! Kein Wunder, dass die Uhr nicht korrekt läuft! Harrison hat einst eine hölzerne Uhr gemacht, wussten Sie das? Sogar die Zahnräder. Alles aus Holz.«
»Harrison, Sir? Ist er in der Armee, Sir?«
»Er ist ein Uhrmacher, Sergeant, ein Uhrmacher. Und ein sehr guter.«
»Kein Franzmann, Sir?«
»Mit einem Namen wie Harrison? Guter Gott, nein. Er ist Engländer, und er macht gute, genau gehende Uhren.«
»Freut mich, das zu hören, Sir«, sagte Hakeswill, dann erinnerte er den Major an den Grund seines Besuchs in der Waffenkammer. »Sergeant Sharpe, Sir, mein guter Freund, Sir, ist er hier?«
»Er ist hier«, sagte Stokes und blickte von der Uhr auf, »oder war es, genauer gesagt. Ich sah ihn vor einer Stunde. Doch er ging zu seinem Quartier. Er ist fort gewesen, wissen Sie? War in diese furchtbare Sache in Chasalgaon verwickelt.«
»Chasalgaon, Sir?«
»Schreckliche Sache, schrecklich! So habe ich Sharpe gesagt, er soll sich säubern. Der arme Kerl war mit Blut bedeckt. Sah wie ein gestrandeter Pirat aus. Du meine Güte, das ist aber interessant!«
»Blut, Sir?«, fragte Hakeswill.
»Ein sechszähniges Verbindungsrad! Mit einem gegabelten Verschluss. Ach, du meine Güte! Das ist, als ob man den Pudding mit Korinthen verfeinert! Sie sollten Geduld haben und warten, Sergeant. Sharpe wird bald zurückkommen. Er ist ein wunderbarer Mensch. Lässt mich nie im Stich.«
Hakeswill zwang sich zu einem Lächeln, denn er hasste Sharpe abgrundtief. »Er ist einer der Besten, Sir«, sagte er, und in seinem Gesicht zuckte es. »Und er wird Seringapatam bald zu einem Botengang verlassen, nicht wahr, Sir?«
»O nein«, widersprach Major Stokes und nahm ein Vergrößerungsglas, um genauer in die Uhr zu spähen. »Ich brauche ihn hier, Sergeant. Da haben wir’s, sehen Sie, da fehlt ein Stift am Glockenanschlagsrad. Es greift in diese Rädchen hier, und das Getriebe hier erledigt den Rest.« Der Major blickte auf, doch der sonderbare Sergeant mit dem zuckenden Gesicht war verschwunden. Es machte nichts, denn die Uhr war weitaus interessanter.
Sergeant Hakeswill verließ die Waffenkammer und wandte sich zu den Kasernengebäuden, wo er ein vorübergehendes Quartier hatte. Das 33. Regiment des Königs war jetzt in Hurryhur, etwa hundertfünfzig Meilen nördlich, untergebracht, und seine Aufgabe war es, die Straßen im westlichen Maisur von Banditen frei zu halten. So bewegte es sich in diesem Gebiet auf und ab und befand sich in der Nähe von Seringapatam beim Hauptarsenal, und Colonel Gore hatte eine Abteilung losgeschickt, um Munition zu beschaffen. Captain Morris von der Leichten Kompanie hatte die Aufgabe, mit der Hälfte seiner Männer und Sergeant Obadiah Hakeswill für die Sicherheit der Ladung zu sorgen, die am nächsten Morgen die Stadt verlassen würde. Mit Ochsenkarren würden die Waffen nach Arrakerry transportiert werden, wo das Regiment gegenwärtig biwakierte. Ein leichter Job, der Sergeant Hakeswill eine Gelegenheit bot, die er lange gesucht hatte.
Der Sergeant stoppte bei einer der Trinkstuben und bestellte Arrak. Die kleine Gaststube war leer bis auf den Besitzer und einen Bettler ohne Beine, der dem Sergeant die Arme entgegenreckte und für seine Mühe einen Tritt erhielt.
»Raus hier, du schäbiger Bastard!«, rief Hakeswill. »Du bringst die Fliegen rein. Hau ab. Verpiss dich.«
Als der Laden zu seiner Zufriedenheit geleert war, setzte sich Hakeswill in eine düstere Ecke und dachte über sein Leben nach. »Ich hadere mit mir«, murmelte er vor sich hin, und in seinem Gesicht zuckte es. Der Besitzer der Trinkstube wagte ihn kaum anzusehen, denn er fürchtete den finsteren Mann im roten Rock.
»Deine eigene Schuld, Obadiah!«, sagte Hakeswill. »Das hättest du schon vor Jahren erkennen müssen. Vor Jahren! Er ist reich wie ein Jude, das ist er.« Er blickte zu dem Kneipenwirt. »Belauschst du mich, du heidnischer Nigger?«
Der Wirt flüchtete ins Hinterzimmer und ließ Hakeswill grollend am Tisch zurück.
»Sharpie ist stinkreich. Er glaubt, das verbergen zu können, doch das gelingt ihm nicht, und er hat spitzgekriegt, dass er noch mit mir rechnen muss. Er lebt nicht mal in der Kaserne. Hat einige Räume drüben beim Maisur-Tor bekommen. Und einen verdammten Dienerjungen. Verfügt ständig über Bargeld! Kauft Drinks.« Hakeswill schüttelte den Kopf über die Ungerechtigkeit der Welt.
Das 33. Regiment hatte die letzten vier Jahre mit Patrouillen auf den Straßen von Maisur verbracht, und Sharpe hatte in dieser Zeit den Luxus von Seringapatam genossen. Das war nicht richtig, das war nicht fair. Hakeswill hatte sich Gedanken darüber gemacht und sich gefragt, weshalb Sharpe so reich war. Zuerst hatte er angenommen, dass Sharpe krumme Geschäfte in den Waffenlagern gemacht hatte, doch das konnte nicht seinen augenscheinlichen Wohlstand erklären.
»Es gibt nur ein gewisses Quantum an Milch in einer Kuh«, murmelte Hakeswill, »ganz gleich, wie hart man sie melkt.«
Jetzt wusste er – oder glaubte, es zu wissen –, warum Sharpe reich war, und was er erfahren hatte, erfüllte Obadiah Hakeswill mit schrecklichem Neid. Er kratzte an einem Moskitostich in seinem Nacken. Dort gab es die alte dunkelrote Narbe, wo die Henkerschlinge gebrannt und seine Haut aufgerissen hatte. Obadiah Hakeswill hatte die Hinrichtung durch den Strang überlebt, und seither glaubte er inbrünstig, unsterblich zu sein. Er behauptete, unter Gottes persönlichem Schutz zu stehen.
Aber er war nicht reich, überhaupt nicht. Und Richard Sharpe war reich. Gerüchte besagten, dass Richard Sharpe Lalis Haus besucht hatte, und das war ein Bordell, das nur für Offiziere zugelassen war. Warum hatte man dann Sergeant Sharpe nicht rausgeschmissen? Weil er reich war, das war der Grund, und Hakeswill hatte schließlich Sharpes Geheimnis entdeckt.
»Es war Tippu!«, sagte er laut, dann donnerte er mit seinem Zinnkrug auf den Tisch, um noch einen Arrak zu verlangen. »Und beeil dich damit, du verdammter Nigger!«
Es musste Tippu gewesen sein. Er hatte Sharpe doch durch die Gegend, wo Tippu getötet worden war, schleichen sehen. Es hieß, dass einer dieser Suffolk-Bastarde vom 12. Regiment des Königs im Chaos am Ende der Belagerung Tippu erwischt hätte, doch Hakeswill hatte schließlich die Wahrheit herausgefunden. Es war Sharpe gewesen, der Tippu besiegt hatte, und er hatte darüber geschwiegen, weil er dem sterbenden Tippu all seine Edelsteine abgenommen hatte, und keiner sollte wissen, schon gar nicht seine vorgesetzten Offiziere, dass er die Juwelen besaß.
»Verdammter Sharpe!«, stieß Hakeswill laut hervor.
Jetzt brauchte er nur einen Vorwand, um Sharpe zum Regiment zurückzubringen. Keinen weiteren sauberen und leichten Dienst mehr für Sharpie! Keine Vögelei mehr in Lalis Haus. Obadiah Hakeswill würde an der Reihe sein, im Luxus zu leben, und das alles durch den Schatz eines toten Königs. »Rubine, Smaragde und Saphire und Diamanten wie Sterne – und Gold, dick wie Butter.« Er lachte glucksend.
Er nahm an, dass er nur eine kleine List anwenden musste. Eine schlaue List, eine kühne Lüge und eine Festnahme. »Und das wird dein Ende sein, Sharpie, endlich dein Aus!«, flüsterte Hakeswill, und er spürte die Schönheit seines Plans erblühen wie eine Lotosblüte in Seringapatams Stadtgraben.
Es würde funktionieren! Sein Besuch bei Major Stokes hatte ergeben, dass Sharpe in der Stadt war. Das bedeutete, dass er seine Lüge verbreiten konnte, und dann würde alles perfekt wie Major Stokes Uhrwerk laufen. Jedes Rädchen würde ineinandergreifen und die Uhr perfekt ticken!
In Sergeant Hakeswills Gesicht zuckte es, und er umkrampfte den Zinnkrug, als sei er die Kehle eines Mannes, den er erwürgte.
Er würde reich sein.
Major William Dodd brauchte drei Tage, um die Munition zu Pohlmanns compoo zu transportieren, die sich außerhalb der Marathen-Stadt Ahmadnagar befand. Die compoo war eine Infanteriebrigade aus acht Bataillonen, von denen jedes die besten Söldner von Nordindien rekrutierte, die allesamt von europäischen Offizieren gedrillt und befehligt wurden.
Dowlut Rao Sindhia, der Maharadscha von Gwalior, dessen Land sich von der Festung Baroda im Norden bis zur Feste von Gawilgarh im Osten und Ahmadnagar im Süden erstreckte, rühmte sich, dass er hunderttausend Mann führte und seine Armee das Land in vernichtendem Griff halten konnte, und diese compoo mit ihren siebentausend Männern war der harte Kern seiner Streitkräfte.
Eines der acht Bataillone seiner compoo war eine Meile außerhalb des Feldlagers angetreten, um Dodd zu begrüßen. Die Kavalleristen, die die Sepoys nach Chasalgaon begleitet hatten, waren vorausgeritten, um Pohlmann über Dodds Rückkehr zu informieren, und Pohlmann hatte einen triumphalen Empfang vorbereitet. Das Bataillon war in weißem Rock angetreten, und die schwarzen Koppeln und Waffen glänzten, doch Dodd an der Spitze seiner kleinen Kolonne hatte nur Augen für den Elefanten, der neben einer gelb und weiß gestreiften Markise stand.
Der große Dickhäuter glitzerte im Sonnenschein, denn Körper und Kopf waren mit einem weiten Ledercape behängt, auf das silberne Quadrate in komplizierten Mustern aufgenäht waren. Das silberne Cape bedeckte den Körper des Elefanten, setzte sich über den Kopf fort – um die Augen waren zwei Kreise ausgeschnitten – und fiel bis zum Boden hinab. Edelsteine glänzten zwischen den silbernen Quadraten, während in Streifen purpurfarbene Seide von der Krone auf den Kopf des Elefanten herabflatterte. Die letzten paar Zoll der großen, geschwungenen Stoßzähne des Elefanten steckten in nadelscharfen Stahlspitzen.
Der Elefantenführer, der Mahout, schwitzte in einem altmodischen Kettenpanzer, der ebenso blitzblank poliert war wie die silberne Schutzdecke des Elefanten, während der Sitz auf seinem Rücken mit goldenen Platten besetzt war und einen Baldachin aus gelber Seide hatte.
Lange Reihen aus Infanteristen mit purpurfarbenen Röcken standen im Stillstand auf beiden Seiten des Elefanten. Einige der Männer waren mit Musketen bewaffnet, andere hielten Langspieße, deren breite Klingen poliert waren, damit sie silbern blitzten.
Der Elefant kniete sich hin, als Dodd noch zwanzig Schritte entfernt war, und der Mann, der auf dem Sitz auf seinem Rücken gesessen hatte, stieg vorsichtig auf eine silbern besetzte, kurze Treppe hinab, die von seinen Leibwächtern in den purpurfarbenen Röcken dort hingestellt worden war, und schritt dann in den Schatten der gestreiften Markise.
Er war ein großer und kräftiger, jedoch nicht fetter Mann, und auf den ersten Blick konnte man ihn für übergewichtig halten, doch bei genauerem Hinsehen stellte man fest, dass er äußerst muskulös war. Er hatte ein rundliches, vom Sonnenschein gerötetes Gesicht, einen buschigen schwarzen Schnurrbart und Augen, die sich über alles, was sie sahen, zu freuen schienen. Die Uniform war seine eigene Kreation: weiße Seidenreithose über englischen Reitstiefeln, ein grüner Rock, geschmückt mit goldener Tresse und Achselschnüren, und auf den breiten Schultern des Rocks dicke goldene Epauletten mit kurzen Bouillons. Der Rock hatte scharlachrote Aufschläge und Ärmelpatten sowie vergoldete Knöpfe. Der Hut des großen Mannes war ein Zweispitz mit purpurfarbenen Federn, die von einer Spange gehalten wurden, die das weiße Pferd von Hannover zeigten; der goldene Griff seines Säbels hatte die Form eines Elefantenkopfes, und goldene Ringe glänzten an seinen dicken Fingern. Im Schatten der Markise ließ er sich auf einen Diwan nieder, und seine Adjutanten versammelten sich um ihn.
Dies war Colonel Anthony Pohlmann, und er hatte das Kommando über die compoo und fünfhundert Kavalleristen und sechsundzwanzig Feldgeschütze. Vor zehn Jahren, als Sindhias Armee nur eine Horde zerlumpter Soldaten auf halb verhungerten Kleppern gewesen war, war Anton Pohlmann Sergeant in einem Hannoverschen Regiment der East India Company gewesen. Jetzt ritt er einen Elefanten und brauchte zwei weitere der Dickhäuter zum Transport seiner Truhen mit Goldstücken, die ihn überallhin begleiteten.
Pohlmann erhob sich, als Dodd von seinem Pferd stieg.
»Gut gemacht, Major!«, rief der Colonel in seinem deutsch akzentuierten Englisch. »Außerordentlich gut!«
Pohlmanns Adjutanten, die Hälfte davon Europäer und die andere Hälfte Inder, applaudierten wie ihr Vorgesetzter dem zurückkehrenden Helden, während die Leibwache Spalier stand und Dodd hindurchgehen und den strahlenden Colonel begrüßen konnte. »Achtzigtausend Patronen unserem Feind entrissen!«, triumphierte Pohlmann.
»Dreiundsiebzigtausend, Sir«, sagte Dodd und klopfte Staub von seiner Hose.
Pohlmann grinste. »Siebentausend Schwund, wie? Das ändert nichts.«
»Kein Schwund durch mich, Sir«, grollte Dodd.
»Das hatte ich nie angenommen«, sagte Pohlmann. »Gab es irgendwelche Probleme?«
»Nein«, antwortete Dodd. »Wir haben keinen einzigen Verlust, nicht mal einen Verletzten, während kein einziger feindlicher Soldat überlebt hat.« Er lächelte, und die Staubschicht auf seinem Wangen bekam Risse. »Kein Einziger.«
»Ein voller Erfolg! Wir müssen den Triumph feiern!« Polmann wies zum Zelt. »Wir haben Wein, verschiedene Sorten. Außerdem Rum, Arrak und sogar Wasser. Kommen Sie, Major.«
Dodd rührte sich nicht. »Meine Männer sind müde, Sir«, gab er zu bedenken.
»Dann sollten Sie sie wegtreten lassen, Major. Sie können in meinem Küchenzelt Erfrischungen zu sich nehmen.«
Dodd ging, um seine Männer zu entlassen. Er war ein schlaksiger Engländer mit länglichem, blassem Gesicht, das verdrossen wirkte. Dodd war einer der äußerst seltenen Offiziere, die von der East India Company desertiert waren, obendrein mit hundertdreißig seiner eigenen Sepoy-Soldaten. Vor drei Wochen war er zu Pohlmann gekommen, und einige von Pohlmanns europäischen Offizieren waren überzeugt gewesen, dass Lieutenant Dodd ein Spion sei, geschickt von den Briten, dessen Armee sich auf einen Angriff des Marathen-Bündnisses vorbereitete, doch Pohlmann war sich dessen nicht so sicher gewesen.
Es stimmte, dass kein anderer britischer Offizier jemals desertiert war wie Dodd, doch wenige hatten Gründe wie Dodd, und Pohlmann hatte ebenfalls Dodds Ehrgeiz, seine Unbeholfenheit, seinen Zorn und sein Können erkannt. Lieutenant Dodds Personalakte zeigte, dass er kein gewöhnlicher Soldat war, seine Sepoys mochten ihn, und er hatte enorme Ambitionen. Pohlmann hatte die Überzeugung gewonnen, dass Dodds Überlaufen sowohl halbherzige als auch echte Gründe hatte. Er hatte Dodd zum Major befördert und ihn dann einem Test unterzogen, indem er ihn nach Chasalgaon geschickt hatte. Wenn Dodd sich als fähig erwies, seine alten Kameraden zu töten, dann war er kein Spion, und Dodd hatte die Prüfung triumphal bestanden, und Sindhias Armee war jetzt mit dreiundsiebzigtausend erbeuteten Patronen bedeutend besser dran.
Dodd kehrte zur Markise zurück und erhielt den Ehrenstuhl auf der rechten Seite von Pohlmanns Diwan. Der Stuhl links davon war von einer Frau besetzt, einer Europäerin, und Dodd konnte kaum den Blick von ihr nehmen, was verständlich war, denn sie war ein außergewöhnlicher Anblick in Indien. Sie war jung, kaum älter als achtzehn oder neunzehn, hatte ein blasses Gesicht und hellblondes Haar. Ihre Lippen waren vielleicht eine Spur zu dünn und ihre Stirn vielleicht ein wenig zu breit, doch es war etwas sonderbar Attraktives an ihr.
Sie hat ein Gesicht, bei dem die Unzulänglichkeiten zur Schönheit werden, dachte Dodd, und sie wirkt verletzlich. Zuerst nahm Dodd an, die Frau sei Pohlmanns Mätresse, doch dann sah er, dass ihr weißes Leinenkleid am Saum ausgefranst und die Spitze an ihrem bescheidenen Kragen geflickt war, und er sagte sich, dass Pohlmann seiner Mätresse niemals erlauben würde, so schäbig gekleidet zu sein.
»Lassen Sie mich Ihnen Madame Joubert vorstellen«, sagte Pohlmann, der bemerkt hatte, wie fasziniert Dodd die Frau angestarrt hatte. »Dies ist Major William Dodd.«
»Madame Joubert?« Dodd dehnte das »Madame«, erhob sich halb und deutete eine Verneigung an.
»Major«, sagte sie mit leiser Stimme und lächelte nervös. Dann senkte sie den Blick auf den Tisch, der mit Mandelgerichten gedeckt war.
Pohlmann schnippte mit den Fingern nach einem Diener und lächelte dann Major Dodd an. »Simone ist verheiratet mit Captain Joubert, und das dort ist Captain Joubert.« Er wies in den Sonnenschein, wo ein kleiner Captain vor dem Bataillon stand, das in der glühenden Sonne stillstand.
»Joubert befehligt das Bataillon, Sir?«, fragte Dodd.
»Niemand befehligt das Bataillon«, antwortete Pohlmann. »Aber bis vor drei Wochen wurde es von Colonel Mathers geführt. Da hatte es fünf europäische Offiziere. Jetzt hat es Captain Joubert und Lieutenant Sillière.« Er wies auf einen zweiten Europäer, einen jungen Mann, der groß und dünn war, und Dodd, ein aufmerksamer Beobachter, bemerkte, dass Simone Joubert bei der Erwähnung des Namens Sillière errötete. Dodd war amüsiert. Joubert musste mindestens zwanzig Jahre älter als seine Frau sein, während Sillière nur ein, zwei Jahre älter als sie war. »Und wir müssen Europäer haben«, fuhr Pohlmann fort und streckte sich auf dem Diwan aus, der unter seinem Gewicht knarrte. »Die Inder sind feine Soldaten, doch wir brauchen Europäer, die europäische Taktiken verstehen.«
»Wie viele europäische Offiziere haben Sie verloren, Sir?«, fragte Dodd.
»Von dieser compoo? Achtzehn«, sagte Pohlmann. »Zu viele.«
Es waren britische Offiziere, die gegangen waren, und alle hatten Verträge mit Sindhia gehabt, die sie vom Kampf gegen Landsleute befreit hatten, und um die Dinge noch zu verschlimmern, hatte die East India Company jedem britischen Offizier, der von den Marathen desertierte, eine Prämie angeboten. Als Resultat hatte Pohlmann einige seiner besten Männer verloren. Gewiss, er hatte einige gute Offiziere behalten, die meisten davon Franzosen, eine Hand voll Holländer, Schweizer und Deutsche, doch Pohlmann konnte sich den Verlust von achtzehn europäischen Offizieren nicht erlauben. Wenigstens war keiner seiner Artilleristen desertiert, und Pohlmann setzte großes Vertrauen darein, dass seine Geschütze jede Schlacht gewinnen konnten. Diese Kanonen wurden von Portugiesen bedient oder von Halbblut-Indern aus den portugiesischen Kolonien in Indien, und diese Profis hatten sich als loyal erwiesen und waren äußerst tüchtig.
Pohlmann trank ein Glas Rum und schenkte es von Neuem voll. Er konnte ungewöhnlich viel Alkohol vertragen. Dodd war nicht so trinkfest, und der Engländer wusste, dass er leicht betrunken wurde, und nippte nur an seinem Wein mit Wasser.
»Ich habe Ihnen eine Belohnung versprochen, Major, wenn Sie die Patronen erbeuten«, sagte Pohlmann freundlich.
»Zu wissen, dass ich meine Pflicht erfüllt habe, ist Belohnung genug«, erwiderte Dodd. Er fühlte sich schäbig und schlecht gekleidet unter Pohlmanns schmuck uniformierten Adjutanten, und er hielt es für das Beste, den Haudegen-Soldaten zu spielen, eine Rolle, die einem ehemaligen Sergeant gefallen würde. Es hieß, dass Pohlmann seine alte Uniform der East India Company als Erinnerung daran, wie weit er aufgestiegen war, behalten hatte.
»Man schließt sich nicht Sindhias Armee an, nur um die Freude zu haben, seine Pflicht zu erfüllen«, sagte Pohlmann, »sondern wegen der Belohnungen, die solcher Dienst bietet. Wir sind hier, um reich zu werden, nicht wahr?« Er hakte den Säbel mit dem Elefantengriff von seinem Koppel. Die Scheide bestand aus weichem roten Leder und war besetzt mit kleinen Smaragden. »Hier.« Pohlmann hielt den Säbel Dodd hin.
»Ich kann Ihren Säbel nicht annehmen!«, protestierte Dodd.
»Ich habe viele, Major, und schönere. Ich bestehe darauf.«
Dodd nahm den Säbel. Er zog die Klinge aus der Scheide und sah, dass sie gut gearbeitet war, viel besser als der einfache Degen, den er in diesen letzten zwanzig Jahren als Lieutenant getragen hatte. Viele indische Säbel bestanden aus weichem Stahl und brachen leicht im Kampf, doch Dodd nahm an, dass diese Klinge in Frankreich oder Britannien geschmiedet worden war und dann den schönen Elefantengriff in Indien erhalten hatte. Dieses Heft war aus Gold, der Elefantenkopf diente als Knauf, und das Griffstück bestand aus schwarzem Leder mit Golddrähten.
»Danke, Sir«, sagte Dodd bewegt.
»Es ist die erste von vielen Belohnungen«, sagte Pohlmann, »und wir werden mit Belohnungen überschüttet werden, wenn wir die Briten schlagen. Was der Fall sein wird, jedoch nicht hier.« Er trank Rum. »Die Briten werden jetzt jeden Tag angreifen«, fuhr er fort, »und sie werden zweifellos hoffen, dass ich bleibe und mich hier zum Kampf stelle, doch ich habe nicht vor, ihre Erwartung zu erfüllen. Besser, wenn die Bastarde hinter uns hermarschieren müssen. Während sie uns verfolgen, wird der Monsun endlich einsetzen, und die Flüsse werden sie aufhalten. Krankheiten werden sie schwächen. Und wenn sie schwach und müde sind, werden wir stark sein. Alle von Sindhias compoos werden sich zusammenschließen, und der Radscha von Berar hat uns seine Armee versprochen, und wenn wir erst alle vereinigt sind, werden wir die Briten vernichten. Aber das heißt, dass ich Ahmadnagar aufgeben muss.«
»Das ist keine bedeutende Stadt«, bemerkte Dodd. Er bemerkte, dass Simone Joubert am Wein nippte. Sie hielt den Blick gesenkt, schaute nur gelegentlich auf und sah zu ihrem Mann oder zu Lieutenant Sillière. Sie schenkte Dodd keine Beachtung, aber das würde sie noch, versprach er sich, das würde sie noch. Ihre Nase ist zu schmal, dachte er, doch trotzdem ist sie ein blasses und zartes Wunder in diesem heißen Land mit den dunkelhäutigen Menschen. Ihr blondes Haar, das in Löckchen herunterhing, in einer Frisur, die zehn Jahre zuvor in Europa Mode gewesen war, wurde von kleinen Perlmuttspangen an Ort und Stelle gehalten.
»Ahmadnagar ist nicht wichtig«, stimmte Pohlmann zu, »aber Sindhia verliert keine seiner Städte gern, und er hat Ahmadnagar voll mit Versorgungsmaterial gestopft und darauf bestanden, dass ich ein Regiment in der Stadt stationiere.« Er nickte zu den Soldaten in den weißen Röcken. »Dieses Regiment, Major. Es ist vermutlich mein bestes, aber ich bin gezwungen, es in Ahmadnagar einzuquartieren.«
Dodd verstand Pohlmanns missliche Lage. »Sie können es nicht aus der Stadt nehmen, ohne Sindhia aufzuregen«, sagte er, »aber Sie wollen es nicht verlieren, wenn die Stadt fällt.«
»Ich kann es nicht verlieren!«, sagte Pohlmann empört. »Ein so gutes Regiment! Mathers hat es hervorragend ausgebildet. Jetzt ist er zu unseren Feinden übergelaufen, aber ich kann sein Regiment ebenso wenig verlieren, also wer auch immer das Kommando von Mathers übernimmt, muss wissen, wie er seine Männer aus Schwierigkeiten heraushält.«
Dodd spürte Erregung in sich aufsteigen. Ihm gefiel der Gedanke, dass er bei der Company weder wegen des Geldes noch wegen seiner juristischen Probleme desertiert war, sondern wegen der längst fälligen Chance, sein eigenes Regiment zu führen. Er konnte das gut, das wusste er, und er wusste ebenfalls, dass Polmann darauf hinauswollte.
Pohlmann lächelte. »Angenommen, ich gebe Ihnen Mathers’ Regiment, Major. Können Sie es für mich aus dem Feuer reißen?«
»Jawohl, Sir«, erwiderte Dodd.
Simone Joubert blickte zum ersten Mal, seit sie mit Dodd bekannt gemacht worden war, zu ihm auf, aber ohne Freundlichkeit.
»Alles davon?«, fragte Pohlmann. »Mit seinen Kanonen?«
»Alles davon«, sagte Dodd fest, »und mit jedem verdammten Geschütz.«
»Dann ist es von jetzt an Dodds Regiment«, sagte Pohlmann, »und wenn Sie es gut führen, werde ich Sie zum Colonel befördern und Ihnen das Kommando über ein zweites Regiment geben.«
Dodd feierte das, indem er sein Glas Wein leer trank. Er war so bewegt, dass er kaum zu sprechen wagte, doch seine Miene sagte alles. Endlich sein eigenes Regiment! So lange hatte er auf diesen Moment gewartet, und jetzt würde er der Company zeigen, wie gut ihre verschmähten Offiziere kämpfen konnten.
Pohlmann schnippte mit den Fingern, damit man ihm mehr Rum brachte.
»Wie viele Männer wird Wellesley bringen?«, fragte er Dodd.
»Nicht mehr als fünfzehntausend Infanteristen«, antwortete der neue Kommandeur von Dodds Regiment zuversichtlich. »Vielleicht weniger, und die werden sich in zwei Armeen aufteilen. Boy Wellesley hat das Kommando über eine, Colonel Stevenson über die andere.«
»Stevenson ist alt?«
»Alt und vorsichtig.«
»Wie steht es mit Kavallerie?«, fragte Pohlmann.
»Fünf- oder sechstausend. Hauptsächlich Inder.«
»Geschütze?«
»Höchstens sechsundzwanzig. Nichts größer als ein Zwölfpfünder.«
»Und Sindhia kann achtzig Geschütze einsetzen«, sagte Pohlmann, »einige davon Achtundzwanzigpfünder. Und wenn erst die Streitkräfte des Radschas von Berar zu uns stoßen, werden wir vierzigtausend Infanteristen und wenigstens weitere fünfzig Geschütze haben.« Der Hannoveraner lächelte. »Aber Schlachten sind nicht nur Zahlen. Sie werden auch von Generälen gewonnen. Erzählen Sie mir von Major General Sir Arthur Wellesley.«
»Boy Wellesley?« Dodd schnaubte verächtlich. Der britische General war jünger als Dodd, doch das war nicht der Grund für den spöttisch gemeinten Spitznamen »Boy«. Vielmehr war es Neid, denn Wellesley hatte Beziehungen und Wohlstand, während es Dodd an beidem mangelte. »Er ist jung«, sagte Dodd, »nur vierunddreißig.«
»Jugend ist kein Hemmschuh für eine Soldatenkarriere«, sagte Pohlmann tadelnd, obwohl er Dodds Groll verstand. Seit Jahren hatte Dodd jüngere Männer in der Armee des Königs aufsteigen sehen, während er in der engstirnigen Company versauert war. Man konnte keine Beförderung in der Kompanie kaufen, es gab auch keine durch Verdienste, sondern es ging nur nach dem Dienstalter, und so waren Vierundvierzigjährige wie Dodd immer noch Lieutenant, während in der Armee des Königs fast noch Jungs Captains und Majors waren.
»Ist Wellesley gut?«, fragte Pohlmann.
»Er hat noch nie eine Schlacht geschlagen«, sagte Dodd bitter, »Malavelly kann man ja nicht zählen.«
»Nur eine Salve?«, fragte Pohlmann, der sich vage an Geschichten über das Scharmützel erinnerte.
»Eine Salve und ein Bajonettangriff«, sagte Dodd, »keine richtige Schlacht.«
»Er hat Dhoondiah besiegt.«
»Ein Kavallerieangriff gegen einen Banditen«, sagte Dodd spöttisch. »Ich möchte darauf hinweisen, Sir, dass Boy Wellesley nie Artillerie und Infanterie auf einem richtigen Schlachtfeld gegenübergestanden ist. Er wurde nur zum Major General gemacht, weil sein Bruder Generalgouverneur ist. Wenn sein Name stattdessen Dodd gewesen wäre, könnte er sich glücklich preisen, allenfalls Kompaniechef zu sein.«
»Ist er adlig?«, fragte Pohlmann.
»Selbstverständlich. Sein Vater war Earl.«
Pohlmann schob sich eine Hand voll Mandeln in den Mund und kaute einen Augenblick. »Er ist also der jüngere Sohn eines Adligen, der in die Armee geschickt wurde, weil er zu sonst nichts taugte, und seine Familie hat ihn die Dienstränge hinaufgekauft?«
»Genau, Sir, haargenau.«
»Aber ich hörte, er soll tüchtig sein.«
»Tüchtig?« Dodd dachte darüber nach. »Er ist tüchtig, Sir, weil ihm sein Bruder das Bargeld gibt. Er kann sich einen großen Ochsenzug leisten, der seine Lebensmittel transportiert, und so sind seine Männer immer gut versorgt. Aber er hat nie eine Kanonenmündung gesehen oder ihr gegenübergestanden.«
»Er hat seine Sache als Gouverneur von Maisur gut gemacht«, bemerkte Pohlmann milde.
»Er ist also ein tüchtiger Gouverneur? Macht ihn das zu einem General?«
»Er soll ein Zuchtmeister sein«, meinte Pohlmann.
»Ja, er hat einen schönen Exerzierplatz«, stimmte Dodd sarkastisch zu.
»Aber er ist kein Dummkopf?«
»Nein«, gab Dodd zu, »kein Dummkopf, aber auch kein General. Er ist zu schnell und zu jung befördert worden, Sir. Er hat Banditen besiegt, aber er ist selbst außerhalb von Seringapatam geschlagen worden.«
»Ah ja. Der Nachtangriff.« Pohlmann hatte von dem Scharmützel gehört, wie Arthur Wellesley außerhalb von Seringapatam in einem Waldstück Soldaten Tippus angegriffen und Prügel bezogen hatte. »Dennoch ist es nie gut, einen Feind zu unterschätzen«, sagte Pohlmann.
»Überschätzen Sie ihn so viel, wie Sie wollen, Sir«, sagte Dodd heftig, »aber es bleibt die Tatsache, dass Boy Wellesley nie in einer richtigen Schlacht gekämpft hat, nicht mit mehr als tausend Mann unter seinem Kommando. Und er hat nie einer richtigen Armee gegenübergestanden, keiner ausgebildeten Feldarmee mit Artilleristen und disziplinierter Infanterie, und ich bezweifle, dass er siegen wird. Er wird zu seinem Bruder fliehen und mehr Männer verlangen. Er ist ein vorsichtiger Mann.«