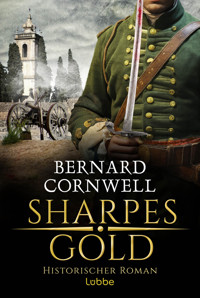9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Winter, 1812. Wellingtons Armee hat sich nach Portugal zurückgezogen, um das Frühjahr abzuwarten. Doch Ruhe ist nicht in Sicht, denn eine Bande von Deserteuren hat im Namen der britischen Armee fürchterliche Gräueltaten auf spanischem Boden begangen. Wellington gibt den Befehl, die Schurken aufzuspüren und zu bestrafen - eine Aufgabe für Richard Sharpe und seine Rifles. Als sie sich auf den Weg machen, ahnt Sharpe nicht, dass unter den Deserteuren auch sein erbittertster Feind ist: Sergeant Hakeswill.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
Zitat
VORWORT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
EPILOG
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Bernard Cornwell
SHARPESFEIND
Richard Sharpe unddie Verteidigung von Portugal,Weihnachten 1812
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Fassung des 1990 bei Bastei Lübbe erschienenen Romans »Sharps Feind«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1984 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Enemy«
Published by arrangement with Marco Vigevani & Associati
Agenzia Letteraria, on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0697-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Tochterin Liebe
»… dieses System steckt noch in den Kinderschuhen …Viel ist in kurzer Zeit erreicht worden,und es gibt allen Grund zu glauben,dass die Genauigkeit von Raketen im Feld auf das gleicheNiveau gehoben werden kann wie das der Artillerie.«
Colonel Sir William Congreve, 1814
VORWORT
Die meisten Sharpe-Romane folgen einem realen Feldzug, was mir das Schreiben erheblich erleichtert, denn die Geschichte bietet mir stets einen verführerischen Höhepunkt in Form einer Schlacht. Sharpes Feind ist jedoch gänzlich erfunden. Seinen Ursprung hat die Geschichte in Charles Omans A History of the Peninsular War. Oman erwähnt dort Banden von ›umhertreibendem Abschaum ungebundener Plünderer, die Fahnenflucht begangen haben und keinerlei Eile zeigen, wieder zurückzukehren‹. Er zitiert die Memoiren eines Franzosen, in denen zu lesen steht, dass eine dieser Banden, deren Mitglieder den verschiedensten Nationen angehörten, groß genug gewesen sei, um ein Bataillon zu besiegen, das sie hätte zur Strecke bringen sollen. Der Anführer dieser Bande erfreute sich des Spitznamens ›Maréchal Chaudron‹ oder ›Marschall Kessel‹, und ich änderte das in Maréchal Pot-au-Feu. Ich nahm diese Änderung vor, weil ich vermeiden wollte, dass ein aufmerksamer Leser von Lemonnier-Delafosses Memoiren mir zum Vorwurf macht, dass ich Chaudrons Geschichte falsch wiedergegeben hätte. Aufmerksame Leser sind in dieser Hinsicht äußerst hilfsbereit.
Die Idee einer Bande von Deserteuren, die aus Franzosen, Briten, Spaniern und Portugiesen besteht, war einfach unwiderstehlich für mich. Sie musste in einem Sharpe-Roman verarbeitet werden, bot sie doch einen Feind, der nichts zu verlieren hatte und dementsprechend gnadenlos vorging. Außerdem wird Richard Sharpe in diesem Roman sein erstes größeres und unabhängiges Kommando übertragen. Zum ersten Mal hat er die Chance, eine Streitmacht von der Größe eines Bataillons in die Schlacht zu führen, und natürlich macht er das hervorragend.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich Hilfe hatte. Oft denke ich, das Schreiben eines Buches gleicht der Besteigung eines Bergs. Blickt man auf halber Strecke zurück, stellt man vermutlich fest, dass es eine bessere Route gegeben hätte. Also geht man wieder runter und beginnt von vorn. Diesmal schaut man nach Dreiviertel des Weges zurück, und wieder sieht man eine bessere Route, und so geht das immer weiter. Es hat Fälle gegeben, da Sharpe sich nach Dreiviertel einer Geschichte ohne Munition in einer Sackgasse wiedergefunden hat, während eine Horde Franzosen nur darauf gewartet hat, ihn in Stücke zu reißen. Dann heißt es, zwei, drei oder mehr Kapitel zurückzugehen und eine Tür am Ende der Sackgasse einzuführen, sodass Sharpe durch sie entkommen kann, wenn er ohne Munition dort ankommt. Auf diese Weise fühlt der Leser sich nicht betrogen, wie es der Fall gewesen wäre, wenn ich die Tür einfach aus dem Hut gezaubert und nicht sechs Kapitel zuvor eingeführt hätte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich beim Schreiben dieses Buches überall im Gelände Nützliches verteilt habe, um es Sharpe zu ermöglichen, gegen eine überwältigende Übermacht anzutreten und zu gewinnen, ohne dabei unglaubwürdig zu wirken.
Und natürlich tritt Sharpe auch wieder gegen Obadiah Hakeswill an, der bisher alles überlebt hat, sogar den Strick. Ich muss gestehen, dass ich diese Vorstellung zu Beginn kaum glauben konnte, doch dann fand ich zu meiner großen Erleichterung heraus, dass es gar nicht mal so ungewöhnlich war, den Galgen zu überleben. Tatsächlich war die Zahl der Überlebenden sogar so groß, dass die Gesellschaft der Bader, eine von zwei Organisationen, die Gehenkte sezieren durften, folgende Regel einführte: Brachte man ihnen einen lebenden ›Leichnam‹, hatten die Überbringer die Behandlungskosten zu übernehmen. Diese Regel lässt darauf schließen, dass es unter dem Galgen einen wahren Kampf gegeben haben muss, wenn Familienmitglieder und Freunde versuchten, einen Gehenkten vor den Leichenfledderern der Anatomen zu retten, und zeitgenössischen Berichten zufolge überlebten in der Tat viele, und die Behörden machten sich in keinem einzigen Fall die Mühe, die Verurteilen wieder einzufangen und ordentlich zu hängen.
Viele Leser, vor allem Frauen, haben mich gefragt, was aus Sharpes Tochter geworden ist, Antonia, und mich angefleht, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Ich will nicht viel zu ihr sagen, sondern nur anmerken, dass Sharpes Feind meiner Tochter gewidmet ist, die zufälligerweise ebenfalls Antonia heißt. Das soll jenen Leser versichern, dass Antonia natürlich glücklich bis ans Ende ihrer Tage lebt. Das sollten wir alle.
PROLOG
Am 8. Dezember 1812 kamen die englischen Soldaten zum ersten Mal nach Adrados.
Das spanische Dorf war vom Krieg verschont geblieben. Obwohl es so nahe der nördlichen Grenze zu Portugal lag, waren nur wenige Soldaten über die einzige Straße gezogen.
Die Franzosen waren vor drei Jahren durch Adrados gekommen, aber sie waren auf der Flucht vor dem englischen Lord Wellington gewesen und hatten es so eilig gehabt, dass sie sich kaum Zeit zu einem Aufenthalt und zum Plündern hatten nehmen können.
Dann waren am 8. Mai 1812 die spanischen Soldaten gekommen, die Garnison von Adrados, doch es hatte die Dorfbewohner nicht besonders gestört. Es waren nur fünfzig Soldaten mit vier Kanonen, und als die Geschütze im alten Castillo de la Virgen und im Wachtturm außerhalb der Stadt in Position gebracht worden waren, hatten die Soldaten den Krieg anscheinend als erledigt betrachtet. Sie tranken in der Dorfschänke und flirteten mit den Frauen, die am Bach auf flachen Steinen die Wäsche wuschen. Zwei Dorfschöne heirateten im Sommer Kanoniere.
Wegen eines Versehens in der spanischen Armee schickte man der »Garnison« einen Pulver-Konvoi, der für Ciudad Rodrigo bestimmt war, und die Soldaten prahlten damit, mehr Pulver und weniger Waffen zu haben als irgendeine andere Artillerietruppe in Europa. Sie arrangierten primitive Feuerwerke für die Hochzeiten, und die Dorfbewohner bewunderten die Explosionen, die in ihrem abgelegenen Tal blitzten und widerhallten.
Im Herbst desertierten einige der spanischen Soldaten, weil sie es leid waren, in einem Tal Wache zu schieben, in das keine Soldaten kamen, und weil sie in ihre Heimatorte und zu ihren Frauen zurückkehren wollten.
Dann kamen die englischen Soldaten.
Adrados war kein besonders wichtiger Ort. Dort gab es Schafe und Dornbüsche, und der Priester sagte den Dorfbewohnern, dies mache das Dorf zu einer heiligen Stätte, denn Christi Leben habe mit dem Besuch der Schäfer begonnen und mit einer Dornenkrone geendet. Der Priester brauchte den Dorfbewohnern jedoch nicht zu sagen, dass Adrados heilig war, denn nur eine einzige Attraktion brachte Besucher in das Dorf, und das war der Feiertag am 8. Dezember.
Vor vielen Jahren – keiner wusste, vor wie vielen, nicht einmal der Priester, aber in jenen Tagen, als die Christen gegen die Mauren in Spanien kämpften – war die Heilige Mutter nach Adrados gekommen. Jeder kannte die Geschichte. Kreuzritter waren durch das Tal zurückgewichen, hart verfolgt, und ihr Führer hatte bei einem Granitfelsen am Rande des Passes gebetet, der westwärts nach Portugal führte, und dann war es geschehen. Sie war erschienen! Sie stand auf dem Granitfelsen und sagte dem Kreuzritter, dass die Mauren, die ihn und seine Mannen verfolgten, bald hier halten würden, um ebenfalls zu beten und ostwärts zu ihrer heidnischen Heimat zu blicken. Wenn er und seine erschöpften Männer die Schwerter zogen und kämpften, dann würden sie dem Kreuz Ehre erweisen.
Zweitausend maurische Köpfe rollten an diesem Tag. Noch mehr! Keiner wusste genau, wie viele, und jedes Jahr wuchs die Zahl beim Erzählen der Geschichte. Geschnitzte maurische Köpfe zierten den Kreuzgang des Frauenklosters, das um die Stelle herum erbaut worden war, an der Sie erschienen war. In der Kapelle des Klosters, oberhalb der Treppe zum Altar, befand sich ein kleiner Fleck von poliertem Granit, dort hatte die Heilige Mutter den Fuß auf den Felsen gesetzt.
Jedes Jahr am 8. Dezember, dem Tag des Wunders, kamen Frauen nach Adrados. Es war ein Tag der Frauen, keiner der Männer, und die Männer trugen die Statue der Jungfrau, deren Juwelen unter dem vergoldeten Baldachin schwangen, durch das Dorf und wieder zurück zum Kloster. Anschließend gingen die Männer ins Gasthaus.
Die Nonnen hatten das Kloster vor zweihundert Jahren verlassen und Häuser in den Ebenen vorgezogen. Sie hatten nicht mit den Städten konkurrieren können, wo sich die Heilige Mutter in ihrem Erscheinen großzügiger gezeigt hatte. Die Klostergebäude waren jedoch noch gut erhalten. Die Kapelle wurde zur Dorfkirche, der obere Kreuzgang war ein Lagerraum, und an einem Tag im Jahr war das Kloster immer noch eine Stätte der Wunder.
Die Frauen betraten die Kapelle auf den Knien. Sie bewegten sich kriechend über die Steinplatten durch die Kapelle und die Treppe hinauf, wobei sie den Rosenkranz hielten und beteten. Der Priester intonierte sein Latein. Die Frauen verneigten sich und küssten den glatten, dunklen Granit. Es war ein Loch im Gestein, und die Legende besagte, wenn eine Frau diese Stelle küsste und mit der Zungenspitze den Grund des Lochs erreichen konnte, dann würde das Baby ein Junge werden.
Die Frauen weinten, wenn sie den Stein küssten, nicht aus Kummer, sondern aus einer Art Ekstase. Manche fielen in Ohnmacht und mussten weggetragen werden.
Einige beteten um Erlösung von Krankheit. Sie brachten ihre Tumorkranken, Verunstalteten und verkrüppelten Kinder mit. Andere beteten, um ein Kind zu bekommen, und ein Jahr später kamen sie wieder und dankten der Heiligen Mutter, weil sie jetzt Ihr Geheimnis teilten. Sie beteten zu der Jungfrau, die gebar, und sie wussten, wie kein Mann es wissen konnte, dass eine Frau ihre Kinder unter Schmerzen gebiert, doch sie beteten, Mutter zu werden, und schoben die Zunge durch das Loch im Granit bis zum Grund. Sie beteten im Kerzenschein der Klosterkapelle von Adrados, und der Priester stapelte ihre Geschenke hinter dem Altar, die Ernte eines jeden Jahres.
8. Dezember 1812. Die Engländer kamen.
Sie waren nicht die ersten Besucher. Seit dem Morgengrauen waren Frauen eingetroffen, die einen Weg von zwanzig Meilen oder mehr hinter sich hatten. Einige kamen aus Portugal, doch die meisten stammten aus den Dörfern, die so versteckt wie Adrados ringsum im Hügelland lagen. Dann trafen zwei englische Offiziere auf großen Pferden ein, und in ihrer Begleitung befand sich eine junge Frau. Die Offiziere halfen der Frau vor dem Kloster vom Pferd und ritten weiter zum Dorf, wo sie dem spanischen Kommandanten ihre Aufwartung machten und mit ihm den herben Rotwein der Region tranken, der im Gasthaus serviert wurde. Die Männer in der Schänke waren gut gelaunt. Sie wussten, dass viele der Frauen beteten, ein Kind zu bekommen, und dass man sie brauchte, um der Heiligen Mutter bei der Erfüllung des Gebets zu helfen.
Die anderen britischen Soldaten kamen von Osten, was sonderbar war, denn dort hätten eigentliche keine sein sollen, aber niemandem fiel das auf. Es gab keinen Alarm. Die Briten waren noch nicht in Adrados gewesen, doch die Dorfbewohner hatten gehört, dass diese heidnischen Soldaten anständig und respektvoll waren. Ihr General hatte ihnen befohlen, stillzustehen, als die Statue der Jungfrau durch das Dorf getragen wurde, und das war gut. Dennoch waren diese englischen Soldaten anders als die der spanischen Garnison. Diese Männer mit den roten Uniformröcken sahen verdorben, gemein und ungepflegt aus, und ihre Gesichter spiegelten Brutalität und Hass wider.
Hundert dieser Männer warteten am östlichen Rand der Stadt beim Waschplatz neben der Straße und rauchten kurze Tonpfeifen. Hundert andere Männer, angeführt von einem großen Mann zu Pferde, dessen roter Uniformrock reich mit goldenen Tressen verziert war, marschierten durch das Dorf. Ein spanischer Soldat, der von der Burg her zum Gasthaus kam, salutierte vor dem Colonel und war überrascht, als der englische Offizier ihn anlächelte, sich ironisch verneigte und einen fast zahnlosen Mund zeigte.
Der Spanier musste etwas in der Schänke gesagt haben, denn zwei britische Offiziere kamen mit offenen Uniformröcken auf die Straße und schauten den letzten der Soldaten nach, die zum Kloster marschierten. Einer der Offiziere runzelte die Stirn. »Wer zum Teufel sind Sie?«
Der Soldat, den er angesprochen hatte, grinste breit. »Smithers, Sir.«
Der Blick des Captains schweifte an der Reihe der Soldaten entlang. »Welches Bataillon?«
»Das Dritte, Sir.«
»Welches verdammte Regiment, Sie Narr?«
»Das wird Ihnen der Colonel sagen, Sir.« Smithers trat auf die Mitte der Straße, hielt eine Hand an den Mund und rief nach dem Colonel.
Der große Mann zog sein Pferd um die Hand, parierte es und ritt dann zum Gasthaus. Die beiden Captains standen stramm und salutierten.
Der Colonel zügelte sein Pferd. Er hatte anscheinend die Gelbsucht gehabt, vielleicht hatte er auf den Fieberinseln dienen müssen, denn seine Haut war gelblich wie altes Pergament. Das Gesicht unter dem Zweispitz zuckte krampfartig. Die blauen Augen blickten unfreundlich. »Knöpfen Sie die verdammten Röcke zu!«
Die Captains stellten ihre Weinbecher ab, knöpften die Uniformröcke zu und rückten die Koppel zurecht. Einer der beiden, ein rundlicher junger Mann, runzelte missbilligend die Stirn, weil der Colonel sie beide vor grinsenden Privates angeschnauzt hatte.
Der Colonel ritt zwei Schritte näher an die beiden Captains heran. »Was treiben Sie hier?«
»Hier, Sir?« Der größere, dünnere Captain lächelte. »Wir sind nur zu Besuch hier, Sir.«
»Nur zu Besuch, wie?« Das Gesicht zuckte wieder. Der Colonel hatte einen sonderbar langen Hals, der von einem Halstuch verhüllt war, das er hoch an der Kehle zusammengebunden hatte. »Nur ihr beide?«
»Jawohl, Sir.«
»Und Lady Farthingdale, Sir«, fügte der rundliche Captain hinzu.
»Und Lady Farthingdale, wie?« Der Colonel ahmte den Tonfall des Captains nach, und dann schrie er jähzornig: »Ihr seid eine verdammte Schande, das seid ihr! Ich hasse euch! Verdammt noch mal! Ich hasse euch!«
Auf der Straße war es plötzlich still.
Die Soldaten, die sich zu beiden Seiten des Reiters versammelt hatten, grinsten die beiden Captains an.
Der größere Captain wischte sich den Speichel, der dem Colonel bei seinem Zornausbruch aus dem Mund gesprüht war, vom roten Uniformrock. »Ich muss protestieren, Sir!«
»Protestieren? Du Scheißkerl! Smithers!«
»Ja, Sir?«
»Erschießen!«
Der rundliche Captain grinste, als wäre das ein Scherz, doch der andere riss abwehrend einen Arm hoch und zuckte zusammen. Während Smithers grinsend seine Muskete anhob und feuerte, zog der Colonel eine ziselierte Pistole und schoss dem rundlichen Captain eine Kugel in den Kopf. Die Schüsse hallten in der Straße wider, der Rauch aus zwei Waffen wallte über den Leichen, und der Colonel lachte und stellte sich in den Steigbügeln auf. »Los, Jungs, jetzt!«
Als Erstes fielen sie ins Gasthaus ein, stürmten über die Toten hinweg, deren Blut auf die Tür gespritzt war, und die Musketen krachten in der Schänke. Die Gäste wurden mit Bajonetten in Ecken getrieben und getötet. Der Colonel winkte die hundert Männer, die am östlichen Ende des Dorfs gewartet hatten, in die Straße. Er hatte nicht so schnell anfangen wollen, doch diese verdammten Captains hatten ihn verärgert und zum Handeln veranlasst. Der Colonel schrie seine Männer an, peitschte sie mit Befehlen vorwärts und führte die Hälfte seiner Truppe zum großen, quadratischen Frauenkloster.
Die Frauen im Kloster hatten nicht die Schüsse gehört, die fünfhundert Yards östlich gefallen waren. Die Frauen drängten sich im Kreuzgang, warteten darauf, auf Knien in die Kapelle vorzurücken, und sie erkannten erst, dass das Grauen des Krieges nach Adrados gekommen war, als die Männer mit den roten Uniformröcken auftauchten, die Bajonette auf sie richteten und das Schreien begann.
Andere Männer drangen in die Häuser des Dorfs ein, während noch viele mehr durch das Tal auf das Castillo zuströmten. Die Männer der spanischen Garnison hatten im Dorf getrunken. Nur ein paar befanden sich auf ihrem Posten. Sie sahen die britischen Uniformen und nahmen an, dass da ihre Verbündeten kamen und ihnen erklären konnten, was der Lärm im Dorf zu bedeuten hatte. Die Spanier sahen die Rotröcke über den Schutt der eingefallenen östlichen Mauer der Burg kommen, riefen ihnen Fragen zu, und dann krachten die Musketen, wüteten die Bajonette, und die Männer der Garnison starben in den mittelalterlichen Mauern. Ein Lieutenant tötete zwei der Rotröcke. Er kämpfte mit Geschick und Zorn, trieb weitere Eindringlinge zurück, entkam über die eingefallene Mauer und hetzte durch die Dornenbüsche zum Wachtturm auf dem Hügel im Osten. Er hoffte, dort eine Handvoll seiner Männer zu finden, doch er starb im Dornengestrüpp durch die Kugel eines versteckten Scharfschützen. Der spanische Leutnant erfuhr nicht mehr, dass die Männer, die den Wachtturm eingenommen hatten, kein britisches Rot, sondern französisches Blau trugen. Seine Leiche rollte unter einen Dornbusch und zerdrückte die alten, brüchigen Gebeine eines Raben, die von einem Fuchs zurückgelassen worden waren.
Auf der Straße gellten Schreie. Männer starben, die versuchten, ihr Heim zu verteidigen, Kinder schrien, als ihre Väter starben, als Männer gewaltsam in die Häuser eindrangen. Kleine weiße Rauchwölkchen vom Musketenfeuer wogten in der Brise.
Weitere Männer kamen von Osten, Männer in Uniformen, die so unterschiedlich wie die Bataillone waren, die in den vier Jahren Krieg auf der Iberischen Halbinsel für Portugal und Spanien gekämpft hatten. Mit den Männern kamen Frauen, und sie waren es, die die Kinder im Dorf töteten, sie erschossen oder erstachen und nur diejenigen am Leben ließen, die arbeiten konnten. Die Frauen stritten sich um die Hütten, zankten sich um die Beute, und manchmal bekreuzigten sie sich, wenn sie an einem Kruzifix vorbeikamen, das an die niedrigen Wände genagelt war. Es dauerte nicht lange, bis Adrados zerstört war.
Im Kloster gellten ständig Schreie. Die englischen Soldaten stürmten durch die Kreuzgänge, die Halle, die leeren Kammern und die volle Kapelle. Der Priester war zur Tür gerannt, hatte sich einen Weg zwischen den Frauen gebahnt, und jetzt zitterte er im Griff zweier stämmiger Soldaten, die ihn festhielten, während die anderen Rotröcke ihre Beute unter sich aufteilten. Einige Frauen wurden aus dem Gebäude getrieben, die glücklichen, zu krank oder zu alt, und einige wurden mit den langen Bajonetten getötet. In der Kapelle nahmen die Soldaten den Kirchenschmuck vom Altar, durchwühlten die Geschenke, die dahinter aufgestapelt waren, und andere brachen den Schrank auf, der den Messwein und andere Dinge für die Messe enthielt. Einer der Soldaten zog das weißgoldene Gewand an, das der Priester an Ostern trug. Er ging durch die Kapelle und segnete seine Kameraden, die Frauen auf den Boden zerrten. Die Kapelle war erfüllt von Schreien, Schluchzen, Männergelächter und dem Reißen von Stoff.
Der Colonel war in den oberen Kreuzgang geritten. Dort beobachtete er grinsend seine Männer. Er hatte zwei Männer, denen er vertrauen konnte, in die Kapelle geschickt, und sie tauchten jetzt auf. Sie schleppten eine Frau zwischen sich. Der Colonel sah die Frau an und leckte sich über die Lippen. In seinem Gesicht zuckte es.
Alles an der Frau wies auf Reichtum hin, von der teuren Kleidung bis zur Frisur. Ihr Haar war schwarz und gewellt. Es umrahmte ein Gesicht, das einen hochmütigen und zugleich herausfordernden Zug hatte. Sie hatte dunkelbraune Augen, die ihn furchtlos anblickten, der Mund mit den vollen Lippen schien oft zu lächeln, und über dem Kleid trug sie einen schwarzen Umhang, der reich mit Silber besetzt und mit Pelz gesäumt war.
Der Colonel lächelte. »Ist sie das?«
Smithers grinste. »Das ist sie, Sir.«
»Gut, gut, gut, Lord Farthingdale ist ein glücklicher Bastard, wie? Nimm ihr den verdammten Umhang ab. Ich will sie mir genauer ansehen.«
Smithers wollte den pelzgesäumten Umhang öffnen, doch die Frau schob die Männer fort, hakte den Verschluss an ihrem Hals auf und zog langsam den Umhang von ihren Schultern. Sie hatten einen üppigen Körper, in der Blüte ihrer Jugend, und es war etwas Aufreizendes für den Colonel in ihrem Mangel an Furcht. Im Kreuzgang stank es nach frischem Blut, Schreie von Frauen und Kindern gellten, doch diese reiche, schöne Frau stand ruhig und gelassen vor ihm. Der Colonel lächelte wieder mit seinem fast zahnlosen Mund. »Du bist also mit Lord Farthingdale verheiratet, wer immer das sein mag?«
»Mit Sir Augustus Farthingdale.« Sie war keine Engländerin.
»Ach du meine Güte. Ich bitte Euer Gnaden um Verzeihung.« Der Colonel lachte. »Sir Augustus. Ist er ein General?«
»Colonel.«
»Wie ich.« In dem gelblichen Gesicht zuckte es, als er lachte. »Reich, wie?«
»Sehr.« Sie sagte es gleichmütig, sachlich.
Der Colonel stieg schwerfällig vom Pferd. Er war groß und hager, und seine Hässlichkeit war wirklich bemerkenswert. In seinem Gesicht zuckte es, als er sich ihr näherte. »Du bist keine verdammte Engländerin, oder?«
Sie wirkte immer noch völlig furchtlos. Sie bedeckte ihr schwarzes Reitkleid wieder lässig mit dem pelzgesäumten Umhang und lächelte sogar leicht. »Portugiesin.«
Er musterte sie prüfend. »Woher soll ich wissen, ob du mir die Wahrheit sagst? Wie kommt es, dass eine Portugiesin mit Sir August Farthingdale verheiratet ist?«
Sie zuckte mit den Schultern, zog von ihrer linken Hand einen Ring und warf ihn dem Colonel zu. »Vertrauen Sie darauf.«
Der Ring war aus Gold. Darin eingeprägt war ein gevierteiltes Wappen, und der Colonel lächelte, als er es sah. »Wie lange bist du verheiratet?«
Diesmal lächelte sie richtig, und die Soldaten schauten sie grinsend und voller Begierde an. Dies war die Trophäe für den Colonel, aber er konnte manchmal großzügig sein. Sie strich das schwarze Haar vom Gesicht mit dem dunklen Teint zurück. »Ein halbes Jahr.«
»Ein halbes Jahr? Da seid ihr ja noch heiß auf euch, wie?« Er lachte meckernd. »Wie viel wird Sir Augustus zahlen, um dich als Bettwärmer zurückzubekommen?«
»Eine Menge.« Sie sagte es mit gesenkter Stimme und legte ein Versprechen hinein.
Der Colonel lachte. Schöne Frauen mochten ihn nicht, und so konnte er sie nicht ausstehen. Dieses reiche Weib hatte Geist und Mut, aber er konnte sie kirre machen. Er schaute zu seinen Männern, die sie mit den Blicken förmlich verschlangen, und grinste. Er warf den goldenen Ring hoch und fing ihn wieder auf. »Was hast du hier gemacht, Mylady?«
»Ich betete für meine Mutter.«
Das Grinsen verschwand schlagartig. Sein Blick war plötzlich verschlagen, und seine Stimme klang gedämpft. »Was hast du gemacht?«
»Ich habe für meine Mutter gebetet. Sie ist krank.«
»Du liebst deine Mutter?« Die Frage klang gespannt.
Sie nickte verwundert. »Ja.«
Der Colonel fuhr auf dem Absatz zu seinen Männern herum und stieß den Finger wie einen Degen auf sie. »Keiner rührt sie an!«, schrie er. »Keiner! Verstanden? Keiner!« Sein Gesicht zuckte, und er wartete, bis der Krampf vorüberging. »Ich werde jeden Bastard töten, der sie anfasst! Jeden!« Er wandte sich wieder der Frau zu und verneigte sich unbeholfen. »Lady Farthingdale«, sagte er plötzlich förmlich, nachdem er sie die ganze Zeit über herablassend geduzt hatte. »Sie werden sich mit uns abfinden müssen.« Er blickte suchend durch den Kreuzgang und sah den Priester, der inzwischen an eine Säule gefesselt worden war. »Wir schicken den Pfarrer mit einem Brief und dem Ring los. Ihr Ehemann kann für Sie bezahlen, Mylady, aber niemand wird Sie anrühren, das verspreche ich Ihnen.« Er fuhr wieder zu seinen Männern herum, schrie sie an, und Speichel tropfte von seinen Lippen. »Keiner rührt sie an!« Seine Stimmung schlug von einem Augenblick zum anderen wieder um. Er schaute durch den Kreuzgang zu den Frauen, die blutend und geschändet am Boden lagen, und zu den anderen, die angsterfüllt und entsetzt und von Bajonetten bedroht warteten, und er grinste. »Genug für jeden, wie? Genug!«
Er lachte meckernd und wandte sich ab. Sein Degen schabte über den Boden. Er sah ein junges Mädchen, das mager und kaum dem Kindesalter entwachsen war, und stieß den Finger in ihre Richtung. »Das ist meine! Bringt sie her!« Er lachte, stemmte die Hände in die Hüften und grinste die Männer im Kloster an. »Willkommen in eurer neuen Heimat, Jungs.«
Der Tag des Wunders war wieder für Adrados gekommen, und die Hunde des Dorfs schnüffelten an dem Blut, das auf der einzigen Straße trocknete.
KAPITEL 1
Richard Sharpe, Captain der Leichten Kompanie, des einen und einzigen Bataillons des South Essex Regiments, stand am Fenster und schaute auf die Prozession, die über die Straße zog. Es war draußen kalt, das wusste er nur zu gut. Er hatte soeben seine geschrumpfte Kompanie von Castillo Branco aus nordwärts marschieren lassen, weil er den geheimnisvollen Befehl erhalten hatte, sich im Hauptquartier zu melden. Eine Erklärung hatte man ihm immer noch nicht gegeben. Das Hauptquartier gab einem Captain zwar selten Erklärungen ab, doch Sharpe ärgerte sich darüber, dass er jetzt bereits zwei Tage lang in Frenada war und immer noch keine Ahnung hatte, was es mit dem Befehl auf sich hatte. Der General, Viscount Wellington von Talavera, hatte ihn nach Frenada befohlen – nein, das stimmte nicht mehr! Er war jetzt der Marquis von Wellington, Grande von Spanien, Herzog von Ciudad Rodrigo, Oberbefehlshaber aller spanischen Armeen, »Nosey« für seine Männer, »der Peer« für seine Offiziere.
Wellington hatte Sharpe also nach Frenada befohlen, aber er war nicht hier. Er war in Cadiz oder Lissabon oder wer weiß wo, die britische Armee hatte sich in ihre Winterquartiere zurückgezogen, und nur Sharpe und seine Kompanie marschierten im kalten Dezember durch das raue Land. Major Michael Hogan, Sharpes Freund und Wellingtons Geheimdienstchef, war mit dem General südwärts gezogen, und Sharpe vermisste ihn. Hogan hätte ihn nicht warten lassen.
Immerhin hatte Sharpe es warm. Er hatte dem Angestellten im Erdgeschoss seinen Namen genannt und ihm gesagt, dass er oben im Kasino des Hauptquartiers warten werde, wo ein Feuer Wärme spendete. Sharpe war nicht berechtigt, den Raum zu benutzen, aber nur wenige Leute wollten sich mit dem großen Schützen anlegen, der eine Narbe hatte, die seinem Gesicht ein leicht spöttisches Aussehen verlieh.
Er spähte hinab auf die Straße. Ein Priester sprenkelte Weihwasser. Messdiener bimmelten mit Glöckchen und schwangen Weihrauchgefäße. Messdiener mit Kirchenfahnen folgten der Statue der Jungfrau Maria. Frauen knieten vor den Gebäuden und reckten die gefalteten Hände zur Statue empor, die vorbeigetragen wurde. Schwacher Sonnenschein fiel auf die Straße, Wintersonnenschein, und Sharpe hielt automatisch nach Wolken Ausschau. Der Himmel war wolkenlos.
Das Kasino war leer. Wellington war fort, und die meisten der Offiziere verbrachten anscheinend den Morgen im Bett oder hockten im Gasthaus nebenan, wo der Wirt dazu angehalten worden war, ein anständiges Frühstück zu machen. Schweinekotelett, Spiegeleier, gebratene Nieren, Schinkenspeck, Toast, roter Bordeauxwein, noch mehr Toast, Butter und Tee, der so stark war, dass man damit einen verdreckten Kanonenlauf blank putzen konnte. Einige der Offiziere waren bereits zum Weihnachtsurlaub nach Lissabon gereist. Wenn die Franzosen jetzt angreifen, dachte Sharpe, dann können sie durch Portugal bis zum Meer spazieren.
Die Tür flog auf, und ein Mann in mittlerem Alter, der einen weißen Morgenmantel über seiner Uniform trug, trat ein. Er starrte den Schützen finster an. »Sharpe?«
»Jawohl, Sir.« Sharpe hielt »Sir« für angebracht, denn der Mann strahlte Autorität aus, obwohl er einen fürchterlichen Schnupfen hatte.
»Major General Nairn.« Der Major General warf Papiere auf einen Tisch, auf dem alte Ausgaben von Times und Courier aus London lagen. Dann ging er hinüber zum anderen hohen Fenster und starrte finster auf die Straße. »Verdammte Papisten!«
»Jawohl, Sir.« Wiederum eine wohl überlegte Antwort.
»Verdammte Papisten! Die Nairns, Sharpe, sind allesamt schottische Presbyterianer! Wir mögen langweilig sein, aber bei Gott, wir sind fromm!« Er grinste, dann nieste er heftig und putzte sich anschließend die Nase mit einem großen grauen Tuch. Er wies zur Prozession hin. »Ein weiterer gottverdammter Feiertag, Sharpe. Ich kann nicht verstehen, warum die Leute alle so mager sind.« Er lachte und blickte Sharpe dann durchdringend an. »Sie sind also Sharpe?«
»Jawohl, Sir.«
»Kommen Sie mir nur ja nicht zu nahe, ich habe eine verdammte Erkältung.« Er ging zum Feuer im Kamin. »Habe über Sie so einiges gehört, Sharpe. Verdammt Beeindruckendes! Sie sind Schotte, nicht wahr?«
»Nein, Sir.« Sharpe grinste.
»Nicht Ihre Schuld, Sharpe, nicht Ihre Schuld. Für unsere verdammten Eltern können wir nichts, und darum müssen wir unsere verdammten Kinder verdreschen.« Er musterte Sharpe schnell, wie um sich zu vergewissern, ob er die Worte zu schätzen wusste. »Sie sind aus den Mannschaften aufgestiegen, nicht wahr?«
»Jawohl, Sir.«
»Sie haben sich gut gemacht, Sharpe, verdammt gut.«
»Danke, Sir.« Erstaunlich, wie wenig Worte für gewöhnlich nötig waren, um mit ranghöheren Offizieren Konversation zu treiben.
Major General Nairn bückte sich, nahm einen Schürhaken auf und stocherte in der Glut des Kaminfeuers. »Ich nehme an, Sie fragen sich, warum Sie hier sind. Richtig?«
»Jawohl, Sir.«
»Sie sind hier, weil dies der wärmste Raum in Frenada ist und Sie offenbar kein Dummkopf sind.« Nairn lachte, legte den Schürhaken ab und schnäuzte sich geräuschvoll. »Verdammt mieses Kaff, dieses Frenada.«
»Jawohl, Sir.«
Nairn schaute Sharpe finster an. »Wissen Sie, warum der Peer Frenada als sein Winterhauptquartier ausgewählt hat?«
»Nein, Sir.«
»Einige Leute werden Ihnen erzählen, dass Frenada ausgewählt wurde, weil es nahe der spanischen Grenze liegt.«
Der Major General ließ sich mit einem zufriedenen Seufzen in einen Sessel sinken, der mit Pferdefell bezogen war. »Daran ist etwas Wahres, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Andere Leute werden Ihnen sagen, dass der Peer diese Stadt gewählt hat, weil sie verdammt weit weg von Lissabon ist und kein Postenjäger und Speichellecker sich die Mühe machen wird, die Reise hier herauf auf sich zu nehmen und ihn zu belästigen. Auch das mag ein Körnchen Wahrheit enthalten, abgesehen davon, dass sich der Peer fast die halbe Zeit dort unten aufhält, was es den kriecherischen Bastarden verdammt leicht macht. Nein, Sharpe, Sie müssen den wahren Grund woanders suchen.«
»Jawohl, Sir.«
Nairn stöhnte, als er sich reckte. »Der wahre Grund, Sharpe, ist folgender: Dieses gottverdammte Kaff wurde gewählt, weil es mitten in der besten gottverdammten Fuchsjagd in Portugal liegt.«
Sharpe grinste. »Jawohl, Sir.«
»Und der Peer liebt die Fuchsjagd. So sind wir zu den ewigen Qualen dieser gottverdammten Stadt verdammt. Setzen Sie sich, Mann!«
»Jawohl, Sir.«
»Und hören Sie mit dem ›jawohl, Sir‹ und ›nein, Sir‹ auf, das klingt nach einem verdammten Speichellecker.«
»Jawohl, Sir.« Sharpe setzte sich in den Sessel gegenüber von Major General Nairn. Der Schotte hatte buschige graue Augenbrauen. Es hatte den Anschein, als wüchsen sie aufwärts, um sich mit seinem grauen Haarschopf zu vereinigen. Das markante Gesicht mit den listig blickenden Augen wirkte heiter, und nur die von der Erkältung gerötete Nase trübte diesen Eindruck ein wenig. Nairn musterte Sharpe von den französischen Kavalleriestiefeln hinauf bis zum schwarzen Haar, und dann drehte er sich im Sessel um und rief zur Tür: »Chatsworth! Sie Mistkerl. Sie Hurensohn! Chatsworth! Bei Fuß! Haben Sie gehört? Bei Fuß!«
Eine Ordonnanz tauchte auf und grinste Nairn vergnügt an.
»Sir?«
»Tee, Chatsworth, Tee! Bringen Sie mir starken Tee. Etwas, das meine militärische Begeisterung wiedererweckt! Und seien Sie so freundlich, ihn vor dem neuen Jahr zu bringen.«
»Der Tee zieht bereits, Sir. Möchten Sie etwas essen, Sir?«
»Essen? Ich habe eine schlimme Erkältung, Chatsworth. Ich bin dem Tode nahe, und da schwätzen Sie mir was von essen! Was haben Sie denn?«
»Ich habe Schinken, Sir, von dem, der Ihnen so gut schmeckt. Senf, Brot und frische Butter.« Chatsworth war sehr eifrig, offensichtlich mochte er Nairn.
»Ah, Schinken! Bringen Sie uns Schinken, Chatsworth, Schinken und Senf und meinetwegen Ihr Brot und die Butter. Haben Sie die Gabel zum Brotrösten aus diesem Kasino geklaut, Chatsworth?«
»Nein, Sir.«
»Dann finden Sie heraus, welcher Ihrer diebischen Kameraden sie entwendet hat. Lassen Sie ihn auspeitschen und bringen Sie mir die Gabel!«
»Jawohl, Sir.« Chatsworth grinste, als er das Kasino verließ.
Nairn lächelte Sharpe an. »Ich bin ein harmloser alter Mann, Sharpe, allein gelassen mit dem Kommando über dieses verdammte Irrenhaus, während sich der Peer auf der halben verdammten Halbinsel herumtreibt. Ich soll, Gott stehe mir bei, dieses Hauptquartier führen. Ich! Wenn ich Zeit hätte, Sharpe, dann könnte ich vermutlich die Truppen in einen Winterfeldzug führen! Ich könnte meinen Namen mit Ruhm überhäufen, aber ich habe keine verdammte Zeit! Sehen Sie sich das an!« Er nahm ein Blatt Papier von einem Stapel neben sich. »Ein Brief von General Miller, dem obersten Militärkaplan. Wissen Sie, dass er fünfhundertfünfundsechzig Pfund im Jahr verdient, Sharpe, und nebenbei Berater für die Errichtung von Signalmasten ist, wofür er weitere sechshundert Pfund kassiert? Können Sie das glauben? Und was macht Gottes Kaplan in der Armee Seiner Majestät mit seiner gut bezahlten Zeit? Er schreibt mir so was!« Nairn hielt Sharpe den Brief hin. »›Ich bitte Sie, mir den Bericht über die Eindämmung des Methodismus in der Armee zu schicken.‹ Allmächtiger! Was soll man mit einem solchen Schreiben tun, Sharpe?«
Sharpe lächelte. »Ich habe keine Ahnung, Sir.«
»Aber ich, Sharpe, aber ich. Deshalb bin ich Major General.« Nairn neigte sich vor und warf den Brief ins Feuer. »Das muss man mit solchen Briefen machen.« Er kicherte zufrieden, als der Brief Feuer fing und die Flamme aufloderte. »Sie möchten wissen, weshalb Sie hier sind, nicht wahr?«
»Jawohl, Sir.«
»Sie sind hier, Sharpe, weil der Prince of Wales irre geworden ist. Genau wie sein Vater, der arme Mann, ist er total verrückt geworden.« Nairn lehnte sich zurück, sah Sharpe triumphierend an und wartete auf eine Reaktion. »Verdammt, Sharpe, Sie sollten etwas sagen! Gott segne den Prince of Wales, das würde zur Not reichen, aber Sie sitzen da, als ob die Nachricht nichts bedeutet. Das liegt vermutlich daran, dass Sie ein Held sind, da müssen Sie immer gelassen bleiben und keine Miene verziehen. Ein ernster Job, ein Held zu sein, was?«
»Jawohl, Sir.« Sharpe grinste breit.
Die Tür wurde geöffnet, und Chatsworth brachte ein schweres Holztablett, das er vor dem Kamin auf dem Boden abstellte. »Brot und Schinken, Sir, und Senf in dem kleinen Topf. Der Tee hat genau richtig gezogen, und ich möchte melden, dass ich die Gabel zum Brotrösten in Ihrem Zimmer gefunden habe, Sir. Hier ist sie, Sir.«
»Sie sind ein Gauner und Schurke, Chatsworth. Als Nächstes werden Sie mich noch bezichtigen, die Korrespondenz vom Militärkaplan verbrannt zu haben.«
»Jawohl, Sir.« Chatsworth grinste zufrieden.
»Sind Sie ein Methodist, Chatsworth?«
»Nein, Sir. Eigentlich weiß ich nicht genau, was ein Methodist ist, Sir.«
»Da sind Sie wirklich ein Glückspilz.« Nairn spießte eine Scheibe Brot mit der Gabel zum Rösten auf. Ein Lieutenant tauchte in der offenen Tür auf und klopfte zögernd an, um auf sich aufmerksam zu machen. »General Nairn, Sir?«
»Major General Nairn ist in Madrid! Handelt eine Kapitulation der Franzosen aus!« Nairn umwickelte seine Hand mit dem Taschentuch zum Schutz gegen die Hitze und hielt die Brotscheibe zum Rösten ins Feuer.
Der Lieutenant lächelte nicht. Er blieb an der Tür stehen. »Colonel Greave lässt grüßen, Sir, und anfragen, was er mit den Eisenklammern für den Ponton machen soll.«
Nairn verdrehte die Augen zur vergilbten Decke. »Wer ist verantwortlich für die Pontons, Lieutenant?«
»Die Pioniere, Sir.«
»Und wer, bitte, hat das Kommando über unsere tapferen Pioniere?«
»Colonel Fletcher, Sir.«
»Was sagen Sie also unserem werten Colonel Greave?«
»Ich verstehe, Sir. Jawohl, Sir.« Der Lieutenant überlegte noch einmal schnell. »Er soll Colonel Fletcher fragen, Sir?«
»Sie haben das Zeug zum General, Lieutenant. Gehen Sie und erledigen Sie das in diesem Sinne, und sollte die für die Waschfrauen zuständige Generalin mich zu sehen wünschen, sagen Sie ihr, dass ich ein verheirateter Mann und gegen ihre Annäherungsversuche immun bin.«
Der Lieutenant ging, und Nairn starrte die Ordonnanz an: »Hören Sie mit dem Grinsen auf, Chatsworth. Der Prince of Wales ist irre geworden, und Sie können nur grinsen!«
»Jawohl, Sir. Ist das alles, Sir?«
»Das ist es, Chatsworth, und ich danke Ihnen. Gehen Sie jetzt, und schließen Sie die Tür leise.«
Nairn wartete, bis die Tür geschlossen war. Er drehte das auf die Gabel gespießte Brot. »Sie sind kein Dummkopf, Sharpe, oder doch?«
»Nein, Sir.«
»Gott sei Dank. Es ist möglich, dass der Prince of Wales eine Spur vom Wahnsinn seines Vaters geerbt hat. Er redet in die Armee hinein, und der Peer ist verdammt verärgert.« Nairn legte eine Pause ein und hielt das Brot gefährlich nahe an die Flammen. Sharpe sagte nichts, aber er ahnte, dass Wellingtons Verärgerung und die Einmischung des Prince of Wales etwas mit seiner plötzlichen Abkommandierung nach Norden zu tun hatten. Nairn musterte Sharpe. »Haben Sie von Congreve gehört?«
»Der Raketenmann?«
»Genau, Sir William Congreve, der die Vormundschaft über Prinny hat und der Vater eines Systems von Raketenartillerie ist.« Rauch stieg von der Brotscheibe auf, und Nairn zog sie schnell vom Feuer. »Wir brauchen Kavallerie, Artillerie und Infanterie, und was schickt man uns, Sharpe? Raketen! Einen Trupp Raketen-Kavallerie! Und alles, weil Prinny, mit einer Spur vom Wahnsinn seines Vaters, der Meinung ist, sie werden den Krieg gewinnen. Hier.« Er hielt Sharpe die Gabel zum Rösten hin und strich Butter auf seine geröstete Brotscheibe. »Tee?«
»Verzeihung, Sir.« Sharpe hätte einschenken sollen. Er füllte jetzt zwei Tassen, während Nairn seinen Toast mit einer dicken Scheibe Schinken belegte und großzügig Senf darauf strich. Nairn nippte am Tee und seufzte.
»Chatsworth macht himmlischen Tee. Er wird eines Tages eine Frau sehr glücklich machen.« Er schaute zu, während Sharpe eine Scheibe Brot röstete. »Raketen, Sharpe! Wir haben einen Trupp Raketen-Kavallerie in der Stadt, und man hat uns befohlen, dieser Raketen-Truppe einen fairen und gründlichen Test zu gewähren.« Er grinste. »Mögen Sie das Brot nicht ein bisschen dunkler?«
»Nein, Sir.« Sharpe drehte die nur leicht gebräunte Brotscheibe auf die andere Seite.
»Ich mag es dunkel.« Nairn kaute einen großen Bissen Brot mit Schinken. »Wir müssen diese verdammten Raketen testen, und wenn wir feststellen, dass sie nicht funktionieren, schicken wir sie zurück nach England und behalten all die Pferde des Trupps, die wir gut gebrauchen können. Verstanden?«
»Jawohl, Sir.«
»Gut! Denn Sie bekommen den Job. Sie werden das Kommando über Captain Gilliland und seine teuflischen Maschinen bekommen und ihn üben lassen, als wäre er in der Schlacht. So lauten Ihre Befehle. Ich sage darüber hinaus, und der Peer würde es auch sagen, wenn er hier wäre, dass Sie ihn so verdammt hart testen sollen, dass er sich mit wenigstens einer Spur von Verstand nach England zurück schleicht.«
»Sie wollen, dass die Raketen versagen, Sir?« Sharpe strich Butter auf die Brotscheibe.
»Ich will nicht, dass sie versagen, Sharpe. Ich wäre entzückt, wenn sie funktionierten, aber das werden sie nicht. Wir hatten vor einigen Jahren ein paar, und sie waren so flatterhaft wie eine läufige Hündin, aber Prinny meint, es besser zu wissen. Sie, Sharpe, testen die Raketen, und Sie bringen außerdem Captain Gilliland Kriegsmanöver bei. Mit anderen Worten, Sharpe, Sie lehren ihn, wie er mit der Infanterie zusammenarbeitet, denn wenn er jemals in die Schlacht zieht, wird Infanterie ihn vor den Truppen des stolzen Tyrannen schützen müssen.« Nairn verschlang einen weiteren Bissen Schinkenbrot. »Unter uns gesagt, es würde mich freuen, wenn Bonaparte ihn und seine verdammten Raketen erledigt, aber wir müssen Bereitwilligkeit zeigen.«
»Jawohl, Sir.« Sharpe trank einen Schluck Tee. Es lag etwas Sonderbares in der Luft. Irgendetwas war noch ungesagt geblieben. Sharpe hatte von Congreves Raketensystem gehört. Es gab schon seit fünf oder sechs Jahren Gerüchte über die neue geheime Artillerie. Aber warum war er, Sharpe, ausgewählt worden, um die Sache zu testen? Er war Captain, und Nairn hatte davon gesprochen, dass er das Kommando über einen anderen Captain erhalten würde. Das ergab keinen Sinn.
Nairn hielt eine weitere Brotscheibe übers Feuer. »Sie fragen sich, weshalb die Wahl auf Sie gefallen ist, nicht wahr? Weshalb wir von allen tapferen Offizieren und Gentlemen ausgerechnet Sie ausgewählt haben, ja?«
»Ja, Sir, das frage ich mich.«
»Weil Sie eine Plage sind, Sharpe. Weil Sie nicht in das gut geordnete Schema des Peer passen.«
Sharpe aß sein Schinkenbrot und ersparte sich eine Antwort. Nairn hatte anscheinend das Rösten vergessen. Die Röstgabel samt Brotscheibe lag auf dem Feuer. Er nahm ein anderes Schriftstück vom Stapel, der auf dem Tisch lag. »Ich sagte schon, Sharpe, dass Prinny verrückt geworden ist. Er hat uns nicht nur den schrecklichen Gilliland mit seinen verdammten Raketen auf den Hals geschickt, sondern uns auch noch das hier angetan.«
Das hier war das Schriftstück, das er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, als wäre es ansteckend. »Entsetzlich! Ich nehme an, Sie sollten es lesen, obwohl nur Gott allein weiß, weshalb ich es nicht ins Feuer werfe wie den verdammten Brief des militärischen Oberhirten. Hier.« Er überreichte Sharpe das Schriftstück und kümmerte sich um seinen Toast, der schon recht dunkel geworden war.
Das Papier war dick und cremefarben. Ein großes rotes Siegel befand sich auf der linken Seite. Sharpe hielt das Schriftstück zum Licht, das durch die Fenster hereinfiel, und las den Text. Die beiden Überschriftzeilen schimmerten in dekorativem Kupferstich: »Georg der Dritte von Gottes Gnaden des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, König, Verteidiger des Glaubens.«
Die nächsten Worte waren handgeschrieben. Getreuer und hochgeschätzter Richard Sharpe, Esquire. Dann wieder in Kupferstich: deutlich zu sehen, doch Sharpe verschwammen die Worte vor den Augen. Da war von einer Ernennung die Rede! Sharpe sah zu Nairn auf.
Der Major General strich Butter auf die Brotscheibe. »Zeitverschwendung, Sharpe«, sagte er grollend. »Werfen Sie den Wisch ins Feuer! Der Mann ist irre!«
Sharpe grinste. Er versuchte, die Erregung, die in ihm wuchs, unter Kontrolle zu bekommen, eine Mischung aus Hochgefühl und schierer Ungläubigkeit, und er wagte fast nicht zu lesen, um welche Ernennung es sich handelte:
Major in Unserer Armee, die jetzt in Portugal und Spanien ist.
Mein Gott! Major! Die Hand mit der Ernennungsurkunde begann leicht zu zittern. Sharpe lehnte sich einen Augenblick lang im Sessel zurück und atmete tief durch. Major! Er war jetzt neunzehn Jahre lang in der Armee. Noch vor seinem sechzehnten Geburtstag war er zur Armee gegangen und mit Muskete und Bajonett als gemeiner Soldat durch Indien marschiert, und jetzt war er Major! Lieber Gott! Er hatte so hart gekämpft, um Captain zu werden, hatte bezweifelt, es jemals zu schaffen, und nun kam wie aus heiterem Himmel diese Ernennung! Er war jetzt Major Richard Sharpe!
Nairn lächelte ihn an. »Es ist nur ein Armeerang, Sharpe.«
Also ein Brevet-Major – ein Offizierspatent, das nur einen höheren Rang, aber keine höhere Besoldung mit sich bringt –, aber trotzdem ein Major. Der Regimentsrang war der wahre Rang, und wenn die Ernennung gelautet hätte »Major in unserem South Essex Regiment« dann wäre es ein Regimentsrang gewesen. Ein Armeerang bedeutete, dass er Major war, solange er außerhalb seines eigenen Regiments diente. Vorübergehend würde er als Major bezahlt werden, doch wenn er jetzt seinen Abschied nahm, würde sein Regimentsrang gelten, also Captain und nicht Major. Aber was machte das? Er war Major!
Nairn musterte Sharpes hartes, tief gebräuntes Gesicht. Er wusste, dass er einen bemerkenswerten Mann vor sich hatte, der so schnell so hoch aufgestiegen war, und er fragte sich, was Sharpe dazu getrieben hatte.
Sharpe saß mit der Ernennungsurkunde in der Hand beim Feuer und wirkte ruhig und beherrscht, doch Nairn wusste vieles über den Soldaten Sharpe. Nur wenige Leute in der Armee hatten noch nichts über Sharpe gehört. Der Peer nannte ihn den besten Führer einer Leichten Kompanie in der britischen Armee, und das war vielleicht der Grund, weshalb Wellington verärgert über die Einmischung des Prince of Wales war. Sharpe war ein guter Captain, aber würde er ein guter Major sein? Bei diesem Gedanken zuckte Nairn unwillkürlich mit den Schultern. Dieser Richard Sharpe, der Mann, der immer noch darauf bestand, die grüne Uniform der Schützen zu tragen, hatte die Armee noch niemals enttäuscht, und die Ernennung zum Major würde ihm wohl kaum die Wildheit seiner Kampfkraft nehmen.
Sharpe las die Ernennung bis zum Ende. Er war entschlossen, sowohl rangniedrigere Offiziere als auch die Mannschaften gut zu führen und die Befehle zu beachten und zu befolgen, die ihm gegeben wurden. Lieber Gott! Ein Major!
Die Ernennung trug das Datum 14. November 1812. Die Worte »Auf Befehl seiner Majestät« waren durchgestrichen. Stattdessen stand in der Ernennung: Auf Befehl seiner Königlichen Hoheit des Prinzregenten, im Namen und im Auftrag Seiner Majestät.
Nairn lächelte Sharpe an. »Prinny erfuhr von Badajoz und dann von der Schlacht bei Garcia Hernandez, und er bestand auf der Ernennung. Es ist natürlich gegen die Regeln, völlig gegen die Vorschriften. Der verdammte Kerl hat kein Recht, Sie zu befördern. Werfen Sie den Wisch ins Feuer!«
»Würden Sie es mir verübeln, wenn ich diesen Befehl verweigere, Sir?«
»Glückwunsch, Sharpe! Sie machen weiter, wie Sie es vorgehabt haben.« Die letzten Worte stieß er hastig hervor, weil ihn ein Niesreiz befiel. Nairn nahm schnell sein Tuch und trompetete hinein. Er schüttelte den Kopf, schnäuzte sich ein paar Mal und lächelte wieder. »Meine echten Glückwünsche.«
»Danke, Sir.«
»Danken Sie nicht mir, Major. Danken Sie uns allen, indem Sie dafür sorgen, dass die Raketen von diesem Gilliland eine Pleite werden. Wissen Sie, dass der Kerl hundertfünfzig Pferde für seine Spielzeuge bekommen hat? Hundertfünfzig Pferde! Wir brauchen diese Pferde, Sharpe, aber wir können sie verdammt nicht anrühren, solange Prinny denkt, wir machen Boney damit fertig. Beweisen Sie Prinny, dass er sich irrt, Sharpe! Er wird auf Sie hören.«
Sharpe lächelte. »Deshalb wurde ich also ausgewählt?«
»Genau. Sie sind kein Dummkopf. Natürlich wurden Sie deshalb ausgewählt, und selbstverständlich als Bestrafung.«
»Bestrafung?«
»Weil Sie vorzeitig befördert wurden. Wenn Sie gewartet hätten, bis einer unserer Majors vom South Essex abkratzt, dann hätten Sie den Regimentsrang erhalten. Er wird kommen, Sharpe, er wird kommen. Wenn 1813 wie dieses Jahr wird, dann werden wir nächstes Jahr zu Weihnachten alle Feldmarschall sein.« Nairn zog den Morgenmantel fest um seine Brust zusammen. »Wenn wir nächstes Jahr Weihnachten noch leben, was ich bezweifle.«
Nairn erhob sich. »Auf, auf, Sharpe! Sie werden Gilliland an der Straße nach Guarda finden, wo er Feuerwerk spielt. Hier sind Ihre Befehle. Er weiß, dass Sie kommen, das arme Schaf. Schicken Sie ihn zurück zu Prinny, aber behalten Sie die verdammten Pferde!«
»Jawohl, Sir.« Sharpe stand auf, nahm die Befehle, die Nairn ihm überreichte, und geriet wieder in Jubelstimmung. Er war Major!
Plötzlich läuteten Kirchenglocken, und Vögel flogen erschreckt auf. Nairn zuckte bei dem Läuten zusammen und ging zum Fenster. »Schaffen Sie uns Gilliland vom Hals, und dann können wir alle ruhige Weihnachten feiern!« Nairn rieb sich die Hände. »Außer diesen verdammten Kirchenglocken stört Gott sei Dank nichts die Armee seiner Majestät in Portugal und Spanien, Major.«
»Jawohl, Sir. Danke, Sir.« Wie gut die Anrede »Major« klang!
Die Glocken läuteten weiter zum Feiertag, während etwa fünfzig Meilen nordöstlich die ersten englischen Soldaten mit ungepflegten roten Uniformröcken in das Dorf Adrados einmarschierten.
KAPITEL 2
Die Gerüchte erreichten Frenada sehr schnell, doch auf dem Weg durch die portugiesische Landschaft wurde die Geschichte durcheinander gewirbelt wie die Rauchspuren von Congreves Raketen über dem kleinen Tal, in dem Sharpe sie testete.
Sergeant Patrick Harper war der Erste von Sharpes Kompanie, der die Geschichte hörte. Er erfuhr sie von seiner Frau Isabella, die sie von der Kanzel von Frenadas Kirche herunter gehört hatte. Empörung erfasste die Stadt, und Harper teilte die Entrüstung. Englische Truppen, und obendrein Protestanten, waren in ein abgelegenes Dorf einmarschiert und hatten an einem heiligen Tag getötet, vergewaltigt und geplündert.
Patrick Harper erzählte das Sharpe. Sie saßen mit Lieutenant Price und den beiden anderen Sergeants der Kompanie im Wintersonnenschein des Tals zusammen. Sharpe hörte seinen Sergeant an und schüttelte dann den Kopf. »Das glaube ich nicht.«
»Ich schwöre es, Sir. Der Priester sagte es in der Kirche!«
»Hast du es gehört?«
»Isabella hat es gehört!« Harpers Augen unter den sandfarbenen Brauen funkelten streitlustig. Seine Empörung wurde noch durch den Ulster-Akzent betont. »Der Priester wird kaum auf seiner Kanzel lügen! Was hätte er davon?«
Sharpe schüttelte den Kopf. Er hatte mit Harper auf vielen Schlachtfeldern gekämpft und betrachtete ihn als Freund, doch er war nicht an diese Verbitterung gewöhnt. Harper hatte die ruhige Zuversicht eines starken Mannes. Er hatte einen unbezwingbaren Humor, der ihm auf den Schlachtfeldern, in den Biwaks und gegen das boshafte Schicksal geholfen hatte, das ihn, einen Iren, in die englische Armee gezwungen hatte. Die Gedanken an seine Heimat Donegal waren jedoch nie fern, und da war etwas an diesen Gerüchten, das einen patriotischen Nerv bei Harper traf, der schmerzte, wann immer Harper daran dachte, wie Irland von England behandelt worden war. Protestanten hatten Katholiken getötet und vergewaltigt, eine heilige Stätte geschändet. All das ging Harper nicht aus dem Kopf.
Sharpe lächelte. »Glaubst du wirklich, dass einige unserer Jungs in ein Dorf gehen, die Männer einer spanischen Garnison töten und alle Frauen vergewaltigen? Findest du das nicht sehr unwahrscheinlich?«
Harper zuckte mit den Schultern und dachte widerstrebend nach. »Ich gebe zu, dass es das erste Mal wäre, das gebe ich zu. Aber es ist geschehen!«
»Warum, um Gottes willen, würden sie das tun?«
»Weil sie Protestanten sind, Sir! Die marschieren hundert Meilen weit, nur um einen Katholiken zu töten. Das liegt ihnen im Blut!«
Sergeant Huckfield, ein Protestant aus England, spuckte einen Grashalm von den Lippen. »Harps! Und was ist mit eurem verdammten Pack? Mit der Inquisition? Haben Sie nie von der Inquisition in Ihrem Land gehört? Allmächtiger! Sie reden vom Töten! Wir haben das alles vom verdammten Rom gelernt!«
»Genug!« Sharpe hatte diesen Streit zu oft ertragen, und er wollte ihn nicht ausufern lassen, wenn Harper voller Zorn war. Er sah, dass der irische Hüne zu einer heftigen Entgegnung ansetzte, und er stoppte den Streit, bevor mit jemandem das Temperament durchging. »Ich sagte, es reicht!« Er wandte den Kopf, um zu sehen, ob Gillilands Soldaten ihre scheinbar unendlichen Vorbereitungen beendet hatten, und er ließ seinen Zorn über ihre Langsamkeit aus.
Lieutenant Price lag lang ausgestreckt da und hatte den Tschako über die Augen gezogen. Er lächelte über Sharpes Flüche. Dann schob er den Tschako zurück. »Das liegt daran, weil wir am Sonntag arbeiten. Wir versündigen uns gegen den Tag des Herrn. Es ist noch nie was Gutes dabei herausgekommen, wenn man am Sabbat arbeitet, das sagt mein Pfarrer stets.«
»Außerdem haben wir den dreizehnten«, warf Sergeant McGovern pessimistisch ein.
»Wir arbeiten am Sonntag«, sagte Sharpe mit erzwungener Geduld, »weil wir so diesen Job bis Weihnachten erledigt haben und ihr zum Bataillon zurückkehren könnt. Dann könnt ihr die Gans essen, die Major Forrest freundlicherweise gekauft hat, und euch mit Major Leroys Rum besaufen. Wenn ihr das nicht wollt, dann kehren wir jetzt nach Frenada zurück. Noch irgendwelche Fragen?«
Lieutenant Price sprach mit der Stimme eines kleinen, lispelnden Jungen. »Was schenken Sie mir zu Weihnachten, Major?«
Die Sergeants lachten, und Sharpe sah, dass Gilliland endlich fertig war. Er erhob sich und wischte Erde und Gras von seiner französischen Kavalleriehose, die er zu dem Rock des Schützen trug. »Es ist so weit. Kommt!«
Vier Tage lang hatten sie nun mit Gillilands Raketen geübt. Sharpe wusste, oder glaubte zu wissen, was er über sie zu sagen haben würde. Sie funktionierten nicht. Sie waren unterhaltsam, sogar spektakulär, doch hoffnungslos ungenau.
Raketen waren nichts Neues im Krieg. Gilliland, der sich leidenschaftlich für diese Waffe einsetzte, hatte Sharpe erzählt, dass sie zuerst in China eingesetzt worden waren, vor Jahrhunderten, und Sharpe selbst hatte den Einsatz von Raketen bei indischen Armeen gesehen. Er hatte gehofft, dass sich diese britischen Raketen, das Produkt von Wissenschaft und Technik, als besser als diejenigen erweisen würden, die den Himmel über Seringapatam geschmückt hatten.
Congreves Raketen sahen genauso aus wie die Feuerwerkskörper, mit denen die Königlichen Festtage in London gefeiert wurden. Sie waren nur viel größer. Gillilands kleinste Rakete war ganze elf Fuß lang, und etwa zwei Fuß davon bildete der Zylinder mit dem Pulverantrieb und einer Kanonenkugel oder Granate. Die größte Rakete war laut Gilliland achtundzwanzig Fuß lang, der Kopf war größer als ein Mann, und die Ladung bestand aus über fünfzig Pfund Sprengstoff. Wenn solch eine Rakete auch nur vage in die Nähe des Ziels gebracht werden konnte, dann würde sie eine furchtbare Waffe sein.
Vor zwei Stunden hatte Sharpe wieder unter dem wolkenlosen Himmel und der überraschend warmen Dezembersonne mit Gillilands Männern geübt. Es war vermutlich eine Zeitverschwendung, denn Sharpe bezweifelte, dass Gilliland jemals im Kampf mit der Infanterie Verbindung halten konnte, doch es war etwas an dieser neuen Waffe, das Sharpe faszinierte.
Während er seine dünne Schützenlinie zum vierten Mal von der Front der Batterie zurückzog, dachte er, dass er vielleicht von den Zahlen beeindruckt war. Eine Artillerie-Batterie hatte sechs Geschütze, und sie brauchte hundertzweiundsiebzig Mann und hundertvierundsechzig Pferde, um sie zu bewegen und zu bedienen. In der Schlacht konnte die Batterie zwölf Schuss pro Minute abgeben.
Gilliland hatte die gleiche Anzahl von Männern und Pferden, aber er konnte neunzig Raketen in der Minute abfeuern. Diese Feuerquote konnte er eine Viertelstunde aufrecht erhalten, sein ganzes Kontingent von tausendvierhundert Raketen abfeuern, und keine Artillerie-Batterie konnte mit dieser Feuerkraft konkurrieren.
Es gab noch einen anderen Unterschied, eine unangenehme Tatsache. Zehn von zwölf Kanonenschüssen trafen ihr Ziel auf etwa fünfhundert Yards. Gilliland war glücklich, wenn auf dreihundert Yards auch nur eine Rakete von fünfzig in der Nähe des Ziels einschlug.
Zum letzten Mal an diesem Tag befahl Sharpe seine Schützenlinie zurück. Lieutenant Price signalisierte von der fernen Seite des Tals, dass er mit den Männern die befohlene Position erreicht hatte.
Sharpe schaute Gilliland an und gab den Feuerbefehl.
Sharpes Männer grinsten erwartungsvoll. Diesmal würden nur die zwölf kleinen Raketen abgefeuert werden. Die Artilleristen hielten Feuer an die Lunten, Rauch kräuselte empor, und dann, fast gleichzeitig, schossen die zwölf Raketen empor. Rauch und Funken bildeten einen Schweif hinter ihnen, sie stiegen schneller und schneller, erfüllten das Tal mit ihrem Donnern und röhrten über die Wiese, während Sharpes Männer Freudenschreie ausstießen.
Eine der Raketen streifte den Boden, überschlug sich und brach, und der abgerissene Kopf schmetterte in die Erde. Funken und Rauch stiegen im Tal empor. Eine andere Rakete brach nach rechts aus, kollidierte mit einer anderen, und beide krachten ins Gras. Zwei Raketen schienen perfekt über das Feld zu rasen, während die Übrigen ausscherten und Muster in den Rauch über das Gras schnitten.
Alle bis auf eine. Eine Rakete stieg in einer perfekten Kurve höher und höher, bis sie vom Rauch verhüllt war, der sich unter dem feurigen Schweif zu sammeln schien. Sharpe beobachtete diese Rakete, spähte mit zusammengekniffenen Augen in den wolkenlosen Himmel, sah die Rakete wieder aus dem Rauch auftauchen und sich drehen, und dann war wieder der Feuerschweif zu sehen. Die Rakete hatte sich überschlagen und raste zur Erde, beschleunigte durch den Feuerschub und raste hinab auf die Männer, die sie abgeschossen hatten.
»Rennt!«, schrie Sharpe den Artilleristen zu. Harper, dessen Empörung über das Massaker von Adrados vorübergehend vergessen war, lachte.
»Lauft, ihr Idioten!«
Pferde gingen durch, Männer gerieten in Panik, und das Röhren der Rakete wurde laut wie ein Donnerschlag am Dezemberhimmel. Gilliland schrie mit schriller Stimme seine Männer an und verstärkte noch die Verwirrung. Die Artilleristen warfen sich auf die Erde, hielten die Hände über den Kopf, und der Lärm schwoll an und endete mit einem Krachen, als sich die Sechs-Pfund-Kanonenkugel der Zwölf-Pfund-Rakete ins Erdreich bohrte. Dann herrschte Stille, und bläuliche Flammen züngelten an der zerschmetterten Raketenhülle empor.
Harper wischte sich über die Augen. »Gott schütze Irland!«
»Die anderen?« Sharpe spähte durch das Tal.
Sergeant Huckfield schüttelte den Kopf. »Alle weit verteilt. Die Nächste im Zielgebiet ist vielleicht dreißig Yards vom Ziel entfernt.« Er leckte am Bleistift und notierte die Entfernung in ein Notizbuch. Dann fügte er schulterzuckend hinzu: »Ungefähr der Durchschnitt, Sir.«
Das stimmte und war traurig für Gilliland. Die Raketen schienen einen eigenen Willen zu haben, wenn sie erst in Bewegung waren. Wie Lieutenant Harry Price gesagt hatte, waren sie hervorragend geeignet, Pferde zu erschrecken, solange es keinem etwas ausmachte, ob es Pferde von Franzosen oder Briten waren.
Sharpe ging zwischen den rauchenden Überresten von Raketen zu Captain Gilliland. Die Luft war von Pulverrauch erfüllt. Die Eintragungen im Notizbuch sagten es – die Raketen waren eine Pleite.
Gilliland, ein kleiner, junger Mann mit schmalem Gesicht, der fanatisch von seiner Waffe besessen war, setzte sich leidenschaftlich für seine Raketen ein. Sharpe hatte alle von Gillilands Argumenten schon gehört. Er hörte nur mit halbem Ohr zu und hatte Verständnis für Gillilands verzweifeltes Streben, am Feldzug von 1813 teilzunehmen.
Dieses Jahr endete schlecht. Nach den großen Siegen von Ciudad Rodrigo, Badajoz und Salamanca war der Feldzug vor der französischen Festung von Burgos zum Stillstand gekommen. Im Herbst hatten sich die Briten nach Portugal zurückziehen müssen, zurück zu den Proviantdepots, die ein Überwintern der Armee ermöglichten, und der Rückzug war hart gewesen. Irgendein Idiot hatte den Proviant der Armee über eine andere Straße geschickt, und die Truppen hatten sich durch strömenden Regen wütend und hungrig weiter westwärts schleppen müssen. Die Disziplin war zusammengebrochen. Männer hatten sich von der Straße davongemacht, um zu plündern. Sharpe hatte zwei Betrunkene nackt ausgezogen und sie der Gnade der französischen Verfolger ausgeliefert. Kein Mann des South Essex betrank sich mehr danach, und es war eines der wenigen Bataillone, die geordnet nach Portugal zurückmarschierten.
Im nächsten Jahr würden sie sich für diesen Rückzug rächen, und zum ersten Mal würden die Armeen der Iberischen Halbinsel unter einem einzigen General marschieren. Wellington war jetzt der Oberbefehlshaber der britischen, portugiesischen und spanischen Armeen, und Gilliland, der inständig seine Sache bei Sharpe vertrat, wollte an den Siegen teilhaben, die durch die Vereinigung der Armeen gut möglich waren.
Sharpe unterbrach schließlich Gillilands ausschweifende Rechtfertigungen. »Aber die Dinger haben nichts getroffen, Captain. Sie können sie nicht treffsicher machen?«
Gilliland nickte, zuckte mit den Schultern, schüttelte den Kopf, hob hilflos die Hände und wandte sich dann wieder an Sharpe. »Sir, Sie sagten einst, ein verängstigter Feind ist fast halb besiegt, nicht wahr?«
»Ja.«
»Denken Sie daran, was die Raketen beim Feind anrichten werden. Sie sind Furcht einflößend!«
»Wie Ihre Männer soeben festgestellt haben.«
Gilliland rang verzweifelt die Hände. »Es gibt immer ein paar Raketen, die versagen, Sir. Aber bedenken Sie doch die Wirkung auf einen Feind, der sie noch nie gesehen hat! Plötzlich die Flammen, der Lärm! Bedenken Sie das, Sir!«
Sharpe bedachte es. Er hatte den Befehl, diese Raketen zu testen, und zwar sorgfältig, und das hatte er an vier Tagen harter Arbeit getan. Sie hatten angefangen mit der vollen Reichweite von rund zweitausend Yards und schnell die Entfernung verringert, immer mehr, schließlich auf dreihundert Yards, und die Raketen waren immer noch hoffnungslos ungenau.
Aber trotzdem! Sharpe lächelte vor sich hin. Wie war die Wirkung auf jemanden, der noch niemals Raketen ausgesetzt war? Er blickte zum Himmel. Mittag. Er hatte einen geruhsamen Nachmittag erhofft und dann die Vorstellung von »Hamlet« anschauen wollen, die von den Offizieren der Leichten Division in einer Scheune außerhalb der Stadt aufgeführt wurde, aber vielleicht gab es noch einen Test, den er vergessen hatte. Er brauchte nicht lange zu dauern.
Eine Stunde später beobachtete Sharpe allein mit Sergeant Harper, wie Gilliland sechshundert Yards entfernt seine Vorbereitungen traf. Harper schüttelte den Kopf. »Wir sind verrückt.«
»Du brauchst nicht zu bleiben, Patrick.«
Harper wirkte bedrückt. »Ich habe Ihrer Frau versprochen, ein Auge auf Sie zu halten, Sir. Hier bin ich und halte mein Versprechen.«
Teresa. Sharpe hatte sie vor zwei Sommern kennengelernt, als seine Leichte Kompanie an der Seite ihrer Bande von Partisanen gekämpft hatte. Teresa bekämpfte die Franzosen auf ihre eigene Weise, aus dem Hinterhalt und mit dem Messer, mit Überraschung und Terror. Sie waren jetzt seit acht Monaten verheiratet, und Sharpe bezweifelte, dass er mehr als zehn Wochen mit ihr zusammen verbracht hatte. Ihre Tochter, Antonia, war jetzt neunzehn Monate alt, und er liebte sie, weil sie seine einzige Blutsverwandte war. Er kannte sie kaum, und sie würde mit einer anderen Sprache aufwachsen, aber sie blieb immer noch seine Tochter. Er grinste Harper an. »Uns wird nichts passieren, Patrick. Du weißt doch, dass die Dinger immer daneben gehen.«
»Nicht immer, Sir.«