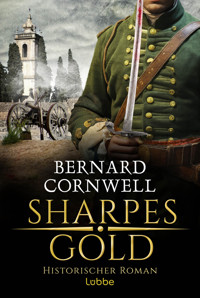9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Im Winter 1811 scheint der Krieg verloren zu sein: Ganz Spanien wurde von Frankreich annektiert. Cádiz ist die letzte Stadt, die sich noch in spanisch-englischer Hand befindet. Doch die französischen Truppen ziehen den Belagerungsring immer enger. Auch Richard Sharpe hält sich in der belagerten Stadt auf - und sieht sich dort gleich mehreren Feinden gegenüber. Einer von ihnen ist ein skrupelloser Priester, dem jedes Mittel recht ist, um sein Ziel zu erreichen: die Auflösung der Allianz von Spanien und England. Kann Sharpe ihn aufhalten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Teil I - Der Fluss
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
Teil II - Die Stadt
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
Teil III - Die Schlacht
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
HISTORISCHE ANMERKUNG
SHARPES GESCHICHTE
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Weitere Informationen finden Sie aufwww.bernardcornwell.net
Bernard Cornwell
SHARPESZORN
Richard Sharpe und die Schlachtvon Barrosa, März 1811
Ins Deutsche übertragen vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Fury«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanjy Østlyngen
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2466-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sharpes Zorn istEric Sykes gewidmet
TEIL IDER FLUSS
KAPITEL 1
In Cadiz war man nie weit vom Meer entfernt. Sein Geruch war stets präsent und fast so stark wie der Gestank des Abwassers. Wenn auf der Südseite der Stadt ein starker Wind aus Richtung Süden wehte, dann brachen sich die Wellen an der Seemauer und Gischt schlug gegen die geschlossenen Fenster an der Promenade. Nach der Schlacht von Trafalgar hatten eine Woche lang Stürme die Stadt heimgesucht, und die Böen hatten die Gischt bis zur Kathedrale getragen und die Gerüste an ihrem unfertigen Turm eingerissen. Die Wellen hatten Cadiz förmlich belagert, und Treibgut der versenkten Schiffe war in die Straßen gespült worden, später dann auch Leichen. Doch das war vor sechs Jahren gewesen, und jetzt kämpfte Spanien auf derselben Seite wie Großbritannien. Allerdings war Cadiz das Einzige, was von Spanien übrig geblieben war. Der Rest des Landes wurde entweder von Frankreich beherrscht oder hatte überhaupt keine Regierung. Guerilleros trieben sich in den Bergen herum, und auf den Straßen herrschte Armut. Spanien war ein trauriger Ort.
Februar 1811. Nachts. Wieder einmal tobte sich ein Sturm über der Stadt aus, und riesige Wellen brachen sich an der Seemauer. Der Beobachter konnte die Schaumexplosionen in der Dunkelheit sehen, und sie erinnerten ihn an den Pulverdampf von Geschützen. Und die Gewalt des Wassers war genauso unberechenbar. Gerade wenn man glaubte, die Wogen hätten ihr Pulver verschossen, da schlug das Wasser hoch über den Kai, und der Wind schleuderte die Gischt wie Kartätschenkugeln gegen die weißen Mauern der Stadt.
Der Mann war ein Priester. Padre Salvador Montseny trug eine Soutane, einen Umhang und einen breiten schwarzen Hut, den er bei dem Wind festhalten musste. Padre Salvador war ein großer Mann, Mitte dreißig und ein leidenschaftlicher Prediger von schwermütigem, aber gutem Aussehen, der jetzt im Schutze eines Torbogens wartete. Er war weit weg von zu Hause. Sein Heim lag im Norden, wo er als ungeliebter Sohn eines verwitweten Advokaten aufgewachsen war, der Salvador auf eine kirchliche Schule geschickt hatte. Er war Priester geworden, weil er nicht gewusst hatte, was er sonst hätte werden sollen, doch nun wünschte er, er hätte sich für das Soldatenleben entschieden. Und Padre Salvador glaubte, er wäre ein guter Soldat geworden, doch das Schicksal hatte ihn stattdessen aufs Meer geführt. Er war Kaplan an Bord eines spanischen Schiffes gewesen, das bei Trafalgar von den Briten erbeutet worden war, und in der Dunkelheit über ihm tobte wieder die Schlacht. Das Geräusch war das Krachen und Reißen der großen Leinenplanen, die die halb fertige Kuppel der Kathedrale schützen sollten. Im Wind klang das wie Kanonendonner. Die Planen, das wusste Padre Salvador, waren einst die Segel der spanischen Kriegsflotte gewesen, doch nach der Schlacht von Trafalgar hatte man den wenigen Schiffen, die sich noch nach Hause hatten schleichen können, die Segel abgenommen. Damals war Padre Salvador in England gewesen. Die meisten spanischen Gefangenen hatte man rasch an Land gesetzt, doch Padre Salvador war der Kaplan eines Admirals gewesen, und diesen hatte er dann auch in das feuchte Landhaus in Hampshire begleitet, wo er im Sommer den Regen und im Winter den Schnee auf den Weiden gesehen und zu hassen gelernt hatte.
Und er hatte dort auch Geduld gelernt, und in Geduld übte er sich auch jetzt. Sein Hut und der Mantel waren völlig durchnässt, und ihm war kalt, doch er rührte sich nicht. Er wartete einfach nur. Padre Salvador hatte eine Pistole im Gürtel, aber er nahm an, dass das Zündpulver ohnehin zu nass war, als dass er sie hätte einsetzen können. Doch das war egal, denn er hatte noch ein Messer. Padre Salvador schloss die Hand um den Griff, lehnte sich an die Wand und sah einen weiteren Brecher am Ende der Straße. Die Gischt rauschte an einem Fenster vorbei, dessen Läden nicht geschlossen waren. Dann hörte Padre Salvador Schritte.
Ein Mann rannte von der Calle Compania in seine Richtung. Padre Salvador wartete weiter. Er war nur ein Schatten inmitten anderer Schatten, und er sah, wie der Mann zu der Tür gegenüber ging. Sie war unverschlossen. Der Mann ging hinein, und der Priester folgte ihm rasch und stieß die Tür im selben Augenblick auf, da der Mann sie hinter sich schließen wollte. »Gracias«, sagte Padre Salvador.
Sie standen in einem gewölbten Durchgang, der auf einen Hof führte. In einer Nische flackerte eine Laterne, und als der Mann sah, dass Padre Salvador ein Priester war, wirkte er erleichtert. »Wohnen Sie hier, Padre?«, fragte er.
»Ich bin hier, um jemandem die Letzte Ölung zu erteilen«, antwortete Padre Salvador und schlug sich das Wasser von der Soutane.
»Ach, die arme Frau da oben.« Der Mann bekreuzigte sich. »Das ist wahrlich eine furchtbare Nacht.«
»Wir haben schon Schlimmeres überstanden, mein Sohn, und auch das wird vorübergehen.«
»Natürlich«, sagte der Mann. Er ging in den Hof und die Treppe zum Balkon im ersten Stock hinauf. »Sind Sie Katalane, Padre?«
»Wie kommst du darauf?«
»Ihr Akzent, Padre.« Der Mann holte seine Schlüssel aus der Tasche, schloss die Tür auf, und der Priester schien sich an ihm vorbeidrängen zu wollen, um die Treppe in den zweiten Stock hinaufzusteigen.
Der Mann öffnete seine Tür und fiel dann nach vorn, als Padre Salvador sich plötzlich umdrehte und ihm einen Stoß versetzte. Der Mann stürzte zu Boden. Er hatte ein Messer und versuchte es zu ziehen, doch der Priester trat ihm hart unters Kinn. Dann flog die Tür zu, und sie waren im Dunkeln. Padre Salvador kniete sich auf die Brust des gestürzten Mannes und hielt ihm das Messer an die Kehle. »Keinen Laut, mein Sohn«, befahl er, tastete unter dem Mantel seines Opfers nach dem Messer und warf es in den Flur. »Du wirst nur sprechen«, fuhr er fort, »wenn du gefragt wirst. Dein Name ist Gonzalo Jurado?«
»Ja.« Jurados Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
»Hast du die Briefe der Hure?«
»Nein«, antwortete Jurado und quiekte, als Padre Salvadors Klinge die Haut an seinem Hals ritzte.
»Es wird dir wehtun, wenn du lügst«, sagte der Priester. »Hast du die Briefe?«
»Ich habe sie, ja!«
»Dann zeig sie mir.«
Padre Salvador ließ Jurado aufstehen und blieb dicht bei ihm, als Jurado in ein Zimmer ging, das zur Straße hin lag, auf der der Priester gewartet hatte. Stahl ließ einen Feuerstein Funken schlagen, dann wurde eine Kerze entzündet. Nun konnte Jurado seinen Angreifer deutlich sehen, und er glaubte, es mit einem verkleideten Soldaten zu tun zu haben, denn das Gesicht wollte einfach nicht zu einem Priester passen. Es war finster, die Augen gnadenlos. »Die Briefe stehen zum Verkauf«, erklärte Jurado und schnappte dann nach Luft, als Padre Salvador ihm in den Magen schlug.
»Ich habe dir doch gesagt, du sollst nur sprechen, wenn ich dich etwas frage«, sagte der Priester. »Und jetzt zeig mir die Briefe.«
Der Raum war klein, aber gemütlich. Es war offensichtlich, dass Jurado Luxus zu schätzen wusste. Zwei Sofas standen einem leeren Kamin gegenüber, über dem ein Spiegel mit goldenem Rahmen hing. Der Boden war mit Teppichen bedeckt, und an der Wand hingen drei Gemälde nackter Frauen. Unter dem Fenster stand ein Sekretär, und dort schloss der verängstigte Mann nun eine Schublade auf und holte einen Stapel Briefe heraus, die mit einem schwarzen Band zusammengebunden waren. Den legte er dann auf den Sekretär und trat einen Schritt zurück.
Padre Salvador schnitt das Band auf und breitete die Briefe auf der mit Leder bezogenen Schreibfläche aus. »Sind das alle?«
»Alle fünfzehn«, antwortete Jurado.
»Und die Hure?«, verlangte Padre Salvador zu wissen. »Hat sie auch noch welche?«
Jurado zögerte. Dann sah er das Messer des Priesters im Kerzenschein funkeln. »Sie hat noch sechs.«
»Sie hat sie behalten?«
»Ja, Padre.«
»Warum?«
Jurado zuckte mit den Schultern. »Fünfzehn reichen doch, oder? Vielleicht kann sie die anderen ja später verkaufen. Oder vielleicht mag sie den Mann ja immer noch. Wer weiß? Wer versteht schon die Frauen? Aber …« Er wollte gerade eine Frage stellen, doch dann bekam er Angst, wieder geschlagen zu werden.
»Sprich weiter«, forderte Padre Salvador ihn auf und nahm sich willkürlich ein paar Briefe.
»Woher wissen Sie überhaupt von diesen Briefen? Außer den Engländern habe ich niemandem davon erzählt.«
»Deine Hure ist zur Beichte gegangen«, antwortete Padre Salvador.
»Caterina? Sie hat gebeichtet?«
»Das macht sie jedes Jahr einmal«, erklärte Padre Salvador und überflog einen Brief, »und zwar immer am Namenstag ihrer Schutzheiligen. Sie ist in die Kathedrale gekommen, hat Gott von ihren vielen Sünden erzählt, und ich habe ihr in seinem Namen die Absolution erteilt. Wie viel willst du für die Briefe?«
»Dreihundert englische Guineas«, antwortete Jurado. »Es sind fünfzehn Briefe, und ich will zwanzig pro Stück.« Allmählich kehrte sein Selbstbewusstsein zurück. Er hatte stets eine geladene Pistole in der obersten Schublade. Jeden Tag prüfte er den Hahn und mindestens einmal im Monat das Pulver. Und seine Angst war inzwischen weit genug abgeklungen, dass er verstand, dass es sich bei Padre Salvador tatsächlich um einen Priester handelte – einen Furcht erregenden Priester zwar, aber immer noch ein Mann Gottes. »Wenn Sie spanisches Geld vorziehen, Padre«, fuhr er fort, »dann gehören die Briefe für dreizehnhundert Real Ihnen.«
»Dreizehnhundert Real?«, erwiderte Padre Salvador gedankenverloren. Er las gerade einen der Briefe. Er war auf Englisch geschrieben, doch das bereitete dem Priester keine Probleme, das hatte er in Hampshire gelernt. Der Verfasser des Briefes war über beide Ohren verliebt und so dumm gewesen, diese Liebe zu Papier zu bringen. Der Narr hatte Versprechen gemacht, doch das Mädchen, dem er sie gemacht hatte, war eine Hure gewesen, und Jurado war ihr Zuhälter, und jetzt wollte der Zuhälter den Briefschreiber erpressen.
»Ich habe eine Antwort bekommen.« Der Zuhälter wagte es tatsächlich, ohne Aufforderung zu sprechen.
»Von dem Engländer?«
»Ja, Padre. Sie ist da drin.« Jurado deutete auf die unterste Schublade des Sekretärs. Padre Salvador nickte zum Zeichen der Einwilligung, und Jurado öffnete die Schublade. Dann schrie er, als ihn eine Faust so hart traf, dass er gegen die Tür hinter sich geworfen wurde. Die Tür gab nach, und Jurado fiel ins Schlafzimmer. Padre Salvador nahm die Pistole aus der Schublade, öffnete die Pfanne, blies das Pulver heraus und warf die nutzlose Waffe auf eines der beiden Seidensofas. »Du hast gesagt, du hättest eine Antwort bekommen«, bemerkte er in einem Tonfall, als wäre nichts geschehen.
Jurado zitterte. »Sie haben gesagt, sie würden zahlen.«
»Und hast du den Austausch arrangiert?«
»Noch nicht.« Jurado zögerte. »Gehören Sie zu den Engländern?«
»Gott sei Dank nein! Ich gehöre zur heiligen römisch-katholischen Kirche. Und? Hast du nun Kontakt zu den Engländern oder nicht?«
»Ich soll eine Nachricht im Cinco Torres hinterlassen.«
»Und an wen ist die adressiert?«
»An Señor Plummer.«
Das Cinco Torres war ein Kaffeehaus an der Calle Ancha. »In deiner nächsten Botschaft«, sagte Padre Salvador, »wirst du diesem Plummer also sagen, wo er dich treffen soll, korrekt? Wo der Austausch stattfinden soll?«
»Ja, Padre.«
»Du warst äußerst hilfreich, mein Sohn«, sagte Padre Salvador, dann streckte er die Hand aus, um Jurado in die Höhe zu ziehen. Dankbar ließ Jurado sich helfen, und erst in der allerletzten Sekunde sah er das Messer in der Hand des Priesters.
Padre Salvador verzog das Gesicht, als er die Klinge quer durch die Kehle seines Opfers zog. Das war schwerer, als er gedacht hatte, und er stieß ein Grunzen aus, als er durch Kehlkopf, Adern und Muskeln schnitt.
Der Zuhälter brach zusammen und gab ein Gurgeln von sich. Padre Salvador hielt Jurado fest, während er starb. Es war eine riesige Sauerei, doch auf Padre Salvadors schwarzer Soutane würde das Blut nicht zu sehen sein. Etwas Blut sickerte durch die Bodenbretter und tropfte in die Sattlerei, die den größten Teil des Erdgeschosses einnahm. Es dauerte über eine Minute, bis der Zuhälter gestorben war, und die ganze Zeit über triefte Blut hindurch, doch schließlich war Jurado tot, und Padre Salvador schlug ein Kreuz über dem Gesicht des Toten und sprach ein kurzes Gebet für dessen Seele. Anschließend steckte er das Messer wieder weg, wischte sich die Hände am Mantel der Leiche ab und ging zum Sekretär zurück.
In einer der Schubladen fand er einen großen Stapel Geld. Er steckte die zusammengefalteten Scheine in seinen linken Stiefel und nahm dann die Briefe an sich. Er verstaute sie in einem Kissenbezug und steckte sie in seine Soutane, damit sie trocken blieben. Schließlich goss er sich noch ein Glas Sherry aus einer Karaffe ein, und während er daran nippte, dachte er an das Mädchen, an das die Briefe adressiert waren. Er wusste, dass sie nur zwei Straßen von hier entfernt lebte, und sie hatte immer noch sechs Briefe, doch er besaß fünfzehn. Das waren mehr als genug, entschied er. Außerdem war das Mädchen mit ziemlicher Sicherheit nicht daheim, sondern bei einem Freier in einem der prachtvolleren Schlafgemächer von Cadiz.
Padre Salvador blies die Kerze aus und trat wieder in die Nacht hinaus, wo sich die Wellen am Rand der Stadt brachen und die großen Segel in der nassen Dunkelheit wie Kanonen knallten. Padre Salvador Montseny, Mörder, Priester, Patriot, hatte gerade dafür gesorgt, dass Spanien gerettet war.
Es hatte alles so gut begonnen.
In der mondhellen Nacht lag der Guadiana unter der Leichten Kompanie des South Essex wie flüssiges Silber, das träge zwischen den schwarzen Hügeln hindurchfloss. Fort Joseph, das nach Napoleons Bruder benannt worden war, der französischen Marionette auf dem spanischen Thron, lag auf dem Hügel, der der Kompanie am nächsten war, während sich Fort Josephine, benannt nach der abgeschobenen Ehefrau des Kaisers, oberhalb eines langen Hangs am anderen Ufer befand. Fort Joseph lag in Portugal, Fort Josephine in Spanien, und zwischen den beiden Forts gab es eine Brücke.
Sechs Leichte Kompanien waren unter dem Befehl von Brigadier General Sir Barnaby Moon aus Lissabon hierhergeschickt worden. Brigadier Moon war der kommende Mann, ein Offizier, der für Höheres bestimmt war, und das hier war sein erstes Kommando. Wenn er hier alles richtig machte und die Brücke zerstörte, dann stand ihm eine Zukunft bevor so glänzend wie der Fluss, der sich zwischen den dunklen Hügeln hindurchwand.
Und es hatte alles so gut begonnen. Die sechs Kompanien waren im Morgennebel mit Fähren über den Tajo gebracht worden und dann durch den Süden Portugals marschiert, der eigentlich französisches Gebiet war, doch die Guerilleros hatten den Briten versichert, die Franzosen hätten ihre wenigen Garnisonen abgezogen, und so war es dann auch gewesen. Nun, nur vier Tage, nachdem sie Lissabon verlassen hatten, hatten sie den Fluss und die Brücke erreicht. Bald würde die Sonne aufgehen. Die britischen Soldaten standen am Westufer des Guadiana, wo sich Fort Joseph auf einem Hügel am Fluss erhob. Die Schatten der Mauern waren deutlich im Licht der Feuer dahinter zu erkennen. Zwar schwächte die Dämmerung diesen Effekt mehr und mehr ab, doch dann und wann war nach wie vor ein Mann hinter den Schießscharten zu sehen.
Die Franzosen waren wach. Die sechs britischen Leichten Kompanien wussten das, weil zum Wecken geblasen worden war – erst im weiter entfernten Fort Josephine, dann in Fort Joseph. Aber nur weil die Franzosen nicht mehr schliefen, hieß das noch lange nicht, dass sie auch wachsam waren. Wenn man Männer jeden Tag in der kalten Dämmerung weckt, lernen sie schon bald, ihre Träume mit auf die Wehrgänge zu nehmen. Dann sahen sie vielleicht so aus, als würden sie aufmerksam in die Dunkelheit spähen, doch in Wahrheit dachten sie an ihre Frauen daheim in Frankreich, an die Frauen, die noch in den Baracken schliefen, oder an die Frauen, von denen sie sich wünschten, sie wären hier bei ihnen im Fort, Frauen, von denen sie nur träumen konnten. Sie waren noch halb im Schlaf.
Und die Forts waren den ganzen Winter über ungestört gewesen. Natürlich gab es Guerilleros in den Bergen hier, doch die wagten sich nur selten näher an die Forts heran, die über Geschütze verfügten, und nur mit Musketen bewaffnete Bauern lernten rasch, dass sie es nicht mit Artillerie in befestigten Stellungen aufnehmen konnten. Die spanischen und portugiesischen Guerillakämpfer lockten entweder die Furagiere der französischen Truppen, die dreißig Meilen entfernt Badajoz belagerten, in Hinterhalte, oder sie versetzten den Streitkräften Maréchal Victors Nadelstiche, der einhundertfünfzig Meilen weiter südlich versuchte, Cadiz einzunehmen.
Einst hatten fünf gute Steinbrücken den Guadiana zwischen Badajoz und dem Meer überspannt, doch die waren inzwischen allesamt von der einen oder anderen Konfliktpartei gesprengt worden, sodass jetzt nur noch diese eine französische Pontonbrücke die beiden Belagerungsarmeen des Kaisers miteinander verband. Sie wurde nicht oft benutzt. Das Reisen in Portugal oder Spanien war gefährlich für Franzosen, denn die Guerilleros waren gnadenlos. Doch ein- bis dreimal die Woche knarrte die Pontonbrücke unter dem Gewicht von Artillerie, und alle paar Tage überquerte ein Kurierreiter mit einer Abteilung Dragoner als Eskorte den Fluss. Einheimische wiederum nutzten die Brücke nur äußerst selten. Zum einen konnten sie sich den Zoll nicht leisten, und zum anderen wollten sie sich nicht der Feindseligkeit der beiden Garnisonen aussetzen. Der Krieg schien hier weit entfernt zu sein, weshalb die Verteidiger auf den Wällen wohl auch eher von Frauen träumten, anstatt nach Feinden Ausschau zu halten, die über einen Ziegenpfad in die Dunkelheit des Tales westlich von Fort Joseph hinabgestiegen waren.
Captain Richard Sharpe, kommandierender Offizier der Leichten Kompanie des South Essex Regiments, war jedoch nicht unten im Tal. Er stand bei seiner Kompanie auf einem Hügel nördlich des Forts. Seine Aufgabe war die leichteste an diesem Morgen. Er sollte ein Ablenkungsmanöver durchführen, was hieß, dass keiner seiner Männer an diesem Morgen sterben oder auch nur verwundet werden dürfte. Das freute Sharpe, doch er wusste, dass man ihm diese leichte Aufgabe nicht als Belohnung übertragen hatte, sondern weil Moon ihn nicht leiden konnte. Der Brigadier hatte ihm das klar und deutlich zu verstehen gegeben, als sich die sechs Leichten Kompanien in Lissabon bei ihm gemeldet hatten. »Mein Name ist Moon«, hatte der Brigadier gesagt, »und Sie, Sharpe, haben einen gewissen Ruf.«
Überrascht von dieser unerwartet direkten Begrüßung hatte Sharpe ihn mit großen Augen angeschaut. »Habe ich?«
»Spielen Sie hier nicht den Unschuldigen, Mann«, hatte Moon erwidert und auf das Abzeichen des South Essex gedeutet, das einen in Ketten gelegten Adler zeigte. Sharpe und sein Sergeant, Patrick Harper, hatten diesen Adler in der Schlacht bei Talavera von den Franzosen erbeutet, und mit so etwas verdiente man sich in der Tat »einen gewissen Ruf«, wie Moon sich ausdrückte. »Unter meinem Kommando ist kein Platz für Heldentaten, Sharpe«, fuhr der Brigadier fort.
»Jawohl, Sir.«
»Einfaches, gutes Kriegshandwerk – damit gewinnt man Kriege«, sagte Moon. »Gewöhnliche Dinge gut zu machen, das ist, was zählt.« Das entsprach zwar ohne Zweifel der Wahrheit, dennoch war es seltsam, das ausgerechnet aus dem Mund von Sir Barnaby Moon zu hören, dessen Ruf alles andere als gewöhnlich war. Moon war jung, nur einunddreißig Jahre alt, und obwohl er erst knapp ein Jahr in Portugal war, hatte er sich schon einen Namen gemacht. Bei Bucaco hatte er mit seinem Bataillon auf dem Hügelkamm gekämpft, den die Franzosen hinaufgeklettert und wo sie gestorben waren, und er hatte zwei seiner Plänkler gerettet, indem er durch die Reihen seiner Männer galoppiert war und die Franzosen mit dem Säbel erschlagen hatte, die die Plänkler gefangen genommen hatten. »Ich werde meine Füsiliere doch nicht von diesen verdammten Froschfressern gefangen nehmen lassen. Niemals!«, hatte er verkündet und die beiden Männer wieder zurückgeführt. Seine Soldaten hatten ihm zugejubelt, und er hatte seinen Dreispitz abgenommen und sich im Sattel vor ihnen verneigt. Außerdem war er als Spieler und gnadenloser Schürzenjäger verschrien, und da er ebenso reich wie gut aussehend war, hatte er auch viel Erfolg. London, so hieß es, sei ein viel sichererer Ort geworden, nun, da Sir Barnaby in Portugal war. Allerdings würden jetzt wohl ein paar Damen in Lissabon Kinder zur Welt bringen, die später Sir Barnabys schmales Gesicht, sein blondes Haar und die ungewöhnlich blauen Augen haben würden. Kurz gesagt, Sir Barnaby war alles Mögliche, aber mit Sicherheit kein gewöhnlicher Soldat, und doch war es genau das, was er nun von Sharpe verlangte, und Sharpe gehorchte ihm nur allzu gern. »Bei mir müssen Sie sich keinen Ruf verdienen, Sharpe«, hatte Sir Barnaby gesagt.
»Ich werde mich bemühen, Sir«, hatte Sharpe erwidert und dafür einen bösen Blick kassiert. Seitdem ignorierte Moon ihn weitgehend. Jack Bullen, Sharpes Lieutenant, nahm an, dass der Brigadier schlicht eifersüchtig war.
»Seien Sie nicht albern, Jack«, hatte Sharpe gesagt, als Bullen das zum ersten Mal erwähnt hatte.
Doch Lieutenant Bullen war stur geblieben. »Sir, in jedem Drama ist nur Platz für einen Helden. Die Bühne ist schlicht zu klein für zwei.«
»Sind Sie jetzt auch noch Theaterexperte, Jack?«
»Ich bin Experte für alles mit Ausnahme der Dinge, die in Ihr Spezialgebiet fallen«, hatte Bullen gesagt, und Sharpe hatte gelacht. Die Wahrheit, nahm Sharpe an, war wohl eher, dass Moon wie die meisten Offiziere instinktiv jedem Mann misstraute, der aus den Mannschaftsrängen in den Offiziersstand erhoben worden war. Sharpe war der Armee als einfacher Schütze beigetreten und hatte später als Sergeant gedient. Jetzt war er jedoch Captain, und manch einer betrachtete Sharpes Aufstieg als Affront gegen die natürliche Ordnung. Sharpe hatte jedoch kein Problem damit. Er würde für Ablenkung sorgen, das Kämpfen den anderen fünf Kompanien überlassen und schließlich wieder nach Lissabon und zu seinem Bataillon zurückkehren. In ein, zwei Monaten, wenn der Frühling nach Portugal kam, würden sie aus den Stellungen vor Torres Vedras in Richtung Norden marschieren und die Truppen von Maréchal Masséna nach Spanien verfolgen. Dort würde es im Frühjahr dann noch genug Kämpfe geben, auch für Emporkömmlinge.
»Da ist das Licht, Sir«, sagte Sergeant Patrick Harper. Er lag flach auf dem Bauch neben Sharpe und spähte ins Tal hinab.
»Bist du sicher?«
»Da – wieder, Sir. Haben Sie es gesehen?«
Der Brigadier verfügte über eine Abblendlaterne, und indem er eine ihrer Klappen öffnete, konnte er Sharpe Signale geben, ohne dass die Franzosen es sahen. Das Licht blitzte erneut auf, und Sharpe rief seinen Männern zu: »Jetzt, Männer!«
Sie mussten nichts weiter tun, als sich zu zeigen. Allerdings würden sie nicht in Linie antreten, sondern zerstreut, sodass sie wie Guerilleros aussahen. Das Ziel war, die Aufmerksamkeit der Franzosen in Richtung Norden zu lenken, sodass sie den von Westen erfolgenden Angriff nicht bemerkten.
»Mehr haben wir nicht zu tun?«, fragte Harper. »Wir pissen hier oben nur ein wenig in der Gegend rum?«
»Mehr oder weniger«, antwortete Sharpe. »Aufstehen, Männer! Zeigt euch den Froschfressern!«
Die Umrisse der Leichten Kompanie waren deutlich auf dem Kamm zu sehen, und das Licht des frühen Morgens reichte gerade so, um zu erkennen, dass die Franzosen in Fort Joseph sie bemerkt hatten. Ohne Zweifel richteten die französischen Offiziere jetzt ihre Ferngläser auf den Hügel, doch Sharpes Männer trugen Mäntel über ihren Uniformen, sodass die Abzeichen nicht zu sehen waren, und Sharpe hatte ihnen befohlen, die Tschakos abzunehmen, damit sie nicht als Soldaten zu erkennen waren.
»Dürfen wir wenigstens ein, zwei Schuss auf die Frösche abfeuern?«, fragte Harper.
»Wir wollen sie doch nicht aufregen«, erwiderte Sharpe. »Wir wollen nur, dass sie uns beobachten.«
»Aber wenn sie richtig aufgewacht sind, dann dürfen wir doch auf sie schießen, oder?«
»Wenn sie die anderen sehen, ja. Dann servieren wir ihnen ein Frühstück nach Grünrockart.«
Sharpes Kompanie war einmalig, denn obwohl die meisten seiner Männer den typischen roten Rock der britischen Infanterie trugen, war eine ganze Reihe anderer in den grünen Jacken der Rifle-Bataillone zu sehen. Der Grund dafür war ein Versehen. Sharpe und seine Riflemen waren während des Rückzugs nach La Coruña vom Rest ihrer Einheit abgeschnitten worden, und als sie es schließlich nach Lissabon geschafft hatten, hatte man sie vorübergehend den Rotröcken des South Essex zugeteilt, und irgendwie waren sie dort hängen geblieben. Die Grünröcke hatten Gewehre. Für die meisten Menschen sah ein Gewehr schlicht wie eine kurze Muskete aus, doch der Unterschied war nicht äußerlich, sondern lag im Lauf verborgen. Die Baker Rifle hatte sieben Züge, die in regelmäßigen Abständen über den Lauf verteilt waren, und diese Züge gaben der Kugel einen Drall, der sie tödlich genau machte. Eine Muskete war rasch zu laden und rasch abzufeuern, doch bei allem, was mehr als sechzig Schritt entfernt war, brauchte man gar nicht erst zu zielen. Das Gewehr wiederum war auf eine dreimal so große Distanz tödlich. Die Franzosen verfügten über keine Gewehre, und das hieß, dass Sharpes Grünröcke auf dem Hügel liegen und die Verteidiger unter Beschuss nehmen konnten, ohne das Feuer der Franzosen fürchten zu müssen.
»Da sind sie«, sagte Harper.
Die fünf Leichten Kompanien rückten den Hügel hinauf vor. Ihre roten Uniformen wirkten schwarz im Zwielicht. Ein paar Soldaten trugen kurze Leitern. Sie haben eine echte Scheißarbeit vor sich, dachte Sharpe.
Das Fort war von einem trockenen Graben umgeben, und vom Grund des Grabens bis zur Brüstung waren es mindestens zehn Fuß. Außerdem war die Brüstung noch mit spitzen Pfählen gesichert. Die Rotröcke mussten den Graben überqueren, ihre Leitern zwischen den Pfählen platzieren und unter dem Musketenfeuer der Verteidiger nach oben klettern. Und schlimmer noch: Sie mussten sich den Kanonen stellen. Die französischen Geschütze waren ohne Zweifel geladen, aber mit was? Mit Kugeln oder mit Kartätschen? Sollten es Kartätschen sein, dann würden Moons Truppen von der ersten Salve hart getroffen werden. Kugeln richteten hingegen weit weniger Schaden gegen Infanterie an.
Doch das war nicht Sharpes Problem. Sharpe ging über den Hügel und achtete dabei sorgfältig darauf, dass man ihn vor dem heller werdenden Himmel sehen konnte, und wundersamerweise hatten die Franzosen die vierhundert Mann, die von Westen her auf sie zu marschierten, noch immer nicht bemerkt.
»Vorwärts, Jungs«, murmelte Harper vor sich hin. Seine Worte waren jedoch nicht an alle vorrückenden Kompanien gerichtet, sondern nur an die Jungs des 88th, der Connaught Ranger, eines irischen Regiments.
Sharpe schaute nicht hin. Plötzlich hatte ihn der Aberglaube überkommen, dass der Angriff scheitern würde, sollte er zuschauen. So starrte er stattdessen zum Fluss hinab und zählte die Pontons der Brücke, die als dunkle Schatten im Nebel über dem Wasser zu erkennen waren. Sharpe beschloss, erst wieder zum Fort zu schauen, wenn der erste Schuss erklang. Einunddreißig, zählte er schließlich, was hieß, dass die Pontons einen Abstand von je zehn Fuß hatten, denn der Fluss war hier knapp über hundert Yards breit. Die Pontons waren große, klobige, eckige Barken, über die man Planken gelegt hatte. Der Winter war in ganz Südspanien und Portugal ungewöhnlich nass gewesen, und dementsprechend viel Wasser führte der Guadiana nun. Sharpe sah deutlich, wie es an den Stellen schäumte, wo es auf die Pontons traf. Jedes Boot war einzeln im Flussbett verankert und über Taue am Bug mit seinen Nachbarn verbunden, während schwere Balken, die quer auf den Bootskörpern lagen, die Planken trugen, welche die eigentliche Brücke bildeten. Vermutlich wog sie mehr als hundert Tonnen, schätzte Sharpe, und ihr Auftrag würde erst zu Ende sein, wenn diese Brücke zerstört war.
»Die Bastarde sind ja wirklich verschlafen«, bemerkte Harper verwundert. Vermutlich sprach er von der Besatzung des Fort Joseph, doch Sharpe wollte noch immer nicht hinschauen. Er starrte zu Fort Josephine auf der anderen Seite des Flusses, wo er sah, wie sich Männer um ein Geschütz drängten. Dann traten sie zurück, das Geschütz feuerte, und schmutziger Rauch erschien über dem dünner werdenden Nebel. Das Geschütz hatte eine Kartätsche abgefeuert. Das Geschoss zerbarst, kaum dass es die Mündung verlassen hatte, und einen halben Zoll dicke Kugeln rasten durch die Luft und auf Sharpes Hügelkamm. Der Knall des Schusses hallte durch das Tal. »Jemand getroffen?«, rief Sharpe. Niemand antwortete ihm.
Das Geschützfeuer veranlasste die Besatzung des näher gelegenen Forts, ihre Aufmerksamkeit nur umso mehr auf den Hügel zu richten. Sie richteten nun eine ihrer eigenen Kanonen auf Sharpe und seine Männer aus und zielten so, dass die Kartätschenladung genau über den Kamm fegen würde.
»Haltet die Köpfe unten!«, befahl Sharpe. Dann ertönte das dumpfe Knallen von Musketen, und er wagte es, wieder zu den Angreifern zu blicken.
Es war so gut wie vorbei. Die Rotröcke waren bereits im Graben und sogar noch mehr auf den Leitern, und Sharpe sah, wie die Infanteristen über die Brüstung sprangen und sich mit aufgepflanztem Bajonett auf die Franzosen stürzten. Seine Gewehre waren unnötig.
»Macht, dass ihr außer Sichtweite der verdammten Kanonen kommt!«, brüllte er, und seine Männer liefen vom Kamm hinunter. Ein zweites Geschütz schoss vom Fort auf der anderen Flussseite, und eine Musketenkugel riss ein Loch in Sharpes Mantel, während eine weitere den Tau vom Gras zu seinen Füßen fegte. Doch dann war er vom Hügel herunter und den Blicken der Schützen verborgen.
In Fort Joseph feuerte kein Geschütz. Die Garnison war vollkommen überrascht worden. Inzwischen waren Rotröcke mitten im Fort zu sehen, und panische Franzosen rannten aus dem Osttor und zur Brücke, die sie über den Fluss und in die Sicherheit von Fort Josephine auf der spanischen Seite bringen würde. Das Musketenfeuer ebbte ab. Vielleicht ein Dutzend Franzosen waren gefangen genommen worden, der Rest auf der Flucht, und noch viel mehr schienen auf die Brücke zuzulaufen. Die Rotröcke brüllten ihre Kriegsschreie in die Morgendämmerung und schwenkten die Bajonette, was die wilde Flucht nur noch beflügelte. Die französische Trikolore wurde bereits eingeholt, bevor die letzten Briten den Graben überquert und die Mauer erklommen hatten. Alles war sehr schnell gegangen.
»Unsere Arbeit ist getan«, erklärte Sharpe. »Runter zum Fort.«
»Das war ja leicht«, bemerkte Jack Bullen glücklich.
»Es ist noch nicht vorbei, Jack.«
»Meinen Sie die Brücke?«
»Die muss noch zerstört werden.«
»Aber das Schwierigste haben wir hinter uns.«
»Das stimmt«, bestätigte Sharpe. Er mochte Jack Bullen, einen schroffen Jungen aus Essex, der sich nie beschwerte und hart arbeitete. Und auch die Männer mochten ihn. Bullen behandelte sie fair und zeigte dabei das Selbstvertrauen eines Mannes von privilegierter Geburt. Doch trotz seines privilegierten Standes war er keinesfalls herablassend, sondern stets von einer gewissen Leutseligkeit. Für Sharpe war er ein guter Offizier.
In Reihe stiegen sie den Hügel hinunter, kletterten durch das felsige Tal, überquerten den kleinen, kalten Bach, der von den Hügeln herabfloss, und marschierten den nächsten Hügel zum Fort hinauf, wo die Sturmleitern noch immer an der Brüstung lehnten. Dann und wann feuerte trotzig ein Geschütz aus Fort Josephine, doch die Kugeln schlugen nutzlos in das Flechtwerk auf der Brüstung ein. »Ah, da sind Sie ja, Sharpe«, grüßte Brigadier Moon unerwartet freundlich. Vor lauter Freude über den Sieg hatte er seine Abneigung gegen Sharpe ganz vergessen.
»Ich gratuliere Ihnen, Sir.«
»Was? Oh – danke – sehr großzügig von Ihnen.« Sharpes Lob schien Moon nicht zu rühren. »Es ist besser gelaufen, als ich zu hoffen gewagt habe. Da drüben steht Tee auf dem Feuer. Lassen Sie Ihre Männer was trinken.«
Die französischen Gefangenen saßen in der Mitte des Forts. In den Ställen hatte man ein Dutzend Pferde gefunden, die nun gesattelt wurden, vermutlich weil Moon, der seit der Überquerung des Tajo zu Fuß marschiert war, glaubte, er habe sich das Privileg verdient, auf dem Rückweg zu reiten. Ein gefangen genommener Offizier stand neben dem Brunnen und schaute untröstlich zu, wie die siegreichen britischen Soldaten fröhlich die Sachen durchwühlten, die sie in den Baracken gefunden hatten. »Frisches Brot!« Major Gillespie, einer von Moons Adjutanten, warf Sharpe einen Laib zu. »Und es ist noch warm. Die Bastarde leben wirklich gut.«
»Ich dachte, die stünden kurz vor dem Verhungern.«
»Also hier jedenfalls nicht. Das hier ist das Land, wo Milch und Honig fließen.«
Moon stieg die Treppe zur Ostbastion hinauf, die der Brücke gegenüberlag, und machte sich daran, die Magazine neben den Geschützen zu untersuchen. Die Artilleristen von Fort Josephine sahen seinen roten Rock, und ihre Geschosse pfiffen durch die Luft. Moon ignorierte sie. »Sharpe!«, rief er und wartete, bis der Rifleman zu ihm heraufgekommen war. »Zeit, dass Sie sich Ihren Sold verdienen, Sharpe«, sagte er. Sharpe erwiderte nichts darauf, sondern schaute nur zu, wie der Brigadier in ein weiteres Magazin blickte. »Kugeln«, verkündete Moon, »ganz gewöhnliche Munition und Kartätschen, aber nur mit großen Kugeln – wie auf See.«
»Keine mit Musketenkugeln, Sir?«
»Nein, das ist definitiv Schiffsmunition. Die Bastarde haben aber keine Schiffe mehr, also haben sie die übrig gebliebene Schiffsmunition wohl hierhergeschafft.« Er ließ den Deckel des Magazins fallen und schaute zur Brücke hinaus. »Mit normaler Munition werden wir das Ding wohl kaum kaputt bekommen«, bemerkte er. »Unten in den Baracken sind gut zwanzig Frauen. Lassen Sie sie von ein paar Ihrer Männer über die Brücke eskortieren. Übergeben Sie sie den Franzosen mit meinen besten Wünschen. Der Rest von Ihren Leuten kann dann Sturridge helfen. Der wird die andere Seite in die Luft jagen müssen.«
Lieutenant Sturridge war ein Royal Engineer, ein Pionier, dessen Aufgabe es war, die Brücke zu zerstören. Er war ein nervöser junger Mann, der offenbar Angst vor Moon hatte. »Die andere Seite?«, fragte Sharpe, um sicherzustellen, dass er richtig gehört hatte.
Moon schaute ihn genervt an. »Sharpe, wenn wir die Brücke auf dieser Seite zum Einsturz bringen«, erklärte er in einem Tonfall, als rede er mit einem dummen Kind, »dann wird das verdammte Ding den Fluss hinabtreiben, aber am anderen Ufer noch befestigt sein. So können die Franzosen die Pontons retten. Es wäre wohl reichlich sinnlos, wenn wir so weit marschiert wären, nur um den Franzosen eine Pontonbrücke zu lassen, die sie ohne Probleme wieder aufbauen können. Aber wenn wir die Brückenaufhängung auf der spanischen Seite sprengen, dann treiben die Pontons auf unsere Seite, und wir können sie verbrennen.« Eine Kartätschenladung zischte über ihre Köpfe hinweg, und der Brigadier warf einen verärgerten Blick in Richtung Fort Josephine. »Und jetzt beeilen Sie sich«, sagte er an Sharpe gewandt. »Ich will morgen früh wieder von hier weg sein.«
Männer des 74th bewachten die achtzehn Frauen. Sechs davon waren Offiziersgattinnen. Sie standen ein wenig abseits von den anderen und versuchten, tapfer auszusehen. »Sie werden sie rüberbringen«, sagte Sharpe zu Jack Bullen.
»Sir?«
»Sie mögen doch Frauen, oder?«
»Natürlich, Sir.«
»Und Sie sprechen auch ein wenig von dieser furchtbaren Sprache, nicht wahr?«
»Sogar furchtbar gut, Sir.«
»Dann bringen Sie die Damen über die Brücke und hinauf zu dem anderen Fort.«
Während Lieutenant Bullen versuchte, die Frauen davon zu überzeugen, dass ihnen kein Leid geschehen würde und dass sie ihre Sachen zusammensuchen sollten, um anschließend über die Brücke gebracht zu werden, suchte Sharpe nach Sturridge. Er fand den Pionier im Hauptmagazin des Forts. »Pulver«, begrüßte Sturridge Sharpe. Er hatte gerade ein Fass geöffnet und schmeckte das Schwarzpulver. »Und zwar verdammt schlechtes.« Er spie es aus und verzog das Gesicht. »Dieses verfluchte französische Pulver. Das ist doch nur Staub – und auch noch feucht.«
»Wird es denn funktionieren?«
»Also, einen Knall werden wir wohl hören«, knurrte Sturridge düster.
»Ich werde Sie über die Brücke bringen«, verkündete ihm Sharpe.
»Da draußen steht ein Handkarren«, sagte Sturridge. »Den werden wir brauchen. Fünf Fässer sollten reichen, selbst von diesem Müll.«
»Haben Sie auch Zündschnüre?«
Sturridge knöpfte seine blaue Jacke auf, um zu zeigen, dass er sich mehrere Yards Zündschnur um die Taille gewickelt hatte. »Sie haben wohl geglaubt, ich sei einfach fett.« Er grinste. »Übrigens – warum lässt er die Brücke nicht einfach auf dieser Seite sprengen? Oder in der Mitte?«
»Er will vermeiden, dass die Franzosen sie reparieren.«
»Das können sie so oder so nicht. Man braucht schon einen fähigen Ingenieur, um so eine Brücke zu bauen. Sie in die Luft zu jagen mag ja einfach sein, aber ihr Bau ist nichts für Amateure.« Sturridge schloss das Pulverfass wieder. »Ich nehme an, den Franzosen wird es nicht gerade gefallen, wenn wir uns da drüben an die Arbeit machen.«
»Davon können wir wohl ausgehen.«
»Dann ist das also der Ort, wo ich für England sterben werde, hm?«
»Deshalb bin ich ja da – um sicherzustellen, dass das nicht passiert.«
»Welch ein Trost«, seufzte Sturridge. Er schaute zu Sharpe, der mit verschränkten Armen an der Wand lehnte. Der Schatten des Tschakos fiel auf Sharpes Gesicht, doch seine Augen funkelten hell. Das Gesicht war vernarbt, hart, wachsam und hager. »Ich meine das ernst«, sagte Sturridge. »Das ist wirklich ein Trost.« Dann zuckte er unwillkürlich zusammen, als der Brigadier im Hof bellte und zu wissen verlangte, wo Sturridge steckte und warum die verdammte Brücke noch immer intakt war. »Dieser verdammte Kerl«, knurrte Sturridge.
Sharpe kehrte ins Sonnenlicht zurück, wo Moon gerade ein requiriertes Pferd einritt und vor den französischen Frauen, die sich am Osttor versammelt hatten, mit seiner Reitkunst prahlte. Jack Bullen hatte dort einen Handkarren für ihr Gepäck bereitgestellt. Sharpe befahl, das Gepäck wieder abzuladen und den Karren zum Magazin zu bringen, wo Harper und ein halbes Dutzend Männer ihn mit Pulver beluden. Das Gepäck der Frauen wurde anschließend wieder draufgelegt. »So sind die Pulverfässer versteckt«, erklärte Sharpe Harper.
»Versteckt, Sir?«
»Was, glaubst du wohl, werden die Froschfresser tun, wenn sie sehen, wie wir mit dem Pulver die Brücke überqueren?«
»Also, glücklich werden sie nicht gerade sein, Sir.«
»Nein, Pat, das werden sie nicht. Sie werden uns als Zielscheiben benutzen.«
Es war schon Vormittag, als endlich alles bereit war. Die Franzosen in Fort Josephine hatten ihr unsinniges Geschützfeuer inzwischen eingestellt. Sharpe hatte erwartet, dass der Feind einen Abgesandten über den Fluss schicken würde, um sich nach den Frauen zu erkundigen, doch es war niemand gekommen. »Drei der Offiziersgattinnen gehören zum Achten«, bemerkte Jack Bullen Sharpe gegenüber.
»Was meinen Sie damit?«, hakte Sharpe nach.
»Das ist ein französisches Regiment, Sir. Das Achte. Es war in Cadiz, ist aber nach Badajoz verlegt worden, um dort die Belagerer zu verstärken. Das Regiment liegt auf der anderen Seite des Flusses, Sir, doch einige der Offiziere und ihre Frauen haben die letzte Nacht hier verbracht. Hier sind die Quartiere besser, wissen Sie?« Bullen hielt kurz inne. Offensichtlich erwartete er irgendeine Reaktion von Sharpe. »Verstehen Sie nicht, Sir? Da drüben liegt ein ganzes französisches Regiment, das Achte. Da gibt es nicht nur eine Garnison, sondern ein ganzes, kampfbereites Regiment. Oh, mein Gott!« Letzteres galt zwei Frauen, die sich von den anderen gelöst hatten und nun auf Spanisch auf ihn einredeten. Bullen beruhigte sie mit einem Lächeln. »Sie sagen, sie seien Spanierinnen, Sir«, erklärte er Sharpe, »und sie wollen nicht in das andere Fort gebracht werden.«
»Wenn sie Spanierinnen sind, was haben sie dann überhaupt hier gemacht?«
Nun wandten sich die beiden Frauen an Sharpe. Sie redeten gleichzeitig, bedrängten ihn, und er glaubte zu verstehen, dass sie Gefangene der Franzosen waren, die man gezwungen hatte, mit jeweils einem Soldaten zusammenzuleben. Das könnte durchaus stimmen, dachte er. »Und wo wollt ihr jetzt hin?«, fragte er sie in schlechtem Spanisch.
Wieder redeten die beiden gleichzeitig, deuteten über den Fluss nach Süden und behaupteten, dass sie von dort gekommen seien. Sharpe brachte sie zum Schweigen und wandte sich dann seinem Lieutenant zu. »Sie können gehen, wohin sie wollen, Jack. Mir egal.«
Das Tor des Forts wurde geöffnet. Bullen führte die Kolonne hindurch, wobei er die Arme hob, um den Franzosen jenseits des Flusses zu zeigen, dass er keine bösen Absichten hatte. Die Frauen folgten ihm. Der Weg zum Fluss hinunter war steinig und unwegsam, und die Frauen kamen nur langsam voran, doch schließlich erreichten sie die Holzplanken, die über die Pontons führten. Sharpe und seine Männer bildeten die Nachhut. Harper, der seine siebenläufige Flinte neben dem Gewehr trug, nickte in Richtung des anderen Ufers. »Da ist das Empfangskomitee, Sir«, sagte er und meinte damit drei berittene französische Offiziere, die gerade aus Fort Josephine gekommen waren. Sie warteten und beobachteten aufmerksam die näher kommenden Frauen und Soldaten.
Ein Dutzend von Sharpes Männern zog und schob den Karren. Lieutenant Sturridge, der Pionier, begleitete sie. Immer wieder zuckte er unwillkürlich zusammen, weil der Karren eine krumme Achse hatte und ständig nach links zog. Erst als sie auf der Brücke waren, ging es schneller voran. Allerdings waren die Frauen nervös, denn die behelfsmäßige Brücke bebte unter ihren Schritten, und deutlich spürten sie den Druck der Strömung an den Pontons. Abgestorbene Äste und anderes Treibgut hatten sich an der stromaufwärts gelegenen Seite verfangenen und erhöhten den Druck noch. Jeder einzelne der großen Kähne, die als Pontons dienten, wurde von zwei dicken Ankerketten festgehalten. Sharpe hoffte nur, dass fünf Fässer nasses Pulver reichten, um die massive Konstruktion zu zerstören.
»Denken Sie, was ich auch denke?«, fragte Harper.
»Porto?«
»All die armen Kerle«, sagte Harper und erinnerte sich an den furchtbaren Augenblick, da die Pontonbrücke über den Duero gerissen war. Die Brücke war voller Menschen gewesen, die vor den vorrückenden Franzosen geflohen waren, und Hunderte von ihnen waren ertrunken. In seinen Träumen sah Sharpe noch immer die Gesichter der Kinder.
Die drei französischen Offiziere ritten zur Brücke hinunter. Dort warteten sie wieder. Sharpe eilte an den Frauen vor bei. »Jack!«, rief er nach Bullen. »Ich brauche Sie als Dolmetscher!«
Sharpe und Bullen gingen zum spanischen Ufer voraus. Die Frauen folgten ihnen zögernd. Als Sharpe näher kam, nahm einer der französischen Offiziere zum Gruß den Hut ab. »Mein Name ist Lecroix«, stellte er sich auf Englisch vor. Lecroix war noch recht jung. Er trug eine exquisite Uniform. Sein gut aussehendes Gesicht war schmal und sein Gebiss ungewöhnlich weiß. »Capitaine Lecroix vom Achten Regiment«, fügte er hinzu.
»Captain Sharpe.«
Lecroix’ Augen weiteten sich ein wenig, vielleicht weil Sharpe nicht wie ein Offizier aussah. Seine Uniform war zerrissen und verschmutzt, und er trug zwar einen Säbel, wie es für Offiziere üblich war, doch dabei handelte es sich um die Waffe eines Kavalleristen, deren schwere, unhandliche Klinge eher für einen Schlachter geeignet war. Außerdem hatte er noch ein Gewehr dabei, und Offiziere trugen für gewöhnlich keine Langwaffen. Dann war da sein Gesicht, braungebrannt und voller Narben, ein Gesicht, wie man es eher in einer finsteren Gasse und nicht in einem Salon erwartete. Es war ein Furcht erregendes Gesicht, und Lecroix, an sich kein Feigling, wäre fast vor der Feindseligkeit in Sharpes Augen zurückgezuckt. »Colonel Vandal«, sagte er und betonte deutlich die zweite Silbe des Namens, »lässt Ihnen seine Grüße übermitteln, Monsieur. Er ersucht Sie um die Erlaubnis, unsere Verwundeten zurückzuholen.« Er hielt kurz inne und schaute zu dem Karren, von dem das Gepäck der Frauen inzwischen abgeladen worden war, sodass die Pulverfässer zu sehen waren. »Natürlich bevor Sie versuchen, die Brücke in die Luft zu sprengen.«
»Versuchen?«, hakte Sharpe nach.
Lecroix ignorierte den verächtlichen Unterton. »Oder beabsichtigen Sie etwa, unsere Verwundeten zum Amüsement der Portugiesen zu behalten?«
Sharpe war versucht zu antworten, dass die verwundeten Franzosen verdient hätten, was auch immer die Portugiesen ihnen antun würden, doch er widerstand dem Verlangen. Tatsächlich war die Bitte sogar angemessen, sinnierte er, und so nahm er Jack Bullen ein Stück beiseite, damit die französischen Offiziere sie nicht hören konnten. »Gehen Sie zum Brigadier«, befahl er dem Lieutenant, »und sagen Sie ihm, dass die Froschfresser ihre Verwundeten über den Fluss holen wollen, bevor wir die Brücke sprengen.«
Bullen machte sich auf den Weg über die Brücke, und zwei der französischen Offiziere ritten zum Fort zurück, gefolgt von den Frauen mit Ausnahme der beiden Spanierinnen, die barfuß und in zerlumpten Kleidern dem Fluss in Richtung Süden folgten. Lecroix schaute ihnen hinterher. »Wollten diese beiden nicht bei uns bleiben?« Er klang überrascht.
»Sie haben gesagt, Sie wären Gefangene gewesen.«
»Vermutlich stimmt das sogar.« Lecroix holte eine kleine Ledertasche mit Zigarren aus der Jacke und bot Sharpe eine an. Sharpe schüttelte den Kopf, dann wartete er, während Lecroix sich eine anzündete. »Das heute Morgen haben Sie gut gemacht«, bemerkte der Franzose.
»Ihre Garnison hat geschlafen«, erwiderte Sharpe.
Lecroix zuckte mit den Schultern. »Garnisonstruppen. Die sind einfach zu nichts nütze. Alte, kranke, müde Männer.« Er spie ein paar Tabakkrümel aus. »Aber ich denke, weiteren Schaden werden Sie heute nicht mehr anrichten. Sie werden die Brücke nicht zerstören.«
»Ach ja?«
»Geschütze«, erwiderte Lecroix lakonisch und deutete zu Fort Josephine zurück. »Und mein Colonel ist fest entschlossen, die Brücke zu verteidigen, und was sich mein Colonel einmal in den Kopf gesetzt hat, das schafft er auch.«
»Colonel Vandal?«
»Vandal«, korrigierte Lecroix Sharpes falsche Aussprache. »Colonel Vandal vom Achten Linienregiment. Haben Sie schon von ihm gehört?«
»Nein.«
»Dann ist es wohl an der Zeit, dass Sie sich ein wenig bilden«, sagte Lecroix und lächelte. »Lesen Sie die Kampfberichte von Austerlitz und staunen Sie über Colonel Vandals Tapferkeit.«
»Austerlitz?«, hakte Sharpe nach. »Wann war das denn?«
Wieder zuckte Lecroix mit den Schultern. Das Gepäck der Frauen war inzwischen komplett abgeladen. Sharpe schickte die Männer zurück, dann folgte er ihnen, bis er Lieutenant Sturridge erreichte, der gerade gegen die Planken am Bug des vierten Pontons vom Ufer trat. Das Holz war verrottet, und Sturridge war es bereits gelungen, ein Loch hineinzutreten. Der Gestank faulen Wassers kam aus dem Loch. »Wenn wir das noch etwas größer machen«, erklärte Sturridge, »dann sollten wir in der Lage sein, das ganze Ding zur Hölle zu jagen.«
»Sir!«, rief Harper.
Sharpe drehte sich nach Osten um und sah französische Infanterie aus Fort Josephine marschieren. Sie pflanzten die Bajonette auf und bildeten eine Linie direkt am Fort, doch Sharpe bezweifelte, dass sie auch zur Brücke herunterkommen würden. Es war eine große Kompanie, mindestens hundert Mann. Französische Regimenter waren in sechs Kompanien unterteilt, während britische über zehn verfügten, und diese hier sah mit ihren aufgepflanzten Bajonetten Furcht einflößend aus. Verdammte Scheiße, dachte Sharpe, doch wenn die Froschfresser um die Brücke kämpfen wollten, dann sollten sie sich besser beeilen, denn mithilfe eines halben Dutzends von Sharpes Männern riss Sturridge weiter an den Planken, und Harper trug bereits das erste Pulverfass zum Loch.
Ein Donnern ertönte auf der portugiesischen Seite der Brücke, und Sharpe sah, wie sein Brigadier in Begleitung von zweien seiner Offiziere auf die Brücke galoppierte. Dann strömten weitere Rotröcke aus dem Fort und liefen den steinigen Weg hinunter, offensichtlich um Sharpes Männer zu verstärken. Der requirierte Hengst des Brigadiers war nervös, doch Moon war ein exzellenter Reiter, und so behielt er die Kontrolle über das Tier. Er lenkte das Pferd dicht an Sharpe heran. »Was zum Teufel ist hier los?«
»Sie haben gesagt, sie würden gern ihre Verwundeten holen, Sir.«
»Und was machen die verdammten Kerle dann da?« Moon schaute zu der französischen Infanterie.
»Ich nehme an, sie wollen uns davon abhalten, die Brücke in die Luft zu jagen, Sir.«
»Die sollen zur Hölle fahren«, knurrte Moon und warf Sharpe einen wütenden Blick zu, als wäre das alles seine Schuld. »Entweder reden sie mit uns oder sie kämpfen. Beides geht nicht! Im Krieg gibt es schließlich Regeln, verdammt noch mal!« Er trieb sein Pferd nach vorn. Major Gillespie, der Adjutant des Brigadiers, folgte ihm und warf Sharpe im Vorbeireiten einen mitfühlenden Blick zu. Der dritte Reiter war Jack Bullen. »Kommen Sie, Bullen!«, schrie Moon. »Sie können für mich übersetzen. Ich habe keine Ahnung von dieser verdammten Froschsprache.«
Harper füllte den Bug des vierten Pontons mit den Fässern, und Sturridge zog seine Jacke aus und wickelte die Zündschnur von der Taille. Es gab hier nichts für Sharpe zu tun, also ging er wieder ans Ufer, wo Moon gerade Lecroix anknurrte. Der wesentliche Grund für die Wut des Brigadiers war die Tatsache, dass die französische Infanterie inzwischen halb den Hügel heruntergekommen war und in Linie vor der Brücke stand. Begleitet von drei berittenen Offizieren waren sie nur noch knapp hundert Schritt entfernt. »Sie können nicht von uns verlangen, dass wir Ihnen gestatten, Ihre Verwundeten zurückzuholen, und uns gleichzeitig bedrohen!«, schnappte Moon.
»Monsieur, diese Männer dort sollen lediglich den Verletzten helfen«, erwiderte Lecroix beruhigend.
»O nein, nicht mit Waffen«, erklärte Moon, »und nicht ohne meine Erlaubnis! Und warum zum Teufel haben sie die Bajonette aufgepflanzt?«
»Das ist sicher nur ein Missverständnis«, entgegnete Lecroix nach wie vor in ruhigem Ton. »Würden Sie uns vielleicht die Ehre erweisen und die Lage mit meinem Colonel persönlich besprechen?« Er deutete zu den Reitern, die hinter der französischen Infanterie warteten.
Doch Moon dachte gar nicht daran, sich von einem französischen Colonel einbestellen zu lassen. »Sagen Sie ihm, er soll herkommen«, erklärte er.
»Oder wie wäre es, wenn Sie einen Emissär zu ihm schicken würden?«, schlug Lecroix vor und ignorierte den direkten Befehl des Brigadiers.
»Ach, um Himmels willen …«, knurrte Moon. »Major Gillespie? Gehen Sie und bringen Sie den Mann zur Vernunft. Sagen Sie ihm, er könne einen Offizier und zwanzig Soldaten schicken, um die Verwundeten zu holen. Die Männer dürfen keine Waffen mitbringen, aber der Offizier darf seinen Degen natürlich behalten. Lieutenant?« Der Brigadier drehte sich zu Bullen um. »Gehen Sie mit und übersetzen Sie.«
Gillespie und Bullen ritten mit Lecroix den Hügel hinauf. Inzwischen war die Leichte Kompanie des 88th auf der französischen Seite der Brücke eingetroffen, sodass es hier nun von Soldaten nur so wimmelte.
Sharpe machte sich Sorgen. Seine eigene Kompanie war auf der Brücke und bewachte Sturridge, und nun hatte sich die Leichte Kompanie zu ihnen gesellt, und sie alle gaben ein hervorragendes Ziel für die französische Linieninfanterie ab, die in drei Reihen aufmarschiert war. Dann waren da noch die französischen Kanoniere auf den Mauern von Fort Josephine, und die hatten mit Sicherheit Kartätschen in ihre Geschütze geladen. Moon hatte das 88th zur Brücke befohlen, doch nun schien er zu erkennen, dass der Aufmarsch eher peinlich als eine Verstärkung war.
»Führen Sie Ihre Männer ans andere Ufer zurück!«, rief er dem Captain der Kompanie zu. Dann drehte er sich wieder um, weil ein einzelner Franzose auf die Brücke zugeritten kam. Gillespie und Bullen waren inzwischen bei den anderen französischen Offizieren hinter der feindlichen Kompanie eingetroffen.
Der französische Offizier zügelte sein Pferd gut zwanzig Schritt entfernt. Sharpe nahm an, dass es sich bei dem Mann um den berühmten Colonel Vandal handelte, den befehlshabenden Offizier des 8. Linienregiments, denn er hatte zwei schwere goldene Epauletten auf seinem blauen Rock und sein Hut wurde von einem weißen Federbusch gekrönt, was ein wenig frivol bei einem Mann wirkte, der so boshaft dreinblickte. Der Colonel hatte ein wildes, unfreundliches Gesicht mit einem schmalen schwarzen Schnurrbart. Er schien ungefähr in Sharpes Alter zu sein, Mitte dreißig, und strahlte ein kraftvolles, arrogantes Selbstvertrauen aus. Er sprach ein gutes Englisch, und seine Stimme klang rau. »Sie werden sich aufs andere Ufer zurückziehen«, erklärte er ohne weiteres Vorgeplänkel.
»Und wer zum Teufel sind Sie?«, verlangte Moon zu wissen.
»Colonel Henri Vandal«, antwortete der Franzose, »und Sie werden sich ans andere Ufer zurückziehen und die Brücke unbeschädigt lassen.« Er zog eine Uhr aus der Tasche, klappte sie auf und drehte sich wieder zu Moon um. »Ich gebe Ihnen eine Minute. Dann werde ich das Feuer eröffnen lassen.«
»Das ist kein Benehmen«, entgegnete Moon hochmütig. »Wenn Sie zu kämpfen wünschen, Colonel, dann werden Sie ja wohl genug Anstand besitzen, vorher meine Emissäre zurückzuschicken.«
»Ihre Emissäre?« Das Wort schien Vandal zu amüsieren. »Ich habe keine Parlamentärsfahne gesehen.«
»Ihr Mann hatte ebenfalls keine dabei!«, protestierte Moon.
»Und Capitaine Lecroix hat mir berichtet, dass Sie Ihr Pulver mit unseren Frauen herübergebracht haben. Daran konnte ich Sie natürlich nicht hindern, ohne auch die Frauen zu töten. Sie haben das Leben der Frauen riskiert, nicht ich, also muss ich davon ausgehen, dass Ihnen die Regeln zivilisierter Kriegsführung nicht allzu viel bedeuten. Dennoch werde ich Ihnen Ihre Offiziere zurückschicken, sobald Sie die Brücke unbeschädigt verlassen haben. Sie haben eine Minute, Monsieur.« Und mit diesen Worten zog Vandal sein Pferd herum und ritt wieder den Hügel hinauf.
»Halten Sie meine Männer gefangen?«, rief Moon ihm hinterher.
»Ja, das tue ich!«, rief Vandal sorglos zurück.
»Im Krieg gibt es Regeln!«, schrie Moon dem sich immer weiter entfernenden Colonel hinterher.
»Regeln?« Vandal drehte sich noch einmal um, und seine Verachtung war ihm deutlich anzusehen. »Glauben Sie wirklich, es gebe Regeln im Krieg? Halten Sie das hier etwa für eines Ihrer englischen Kricketspiele?«
»Ihr Mann hat uns gebeten, einen Emissär zu schicken«, erwiderte Moon mit hochrotem Kopf. »Und das haben wir getan. Es gibt Regeln für so etwas. Selbst Sie als Franzose wissen das.«
»Ich als Franzose«, erwiderte Vandal amüsiert, »werde Ihnen jetzt einmal die Regeln erklären, Monsieur. Ich habe den Befehl, die Brücke mit einer Artilleriebatterie zu überqueren, aber wenn es keine Brücke mehr gibt, dann kann ich sie auch nicht überqueren. Also habe ich es mir zur Regel gemacht, die Brücke zu erhalten. Kurz gesagt, Monsieur, es gibt im Krieg nur eine Regel, und die besagt, dass man gewinnen muss. Abgesehen davon kennen wir Franzosen keine Regel, Monsieur.« Er ritt weiter den Hügel hinauf. »Sie haben eine Minute!«, rief er in sorglosem Ton noch mal zurück.
»Grundgütiger!«, sagte Moon und starrte dem Franzosen hinterher. Der Brigadier war von Vandals Kaltblütigkeit nicht nur überrascht, sondern offensichtlich auch verwirrt. »Es gibt Regeln!«, protestierte er noch einmal laut, doch an niemanden im Speziellen gewandt.
»Wollen Sie, dass wir jetzt die Brücke sprengen, Sir?«, fragte Sharpe in festem Ton.
Moon starrte noch immer Vandal hinterher. »Sie haben uns zu Gesprächen eingeladen! Der verdammte Kerl hat uns eingeladen! Das können sie doch nicht tun. Es gibt Regeln!«
»Wollen Sie, dass wir jetzt die Brücke sprengen, Sir?«, fragte Sharpe noch einmal.
Moon schien ihn nicht zu hören. »Er muss Gillespie und Ihren Lieutenant zurückschicken«, sagte er. »Verdammt noch mal, dafür gibt es Regeln!«
»Er wird sie aber nicht zurückschicken, Sir«, sagte Sharpe.
Moon runzelte die Stirn. Er wirkte nach wie vor verwirrt, als wisse er nicht, wie er auf Vandals Verrat reagieren sollte. »Er kann sie doch nicht einfach so gefangen nehmen!«, protestierte er.
»Sir, er wird sie bei sich behalten, es sei denn, Sie befehlen mir, die Brücke intakt zu lassen.«
Moon zögerte, doch dann erinnerte er sich an seine weitere Karriere und all die fantastischen Belohnungen, die ihn nur erwarteten, wenn er die Brücke zerstörte. »Jagen Sie die Brücke in die Luft«, befahl er in hartem Ton.
Sharpe drehte sich zu seinen Männern um. »Zurück!«, brüllte er. »Alle zurück! Mister Sturridge! Zünden Sie die Lunte!«
»Verdammt!« Der Brigadier erkannte plötzlich, dass er sich am falschen Ufer befand, und nun war die Brücke voller Männer, und in gut einer halben Minute wollten die Franzosen das Feuer eröffnen. Also riss er sein Pferd herum und trieb es über die Planken. Die Riflemen und Rotröcke liefen los, und Sharpe folgte ihnen. Das Gewehr in der Hand, ging er rückwärts und ließ die Franzosen dabei keinen Moment aus den Augen. Er schätzte, dass er einigermaßen sicher war. Die französischen Soldaten waren einen langen Musketenschuss weit entfernt, und bis jetzt hatten sie keinerlei Anstalten gemacht, die Distanz zu verkürzen, doch dann sah Sharpe, wie Vandal sich umdrehte und in Richtung Fort winkte.
»Verdammt«, knurrte Sharpe, und einen Augenblick später bebte die Luft, als sechs Geschütze ihre Kartätschen auf die Briten feuerten. Dunkler Rauch stieg in den Himmel hinauf. Die Kugeln kreischten um Sharpe herum, schlugen in die Brücke und die Männer und ließen das Wasser schäumen. Sharpe hörte einen Schrei hinter sich, dann sah er, wie die französische Kompanie auf die Brücke zustürmte.
Nachdem die Geschütze gefeuert hatten, herrschte eine seltsame Stille. Bis jetzt waren keine Musketen zum Einsatz gekommen. Der Fluss beruhigte sich wieder nach dem Einschlag der Kartätschenkugeln, und Sharpe hörte einen weiteren Schrei. Er warf einen Blick nach hinten und sah, wie Moons Hengst scheute und stieg. Blut strömte aus dem Hals des Tieres. Dann stürzte der Brigadier inmitten der Männer auf die Planken.
Sturridge war tot. Sharpe fand ihn gut zwanzig Schritt hinter den Pulverfässern. Der Pionier war von einer Kartätschenkugel in den Kopf getroffen worden. Er lag neben der Lunte. Sie war noch nicht entzündet, und die Franzosen hatten fast die Brücke erreicht. Sharpe schnappte sich Sturridges Zunderkiste und lief zu den Pulverfässern. Er verkürzte die Lunte, indem er ein Stück abriss, dann schlug er den Feuerstein auf den Stahl. Ein Funken flog und erlosch sofort. Sharpe schlug erneut, und diesmal landete der Funken auf einem Fetzen trockenen Leinens, und Sharpe blies sanft darauf. Schließlich fing der Zunder Feuer, und die Zündschnur brannte zischend ab.
Die ersten Franzosen wurden vom Gepäck der Frauen aufgehalten, das noch immer am anderen Ufer lag, doch sie traten es rasch beiseite, liefen auf die Brücke, knieten sich nieder und zielten mit ihren Musketen.
Sharpe beobachtete die Zündschnur. Sie brannte so verdammt langsam! Sharpe hörte Gewehrfeuer. Es unterschied sich deutlich von dem einer Muskete, und ein Franzose kippte langsam vornüber, einen entrüsteten Ausdruck auf dem Gesicht, und Blut floss über seinen weißen Brustgürtel. Dann feuerten die Franzosen, und ihre Kugeln zischten Sharpe um die Ohren. Die verdammte Zündschnur kroch förmlich nur! Die Franzosen waren nur noch wenige Yards entfernt. Sharpe hörte das Feuer weiterer Gewehre. Ein französischer Offizier schrie seinen Männern etwas zu, und Sharpe riss ein weiteres Stück von der Lunte ab und entzündete es mit der alten. Diese neue Zündschnur war nur wenige Zoll von dem Fass entfernt. Sharpe blies darauf, um sicherzustellen, dass sie so gut wie möglich brannte. Dann drehte er sich um und rannte zum Westufer.
Moon war verwundet, doch zwei Männer des 88th trugen den Brigadier von der Brücke. »Kommen Sie, Sir!«, schrie Harper.
Sharpe hörte französische Stiefel auf den Planken, dann senkte Harper seine siebenläufige Flinte. Es war eine Marinewaffe, die nie allzu gut funktioniert hatte. Sie diente dazu, im Enterkampf feindlichen Schützen in der Takelage eine ganze Salve von Kugeln entgegenzuschleudern, doch ihr Rückschlag war so gewaltig, dass nur wenige Männer stark genug waren, um sie zu führen – und Patrick Harper war stark genug.
»Runter, Sir!«, rief er, und Sharpe warf sich flach auf den Boden, als der Sergeant den Abzug drückte. Das Krachen ließ Sharpe taub werden. Die vordere Reihe der Franzosen wurde von den sieben Kugeln förmlich in Stücke gerissen. Ein Sergeant überlebte jedoch, und der rannte nun zu der brennenden Lunte. Sharpe lag noch immer flach auf den Planken, aber es gelang ihm, sein Gewehr vom Rücken zu nehmen. Er hatte jedoch keine Zeit zum Zielen. Stattdessen richtete er einfach den Lauf auf den Franzosen, drückte ab und sah durch den Mündungsrauch, wie das Gesicht des französischen Sergeanten in einem blutroten Nebel verschwand. Der Mann wurde nach hinten geschleudert. Die Lunte qualmte noch. Und dann explodierte die Welt.
Das Feuer hatte sich bis zu Sturridges Ladung durchgebrannt, und das Pulver flog in die Luft. Ein gewaltiger Knall erfüllte die Luft, und alles versank in Dunkelheit. Flammen, Rauch und Holzsplitter wurden in die Luft geschleudert. Allerdings ging die Hauptwirkung der Explosion in den Ponton und drückte den Kahn nach unten in den Fluss. Die Brücke krümmte sich, und einzelne Planken wurden losgerissen. Die Franzosen wurden zurückgeworfen. Einige von ihnen waren tot, andere verbrannt oder bewusstlos, und dann schoss der nach unten gedrückte Ponton wieder nach oben, und die Ankerkette riss. Mit einem Ruck bewegte sich die Brücke flussabwärts. Harper wurde von den Beinen gerissen. Er und Sharpe klammerten sich an die Planken. Die Brücke bebte, und der Fluss schäumte und presste gegen die Lücke, wo das zerfetzte Holz brannte. Sharpe war von der Explosion kurz benommen gewesen, nun fiel es ihm schwer zu stehen, aber er taumelte auf das von den Briten gehaltene Ufer zu. Dann riss eine Ankerkette nach der anderen, und je mehr rissen, desto größer wurde der Druck auf die verbliebenen.