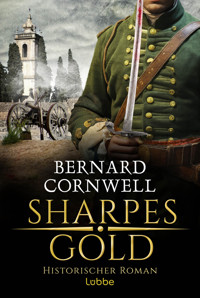9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
1814. Die Invasion Frankreichs hat begonnen, und die Royal Navy bittet Major Richard Sharpe um Unterstützung. Er soll mit seinen Scharfschützen eine Festung an der französischen Küste einnehmen und sichern. Das gefährliche Unterfangen gelingt, doch durch die Feigheit eines Navy Captains stehen Sharpe und seine Männer plötzlich allein einer übermächtigen Streitmacht gegenüber. Die Niederlage erscheint unvermeidlich. Sharpe bleibt keine Wahl, als ihr aller Schicksal einem amerikanischen Freibeuter anzuvertrauen, einem Mann, mit dem er schon einmal aneinandergeriet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
Epilog
Historische Anmerkung
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Bernard Cornwell
SHARPESTRIUMPH
Richard Sharpe undder Winterfeldzug 1814
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Fassung des 1991 bei Bastei Lübbe erschienenenRomans »Sharps Triumph«
Für die Originalausgabe:Copyright © 1987 by Bernard CornwellTitel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Siege«Published by arrangement withMarco Vigevani & Associati Agenzia Letteraria,on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer DelfsTitelillustration: © Bao PhamUmschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
eBook-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3081-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sharpes Triumph istBrenim McNight, Terry Farrand, Brian Thorniley,Diana Colbert, Ray Steele und Stuart Wilkie
KAPITEL 1
Es war zehn Tage vor Maria Lichtmess im Jahre 1814, und der Wind vom Atlantik brachte kalte Regenschauer. Der Regen prasselte auf das Kopfsteinpflaster enger Gassen, strömte aus beschädigten Dachrinnen und trommelte auf das Wasser im Binnenhafen von St. Jean de Luz. Der Winterwind war kalt und schneidend. Er wirbelte den Rauch aus den Schornsteinen in die tief hängenden Wolken, die den Himmel über der südwestlichen Ecke Frankreichs verhüllten, wo sich die britische Army in diesem Januar festgesetzt hatte.
Ein britischer Soldat ritt auf einem erschöpften und schlammbespritzten Pferd über eine Kopfsteinpflasterstraße von St. Jean de Luz. Er duckte sich unter dem hölzernen Schild einer Bäckerei, lenkte seine Stute an einem Fischkarren vorbei und saß an einer Ecke ab, wo er die Zügel seines Pferdes an einem eisernen Poller anband. Er tätschelte das Pferd, schnallte die Satteltaschen ab und warf sie sich über die Schulter. Es war offenkundig, dass er weit geritten war.
Er ging in eine schmale Gasse und suchte ein Haus, das er nur von der Beschreibung her kannte, ein Haus mit blauer Tür und zersprungenen grünen Kacheln über dem Sturz. Er erschauerte in Regen und Kälte. An seiner Hüfte hing ein schwerer Kavalleriesäbel in einer Metallscheide, und über seiner rechten Schulter trug er ein Gewehr. Er machte einer korpulenten, schwarzgekleideten Frau Platz, die einen Korb mit Hummern am Arm hängen hatte. Sie lächelte, dankbar über diese kleine Höflichkeit eines feindlichen Soldaten, doch als sie sicher an ihm vorbei war, bekreuzigte sie sich. Das Gesicht des Soldaten war grimmig und narbig. Es sah auf harte Weise gut aus, aber es war das Gesicht eines tödlichen Kämpfers. Die Frau dankte ihrem Schutzpatron, dass ihr Sohn nicht gegen einen solchen Mann in der Schlacht kämpfen musste, sondern stattdessen eine sichere und gefahrlose Arbeitsstelle beim französischen Zoll hatte.
Der Soldat fand die blaue Tür unter den grünen Kacheln. Obwohl es bitterkalt war, stand die Tür einen Spaltbreit offen. Ohne anzuklopfen trat er ein. In der Diele legte er sein Gepäck und das Gewehr auf dem abgelaufenen Teppich ab und sah sich plötzlich einem Stabsarzt der britischen Army gegenüber, der ihn gereizt anstarrte.
»Ich kenne Sie«, sagte der Stabsarzt, dessen Hemdmanschetten mit getrocknetem Blut bedeckt waren.
»Sharpe, Sir, von den Eigenen Freiwilligen des Prinzen von Wales …«
»Ich sagte, ich kenne Sie«, fiel ihm der Stabsarzt ins Wort. »Ich holte nach der Schlacht bei Fuentes d’Onoro eine Musketenkugel aus Ihnen heraus. War ziemlich mühsam, wie ich mich erinnere.«
»In der Tat.« Sharpe hatte es nur allzu gut in Erinnerung. Der Stabsarzt war halb betrunken gewesen. Im Schein einer flackernden Kerze hatte er die Kugel mehr aus Sharpes Körper herausgewühlt als herausoperiert. Jetzt sahen sich die beiden Männer im Vorzimmer von Lieutenant Colonel Michael Hogans Quartier wieder.
»Sie können da nicht rein.« Die Kleidung des Stabsarztes war zur Vorbeugung mit Essig getränkt, und der Geruch erfüllte die Diele. »Es sei denn, Sie wollen sich den Tod holen.«
»Aber …«
»Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde.« Der Stabsarzt wischte das Gefäß zum Aderlass mit dem Hemdschoß ab und warf es in seine Arzttasche. »Wenn Sie sich das Fieber holen wollen, gehen Sie rein, Major.« Er spuckte auf ein breitklingiges Messer zum Skarifizieren, wischte das Blut davon ab und zuckte mit den Schultern, als Sharpe die Innentür öffnete.
Hogans Zimmer wurde von einem großen Kaminfeuer beheizt, in dem es zischte, wenn Regen durch den Schornstein in die Flammen fiel. Hogan lag im Bett und war mit ein paar Decken zugedeckt. Er fror und schwitzte gleichzeitig. Sein Gesicht war grau und schweißbedeckt, und die Augen waren rot gerändert. Er murmelte etwas Unzusammenhängendes.
»Er fantasiert im Fieber«, sagte der Stabsarzt hinter Sharpe. »Haben Sie dienstlich mit ihm zu tun?«
Sharpe schaute auf den Kranken. »Er ist mein besonderer Freund.« Er wandte sich zu dem Stabsarzt um und sah ihn an. »Ich konnte ihn nicht eher besuchen. Ich wusste, dass er krank ist, aber …« Er fand keine Worte mehr.
Der Stabsarzt wurde etwas freundlicher. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas Hoffnung machen, Major.«
»Das können Sie nicht?«
»Er hat vielleicht noch zwei Tage. Vielleicht lebt er auch noch eine Woche.« Der Stabsarzt zog seinen Rock an, den er abgelegt hatte, bevor er Hogan zur Ader gelassen hatte. »Er ist in rotes Flanell eingehüllt, wird regelmäßig geschröpft, und wir haben ihm Schießpulver und Brandy gegeben. Mehr können wir nicht tun, Major, außer beten um Gottes Barmherzigkeit.«
Im Krankenzimmer stank es nach Erbrochenem. Sharpe schwitzte in der Hitze des großen Kaminfeuers. Seine nasse Uniform begann zu dampfen. Er trat näher ans Bett heran, aber Hogan erkannte ihn nicht. Der Ire in mittleren Jahren, Wellingtons Geheimdienstchef, zitterte und schwitzte und stammelte Unzusammenhängendes mit der Stimme, die Sharpe so oft durch den trockenen Humor Hogans belustigt hatte.
»Es ist möglich, dass mit dem nächsten Konvoi etwas Chinarinde kommt«, sagte der Stabsarzt aus der Diele.
»Chinarinde?« Sharpe wandte den Kopf und sah den Arzt fragend an.
»Die Rinde eines südamerikanischen Baums, Major, auch Chinin genannt. Wenn man die richtig verabreicht, kann sie Wunder bewirken. Aber es ist eine seltene Substanz, Major, und wahnsinnig teuer!«
Sharpe trat noch näher ans Bett. »Michael? Michael?«
Hogan sagte etwas auf Gälisch. Sein Blick ging an Sharpe vorbei und flackerte. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder.
»Michael?«
»Ducos«, sagte der Kranke deutlich. »Ducos.«
»Er spricht wirres Zeug«, bemerkte der Stabsarzt.
»Soeben aber nicht.« Sharpe hatte klar einen Namen gehört, einen französischen Nachnamen, den Namen eines Feindes, aber Sharpe wusste nicht, in welchem Zusammenhang der Fiebernde den Namen benutzte.
»Der Field Marshal ließ mich holen«, erklärte der Stabsarzt. »Aber ich kann keine Wunder bewirken, Major. Nur der Allmächtige kann das.«
»Oder diese Chinarinde.«
»Die ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe.« Der Stabsarzt stand immer noch an der Tür. »Darf ich darauf bestehen, dass Sie jetzt gehen, Major? Gott schütze uns vor einer Ansteckung.«
»Ja.« Sharpe würde sich nie verzeihen, wenn er Hogan nicht eine Geste der Freundschaft erwies, so nutzlos sie auch war, und so neigte er sich zu ihm, nahm die Hand des Kranken und drückte sie leicht.
»Maquereau«, sagte Hogan mit klarer Stimme.
»Maquereau?«
»Major!«, rief der Stabsarzt.
Sharpe gab dem Drängen des Stabsarztes nach und verließ das Zimmer. »Sagt Ihnen maquereau etwas?«
»Das ist ein Fisch. Die Makrele. Damit bezeichnet man in der französischen Umgangssprache auch einen Zuhälter, Major. Ich sagte Ihnen ja, er fantasiert.« Der Stabsarzt schloss die Tür des Krankenzimmers. »Und ich möchte Ihnen noch einen Rat geben, Major.«
»Ja?«
»Wenn Sie wollen, dass Ihre Frau am Leben bleibt, dann sagen Sie ihr, dass sie ihn nicht mehr besuchen soll.«
Sharpe verharrte bei seinem nassen Gepäck. »Jane besucht ihn?«
»Eine Mrs Sharpe besucht den Lieutenant Colonel täglich«, sagte der Stabsarzt, »ihren Vornamen kenne ich nicht. Guten Tag, Major.«
Es war Winter in Frankreich.
Der Boden bestand aus glänzendem Parkett, die Wände waren mit Marmor verkleidet, und die Decke aus Stuck war eine wahre Farbenorgie. Mitten auf dem Boden, unter dem großen Kronleuchter und zwergenhaft klein im Vergleich zu den Proportionen des riesigen Raums, stand ein Tisch aus Malachit. Sechs Kerzen, deren Schein zu schwach war, um die Ecken des großen Zimmers zu erreichen, beleuchteten Landkarten, die auf dem grünen Steintisch ausgebreitet lagen.
Ein Mann ging von dem Malachittisch zum Feuer, das im kunstvoll behauenen Kamin brannte. Er starrte in die Flammen, und als er schließlich sprach, hallten seine Worte dumpf von den Marmorwänden wider. »Es gibt keine Reserven.«
»Calvets halbe Brigade …«
»Ist unverzüglich nach Süden abkommandiert.« Der Mann wandte sich vom Feuer ab und schaute zum Tisch, wo der Kerzenschein auf zwei blasse Gesichter über dunklen Uniformen fiel. »Der Kaiser wird nicht erfreut sein, wenn wir …«
»Der Kaiser belohnt Erfolge«, unterbrach der kleinste Mann mit überraschend tiefer und harter Stimme.
Der Januarregen prasselte gegen die hohen Fenster, die nach Osten wiesen. Die Samtvorhänge dieses Zimmers waren vor einundzwanzig Jahren heruntergerissen worden, Trophäen für einen Revolutionsmob, der triumphierend durch die Straßen von Bordeaux gezogen war, und es hatte weder das Geld noch den Willen gegeben, neue Vorhänge aufzuhängen. Das Resultat war, dass es in solch kalten Wintern schlimm zog. Das Feuer konnte kaum den Kamin erwärmen, geschweige denn den ganzen riesigen Raum, und der Général, der vor den schwachen Flammen stand, fröstelte. »Osten oder Norden, das ist die Frage.«
Das Problem war einfach genug. Die Briten waren in eine kleine Ecke des südlichen Frankreichs einmarschiert, nichts als ein Fußfassen zwischen den südlichen Flüssen und dem Golf von Biskaya, und diese drei Männer rechneten damit, dass die Briten wieder angriffen. Aber würde Feldmarschall Lord Wellington nach Osten oder Norden vorstoßen?
»Wir wissen, dass er nach Norden will«, sagte der kleinste der drei Männer. »Warum sonst sammeln sie Boote?«
»In diesem Fall, mein lieber Ducos, geht es um eine Brücke oder einen Anlegeplatz.« Der Général ging zum Tisch zurück.
Der dritte Mann, ein Colonel, warf einen Zigarrenstummel auf den Boden und trat ihn mit dem Absatz aus. »Vielleicht kann uns das der Amerikaner sagen?«
»Der Amerikaner ist ein Floh auf dem Hintern eines Löwen«, sagte Pierre Ducos verächtlich. »Ein Abenteurer. Ich benutze ihn, weil kein Franzose die Aufgabe erledigen kann, aber ich erwarte keine große Hilfe von ihm.«
»Wer kann uns dann die Informationen beschaffen?« Der Général trat in den Lichtkreis der Kerzen. »Ist das nicht Ihre Aufgabe, Ducos?«
Commandant Pierre Ducos’ Fähigkeiten wurden nur selten angezweifelt, wie es die herausfordernde Frage andeutete, aber Frankreich wurde angegriffen, und Ducos war fast hilflos. Als er mit dem Rest der französischen Armee aus Spanien hinausgeworfen worden war, hatte Ducos seine besten Agenten verloren. Jetzt versuchte Ducos sich in die Gedanken des Feinds zu versetzen, und er sah nur Nebel.
»Da gibt es einen Mann«, sagte er leise.
»Und?«
Ducos’ runde, dicke Brillengläser spiegelten den Kerzenschein wider, als er auf eine Landkarte schaute. Er würde eine Botschaft durch die feindlichen Linien schicken müssen, und er riskierte den Verlust seines letzten Agenten in britischer Uniform, aber vielleicht war das Risiko berechtigt, wenn Frankreich dadurch die Informationen erhielt, die es so dringend brauchte. Griffen die Briten östlich oder nördlich an, war ihr Ziel eine Brücke oder eine Anlegestelle? Pierre Ducos nickte. »Ich werde es versuchen.«
So kam es, dass drei Tage später ein französischer Lieutenant vorsichtig über eine gefrorene Plankenbrücke ging, die sich über einen Nebenfluss des Flusses Nive spannte. Er kündigte sich mit einem fröhlichen Ruf bei den feindlichen Feldposten an.
Zwei Briten in roten Uniformröcken, die sich zum Schutz vor der bitteren Kälte Lappen um die Gesichter gebunden hatten, riefen ihren Offizier. Der französische Lieutenant, der wusste, dass er sicher war, grinste die Posten an. »Kalt, was?«
»Verdammt kalt.«
»Für euch.« Der französische Lieutenant gab den Rotröcken ein Stoffbündel, das einen Laib Brot und eine Wurst enthielt, die übliche Geste bei solchen Anlässen, und dann begrüßte er seinen britischen Offizierskollegen mit freudiger Vertrautheit. »Ich bringe den Kattun für Captain Salmon.« Der Franzose schnallte sein Gepäck ab. »Aber ich konnte keine rote Seide in Bayonne auftreiben. Kann die Frau des Colonels warten?«
»Es wird ihr nichts anderes übrig bleiben.« Der britische Lieutenant bezahlte mit Silbergeld für den Kattun und gab dem Franzosen ein Stück Kautabak als Belohnung. »Können Sie Kaffee kaufen?«
»Jede Menge. Ein amerikanischer Schoner ist durch eure Blockade geschlüpft.« Der Franzose öffnete seine Patronentasche. »Ich habe auch drei Briefe.« Wie üblich waren die Briefe unversiegelt, zum Zeichen, dass sie gelesen werden konnten. Nicht wenige Offiziere der britischen Army hatten Bekannte, Freunde oder Verwandte in den Reihen des Feindes, und die feindlichen Posten hatten stets als inoffizielles Postsystem zwischen den Armeen gedient. Der Franzose lehnte dankend einen Becher mit britischem Tee ab und versprach, einen Vier-Pfund-Sack Kaffee auf dem Markt von Bayonne zu kaufen und am nächsten Tag zu bringen. »Das heißt, wenn ihr morgen noch hier seid.«
»Wir werden hier sein.«
Und so wurde Pierre Ducos’ Botschaft sicher und auf eine Art und Weise übermittelt, die völlig normal und über jeden Verdacht erhaben war.
»Warum sollte ich Michael nicht besuchen? Das ist doch völlig korrekt. Schließlich kann ein kranker Mann sich kaum bei einer Dame danebenbenehmen.«
Sharpe lächelte nicht über Janes scherzhafte Bemerkung. »Ich will nicht, dass du dir das Fieber holst. Gib das Essen bei der Ordonnanz ab.«
»Ich habe Michael jeden Tag besucht«, sagte Jane, »und ich bin bei bester Gesundheit. Außerdem hast du ihn ebenfalls besucht.«
»Ich könnte mir denken, dass meine Konstitution robuster ist als deine«, erwiderte Sharpe.
»Sie ist mit Sicherheit hässlicher«, sagte Jane.
»Ich muss darauf bestehen, dass du die Gefahr einer Ansteckung vermeidest.« Sharpe bemühte sich um einen würdevollen Tonfall.
»Ich habe jede Absicht, eine Ansteckung zu vermeiden.« Jane saß still, während ihr neues französisches Hausmädchen Kämme in ihr Haar steckte. »Aber Michael ist unser Freund, und ich werde nicht zulassen, dass er vernachlässigt wird.« Sie legte eine Pause ein, als erwarte sie einen Widerspruch ihres Mannes, doch Sharpe hatte schnell gelernt, dass man bei dem großen Gefecht namens Ehe das Glück durch häufigen Rückzug erkaufen muss. Jane lächelte. »Und wenn ich dieses Wetter aushalten kann, muss ich so widerstandsfähig wie jeder Rifleman sein.«
Der Seewind heulte von der Biskaya her und rüttelte an den Flügelfenstern des Quartiers. Über die Dächer der Häuser hinweg konnte Sharpe die Masten und Rahen der vielen Schiffe sehen, die im Binnenhafen lagen. Eines dieser Schiffe hatte die neuen Uniformen gebracht, die an seine Männer ausgegeben worden waren.
Es war an der Zeit gewesen. Die Altgedienten des South-Essex-Regiments, das Sharpe jetzt die Eigenen Freiwilligen des Prinzen von Wales nennen musste, hatten seit drei Jahren keine neuen Uniformen erhalten. Ihre Röcke waren zerlumpt, verblichen und geflickt, doch jetzt wurden diese alten Röcke, mit denen die Männer in Spanien gekämpft hatten, durch neue ersetzt. Einige französische Bataillone würden aus diesen neuen Uniformröcken schließen, dass sie es mit einer frischen, unerfahrenen Einheit zu tun hatten, und zweifellos teuer für den Irrtum bezahlen. Die Befehle zur Neuausstattung hatten Sharpe ermöglicht, bei seiner Frau zu sein wie alle verheirateten Männer des Bataillons. Das Bataillon war beim Fluss Nive stationiert, nahe den französischen Patrouillen, und Sharpe hatte befohlen, dass die Frauen in St. Jean de Luz blieben. Diese paar Tage, fort vom gefrorenen Flussufer, waren für Sharpe eine kostbare Zeit mit Jane, nur verdorben durch die Krankheit, die Michael Hogans Leben bedrohte.
»Ich bringe ihm Essen aus dem Club«, sagte Jane.
»Aus dem Club?«
»Wo wir zu Mittag essen werden, Richard.« Sie wandte den Blick vom Spiegel ab mit der Miene einer Frau, die zufrieden mit ihrem Aussehen ist. »Euer Kasino, nehme ich an.«
In jeder Stadt, die von den Briten besetzt wurde und in der sie mehr als nur ein paar Tage verbrachten, wurde ein Gebäude zum Club der Offiziere. Das Gebäude wurde nie offiziell ausgewählt und auch nicht so bezeichnet, doch durch eine sonderbare Prozedur wurde binnen spätestens zwei Tagen nach Ankunft der Army ein bestimmtes Haus allgemein als »Kasino« betrachtet, als Club, in den sich elegante Gentlemen zurückziehen könnten, um die Londoner Zeitungen zu lesen, an einem anständigen Kaminfeuer Glühwein zu trinken und des Abends ein paar Runden Whist zu spielen. In St. Jean de Luz war es ein Haus mit Blick auf den äußeren Hafen.
Major Richard Sharpe, der in einem einfachen Gasthaus geboren worden und aus den Mannschaften der britischen Army aufgestiegen war, hatte noch nie einen solchen vorübergehenden Gentlemen’s Club besucht, doch eine frische und schöne Ehefrau muss bei Laune gehalten werden. »Ich wusste gar nicht, dass Frauen Zutritt zu Gentlemen’s Clubs haben«, sagte er mit Unbehagen und knöpfte widerstrebend seinen neuen grünen Uniformrock auf.
»Hier haben sie das«, sagte Jane. »Und es gibt unter anderem Austern zum Mittagessen.« Damit war die Sache erledigt. Major Richard Sharpe und Gattin würden essen gehen, und Major Sharpe musste die steife, unbequeme Uniform tragen, die er in London für einen Empfang am Königshof gekauft hatte und die er nur äußerst ungern anzog. Als er mit Jane am Arm die breite Treppe zum Offiziersclub hinaufstieg, sagte er sich, dass viel Weisheit in dem alten Rat war, dass ein Offizier niemals eine Frau aus gutem Hause in einen schlechten Krieg mitnehmen sollte.
Sein Unmut verflog jedoch, als er den Speiseraum betrat. Stattdessen stieg der Stolz in ihm auf, den er stets empfand, wenn er Jane in die Öffentlichkeit mitnahm. Sie war unbestreitbar schön, und die Schönheit wurde begleitet von einer Lebendigkeit und Frische, die ihrem Gesicht Charakter verlieh. Sie war mit ihm erst vor ein paar Monaten durchgebrannt, war aus dem Haus ihres Onkels im Marschland von Essex geflüchtet, um in den Krieg zu gehen. Sie zog bewundernde Blicke von Männern an jedem Tisch an, während andere Offiziersfrauen, die die Unannehmlichkeiten bei einem Feldzug um der Liebe willen ertrugen, neidisch auf Jane Sharpes Schönheit waren. Einige der Frauen beneideten sie auch um den großen, schwarzhaarigen Mann mit der Narbe auf der linken Wange, der sich anscheinend unbehaglich in der feudalen Pracht des Clubs fühlte. Sharpes Name wurde von Tisch zu Tisch geflüstert, der Name des Mannes, der eine feindliche Adler-Standarte erbeutet, als Erster durch eine der Breschen bei der Schlacht von Badajoz gestürmt und der bei der Plünderung auf dem blutigen Schlachtfeld bei Vitoria zu einem reichen Mann geworden war, wie Gerüchte besagten.
Ein Kellner mit weißen Handschuhen eilte von einem Tisch, an dem ranghohe Offiziere saßen, an Janes Seite. »Der Kapitän wünschte hier zu sitzen, Ma’am«, sagte der Kellner und wischte unnötigerweise den Sitz eines Stuhls bei einem der großen Fenster ab, »aber ich sagte ihm, dass dieser Tisch für jemand Besonderen reserviert ist.«
Jane schenkte dem Kellner ein Lächeln, das einen Ehefeind zu einem Ehesklaven gemacht hätte. »Wie freundlich von Ihnen, Smithers.«
»Jetzt sitzt er dort drüben.« Smithers nickte geringschätzig zu einem Tisch beim Kamin, wo zwei Navy-Offiziere in warmer Behaglichkeit saßen. Der eine Offizier war Lieutenant, während die nagelneuen Epauletten des anderen Mannes verrieten, dass er erst vor Kurzem zum Captain befördert worden war.
Smithers sah Jane wieder hingebungsvoll an. »Ich habe eine Flasche oder zwei von diesem roten Bordeaux reserviert, der Ihnen so gut schmeckt.«
Sharpe, der von dem Kellner ignoriert worden war, nannte den Weinnamen auf Französisch und hoffte, dass er ihn richtig aussprach. Die Austern waren gewiss gut, und er bestellte sie ebenfalls. Jane erklärte, dass sie am Nachmittag eine Portion in Hogans Quartier bringen würde. Sharpe bestand von Neuem darauf, dass sie das Krankenzimmer meiden sollte, um sich nicht anzustecken, und er sah eine Spur von Ärger auf Janes Gesicht. Der Ärger war jedoch nicht auf Sharpes Worte zurückzuführen, sondern auf den Navy Captain, der ohne Manieren an den Tisch gekommen war, hinter Sharpe stand und die Unterhaltung mithören konnte.
»Das sind chasse-marées«, sagte Jane zu ihrem Mann.
»Chasse-marrys?«
»Küstenfrachter, Richard. Sie transportieren jeweils fünfzig Tonnen Fracht.« Jane lächelte und freute sich, weil sie ihr Wissen zeigen konnte. »Du vergisst, dass ich an der Küste aufgewachsen bin. Die Schmuggler in Dünkirchen benutzen chasse-marées. Die Navy …« Jane sagte es so laut, dass der aufdringliche Navy Captain es hören musste, »… konnte sie noch nie schnappen.«
Der Navy-Offizier bekam Mrs Sharpes Stichelei jedoch nicht mit. Er starrte auf die Flotte der Frachter, die aus einem Regenschleier auftauchten und seitwärts abzudrehen schienen, um einer Sandbank auszuweichen, die von einer unregelmäßigen Linie schmutzigen Schaums markiert war. »Ford! Ford!«
Der Navy Lieutenant tupfte die Lippen mit einer Serviette ab, trank rasch noch einen Schluck Wein und eilte dann zu seinem Captain. »Sir?«
Der Captain nahm ein kleines Fernrohr aus der Tasche seines Uniformrocks. »Da ist ein ziemlich schneller, Ford. Merken Sie den vor!«
Sharpe fragte sich, weshalb Navy-Offiziere so interessiert an französischen Küstenschiffen waren. Jane erklärte ihm, dass die Navy die chasse-marées seit Tagen sammelte. Sie hatte gehört, dass die Schiffe mit ihren französischen Besatzungen für englisches Geld angeheuert wurden, aber sie wusste nicht, zu welchem Zweck.
Die kleine Flotte war jetzt nur noch etwa eine Viertelmeile vom Hafen entfernt, und um die Einfahrt in die befahrene Fahrrinne zu erleichtern, hatte jedes Schiff die Toppsegel eingeholt. Die Brigg hatte ebenfalls beigedreht, doch eines der französischen Küstenschiffe, das größer als die anderen war, fuhr immer noch unter vollen Segeln. Das Wasser brach sich weiß am Vordersteven und glitt in wirbelndem grauen Schaum am Rumpf entlang, der schnittiger war als der Rumpf der anderen, kleineren Schiffe.
»Der denkt, es ist ein Wettrennen, Sir«, sagte der Lieutenant über Sharpes Schulter hinweg.
»Verdammt wendig«, sagte der Captain mit widerwilliger Bewunderung. »Zu gut für die Army. Ich denke, wir sollten uns damit verstärken.«
»Aye, aye, Sir.«
Der schnellere, größere Frachtsegler hatte sich von der kleinen Flotte gelöst. Seine Segel waren schmutziggrau wie der Winterhimmel, und der Rumpf war pechschwarz angestrichen. Das Deck war wie bei allen chasse-marées eine freie Fläche, die nur von den drei Masten und der Ruderpinne durchbrochen war, an der zwei Männer standen. Auf den Decksplanken lag unordentlich ein Haufen Ausrüstung zum Fischen.
Die Besatzung der Brigg der Navy sah den größeren Frachter voraussegeln und hisste eine Leine mit bunten Flaggen. Der Captain schnaubte. »Die verdammten Froschfresser werden das nicht verstehen!«
Sharpe hatte sich über die aufdringliche Nähe der beiden Navy-Offiziere geärgert und nach einem Grund gesucht, um sie zurechtzuweisen, und jetzt hatte er ihn, weil der Mann vor Jane fluchte. Sharpe erhob sich. »Sir.«
Der Captain wandte sich absichtlich langsam Sharpe zu und heftete den Blick seiner graugrünen Augen auf den Army Major. Der Navy Captain war jung, stämmig und überzeugt, dass er einen höheren Rang hatte als Sharpe.
Sie starrten sich in die Augen, und Sharpe hatte plötzlich das sichere Gefühl, dass er diesen Mann hassen würde. Es gab keinen Grund dafür, keine Berechtigung, sondern nur eine starke Abneigung gegen diese arrogante, belustigte Miene des Mannes, der ihn offenkundig verachtete.
»Ja?« Die Stimme des Navy-Offiziers verriet freudige Erwartung auf einen bevorstehenden Streit.
Jane entschärfte die Konfrontation. »Mein Mann reagiert empfindlich auf die Ausdrucksweise kämpfender Männer.«
Der Captain, der sich nicht sicher war, ob das ein Kompliment oder Spott war, entschied sich, die Worte als eine Anerkennung seiner Tapferkeit zu werten. Er musterte Sharpes nagelneuen grünen Uniformrock. Daraus schloss er, dass Sharpe trotz der Narbe ein Neuling im Krieg war. Der Captain lächelte hochnäsig. »Ihre Empfindlichkeit wird zweifellos durch französische Kugeln verstärkt werden, Major.«
Jane freute sich über den Anknüpfungspunkt und lächelte süß. »Ich bin sicher, dass Major Sharpe dankbar für Ihre Meinung ist, Sir.«
Das führte zu einer befriedigenden Reaktion. Eine Mischung aus Erstaunen und Bestürzung zeichnete sich auf dem feisten Gesicht des jungen Navy-Offiziers ab. Er wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Dann erinnerte er sich an den Anlass zu dem Streit und verneigte sich vor Jane. »Verzeihen Sie, Mrs Sharpe, wenn meine Ausdrucksweise Sie verletzt hat.«
»Schon gut, Captain …« Jane ließ die Worte fragend ausklingen.
Der Kapitän zur See verbeugte sich noch einmal. »Bampfylde, Kapitän zur See Horace Bampfylde, Ma’am. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen Lieutenant Ford vorstelle.«
Jane erlaubte es liebenswürdig, es wurde als Geste des Friedens betrachtet, und Sharpe, überlistet von überschwänglicher Höflichkeit, nahm wieder Platz. »Der Mann hat keine Manieren«, grollte Sharpe laut genug, damit ihn die beiden Navy-Offiziere hören konnten.
»Vielleicht hat er nicht deine Erfahrungen gemacht?«, meinte Jane süß, aber von Neuem lenkte die Szene jenseits des Fensters die beiden Navy-Offiziere von den bissigen Bemerkungen ab.
»Verdammt!« Captain Horace Bampfylde stieß es hervor, ohne auf das Risiko zu achten, dass er ein Dutzend Ladys im Speiseraum schockieren konnte. Bei seinem zornigen Ruf wurde es sofort still, und die Aufmerksamkeit aller Anwesenden richtete sich auf das kleine Drama, das sich auf dem winterkalten Meer abspielte.
Der Frachter mit dem schwarzen Rumpf hatte die Kommandos der Brigg, die Segel einzuholen und umgehend in den Hafen von St. Jean de Luz einzulaufen, einfach missachtet und stattdessen den Kurs geändert. Er war nach Süden gesegelt, doch jetzt drehte er nach Westen ab. Selbst Sharpe, der kein Seemann war, sah, dass die Takelung das Schiff zu einem wendigen und schnellen Segler machte.
Es war nicht allein die Kursveränderung, die Bampfylde betroffen machte. Auf dem Deck des schnellen Seglers tauchten plötzlich Männer auf wie Drachenzähne, die sich in Krieger verwandelten, und am Besanmast war eine Flagge gehisst worden.
Es war weder die blaue Flagge der britischen Navy noch die Trikolore Frankreichs. Es war die Fahne von Britanniens neuestem Feind – das Sternenbanner der Vereinigten Staaten von Amerika.
»Ein Amerikaner!«, stieß jemand empört hervor.
»Feuer, Mann!« Bampfylde brüllte es im Befehlston durch den Speiseraum, als könne der Kapitän der Brigg ihn hören. Doch auf der Brigg war man hilflos. Männer rannten auf Deck, Stückpforten wurden geöffnet, doch der amerikanische Segler segelte an der Brigg vorbei, und Sharpe sah graue Pulverrauchwolken, als eine Breitseite auf das britische Schiff abgefeuert wurde.
Lieutenant Ford stöhnte auf. David griff Goliath an und gewann!
Das Krachen des amerikanischen Geschützfeuers hallte wie Donnergrollen über das im Wind gekräuselte Wasser, dann drehte der Frachtsegler ab und nahm Gegenkurs, vorbei an der Brigg und auf die Flotte der chasse-marées zu.
Die Brigg, deren Focksegel endlich den Wind fingen, sodass sie drehen konnte, erhielt wie zum Spott eine zweite Breitseite. Der Amerikaner hatte fünf Geschütze an jeder Seite, kleine Geschütze, doch ihr Feuer brachte den Tod auf das volle Deck der Brigg.
Zwei der Kanonen der Brigg spuckten Feuer und Rauch in den kalten Wind, doch der Amerikaner hatte seine Aktion gut abgeschätzt, und der Kapitän der Brigg wagte nicht mehr, feuern zu lassen, weil er befürchtete, die chasse-marées zu treffen, zwischen die der Amerikaner segelte.
Die angeheuerten Küstenschiffe waren unbewaffnet. Jedes hatte vier Mann Besatzung, die unter dem Schutz der Marine des Feindes nicht damit rechnete, dem Geschützfeuer eines Verbündeten ausgeliefert zu sein.
Die zivilen französischen Besatzungen der chasse-marées sprangen ins eiskalte Wasser, und die Amerikaner, die ihre Geschütze so wirkungsvoll einsetzten, dass Sharpe es bewundernswert fand, obwohl er nicht applaudieren konnte, schossen Kanonenkugel um Kanonenkugel in die Rümpfe der Frachter. Die Kanoniere zielten tief, um zu zerstören, zu versenken, um Panik hervorzurufen.
Schiffe kollidierten. Der Mast eines chasse-marée brach und fiel in einem Gewirr von Tauen und Stangen ins Wasser. Ein Schiff sank in der brodelnden See, und ein anderes, dessen Ruder weggeschossen worden war, drehte sich und wurde vom Bug eines anderen gerammt.
»Feuer!«, brüllte Bampfylde abermals, diesmal nicht als Befehl, sondern als Alarm. Flammen schlugen aus einem der französischen Schiffe, dann aus einem zweiten, und Sharpe nahm an, dass die Amerikaner Granaten verschossen. Segel brannten plötzlich, zwei weitere Schiffe kollidierten, noch mehr Flammen loderten empor. Dann setzte von der Biskaya her ein gnädiger Regen ein und half, die Flammen zu löschen, wie er half, das amerikanische Schiff in einem Regenschleier zu verbergen.
»Sie werden den Amerikaner nicht erwischen!«, sagte Lieutenant Ford empört.
»Dieser verdammte blinde Kapitän!«, schimpfte Bampfylde.
Der Amerikaner entkam. Er konnte schneller segeln als die Verfolger, und er schüttelte sie ab. Sharpe sah noch einmal kurz die grauen Segel und das Sternenbanner in der Regenwand, dann war das Schiff im Grau nicht mehr zu erkennen.
»Das war Killick!«, stieß der Navy Captain in hilflosem Zorn hervor. »Ich wette, das war Killicks Werk!«
Die Zuschauer, entsetzt über das, was sie gesehen hatten, beobachteten jetzt das Chaos, das sich dem Hafen näherte. Zwei Frachtsegler sanken, drei brannten, und weitere vier waren nach den Kollisionen ineinander verheddert. Von den übrigen zehn Segelschiffen waren fast die Hälfte an der Sandbank auf Grund gelaufen und wurden von der Wucht der vom Wind gepeitschten Flut unausweichlich höhergeschoben. Ein verdammter Amerikaner mit einem kleinen Segelschiff war regelrecht um die Königliche Navy herumgetänzelt und hatte sie verhöhnt, und schlimmer noch, er hatte es vor den Augen der Army getan.
Captain Horace Bampfylde schob das kleine Fernrohr zusammen und steckte es in die Tasche. Er schaute Sharpe an. »Merken Sie sich das«, sagte er. »Merken Sie sich das gut. Ich werde mich an Sie um Vergeltung wenden.«
»An mich?«, fragte Sharpe verwundert.
Er erhielt keine Antwort. Die beiden Navy-Offiziere eilten bereits davon. Zurück blieben ein verwirrter Sharpe und ein Gewirr von Schiffswracks, die auf der grauen Wasseroberfläche auf und ab wogten, auf das Land zu, wo sich die Army am Rand des Feindeslandes zum nächsten Vormarsch sammelte. Die Franzosen wussten, dass der Vormarsch stattfinden würde, aber niemand in Frankreich wusste, ob nach Norden oder Osten, über Brücken oder per Schiff.
KAPITEL 2
Der Mann hatte ein scharf geschnittenes, zerfurchtes, tief gebräuntes Gesicht und wirr abstehendes, dunkelblondes Haar. Das Gesicht war von Wind und Wetter gegerbt, narbig von Messerwunden und gezeichnet von brennendem Pulver, doch es war ein gut aussehendes Gesicht, bei dem die Frauen zweimal hinblickten. Es war ein Gesicht, über dessen Anblick sich Major Pierre Ducos ärgerte, weil er große, selbstsichere, gut aussehende Männer hasste.
»Alles, was Sie mir sagen können, wird von größtem Nutzen sein«, sagte Ducos mit erzwungener Höflichkeit.
»Ich kann Ihnen sagen«, antwortete Cornelius Killick, »dass eine britische Brigg ihre Toten begräbt und dass die Bastarde fast vierzig chasse-marées im Hafen haben.«
»Fast vierzig?«
»Es ist schwierig, genau zu zählen, wenn man mit seinen Kanonen feuert, Major.« Der Amerikaner, dem Ducos unheimliche Macht gleichgültig war, lehnte sich über den Malachittisch und zündete eine Zigarre an einer Kerzenflamme an. »Wollen Sie sich nicht bei mir bedanken?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!