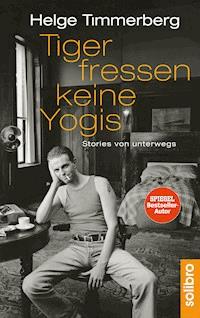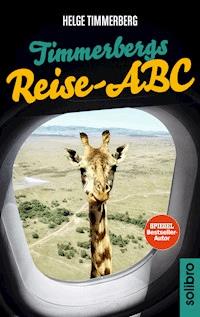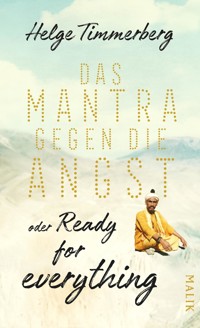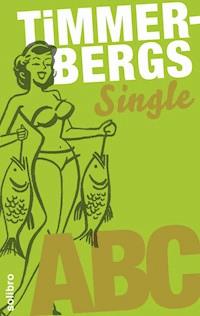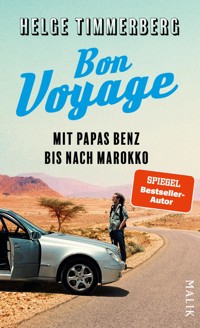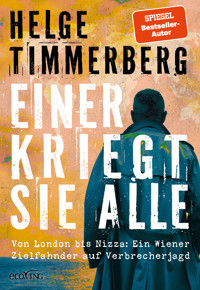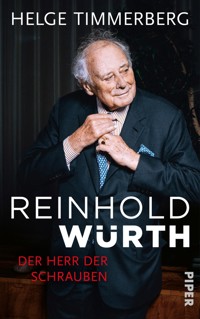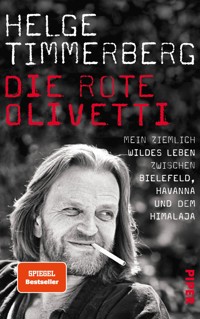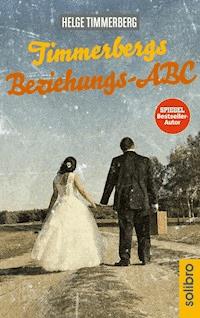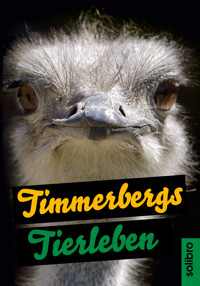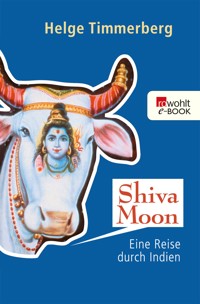
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Ganges ist Indiens Schicksalsstrom – heiliger Fluss und Lebenselixier. Helge Timmerberg ist ihm gefolgt, von der Quelle im Himalaya bis zum Delta am Indischen Ozean. Er durchstreift Rishikesh, die Stadt, in die die Beatles pilgerten und wo Autos, Alkohol und Fleisch verboten sind, trifft Sadhus, Bettelmönche, und zwei wahnsinnig schöne Geistheilerinnen. Er besucht das sechstausend Jahre alte Varanasi, die heiligste Stadt der Hindus und die Metropole der Astrologie – Madonna, so heißt es, lässt sich dort regelmäßig die Sterne deuten. Sein Weg führt ihn in die Slums von Kalkutta, das «Haus der Toten» und das schönste Kaffeehaus der Welt. Mit großer Kraft und feinem Humor erzählt Helge Timmerberg von einer Reise, die seinen Blick auf sich und die Welt verändert hat, von ewiger Pilgerschaft und dem Verlust des Glaubens, von Haschischentzug und der Suche nach Klarheit: Es geht um Shiva Moon, den Mond der Zerstörung, und es geht um die Liebesgeschichte zwischen Timmerberg und Indien – dem Land, das er wieder und wieder bereist hat, seit mehr als drei Jahrzehnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Helge Timmerberg
Shiva Moon
Eine Reise durch Indien
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Die Maus wohnt im Wasserfilter
2. Scarlets Yogalehrer
3. Böse Tomaten
4. Wenn hundert Inder schnarchen
5. Endlich Haschisch
6. Die Ehre der Bettler I
7. Die wahnsinnig schönen Geistheilerinnen
8. Jesus, Hannibal, Gaddafi und ich
9. Scarlets Zaubersatz
10. Keine Götter, keine Träume, keine Märchen
11. Die Ehre der Bettler II
12. Big Mother Ganga
13. Sechshundert Mahatma Gandhis
[LovelyBooks Stream]
Für meine Mutter,
die noch nie in Indien war
1.Die Maus wohnt im Wasserfilter
Es gibt drei Möglichkeiten, in New Delhi anzukommen: die spottbillige, die superteure und das «La Sagrita». Ich habe alle drei Hotels schon ausprobiert. Jedes hat seine Schwächen. Das spottbillige in der Bahnhofsgegend kostet fünf Dollar die Nacht, und das Zimmer hat einen kleinen Balkon zur Straße, auf der Leute schlafen und Hunde bellen und Katzen streunen. Es ist nicht sauber, aber das Personal ist lieb, und sie organisieren warmes Bier, egal, wann du kommst. Das ist der Haken beim Landen in Delhi. Es ist immer nach Mitternacht, weit nach Mitternacht, aber noch nicht nah genug am Morgen, du landest in einer schlafenden Stadt, das Taxi fährt durch Geisterstraßen. Nur du kannst nicht pennen. Jetlag in einem Loch mit warmem Bier und hoffentlich noch ausreichend Zigaretten, nein, es stehen ein paar widerliche Stunden bevor, wenn man in einem der billigen Hotels am Bahnhof eincheckt. Widerlich im Sinne von widerlichen Gedanken. «Mein Gott, was willst du hier? Was hast du aus deinem Leben gemacht, dass du noch immer auf diesem Niveau reist?» Als Siebzehnjähriger schmeckt das abenteuerlich, mit fünfzig ist es schwer deprimierend.
Die zweite Möglichkeit, in New Delhi anzukommen, ist das «Imperial». Das schönste Hotel der Welt, eine Mischung aus Mogul und Kolonial, Maharadscha und Offizier, Turban und Krone, Schönheit und Macht. Mein letztes Gespräch am Mahagonitresen der Rezeption verlief so:
«How much is the room?»
«Single or double, Sir?»
«Single.»
«Two hundred and eighty US only, Sir.»
Das «only» war nicht ironisch gemeint, das sagen sie immer, nach jedem Preis. Alles in Indien kostet irgendwas «only», außerdem sind zweihundertachtzig Dollar für ein Hotel wie das «Imperial» im internationalen Vergleich tatsächlich «only», aber für mich war das die Hälfte meiner Miete zu Haus. Und für den Jungen an der Rezeption war es ein Monatsgehalt. «Okay», sagte er. «Two hundred US, Sir, last price.»
Ich fragte ihn, ob die Bar noch geöffnet habe, denn ich müsse mich betrinken, um diesen Preis zu akzeptieren, und nachdem ich drei Gin Tonic intus hatte, war ich wieder bei ihm.
«Now you are ready, Sir?»
Er war mir sympathisch. Ich checkte in ein großes Zimmer ein, das wie ein Museum für Agatha Christies Reisen möbliert war, und sogar der Flaschenöffner war da. Kennen Sie das, wenn in den Fünfsternehotels der Flaschenöffner fehlt? Nein, er war da.
Die problematische Seite des «Imperial» ist nicht nur der Preis für das Zimmer, es sind die Folgekosten, die einem auf die Nerven gehen. Selbst die Marlboros sind in dem Tabakshop des Hotels fünfundzwanzig Rupien teurer als überall sonst auf dem Subkontinent. Und praktisch jeder will Trinkgeld. Damit wir uns nicht missverstehen: Ich liebe es, Trinkgeld zu geben, aber nicht so häufig, wie ich ein- und ausatmen muss. Und nicht für nichts. Dass einer seinen Schnurrbart bis zu den Ohren zwirbeln kann, ohne dabei den Turban zu verlieren, ist für mich noch kein Trinkgeld wert.
Das «La Sagrita», die dritte Möglichkeit, in Delhi anzukommen, begrenzt die Anzahl der zu tippenden Mitarbeiter auf maximal vier Personen, die Preise sind fair (fünfzig bis siebzig Dollar), in direkter Nachbarschaft finden sich kleine Parks und hübsche Villen, das Ganze nennt sich Sunder Nagar und ist New Delhis beste Kolonie. Das städtebauliche Konzept von Kolonien ist einfach. Es gibt eine große Mauer, es gibt Tore mit Wachen, dahinter wohnt die gehobene Mittelklasse in ruhigen Straßen. Die griechische Botschaft, die Asien-Redaktion der ARD, solche Nachbarn hat das «La Sagrita». Und es hat einen großen Garten und grundsätzlich angenehme Gäste, aber leider hat es wenig Zimmer. Und ist immer ausgebucht. Immer. Außerdem sollte man sich an die Ankunftszeiten interkontinentaler Flüge in Delhi erinnern. Plus die Stunde, die man braucht, um das «La Sagrita» zu erreichen. Als ich das letzte Mal dort war, fand ich den Mann an der Rezeption in tiefem Schlaf. Ich riss ihn da heraus. Der schnellste Weg, wieder einzuschlafen, war, mich abzuweisen. Mich einzuchecken hätte zehnmal so lange gedauert, zwanzigmal so lange, wenn ich ehrlich bin.
«Sorry, Sir, fully booked» hatte für seine Ohren einen beruhigenden Klang. Für meine Ohren nicht. Niemand will das hören nach einem Zehnstundenflug und mitten in der Nacht, und als er mich fragte, warum ich nicht reserviert hätte, sagte ich: «Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch.» Die Antwort ist: Jeder hat eine Macke. Selbst Gandhi hatte eine. Und meine Macke ist, ich kann nicht reservieren. Weil ich keine Kreditkarte habe. Haha, sag mal an der Rezeption, egal wo in der Welt, dass du keine Kreditkarte besitzt. Nicht weil du arm bist, sondern weil du mal eine Bank betrogen hast. Genauso könntest du einem hübschen Mädchen sagen, du hättest zwar Aids, Mundgeruch und paranoide Phantasien, aber wärst ansonsten ein recht häuslicher Typ. «Sorry, Sir, fully booked.»
Ganesha nahte, der Elefantengott, er ist der Schutzpatron der Diebe, Dichter und Händler, deshalb trage ich ihn als Amulett. Er ist aber auch der «Hüter der Schwelle» und der «Überwinder aller Schwierigkeiten», und gerade in der letzten Funktion war er hier gefragt. Ich knöpfte mein Hemd ein bisschen auf, und als der Mann Ganesha sah, kam er sofort hinter dem Tresen hervor, trat auf mich zu und küsste ihn. Erst dann fiel mir auf, dass im Foyer eine mannshohe Ganesha-Statue stand. Der Gott erfreut sich großer Beliebtheit in Indien. Er ist klein, dick, und er hat einen Elefantenkopf. Eine Ratte begleitet ihn. Als «Überwinder aller Schwierigkeiten» arbeitet er folgendermaßen: Entweder er spießt die Hindernisse mit seinen Stoßzähnen auf, oder er drückt sie mit seinem breiten Elefantenschädel zur Seite, oder er schickt seine Ratte los, um Schlupflöcher zu suchen. Ergebnis so oder so: Ich bekam das beste Zimmer. Es war fast so groß wie die Zimmer im «Imperial», aber es hatte eine Dachterrasse mit Blick auf den Mond.
Für welche der drei Möglichkeiten, in Indien anzukommen, werde ich mich dieses Mal entscheiden? Ich weiß es während der Landung noch immer nicht. Jede der drei hat ihre Tücken, ich sagte es bereits. Die Nummer mit Ganesha muss nicht klappen, das «Imperial» bereue ich spätestens beim Auschecken (außerdem verdirbt es einen für alles, was noch kommt), und im Bahnhofsviertel wird bald eine Bombe hochgehen, aber das weiß ich bei der Landung noch nicht. Nein, ich kann mich nicht entscheiden, während ich am Gepäckband stehe, und als ich auf den Schalter für «Prepaid-Taxi» zugehe, kann ich es immer noch nicht. Es gibt eine vierte Möglichkeit, denke ich. Kollegen. Scarlet hat mich x-mal eingeladen, bei ihr zu wohnen, wenn ich in der Stadt bin. Sie wäre sogar beleidigt, wenn ich es nicht tue, und sie wäre es zu Recht. Aber sie hat einen grässlichen, geilen Hund namens Krishna (Gott der Liebe), der Sex mit meinen Beinen haben wollte. Beim letzten Mal.
Ich glaube, es wird deutlich, dass ich öfter in Indien bin. Es ist meine zweite Heimat. Aber nicht eine, die auf die erste folgt, sondern eine für zwischendurch, eine für immer wieder, seit meinem siebzehnten Lebensjahr. Zweimal kam ich über Land, die anderen hundert Mal mit dem Flieger. Und immer Delhi. Da lernt man eben das eine oder andere Mitglied des «Foreign Correspondents’ Club» kennen. Zwei insgesamt. Der eine ist ein amerikanischer Fernsehjournalist, der in Indien seinen Frieden gefunden hat, die andere ist Scarlet. Von dem Amerikaner weiß ich, dass er zurzeit nicht in Delhi ist, sondern beim Dalai Lama in Dharamsala, weil er seinen Frieden inzwischen wieder verloren hat. So ist das Leben. Nichts hat Bestand. Sein Garten war ein kleiner exotischer Platz mit lauschigen Bänken, seine Frau war wunderschön, er hatte immer Haschisch und fast immer fabelhafte Gäste. Ach, Patrick, warum musste das geschehen? Warum musstest du deine Frau verlieren, an einen Australier, der auf Koh Samui lebte, wo sie nach einer Party ertrank? Mohani hatte schon immer Angst vor dem Wasser, jetzt ruht sie auf dem Grund des Pazifischen Ozeans, und du lungerst bei den Lamas rum und versuchst, ihre Schönheit zu vergessen, ihre Gutmütigkeit, ihr Lachen. Sie war eine Lichtgestalt mit pechschwarzen, hüftlangen Locken. Es ist manchmal aber wirklich zum Kotzen.
«Nizamuddin», sage ich, als ich an dem «Prepaid-Taxi»-Schalter stehe. Die Sache mit den Prepaid-Taxis ist folgendermaßen: Als es noch die freien Taxis gab, die man sich vor dem Indira Gandhi Airport selbst besorgte oder besorgen ließ, verschwanden immer mal wieder Touristen, kurz nachdem sie gelandet waren, spurlos. Um das zu beenden, wurde ein Schalter im Flughafengebäude eröffnet, an dem man ein Taxi zugewiesen bekommt. Sie haben deinen Namen, sie kennen dein Ziel, und sie wissen, wer dich fährt.
«Nizamuddin Station, Sir?»
«No, Nizamuddin East.»
«Five hundred rupees only, Sir.»
Die freien Taxis haben nur die Hälfte gekostet, aber was ist schon Geld gegen das relative Gefühl von Sicherheit?
Ich habe mich also für Scarlet entschieden. Eine ihrer vielen guten Seiten ist, dass man sie nach sieben Jahren nachts um vier unangemeldet besuchen kann, ohne dass sie dabei sonderlich die Fassung verliert. Sie umarmt mich, sie sagt «unglaublich», sie fragt, ob ich einen Tee will, sie zeigt mir das Gästezimmer und erzählt mir kurz das Wesentliche. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, ihr Verleger überweist kein Geld, und es gibt Ärger mit ihrem Pressevisum. Wenigstens bei ihr ist alles beim Alten geblieben.
Scarlets Mutter war das schönste Mädchen von Sri Lanka, Scarlets Vater war der hässlichste in Asien tätige britische Anwalt, der vorstellbar ist, durch die Güte der Gene haben ihr beide nur das Beste von sich geschenkt. Kindheit in Ceylon, Schule in London, mit achtzehn reiste sie über Land nach Indien, und bevor sie sich entschloss, Journalistin zu werden, hat sie sich in verschiedenen Berufen (Drogenschmuggel, Nachtclubtätigkeiten) bewährt. Als ich sie kennen lernte, war Scarlet Asienkorrespondentin des «Daily Telegraph». Am liebsten machte sie Afghanistan-Reportagen. Den Tapferkeitsorden des «Foreign Correspondents’ Club of South Asia, New Delhi» erwarb sie sich, indem sie einen Taliban-Offizier ohrfeigte, der ihr blöd gekommen war. Vor versammelter Mannschaft. Dass sie danach nicht erschossen, gesteinigt, zu Tode gepeitscht oder sonst wie exekutiert wurde, lag an der Selbstverständlichkeit, mit der sie die Ohrfeige gegeben hatte. Oder an der Unmissverständlichkeit. Das war nicht Frau gegen Mann oder Ungläubige gegen Moslem, das war blütenreiner, in die Wiege gelegter und natürlich gelebter Kolonialismus. Sorry, Herr Taliban und Ex-Eseltreiber, aber wer nicht hören will, muss fühlen, oder? Inzwischen ist Scarlet Romanautorin geworden. Sie will mir morgen davon mehr erzählen. O Gott, ich hätte es wissen müssen. Privat nach einem Interkontinentalflug abzusteigen hat seine ganz eigenen Tücken.
Scarlets Gästezimmer ist ideal, fast verträumt, märchenhaft. Das erhöhte Bett hat vier Pfosten mit einem Himmel und erinnert an Tausendundeine Nacht. Draußen heulen Hunde. Ich kann nicht einschlafen, und um auf andere Gedanken zu kommen, könnte ich onanieren, lesen oder meditieren. Ich entscheide mich für den Weg der Mitte, also lesen. Der Weg der Mitte. Mit ihm konnte ich erst ab fünfzig was anfangen. Inzwischen bin ich dreiundfünfzig und habe Übung darin. Der Weg der Mitte ist der Weg der kontrollierten Langeweile.
Ich lese einen Roman von Tom Wolfe. Lieber würde ich jetzt einen Roman von Kipling lesen, «Kim» zum Beispiel, oder einen Roman wie den «Palast der Winde» oder «Das indische Grabmal», denn ich bin in Indien, im geheimnisvollen, magischen Indien. Aber nein, Tom Wolfe. «Die Zeit» will eine Rezension von mir. In Indien Tom Wolfe zu lesen ist, wie in einer Kantine der New Yorker Börse Sanskrit zu studieren. Es funktioniert, weil Yin und Yang funktioniert. Die ewige Beziehungskiste der Pole. Fabelhafter Satz. Ich komme in Form. Ob Scarlet Bier in der Küche hat? Sie hat. Und sie hat eine Maus. Ich überrasche den Nager zwischen Kühlschrank und Herd. Die Maus gibt Gas und verschwindet (ich glaub es nicht) im Wasserfilter. Die Maus wohnt im Wasserfilter. Na dann gute Nacht.
Kein Ausländer und kein Inder ab Mittelschicht aufwärts trinkt in New Delhi das Wasser so, wie es aus dem Hahn kommt. Tut er es doch, wird er die nächsten fünf bis sieben Tage, wenn er Pech hat, auch die nächsten zwei Wochen alles, was er in sich hat, von sich geben, oben wie unten. Diese Krankheit wird Delhi-Belly genannt. Streng genommen ist es keine Krankheit, sondern eine Umstellung des Immunsystems. Es wird einer anderen Welt von Bakterien angepasst. Und wer sich nicht anpassen will, muss von morgens bis abends hellwach sein. Salat wird mit diesem Wasser gewaschen, Früchte werden mit diesem Wasser gewaschen, das Eis im Whiskey ist aus diesem Wasser gefroren, und bei den Mineralwasserflaschen musst du aufpassen, dass der Drehverschluss unversehrt ist, sonst ist auch da diese Kloake drin, die in New Delhi aus dem Hahn kommt. Also Wasserfilter. Sie fallen nicht auf, weil sie so unauffällig sind. Ein kleiner, schlanker Behälter, an die Küchenwand geschraubt, nimmt das Wasser direkt von der Leitung auf und gibt es gefiltert an die Hähne von Scarlets Spülbecken weiter. In diesem kleinen, schlanken Behälter wohnt die Maus.
«Das glaube ich nicht», sagt Scarlet, als ich ihr beim Frühstück davon berichte. «Da würde sie ja ertrinken.»
«Wenn sie den Kopf hoch genug hält, vielleicht nicht.»
«Die wohnt nicht im Wasserfilter, Helge.»
«Die wohnt nicht im Wasserfilter! Die wohnt nicht im Wasserfilter! Ich habe sie ja nur darin verschwinden sehen. Und sie kam nicht wieder raus. Jedenfalls nicht, solange ich in der Küche war. Okay, vielleicht hat sie sich im Wasserfilter auch nur versteckt. Und vielleicht zum ersten Mal. Und ist daran jetzt verreckt.»
Da stehen unsere Gläser mit dem gefilterten Wasser. Meins habe ich nicht angerührt, ihres ist halb leer. Scarlet ist kurz irritiert, aber dann siegt die Afghanistan-Kämpferin. Sie trinkt noch einen Schluck und wechselt das Thema. Meine Pläne? Was ich in Indien will? – Wahrscheinlich dasselbe wie immer. – Aha. Und was noch?– Ein Buch schreiben. – Aha. Worüber? – Den Ganges. Von der Quelle bis zur Mündung. Scarlet sieht mich so belustigt an, wie das nur eine Lady aus der englischen Oberschicht kann. «Also non-fiction», sagt sie. «Ja», sage ich, «non-fiction, und ich weiß, du hast gerade einen Roman geschrieben. Und ich weiß, beim Roman fängt das Schreiben erst an. Und ich weiß auch, dass dir jetzt das Frühstück wieder besser schmeckt, Scarlet. Und im Übrigen hast du es hier richtig nett.»
Das Frühstück findet auf der Terrasse statt, die groß genug ist, um drei bequemen Stühlen, einem Tisch, mehreren tropischen Topfpflanzen und dem Bewegungstrieb eines Hundes Platz zu bieten, eines Hundes, der sich gebessert hat. Krishna ist zwar noch immer ein geiler indischer Straßenköter, aber er hat offensichtlich die eigene Art als Sexualpartner entdeckt. Er steht aufgerichtet am Geländer der Terrasse und hechelt zum Park rüber, in dem seine Freundin gerade Auslauf hat. Park ist eigentlich zu viel gesagt. Und Garten wäre zu wenig. Ein eingezäunter Minipark, eine liebevoll bepflanzte Grünfläche für die Bewohner der umliegenden Häuser. Villen. Residenzen. Hier haben Briten während der Blüte ihres Imperiums gebaut, und die Neubauten dazwischen haben sich dem Stil angepasst. Umrahmt wird die Idylle von einer Mauer, die zur Zeit der Mogul-Herrschaft errichtet worden ist. Alte Steine, schönes Licht, teure Autos, wie halt ein guter Tag beginnt. Außer um mit Scarlet zu quatschen, sollte ich ihn dafür nutzen, mir ein Zugticket und warme Kleidung zu besorgen. Ich muss in den Himalaya. Und zwar ziemlich hoch rauf. «Die Quelle liegt auf viertausend Meter», sagt Scarlet. Sie hat im «Lonely Planet» nachgeschaut. «Und ich fürchte, du musst dich beeilen. Das ist der Nachteil von non-fiction, Sweetheart». (sie klappt den Reiseführer wieder zu), «sie schließen demnächst die Pässe. Und hast du eigentlich mitbekommen, dass Tiziano letztes Jahr gestorben ist?»
Jetzt bin ich ein bisschen von den Socken. Tiziano Terzani, der Ex-Reporter-Star des «Spiegel». Ich habe mal auf einer Party des «Foreign Correspondents’ Club» mit ihm gekifft. Er sagte damals, er habe früher nie gekifft. Erst als sein Sohn zu kiffen aufgehört habe, habe er damit angefangen. Was ist nur mit meinem Indien los? Es stirbt rechts und links.
«Krebs», sagt Scarlet.
«Lungenkrebs?»
«Wahrscheinlich.»
Wieder Flashback zur Party. Tiziano hat mich gefragt, wie viele Zigaretten pro Tag ich rauche. Als ich es ihm sagte, hat er so komisch geguckt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt den Krebs besiegt. Das war vor fünf Jahren. «Hast du sein Buch gelesen?», fragt Scarlet. «Nein, aber er hat mir die Geschichte erzählt.» «Fliegen ohne Flügel» geht auf eine Prophezeiung zurück. Ein Wahrsager wies ihn 1976 darauf hin, dass er 1993 bei einem Flugzeugunglück sterben werde, falls er 1993 mit einem Flugzeug flöge. Tiziano nahm deshalb in diesem Jahr keine Geschichten an, für die er hätte fliegen müssen. Er fuhr entweder mit dem Auto, mit dem Schiff oder mit der Bahn. Anders ging es nun mal nicht. «Der Spiegel» machte da mit, weil der Mann brillant war und alle an die Wand schrieb. 1993 passierte in Asien irgendein Scheiß. Man fragte Tiziano, der in Bangkok weilte, ob er da hinfahren kann, aber Tiziano sagte, bis er mit dem Zug sein Ziel erreicht, ist der Scheiß wieder vorbei. Also schickten sie einen anderen hin. Die Maschine, mit der er unterwegs war, stürzte ab. Und was mich an diesem Tatbestand jetzt so kirre macht, ist Folgendes: Ich habe mal einen Astrologieprofessor in Varanasi gefragt, ob die Astrologie den Zeitpunkt und den Ort des Todes exakt berechnen kann, und er hat ja gesagt, das geht. Dann habe ich ihn gefragt, ob man mit dem Wissen um diese Voraussage den Tod umgehen kann, und er hat nein gesagt, das geht nicht. Aber wenn mir prophezeit wird, dass ich dann und dann in Varanasi sterben werde und deshalb nie mehr nach Varanasi reise, was ist dann? Dann wird es Gründe geben, dass du nach Varanasi zurückkommen MUSST, hat der Astrologieprofessor daraufhin gesagt. Beweist Tizianos Geschichte, dass der Professor irrt, oder bestätigt sie ihn? Tiziano hat das Jahr 1993 überlebt. Aber danach hat er Krebs gekriegt. Das war das eine, was mich flippte. Das andere: Ist das langsame Sterben nicht härter als das schnelle? Weil man weiß, dass man sterben wird, und weil man ab jetzt nur noch verliert? Und weil man im Kopf tausendmal stirbt, bevor es wirklich passiert? Und müssen wir nicht irgendwann alle sterben? Irgendwann, das ist ein merkwürdiges Wort. Es suggeriert noch jede Menge Zeit. Warum, ist mir schleierhaft, denn «irgendwann» legt sich in keiner Weise fest. Irgendwann kann irgendwann sein, aber irgendwann ist auch gleich, also sofort nach jetzt.
2.Scarlets Yogalehrer
Gegen Mittag kommt Scarlets Yogalehrer. Er ist schlank und drahtig, hat einen silbergrauen, kurz gestutzten Vollbart, auch seine Haare sind silbergrau. Eine gepflegte silberne indische Erscheinung um die vierzig. Sie machen ihre Übungen auf dem Teppich im Salon.
Yoga ist nichts Statisches. Nichts Totes. Innerhalb der letzten sechstausend Jahre hat es jeder Yogameister mit seiner persönlichen Note bereichert. Das Verdienst dieses Meisters scheint darin zu bestehen, dass er das Yoga von der Zeitlupe befreit. Das geht alles ziemlich zack, zack bei ihm, und er unterhält sich dabei mit Scarlet über eigentlich jedes vorstellbare Thema, nur nicht, zum Beispiel, übers Atmen. Darauf angesprochen, reagiert er, wie Miles Davis auf die Frage reagiert hätte, warum er keine Volksmusik spielt. Auch das fällt auf an diesem Yogalehrer. Er überzieht jede Geste. Er ist theatralisch.
«Ach, das Yoga der Veden», sagt er und wirft dabei ein Bein um seinen Hals. «Für diesen Scheiß müssen Sie nach Rishikesh fahren.»
«Genau das habe ich vor. Aber erst muss ich noch nach Gangotri.»
«Sie wollen an die Quelle des Ganges?» Scarlets Yogalehrer nimmt fast erschrocken das Bein wieder runter. «Da ist es aber jetzt scheißkalt.»
Der Mann ist goldrichtig. Nachher sitzen wir auf Scarlets Terrasse, und ich erfahre mehr über ihn. Er ist staatlich geprüfter und autorisierter Yogalehrer, seine Schüler sind in- und ausländische Journalisten, Botschaftsangehörige, wie zum Beispiel der Botschafter von Schweden, Politiker, Schriftsteller, Manager, zwanzig Schüler insgesamt, keine Klasse. Nur Hausbesuche. Als Scarlet ihn fragt, ob er auch eine Bollywood-Schönheit oder ein Model in seinem Kreis habe, schaut er ein bisschen nach rechts oben in einer Weise, die nur ein schwuler indischer Yogalehrer draufhat, dem man langweilige heterosexuelle Absichten unterstellt. Er wendet sich zu mir und fragt nach meinen Reiseplänen. Wann soll es losgehen? Und wann schließen eigentlich die Pässe? «In einer Woche», antwortet Scarlet für mich. «Und er braucht fünf Stunden mit dem Zug und dann nochmal fünfzehn Stunden mit dem Taxi, bis er da ist.»
«Plus drei Tage zu Fuß.» Das bin ausnahmsweise mal ich.
Scarlets Yogalehrer bietet mir an, mich zum Bahnhof zu begleiten, um mir beim Kauf der Zugkarte zu helfen. Wir nehmen eine Motorrikscha. Das ist ein Kraftfahrzeug mit drei Rädern. Vorne eins, hinten zwei. Der Fahrer lenkt es wie ein Motorrad, auf der Rückbank ist bequem Platz für zwei, es passt aber auch eine komplette indische Großfamilie rein, und dazu ein an den Pfoten zusammengebundenes Hängebauchschwein. Die Motorrikschas kosten nur halb so viel wie ein Taxi. Das ist ihr Vorteil. Ihr Nachteil: Bei einem Unfall hat man keine Chance. Entweder es schmeißt einen raus, oder man knallt gegen die Metallstangen, die rechts und links und über einem sind. So sind Rikschas gebaut. Überall Stangen. Der andere Nachteil: Man sitzt an der frischen Luft. Es stimmt zwar, dass sie die Luftverschmutzung in New Delhi durch konsequente Umstellung aller öffentlichen Busse, Taxis und Rikschas auf Gasmotoren wieder so weit vermindert haben, dass eine offene Fahrt von Nizamuddin bis zum Hauptbahnhof nicht mehr dem Genuss von tausend Zigaretten gleichkommt, sondern nur noch dem Genuss der Hälfte, aber fünfhundert Zigaretten in dreißig Minuten sind eigentlich auch noch zu viel.
Und der Fahrstil der Inder wird sich nie ändern. Es ist im Grunde kein Stil, sondern ähnlich wie bei den Bakterien eine gänzlich andere Welt. Aber eine, an die man sein Immunsystem nicht anpassen kann. Man kann nur wegsehen. Oder sich suggerieren, man säße im Kino. Animationsfilm. Die rasantesten Fastunfälle. Das Geheimnis des indischen Straßenverkehrs ist neurologischer Natur: Er fließt anders, weil die Gehirnströme der Inder anders fließen, a) in anderen Bahnen und b) in anderen Rhythmen. Wie soll man das erklären? Sie sind wie tief fliegende Schwalben, von denen man auch glaubt, sie würden jeden Moment miteinander kollidieren. Die dritte Möglichkeit, während einer Motorrikscha-Fahrt nicht permanent (und unnötig) Adrenalin auszuschütten, besteht darin, ab und an einen Blick auf den Fahrer zu werfen. Ist er entspannt, wird schon nichts passieren. In diesem Fall sehe ich im Rückspiegel, dass der Mann sehr entspannt ist, möglicherweise zu entspannt. Er fährt mit geschlossenen Augen. «Unser Fahrer schläft», sage ich, und Scarlets Yogalehrer flippt völlig aus.
Thema Zugkarte: Man kann in Indien nicht einfach in den Zug steigen und da das Ticket kaufen. Das geht überhaupt nicht. Man kann aber auch nicht zum Bahnhof gehen, das Ticket erstehen, noch einen Kaffee trinken und eine rauchen und dann den Zug nehmen. Man muss auf jeden Fall und mindestens einen Tag vor Reiseantritt einen Platz reservieren. Man kann aber in Indien nicht einfach an den Schalter treten und einen Platz reservieren. Die Inder haben von den Engländern drei Dinge übernommen, behalten und bis ins Absurde gepflegt: die Angst vor der Sexualität, die Eisenbahn und die Bürokratie. Um eine Fahrkarte zu kaufen, muss man ein Formular ausfüllen, das mal ein Visumantrag werden will, wenn es groß ist. Die Frage nach Vor- und Familienname des Reisenden hat ja noch Sinn, aber was wollen sie mit dem Namen des Vaters (!) und mit der Nummer des Passes und mit dessen Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer? Weil in Indien Züge auch gern mal mit einem halben Jahr Verspätung ankommen und dann das Visum abgelaufen ist? Sicher nicht. Es hat keine praktischen Gründe. Die Hingabe der Inder an die Bürokratie ist religiöser Natur. Ich kann es nicht genauer erklären. Es ist nur so ein Gefühl.
In der Reservierungshalle für Ausländer, in die mich Scarlets Yogalehrer führt, sind gut vierzig Sofas in zwei Hufeisenformationen zusammengerückt. Auf ihnen sitzen etwa hundertfünfzig Rucksacktouristen. Neuankömmlinge nehmen jeweils links außen Platz, um nach rechts außen durchzurutschen. Das Ende der Reise sind die Schalter, hinter denen die Mitarbeiter der indischen Eisenbahn die Reservierungsformulare prüfen. Weil sie das gründlich machen, gehört das «International Reservation Office» im Hauptbahnhof von New Delhi ohne Zweifel zu den glücklichen Oasen des Buchmarkts. Gelesen wird hauptsächlich Englisch, Japanisch und Hebräisch sowie alle romanischen Sprachen. Wie gern hätte ich jetzt nicht meinen Tom Wolfe vergessen. Wie hätte er diese Rucksacktouristen beschrieben?
Die israelischen Frauen erkennt man an ihrer Schönheit und ihrem militärischen Gang, die israelischen Männer sehen allesamt wie Helden aus Bibelverfilmungen aus, denn sie haben seit ihrem Abschied von der Armee weder Haupt- noch Barthaar geschoren, und die Klamotten, die sie tragen, die trägt man halt seit dreitausend Jahren, wenn das Klima mitspielt. Die Amerikaner haben sich durch die Bank für Globetrotter-Vieltaschen-Hosen und vernünftige Hemden entschieden, die Japaner erkennt man daran, dass sie Japaner sind, und dann gibt es noch die Fraktion, die sich wie Inder kleidet. Vornehmlich heilige Inder. In zwei Varianten: der weiße Heilige mit wallendem Gewand oder der wilde Heilige. Letzterer geht halb nackt, und seine Frisur ist eine perfekte Mischung aus Rastafari und Shivaismus. Beide Religionen eint die Vergötterung des Haschisch und die Verteufelung des Kamms. Ansonsten haben sie wenig miteinander zu tun. Und es sind in der Regel die Rucksacktouristen aus Südeuropa, die so zum Bahnhof gehen.
Mache ich mich über junge, unschuldige Menschen lustig? Ich würde sagen: nein. Ich versuche nur, mich damit ein bisschen zu therapieren. Ich hatte einen kleinen Schock bekommen, als ich das «International Reservation Office» betrat. So habe ich auch mal ausgesehen. Und wenn man nicht ganz genau hinschaut, sehe ich immer noch so aus. Onkel Helge ist zurück. Overland forever.
Nach all den Jahren des erwachsenen Reisens rutsche ich wieder demütig und vom Leben kleingekriegt von Zeit zu Zeit ein Plätzchen weiter, und als ich den Flügel der Sitzmöbel-Hufeisen-Formation verlasse, um auf die Gerade einzubiegen, stelle ich Scarlets Yogalehrer die Frage, ob er mir inzwischen ein paar Atemtechniken gegen die Kälte, die in viertausend Meter Höhe herrscht, beibringen kann. Denn meine Angst ist ja nicht, dass die Pässe schon zu sind. Mein Horror ist, sie sind noch offen. Scarlets Yogalehrer sagt, er könne mir durchaus Techniken zum Entfachen der inneren Hitze vermitteln, aber er hält es für realistischer, mir die Geschäfte zu zeigen, in denen es warme Kleidung zu kaufen gibt.
«Mindestens zwei Pullover, besser drei, dazu eine gefütterte Jacke. Und Sie brauchen Unterwäsche mit langen Armen und langen Beinen, und davon müssen Sie minimum zwei Garnituren übereinander tragen, außerdem brauchen Sie eine Mütze und einen Schal.»
«Und ich brauche etwas, von dem ich nicht weiß, wie es auf Englisch heißt. Auf Deutsch heißt es Wärmflasche.»
«Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen.»
«Sicher?»
«Ich glaube, Sie meinen Handschuhe.»
«Nein, ich meine Wärmflasche.»
Nachdem wir den Platz im Zug reserviert haben, kaufen wir all diese Dinge in einem Fachgeschäft für Bergsteigerausrüstung namens «United Colors of Benetton». Sie haben alles, bis auf die Wärmflasche, und weil er mir wirklich sehr geholfen hat, lade ich Scarlets Yogalehrer ins «United Coffee House» zum Essen ein.