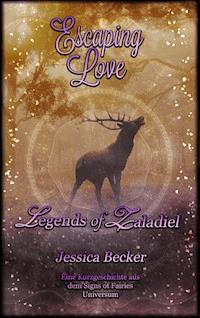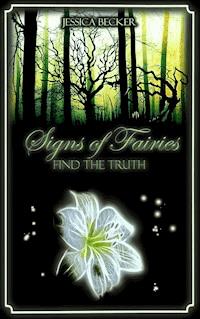
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Signs of Fairies
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Nach einem Schicksalsschlag macht Amelia eine Menge durch. Sie muss zu ihrem Vater nach Broken Village ziehen und dabei ihren besten Freund zurücklassen. Nicht nur, dass sie in eine völlig fremde Stadt zieht, wird ihr bald ein Geheimnis offenbart, welches ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Sie findet zwar schnell neue Freunde, doch Amelia wird das Gefühl nicht los, dass diese sie besser kennen als sie sollten. Und als würde sie ihre Energie nicht schon für diese Situation benötigen, bringt der ebenso neue Schüler Blue das Fass zum Überlaufen und wirft mit seiner bloßen Existenz mehr Fragen auf, als Amelia sich stellen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
~Dieses Buch ist für alle, die noch nicht wissen wo
ihr Platz auf der Welt ist und die noch ihren
eigenen Weg gehen müssen. Aber verliert nicht den
Mut, auch ihr werdet euer Schicksal bald finden. ~
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Prolog
~New York 23.03.2012
»Amelia, wach auf. Du kommst sonst noch zu spät zur Schule.« Sanft drang die Stimme von Mom in meine Ohren und riss mich aus dem Schlaf. Müde rieb ich mir die Augen und setzte mich aufrecht in meinem Bett hin. Während ich versuchte wach zu werden, nagten an mir wieder kleine, düstere Gedanken. Schon seit meiner Kindheit war meine Intuition ungewöhnlich gut ausgeprägt. Als ich mich an diesem Morgen für den Tag fertig machte, war da wieder ein dunkles Gefühl in mir, das mich vor einer wichtigen Sache warnte. Bisher hatte ich diese Zeichen immer wieder ignoriert, denn selbst Mom meinte, ich solle da nicht so viel hineininterpretieren, doch diesmal war es anders als die letzten Male. Etwas Schreckliches würde bald passieren und mein Instinkt sagte mir, ich sollte besser nicht das Haus verlassen.
Allerdings interessierte sich mein Alltag herzlich wenig dafür, also machte ich mich auf den Weg in die Küche. Mama begrüßte mich wie immer mit einem Kuss auf die Wange, dabei stellte sie mir mein Frühstück vor die Nase. French Toast mit einem Latte Macchiato.
»Du bist wirklich die Beste, Mom«, entgegnete ich grinsend und fing hinterher an zu frühstücken.
»Das musst du mir nicht jedes Mal sagen, wenn ich dir etwas zu Essen mache.« Sie setzte sich auf den Stuhl gegenüber von mir und lächelte mich an.
»Doch, das muss ich. Wer weiß, wie oft ich es noch zu dir sagen kann?«
»Noch viele weitere Jahre, Amy«, erwiderte sie liebevoll, wandte sich jedoch ab und trank einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse.
Als ob mir eine Faust in den Magen geschlagen wurde, so zog er sich plötzlich schmerzhaft zusammen. Da war wieder diese böse Vorahnung und ich fragte mich, ob ich nicht krank machen sollte. Allerdings würde Mom es merken wenn ich sie anlog und sobald ich wieder anfing ihr die Situation zu erklären, würde sie es doch nur abwinken und nicht ernst nehmen. Nachdenklich kaute ich auf meinem Frühstück herum und beobachtete sie dabei.
Mom war eine wirklich hübsche Frau. Wir hatten beide lange Haare, die in einem kräftigen, dunklen Rotton leuchteten, waren ungefähr gleich groß und wiesen fast das gleiche Gesicht auf. Nur meine Augen waren blau, wie die meines Vaters und die meiner Mutter waren moosgrün. Außerdem hatten wir beide dasselbe Geburtsmal: Eine verblasste Lilie am linken Handgelenk.
Als ich sie einmal nach der Bedeutung danach fragte, meinte sie bloß, dass sie mir auch nicht sagen konnte woher es kam. Allerdings veränderte sich jedes Mal ihr Gesichtsausdruck, so als ob sie mir nicht ganz die Wahrheit sagte.
»Musst du nicht langsam los?«, fragte sie mich nach einer Weile.
Träge warf ich einen Blick auf die Uhr und sprang schließlich hastig auf.
»Bis später, Mom«, sagte ich zu ihr, gab ihr einen Kuss auf die Wange und verließ das Aparment. Anschließend stieg ich in meinen blauen Peugeot 206 und fuhr los.
Schule war nicht der richtige Begriff für das Höllenloch, in das ich jeden Morgen gehen musste. Ich hatte dort kaum Freunde, eigentlich nur einen einzigen und bis vor einem Jahr wurde ich noch von meinen Mitschülern gemobbt. Ihre Begründung war ganz simpel: Ich war anders als sie.
Wenn man an meiner Schule zu spät kam konnte man direkt mit einer ganzen Woche Nachsitzen rechnen. Das lag daran, dass es eine sehr streng katholische High School war. Aus welchem Grund auch immer fand meine Mutter es gut, dass ich dort die Schule besuchte, obwohl ich an keinen Gott glaubte, da sie mich bisher auch nie zu dem Glauben erzogen hatte. Bis zum heutigen Tage zeigte er sich auch noch nicht sehr erkenntlich und mein Glaube an Lucifer, Gottes böser Bruder, war da sehr viel präsenter.
Jedenfalls war am Morgen in der ersten Stunde immer Beten angesagt und die Lehrer sahen es sehr negativ, wenn das ein Schüler verpassen, oder noch schlimmer, in den Dreck ziehen sollte.
Das war echt furchtbar!
Während ich wie jeden Morgen an derselben Kreuzung im Stau stand, musste ich noch einmal an die Worte von Mom denken. Auch mein Magen rumorte wieder wie verrückt und ich hatte Mühe mich auf den Verkehr zu konzentrieren. Bisher war dieses Gefühl noch nie so ausgeprägt gewesen, sodass ich es immer ignorieren konnte. Doch es wurde mit der Zeit immer stärker und ich machte mir Sorgen vor dem, was passieren könnte.
Ungeduldig trommelte ich mit meinen Fingern auf das Lenkrad und machte die Musik im Radio lauter. Es lief gerade „21 Guns“ von Green Day, eines meiner absoluten Lieblingslieder. Also versuchte ich mich mit der Musik und dem Verkehr von meinen Gedanken abzulenken. Irgendwie schaffte es die Realität mich tatsächlich von meinen Bauchschmerzen und Gefühlen abzulenken. Ein wenig besser gelaunt fuhr ich etwas nach vorne als sich die Autos im Schneckentempo weiter bewegten. Automatisch drehte ich die Musik noch ein wenig lauter und sang mit.
Nach fünf Minuten ging es endlich mal wieder voran und ich konnte nach links abbiegen. Wenige Minuten später erreichte ich die Schule und parkte auf dem großen Parkplatz.
Als ich das Gebäude betrat, konnte ich von weitem schon meinen besten Freund Terry sehen, der gelangweilt neben meinem Spind stand und unsere Mitschüler beobachtete. Als er mich entdeckte hellte sich seine Miene ein wenig auf. Anscheinend schien er noch nicht zu merken, dass in meinem Magen Samba getanzt wurde. Gut so, er sollte sich nicht auch noch Sorgen machen. Derweil erreichte ich ihn und er stieß sich von der Wand ab, um mich in seine Arme zu schließen.
Terry Kingston war einen Kopf größer als ich, noch dazu relativ schlank, hatte dunkelblonde Haare und hellblaue, freundliche Augen. Bald kannten wir uns schon seit zwölf Jahren und es gab seitdem keinen Tag, an dem wir getrennt waren. Bis auf die Jahre in der Junior High, dort waren wir leider in getrennten Klassen gewesen, aber unsere Freundschaft litt darunter überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass es uns noch enger zusammengebracht hatte.
»Na, alles klar?«, wollte er wissen und musterte mein Gesicht.
»Ich bin so froh, wenn ich hier nicht mehr hingehen muss«, beantwortete ich seine Frage und öffnete meinen Spind. Hinterher nahm ich die Bücher für die ersten beiden Stunden heraus und wandte mich wieder an meinen Kumpel.
»Bald haben wir es ja geschafft.« Er grinste mich an und legte einen Arm um meine Schulter.
»Ja, noch verdammte anderthalb Jahre«, murrte ich und ging mit ihm zu unserem ersten Kurs.
Mitten in der zweiten Stunde klopfte es auf einmal an der Tür.
»Herein!«, rief Mrs Roberts und zwei Polizisten betraten den Raum.
Ihre Blicke schweiften durch den Klassenraum und blieben bei mir hängen. Oh Mist! Hoffentlich nannten sie nicht meinen Namen.
»Amelia Watson, könnten Sie bitte mal kurz mit vor die Tür kommen?«, fragte der Ältere der beiden Männer.
Alle Köpfe in der Klasse flogen in meine Richtung und meine Klassenkameraden fingen sofort an zu tuscheln. Verdammt, sofort meldete sich mein Bauch und diese böse Vorahnung wieder. Am liebsten wäre ich sitzen geblieben und hätte mich geweigert mitzugehen, allerdings wollte ich auch wissen was die Männer von mir wollten. Also nickte ich und ging langsam zu den Beamten.
Als ich mit ihnen auf den Flur trat, ging ich in meinem Kopf durch was ich verbrochen haben könnte. Gut, ich hatte einmal die Unterschrift meiner Mutter für eine Entschuldigung gefälscht, weil ich einen Schultag schwänzen wollte um auf ein Open Air Konzert im Central Park zu gehen. Aber deswegen wird man doch nicht verhaftet, oder?
Ich konnte noch einen Blick zu Terry werfen, der mich beruhigend anlächelte, bevor die Tür des Klassenraumes geschlossen wurde. Ich schnitt ihm eine Grimasse und wandte mich dann an die Officer.
»Ms Watson.« Der pummelige Polizist sah mich mitfühlend an. Er war ein wenig am Schwitzen und fuhr sich immer wieder nervös mit einem Tuch über sein Gesicht.
»Hören Sie, wenn es um den einen Tag geht an dem ich die Schule geschwänzt habe, das kann ich erklären«, fing ich an, doch der größere und schmalere Polizist sah mich verwirrt an. Er war derjenige, der mich aus der Klasse gerufen hatte.
»Nein, darum geht es nicht, Ms Watson«, druckste er herum.
»Worum dann?«, horchte ich nach.
»Am besten setzen Sie sich hin.« Er zeigte auf eine Bank, die im Flur stand. Seufzend nahm ich Platz und sah die Polizisten abwartend an.
»Jetzt sagen Sie mir endlich was ich verbrochen habe«, äußerte ich mit einer leichten Ungeduld in meiner Stimme.
»Es geht um Ihre Mutter«, fing der Ältere wieder an.
Sofort sah ich die beiden aufmerksam an. Meine Bauchschmerzen wurden wieder stärker, während mir der Schweiß aus den Poren trat. Scheiße, was sollte das werden?
»Was ist mit ihr?«, wollte ich wissen und versuchte dabei die Panik in meiner Stimme zu verbergen.
Die Beamten warfen sich kurz einen Blick zu, bevor sich der Erfahrenere wieder zu Wort meldete und mich mitfühlend ansah. »Sie hatte einen Autounfall und ihn nicht überlebt.«
Eine unheimliche Stille trat ein, nachdem er den Satz zu Ende gesprochen hatte. Das Blut rauschte mir in den Ohren, mir wurde heiß und kalt zur gleichen Zeit und meine Hände fingen an zu zittern.
»Soll das irgendwie ein schlechter Scherz sein? Heute Morgen habe ich doch noch mit ihr gesprochen«, reagierte ich fassungslos und wäre am liebsten in Gelächter ausgebrochen.
Was erlaubten sich diese Männer bloß? Einfach in meine Schule zu spazieren und mir so etwas Lächerliches zu erzählen?
Die beiden Polizisten wechselten erneut einen Blick, bevor sie sich wieder an mich wandten.
»Wir fahren jetzt mit Ihnen ins Krankenhaus, damit Sie die Leiche nochmal sehen und sich verabschieden können«, fuhr der schmalere Beamte fort und deutete mir ihnen zu folgen.
Zögernd stand ich auf und ging mit ihnen aus der Schule. Bestimmt würde Mom gleich vor dem Gebäude warten und mich mit einem Ausflug überraschen. Manchmal arrangierte sie solche verrückten Sachen, damit ich früher abhauen durfte.
Doch als wir nach draußen traten, stand meine Mutter nicht dort. Stattdessen wartete auf mich ein Polizeiwagen am Straßenrand. Mir blieb die Luft weg, während sich der Schock immer weiter ausbreitete. Nein; dachte ich energisch. Das war nicht wahr!
»Kommen Sie, Miss?« Die beiden Kollegen sahen ungeduldig zu mir herauf, anscheinend wollten sie es schnell hinter sich bringen.
Langsam stieg ich die Treppen hinab und setzte mich hinten in den Wagen. Ich kam mir wie eine Verbrecherin vor, die etwas sehr Schlimmes angestellt hatte und nicht wie ein Mädchen, das gerade erfahren hatte, dass seine Mutter gestorben war. Nein, einfach nein. Es fühlte sich so falsch an.
Nachdem ich angeschnallt war, wurde das Auto gestartet und wir fuhren los.
Etwa 15 Minuten später erreichten wir das Krankenhaus und so schnell ich konnte stieg ich aus dem Wagen aus. Anschließend rannte ich in die Klinik und an die Rezeption.
»Ist meine Mutter hier? Was ist mit ihr passiert?«, fragte ich mit Panik in der Stimme und starrte die Krankenschwester mit weit aufgerissenen Augen an. Mein Atem ging nur noch stoßweise und mein Herz schlug mir bis zum Hals.
»Wie ist Ihr Name?«, erkundigte sie sich geduldig und tippte mit ihren künstlichen Fingernägeln auf der Computertastatur herum.
Wie konnte sie nur so entspannt bleiben? Das Verhalten der Krankenschwester brachte mich nur noch mehr in Rage. Ich wollte doch nur zu meiner Mama.
»Watson, Amelia Watson! Meine Mutter ist Vera Watson! Ich will wissen, was mit ihr los ist. Wenn das nur ein Scherz sein soll, dann ist er nicht lustig!«, antwortete ich und biss mir auf die Lippe. Jetzt bloß nicht heulen.
Die Krankenschwester musterte mich für einen kurzen Moment, dann stand sie auf und lief um den Tresen herum.
»Komm mit, ich bringe dich zu deiner Mutter«, sagte sie abermals ruhig, allerdings mit einem wehmütigen Unterton in der Stimme und ging voran.
Mit schnellen Schritten folgte ich ihr und gemeinsam stiegen wir in den Aufzug. Schwester Marylin, so stand es jedenfalls auf ihrem Namensschild, betätigte kurz darauf den Knopf für den Keller.
Sofort erstarrte ich und mein Atem beschleunigte sich. Die Angst in mir wuchs und ich wollte einfach nur noch Mom sehen. Zitternd faltete ich meine Hände ineinander und versuchte nicht daran zu denken.
Sie war nicht tot.
Der Aufzug hielt endlich an und als sich die Türen öffneten, spürte ich sofort eine eisige Kälte. Wir waren in der Leichenhalle.
Nein, nein, nein.
Schwester Marylin ging voran und nach kurzem Zögern trat ich ebenfalls in den Raum. Ich schluckte den Kloß in meinem Hals hinunter und wollte immer noch nicht daran denken. Der lange Flur endete in einem großen Raum, in dem sehr viele Metalltische aufgereiht waren. Allerdings waren sie alle leer, bis auf einen ganz hinten in der Ecke. Dort stand schon Schwester Marylin und unterhielt sich gerade mit einem Arzt.
Zuerst konnte ich nicht sehen wer dort unter dem Tuch verdeckt war. Doch dann, es war nur eine kleine Bewegung von dem Arzt und ich konnte die roten Haare entdecken, die unter dem Tuch herausragten.
Meine Knie wurden weich und ich musste mich an einem der Tische abstützen, damit ich nicht auf den Boden fiel.
»Mom?«, keuchte ich und jetzt schienen mich die beiden anderen Menschen im Raum erst wahrzunehmen. Angrenzend stand ich genau neben ihnen und schob mich zwischen der Schwester und dem Arzt hindurch, damit ich das Tuch beiseite ziehen konnte. Mit einem Ruck legte ich das Gesicht der Person frei und verlor endgültig die Beherrschung.
Dort lag sie, reglos und steif wie ein Stein.
Geschockt schlug ich mir die Hände vor den Mund und sank auf den Stuhl, der neben dem Tisch stand.
»M-Mom?« Zitternd griff ich nach ihrer Hand, zog meine aber sofort wieder zurück, denn ihre Haut war eiskalt. Jedoch war ich viel zu schockiert über die Tatsache, dass sie sich nicht bewegte, um zu bemerken wie ungewöhnlich ihr kühler Körper war.
»Mom, bitte wach auf«, wisperte ich mit zittriger Stimme und nahm tief Luft.
Eine warme Hand legte sich auf meine Schulter, also wandte ich widerwillig den Blick von Mom ab und sah die Person an.
»Es tut mir wirklich leid für Sie, aber sie wird nicht mehr aufwachen«, flüsterte der Arzt mitfühlend. Wortlos drehte ich mich wieder zu Mama und umfasste vorsichtig ihre Hand.
»Bitte, lass uns nach Hause gehen, Mom«, sagte ich wieder und als sie sich immer noch nicht rührte, dämmerte es mir so langsam. Sie war wirklich tot und sie würde nie wieder zurück kommen.
Ein Schrei entfuhr mir und dann kamen die Tränen. Mein Kopf sank auf die kalte Tischplatte und ich weinte mir die Augen aus. Wieso hast du mich alleine gelassen? Du hattest mir versprochen noch viele weitere Jahre bei mir zu bleiben. Das war nicht fair!
Wie lange ich dort saß und um meine Mutter trauerte, wusste ich nicht. Immer wieder überfielen mich Schluchzer und ich konnte immer noch nicht glauben, dass sie weg war. Sie war nicht mehr hier und mein ganzes Leben bestand nur noch aus einem großen schwarzen Loch.
Die nächsten Tage liefen für mich sehr mechanisch ab. Zuerst nahm ich wieder Kontakt zu meinem Vater auf, da ich zu ihm nach Broken Village ziehen musste. Das hieß ich würde Terry für eine lange Zeit nicht mehr sehen. Dass er deswegen sehr traurig war, ließ er sich jedoch nicht anmerken und wich kaum von meiner Seite. Er half mir, die Beerdigung für meine Mutter zu organisieren, da ich dazu alleine nicht in der Lage war.
Ich hatte mich für eine anonyme Bestattung entschieden, da ein Grab zu teuer gewesen wäre und ich es sowieso nicht hätte besuchen können. Auch wenn ich mir sicher sein konnte, dass Terry dort jeden Tag vorbeischauen würde, wollte ich ihm nicht noch mehr Arbeit machen.
Während der Beerdigung passierte schließlich etwas sehr Merkwürdiges. Obwohl es ein warmer Märztag war, spürte ich plötzlich einen kalten Luftzug um meine nackten Beine streichen und erschauerte für einen kurzen Moment. Verstohlen sah ich zu den anderen Anwesenden, aber weder Terrys Eltern, noch der Pfarrer oder Moms alte Kollegen hatten etwas davon gespürt. Blinzelnd schüttelte ich den Kopf und vergrub mein Gesicht in der Schulter meines besten Freundes doch es kamen keine Tränen. Während alle anderen um mich herum Rotz und Wasser heulten, starrte ich ausdruckslos auf die große, weite Wiese, in der schon viele andere tote Menschen begraben wurden und gab meiner Mutter ein leises Versprechen: Dass ich sie nie vergessen, für immer lieben und mein Leben weiterleben würde. Denn das wäre es, was sie gewollt hätte.
Einige Tage darauf war es auch schon so weit. Die meisten Sachen hatte ich schon gepackt und nach Broken Village geschickt, bis auf die wichtigsten Dinge, die ich noch zum Leben brauchte. Da Terry die letzten Tage bei mir übernachtet hatte, war er es, der mich am Tag meiner Abreise weckte und mich dazu brachte, ein wenig zu essen. Anschließend nahm er meinen Koffer und gemeinsam verließen wir das Apartment. Ich sah mich nicht mehr um, da mit diesem Ort zu viele Erinnerungen verbunden waren und ich sonst Angst hatte zusammenzubrechen.
Vor dem Gebäude wartete ein gelbes Taxi auf uns, das uns zum Flughafen fahren würde. Während der Fahrt hielt ich die ganze Zeit Terrys Hand fest gedrückt und wenn man uns so sah, könnte man denken wir wären ein Pärchen, das sich für immer trennen musste. Doch ich konnte den Gedanken einfach nicht ertragen, meinen besten Freund für eine unbestimmte Zeit zu verlassen. Außerdem hatte ich Sorge davor was mich in Broken Village erwarten würde. Dort kannte ich bloß meinen Vater und wären die Schüler auf der High School dort so wie hier in New York, dann hätte ich niemanden der mir zur Seite stehen würde.
Am Flughafen angekommen hatten wir noch eine Stunde Zeit, bevor mein Flug losging. Schweigend schlenderten wir durch den riesigen Airport und versuchten nicht an den Abschied zu denken. Doch dieser kam schneller als wir dachten. Mein Gepäck hatte ich schon abgeben und nun war es Zeit sich von Terry zu verabschieden. Ich schlang fest meine Arme um ihn und vergrub mein Gesicht an seiner Brust, um seinen vertrauten Geruch ein letztes Mal einzuatmen. Terrys muskulöse Arme hielten mich einige Sekunden fest, doch dann schob er mich von sich weg und sah mir ins Gesicht.
»Ich werde ja nicht aus der Welt sein. Wir können jeden Tag telefonieren«, sagte er und ich wusste, dass er mich damit beruhigen wollte. Ich nickte nur und versuchte ein Lächeln zustande zu bringen.
»Komm bloß nicht auf die Idee, ohne mich Blödsinn zu machen. Das würde ich dir nie verzeihen«, erwiderte ich schniefend und bevor ich es verhindern konnte, kullerten die ersten Tränen über meine Wangen. Wütend wischte ich sie weg, denn ich hatte in den letzten zwei Wochen viel zu oft geweint. »Das würde ich doch nie tun. Wir werden uns bald wiedersehen, das verspreche ich dir. Indianer Ehrenwort«, entgegnete Terry grinsend und hielt mir seinen kleinen Finger hin. Ich grinste leicht zurück und hakte meinen kleinen Finger bei seinem ein.
Schließlich kam die Durchsage für den letzten Aufruf meines Fluges. Schlagartig wurde ich wieder traurig, drückte Terry noch ein letztes Mal an mich und begab mich durch den Schalter. Bevor die Türen sich schlossen, winkte ich Terry noch mal zu und er hob ebenfalls seine Hand zum Abschied, dabei sah er mich mit seinem typischen Lächeln auf dem Gesicht an. Das war das Letzte, was ich sah, bevor sich die Türen endgültig schlossen und ich von einer Stewardess dazu aufgefordert wurde, mich auf meinen Platz zu setzen. Kurz darauf wurden schon die Motoren gestartet, das Flugzeug erhob sich in die Lüfte und brachte mich meinem neuen Leben ein kleines Stück näher.
1
~Broken Village 10.04.2012
Also, hier stand ich nun. Am Flughafen von Broken Village und wartete auf meinen Vater, der schon vor einer halben Stunde da sein sollte. Seufzend sah ich mich um, aber von ihm war weit und breit keine Spur. Doch dann fiel mir ein, dass ich ja noch mein Handy ausgeschaltet hatte. Vor Schreck schlug ich mir die Hand vor den Mund, als ich die elf verpassten Anrufe sah. Schnell wählte ich die Nummer meines Vaters und rief ihn an.
»Hallo Spätzchen«, meldete er sich nach ein paar Sekunden.
»Wo bleibst du, Dad?«, fragte ich ungeduldig und sah mich wieder um.
»Tut mir leid, aber ich musste etwas länger arbeiten und dann stand ich noch im Stau. Ich bin sofort da,« entschuldigte er sich.
»Das will ich auch hoffen«, murmelte ich müde und legte auf.
Ein paar Minuten später entdeckte ich Dad auch schon. Er betrat gerade den Gate und sah sich nach mir um. Seine Haare waren braun und auf seiner Nase trug er stets eine Lesebrille. Zwei unverwechselbare Merkmale, die mich ihn schon von weitem erkennen ließen. Dad war zudem ein sehr intelligenter Mann, mochte Bücher schon immer und war leitender Bibliothekar der Broken Village Bücherei. Dies war seit jeher sein größter Traum gewesen und als sein eigener Boss musste Dad natürlich auch viel arbeiten. Mom hingegen hatte zwar auch hart gearbeitet, allerdings hatte sie nie ein genaues Ziel, welches sie verfolgen wollte. Ihr war es wichtiger, dass für mich gesorgt war und sie Geld nach Hause brachte. Schon interessant, wie sich zwei Menschen die so unterschiedlich waren, sich zueinander hingezogen fühlen konnten. Damit hatten sie bestimmt auch noch nicht gerechnet, als sie sich auf dem College kennengelernt hatten. Vor allem Dad nicht, wenn ich so an die Bilder dachte, die ihn als jungen Mann zeigten. Er war der schüchterne Literaturstudent gewesen, der seinen ersten Kuss wahrscheinlich erst auf seinem Abschlussball bekommen hatte. Mom andererseits war eine selbstbewusste Architekturstudentin, die mit Sicherheit den Männern den Kopf verdreht hatte. Wie genau sie sich damals kennen gelernt hatten wusste ich bis heute nicht, doch Mama hatte Dad geliebt. Dessen war ich mir bewusst.
Als Dad schließlich auf mich zukam, rannte ich auf ihn zu und ließ mich von ihm in eine Umarmung ziehen. Sofort kam mir der vertraue Geruch von Männerparfüm und alten Büchern in die Nase. Nach kurzer Zeit ließ mein Vater mich los und musterte mich.
»Es ist so schön dich wiederzusehen. Hattest du einen angenehmen Flug?«, begrüßte er mich.
»Ja, den hatte ich. Es fiel mir leichter als ich dachte«, erwiderte ich leise und sah ihn an.
Er lächelte mich bekümmert an, drückte meine Schulter leicht und nickte verständnisvoll. Schweigend nahm ich seine Hand in meine und griff mit der anderen einen meiner Koffer.
»Lass uns gehen, ich will hier nicht länger herumstehen«, meinte ich schließlich.
Mein Vater nickte und schnappte sich mein anderes Gepäck. Anschließend verließen wir den Flughafen und fuhren nach Hause.
Während der Autofahrt sah ich die ganze Zeit nur aus dem Fenster und lauschte der Musik im Radio. Mit Dad ein Gespräch zu führen war noch nie leicht gewesen, doch heute kam es mir ganz gelegen. Im Augenblick fühlte ich mich nicht dazu in der Lage mich mit ihm zu unterhalten. Ihm ging es da bestimmt nicht anders und so hingen wir beide unseren Gedanken nach.
Broken Village war wirklich eine schöne Stadt und man hatte einen tollen Ausblick aufs Meer. So etwas war ich gar nicht gewohnt. In New York sah man nur Wolkenkratzer, Autos und jede Menge Menschen. Hier war es ganz anders. Die Häuser lagen alle schön weit auseinander, die Straßen waren frei und man sah nur manchmal jemanden auf dem Bürgersteig Spazieren gehen.
Bevor meine Eltern sich trennten, lebte ich zwar noch in Broken Village, aber da ich noch sehr jung war, konnte ich mich kaum noch an meine Zeit in der Stadt erinnern. Hin und wieder war ich mal zu Besuch gewesen, aber das letzte Mal lag auch schon wieder vier Jahre zurück.
Zehn Minuten später hielt Dad schon vor einem kleinen Haus, das einen gemütlichen Vorgarten und eine Veranda hatte. Anschließend stieg ich aus dem Auto und sah mich um.
»Es ist total schön hier«, stellte ich mal wieder fasziniert fest, dabei bemerkte ich nicht, dass Dad schon meine Koffer an die Tür getragen hatte. Lächelnd ging ich zu ihm und betrat das Haus.
»Du hast bestimmt Hunger. Tut mir leid, aber ich hatte noch keine Zeit zu kochen«, äußerte er sich und sah mich entschuldigend an.
Ich schmunzelte und erwiderte seinen Blick. »Ist schon okay, Dad. Ich bin sowieso noch müde von dem Flug und wollte erst mal schlafen.«
»Na, wenn das so ist, zeige ich dir mal dein Zimmer.« Er lächelte und ging die Treppen nach oben.
Ich folgte ihm und kam gerade oben an, als er das erste und einzige Zimmer auf der linken Seite betrat. Gegenüber befand sich noch eine andere Tür, die wohl zu seinem Schlafraum führte. Mein Schlafzimmer war gerade mal so groß, dass ein Doppelbett, ein Kleiderschrank und ein Schreibtisch hinein passten. Der Boden war mit hellem Laminat ausgelegt und die Wände waren in lavendelfarben gestrichen. So hatte ich es nicht mehr in Erinnerung. Ich konnte mich noch an eine Schlafcouch erinnern und an kahle Wände.
»Ich habe es vor ein paar Tagen renoviert. Hoffe es reicht für den Anfang«, erklärte er mir.
Grinsend umarmte ich Dad und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Es ist perfekt. Danke, Daddy.«
»Ich muss jetzt nochmal ins Archiv. Kann sein, dass ich erst nach Mitternacht wiederkomme. Du kommst zurecht?«, fragte er unsicher und zur Bestätigung nickte ich.
»Mach dir keine Sorgen um mich«, erwiderte ich.
Er lächelte erneut und gab mir einen Kuss auf die Stirn, hinterher verließ er das Zimmer und fuhr zur Arbeit. Dad würde vor Mitternacht nicht zu Hause sein, also hatte ich genug Zeit für mich alleine.
Nachdem ich das Wichtigste aus meinen Koffern geräumt hatte, schnappte ich mir meinen Schlafanzug und machte mich fürs Bett fertig. Während ich mich in die Kissen kuschelte, fiel mein Blick auf das Bild von mir und Mama, welches ich zuvor noch ausgepackt hatte. Ich schluckte und griff mit zittrigen Händen nach dem Foto. Ganz leicht fuhr ich mit meinen Fingern über das Portrait und sah in das lächelnde Gesicht von Mom. Sie war jetzt schon ein paar Wochen tot, aber ich vermisste sie immer noch schrecklich. Plötzlich war mein Hals wie zugeschnürt und schon spürte ich, wie im nächsten Moment die ersten Tränen über meine Wangen liefen. Schnell wischte ich diese mit der Bettdecke weg und stellte das Bild wieder an seinen Platz. Anschließend drehte ich mich auf die andere Seite und zog die Bettdecke bis zu meinem Kinn. Es dauerte auch gar nicht lange bis ich eingeschlafen war.
Gegen fünf Uhr abends wurde ich das erste Mal wach. Meine Wangen fühlten sich heiß an und als ich mit der Hand darüber fuhr, konnte ich meine getrockneten Tränen spüren. Ich musste wohl im Schlaf geweint haben, jedoch fühlte ich mich durch das Nickerchen frisch und erholt.
Nachdem ich in meine kuscheligen Hausschuhe geschlüpft war ging ich nach unten in die kleine geräumige Küche, denn allmählich machte sich mein Magen bemerkbar. An das Haus hier musste ich mich noch gewöhnen, denn es war so ganz anders als das Apartment aus Manhattan. Allerdings passte es perfekt in diese Stadt, genauso wie Dad. Von mir konnte ich das noch nicht behaupten.
Im Kühlschrank suchte ich zuerst einmal nach etwas Essbarem, doch leider besaß Dad nur Fertigprodukte. Da musste ich mit ihm auf jeden Fall noch einkaufen gehen; dachte ich entschlossen. Weil ich nichts anderes fand, schob ich mir eine Tiefkühlpizza in den Backofen. Derweil wollte ich nach etwas zu trinken suchen, fand aber nur Bierflaschen, Whiskey, Wodka und anderen Alkohol. Es stand schlechter um meinen Vater als ich dachte, bemerkte ich besorgt und nahm mir fest vor mit ihm zu reden. Meine Eltern lebten zwar schon seit vielen Jahren getrennt, doch Moms Tod ließ auch ihn nicht kalt. Immerhin waren sie 24 Jahre verheiratet gewesen und bekamen mich als Tochter.
Seufzend nahm ich mir ein Glas und füllte es mit Leitungswasser. Während ich aß, checkte ich meine Nachrichten auf dem Handy, doch auf meine SMS, dass ich gut angekommen war, hatte Terry noch nicht geantwortet. Da heute Sonntag war, war er bestimmt noch mit seinen Hausaufgaben beschäftigt, die er schon immer das ganze Wochenende über vor sich hergeschoben hatte. Schnell schob ich mein Handy in die hinterste Ecke des Tisches. Oh, Terry; du fehlst mir jetzt schon so sehr; dachte ich betrübt und schluckte mit Mühe das Pizzastück hinunter. Es waren gerade mal ein paar Stunden, doch es kam mir schon vor wie Tage, seit denen wir uns nicht mehr gesehen hatten.
Nachdem ich gegessen hatte, wusste ich nicht so recht was ich machen sollte, also entschied ich mich dafür, mich im Haus ein bisschen umzuschauen. Das Wohnzimmer war sehr groß und geräumig, mit hellen Möbeln und einigen Pflanzen. Der Boden war mit beigefarbenen Laminat ausgelegt und die Wandvertäfelung bestand unten aus dunklem Holz und oben aus einem etwas dunklerem Beige als der Fußboden. Eine Glastür führte in den kleinen Garten dahinter und durch die großen Fenster war dies der hellste Raum in unserem Haus. Die Küche befand sich demnach gegenüber des Wohnraumes und wies alles auf, was man zum Kochen brauchte. Am Fenster auf der rechten Seite war noch ein Tisch mit Stühlen. Schließlich gab es noch ein Gäste-WC und eine Tür, hinter der Treppen in die Dunkelheit führten.
Gerade wollte ich in den Keller gehen, als es an der Tür klingelte. Ich fragte mich, wer wohl meinen Vater besuchen wollte, während ich den Flur durchquerte. Ob er eine Freundin hatte? Die letzten Jahre hatte er jedenfalls nichts in der Richtung erwähnt. Doch sollte es sich wirklich um seine Lebensgefährtin handeln, müsste sie doch wissen, dass er arbeiten war.
In dem Moment als ich die Haustür aufriss, starrte ich jäh in zwei eisblaue Augen, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließen, doch keineswegs auf unangenehme Weise. Der Junge grinste mich derweil frech an, da ihm mein Gesichtsausdruck sofort aufgefallen war. Die Haare von ihm waren schwarz und kurz, er hatte dazu hohe Wangenknochen, eine gerade Nase, ein kräftiges Kinn, war mindestens anderthalb Köpfe größer als ich und hatte das Gesicht eines Engels. Mich würde es nicht wundern, wenn all die Mädchen aus der Stadt auf ihn abfuhren.
»Also ich weiß ja, dass Frauen auf mich stehen, aber sprachlos waren sie noch nie«, meldete er sich zu Wort und musterte mich belustigt.
Verdammt, seine Stimme klang wie Musik in meinen Ohren. Blinzelnd sah ich ihn an und holte ein paar Mal tief Luft. Ich wusste es. Er war ein eingebildeter Macho.
»Kann ich dir helfen?«, fragte ich in neutralem Ton und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass mich seine Gegenwart nervös machte.
»Ich wollte das hier zu Mr Watson bringen,« erklärte er mir und hielt ein Buch über amerikanische Geschichte in der Hand.
Bestimmt hatte er es aus der Bibliothek ausgeliehen, aber wieso brachte er es dann nicht einfach dorthin zurück? Statt einer sarkastischen Antwort nickte ich bloß und wollte ihm das Buch abnehmen, doch als sich unsere Hände berührten durchfuhr mich ein so heftiger Stromschlag, dass ich ruckartig meine Hand mitsamt dem Buch zurückzog. Taumelnd ging ich einen Schritt zurück und starrte ihn an. Was zur Hölle war das gerade gewesen?
Der Junge jedoch schien darüber überhaupt nicht überrascht zu sein, denn er war immer noch so gelassen wie vorher und grinste. »Ich heiße übrigens Nick.«
»A... Amelia«, stammelte ich immer noch total geschockt vor mich hin.
»Hat mich gefreut, Amelia«, gab er freundlich zurück, grinste mich nochmal an und verließ dann das Grundstück.
Schnell schloss ich die Tür und lehnte mich mit dem Rücken dagegen. Das war merkwürdig; dachte ich mir und versuchte dabei meinen Atem und rasenden Puls unter Kontrolle zu bekommen. Erst als der erste Schock vorbei war spürte ich, dass mein Mal am Handgelenk brannte. Als ich es mir genauer ansehen wollte, zog ich scharf die Luft ein und wäre am liebsten erneut in Tränen ausgebrochen.
Mein Leberfleck sah auf einmal ganz anders aus! Die Blüten waren weiß und in der Mitte schimmerten sie grünlich. Jetzt sah es so aus, als ob ich mir eine Blume auf mein Handgelenk tätowiert hätte.
Das Buch legte ich erst einmal auf der Kommode ab, ehe ich nach oben ins Badezimmer rannte. Dort ließ ich Wasser über mein Handgelenk laufen, doch es brachte nicht viel und führte nur dazu, dass es noch mehr brannte. Der stechende Schmerz war mittlerweile so schlimm, dass ich kaum noch atmen konnte. Was passierte nur mit mir!? Das war doch nicht mehr normal! Scheiße! Wieder einmal schnürte mir die Panik die Luft ab. In diesem Augenblick fühlte ich mich vollkommen alleine gelassen, aber wer würde mir schon helfen können? Dem Notarzt konnte ich ja schlecht erzählen, dass mich ein Junge berührt und sich daraufhin mein Geburtsmal verändert hatte, welches nun so stark schmerzte, dass ich nicht mal mehr denken konnte. Nein, die würden mich eher in die Klapse fahren, anstatt in die Notaufnahme.
In meinem Schlafzimmer angekommen suchte ich nach einem Desinfektionsmittel. Vielleicht würde das ja helfen; dachte ich hoffnungsvoll. Aber nach wenigen Minuten gab ich die Suche auf und ließ mich einfach auf mein Bett fallen. Mit meiner anderen Hand umklammerte ich mein Handgelenk und versuchte an etwas Schönes zu denken. Vor meinen Augen blitzte Terrys strahlendes Lächeln auf. Er winkte mir zu und deutete mir dann ihm zu folgen. Nur zu gerne ließ ich mich von ihm durch die Straßen von Manhattan führen. Aber schon nach kurzer Zeit veränderte er sich. Seine Haare wurden kürzer und dunkler und als er sich erneut zu mir umdrehte, sah mich Nick aus diesen blauen Augen an. Einige Strähnen fielen ihm frech über die Stirn, was ihn noch verwegener wirken ließ. Nick lächelte mich an und streckte anschließend seine Hand nach mir aus. Vorsichtig ergriff ich sie und ehe ich mich versah, strich er fürsorglich über mein Mal. Die Berührung fühlte sich so echt an, dass ich heftig zusammenzuckte und meinen Arm wieder zurückzog. Das war auch der Moment wo sich mein Tagtraum um mich herum in Luft auflöste und ich mich wieder in meinem Zimmer befand.
In der Zeit hatte sich mein Körper von selbst in einen Dämmerzustand versetzt, dies machte er öfter, wenn es mir nicht gut ging. Hinterher befand ich mich in der kleinen Welt zwischen schlafen und wach sein und empfand nicht mehr so viele Schmerzen. Ich war schon beinahe wieder weg gedämmert, als ich plötzlich das Gefühl bekam, beobachtet zu werden. Also öffnete ich meine Augen einen Spalt und glaubte in der Dunkelheit die Gestalt einer Frau zu erkennen. Doch nachdem ich blinzelte war dort nichts mehr und alles was ich hörte, war das Ticken meines Weckers auf meinem Nachtschrank.
Ich wusste nicht wie lange ich schon auf dem Bett lag, aber irgendwann hörte das Brennen gänzlich auf. Langsam setzte ich mich auf und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Hoffentlich wiederholte sich dieses Ereignis nicht; dachte ich müde und unterdrückte einen Schauer. Jedenfalls hatte ich nicht vor diesen Nick, falls ich ihn überhaupt jemals wiedersehen sollte, auf dieses Ereignis anzusprechen. Er würde denken, dass ich ja völlig bescheuert sei.
Kurzerhand entschied ich mich dazu, Terry eine SMS zu schicken und ihm von den Ereignissen zu erzählen. Er war mein bester Freund und würde mich verstehen. Nachdem ich meinen halben Roman zu Ende geschrieben hatte, legte ich mein Handy weg und riss das Fenster auf. Anschließend fiel ich total erschöpft auf mein Bett und mit dem Gedanken an meinen ersten Schultag war ich erneut eingeschlafen.
Am nächsten Tag wurde ich durch meinen nervigen Wecker wach. Aus Gewohnheit machte ich ihn wieder aus und drehte mich auf die andere Seite. Doch kurz bevor ich wieder einschlafen konnte, hörte ich wie sich meine Zimmertür öffnete.
»Amelia, steh auf. Du willst doch nicht an deinem ersten Schultag zu spät kommen, oder?«, meinte Dad und rüttelte mich leicht an den Schultern.
Murrend zog ich die Decke über meinen Kopf. »Doch, ich will zu spät kommen. Ich hab keine Lust auf Schule«, beschwerte ich mich, dabei konnte ich ihn seufzen hören.
»Steh auf, Amelia. Es wird dir gut tun wieder einen normalen Alltag zu führen«, erwiderte Dad streng und in einem Ton, der keine Widerworte duldete.
»Ich steh ja gleich auf«, grummelte ich schließlich ergeben.
Er schien wohl zufrieden mit der Antwort zu sein, denn er verließ ohne ein weiteres Wort mein Zimmer. Normaler Alltag? Ha, dass ich nicht lache! Wie sollte ich das alles nur ohne Terry schaffen? Er war mein Fels in der Brandung, derjenige der immer für mich da war und mich aus brenzligen Situationen rettete. Er hielt mich fest, wenn ich kurz davor war zu explodieren oder einen Fehler zu begehen. Und wenn ich mit dem Kopf durch die Wand wollte, war er es, der mir einen Vorschlaghammer in die Hand legte. Das alles mochte zwar total kitschig klingen, doch es war die Wahrheit. Ohne Terry fühlte ich mich verloren und allein gelassen.
Es hatte ja doch keinen Sinn, also stand ich auf und machte mich frisch, ehe ich nach unten ging. Mein Vater saß schon am gedeckten Frühstückstisch und las Zeitung. Er lächelte mich an, um mir zu zeigen, dass alles in Ordnung war, doch ich wusste es besser.
Ich glaubte ihm nicht, dass alles im Lot war und dies teilte ich ihm auch in diesem Moment mit: »Dad, du hast ein Problem damit, dass Mom gestorben ist.«
Überrascht sah er mich an und legte die Zeitung beiseite. »Nein! Wie kommst du denn darauf?«
»Weil literweise Alkohol in den Schränken steht und sonst nichts!«, fuhr ich ihn an.
Schuldbewusst zuckte er zusammen, sah mich jedoch aufmerksam an. »Vielleicht ein bisschen«, gab er kleinlaut zu.
Als Antwort grummelte ich etwas Unverständliches. »Ich mache mir Sorgen um dich«, gab ich schließlich ernst zurück und setzte mich gegenüber von ihm hin.
»Das brauchst du nicht. Ich bin ein erwachsener Mann und komme gut klar«, entgegnete er ruhig.
»Dad! Alkohol ist keine Lösung!«, warf ich ein. »Wenn ich heute nach Hause komme, gehen wir einkaufen«, fügte ich noch hinzu und ließ ihn mit diesen Worten sitzen.
Dad war zwar noch nie jemand gewesen, der gerne kochte und sich lieber mal etwas zu Essen bestellte oder nach der Arbeit in einem Diner hielt. Aber mit hochprozentigem Alkohol hatte er noch nie viel am Hut gehabt. Auf Feiern oder Sonstiges hatte er zwar gerne mal mit angestoßen und auch ein Feierabendbier war mal drin, doch das war ja alles noch harmlos. Selbst die Augenringe waren mir nicht entgangen. Es tat mir weh ihn so zu sehen und ich fragte mich wie lange das schon so ging. Erst als er von Moms Tod erfahren hatte oder schon länger? Das würde ich wohl nicht so schnell herausfinden; dachte ich missmutig als ich in meinem Zimmer ankam.
Nach kurzem Überlegen entschied ich mich für ein hellblaues Top, eine schwarze Jeans und meine türkisfarbenen Chucks. Dann zog ich noch mehrere Armbänder über mein linkes Handgelenk, um mein Mal zu verdecken. Schließlich griff ich nach meiner Tasche und verließ das Haus. Wenigstens wurde mein Auto schon ein paar Tage vorher zu meinem Vater geschickt, sodass ich selbst zur Schule fahren konnte. In meinen Navi gab ich noch die Adresse von der Schule ein und fuhr anschließend los.
Eine Viertelstunde später hielt ich schon auf dem Parkplatz von der Broken Village High School. Zuerst konnte ich nur die vordere Fassade sehen und die sah aus wie ein normales Schuldgebäude. Flaches Dach, helle Außenwand und große, eckige Fenster. Zwischen dem Haus und dem Schulfhof befand sich etwas Wiese mit verschiedenen Blumenarten, die allerdings durch einen Zaun geschützt wurden. Ansonsten gab es noch ein paar Tische mit Sitzbänken, also nichts Besonderes.
In dem Augenblick, in dem ich aus dem Auto steigen wollte erblickte ich ihn. Nick stand keine fünf Meter entfernt an einer Mauer gelehnt und unterhielt sich mit einem Mädchen. Da sie mit dem Rücken zu mir stand, konnte ich nur ihre langen, braunen Haare erkennen. Ihre Beine steckten in einer Röhrenjeans und sie trug ganz normale Sneakers. Ob sie wohl seine Freundin war? Sofort verwarf ich den Gedanken und stieg ich aus dem Wagen.
»Hey Amelia! Warte mal!«, rief Nick plötzlich, als ich schon fast den Eingang erreicht hatte.
Verdammt. Ich dachte, er würde mich nicht bemerken. Seufzend blieb ich stehen und sah ihn an.
»Ich muss zum Sekretariat«, gab ich knapp zurück.
»Ich kann es dir zeigen«, warf er breit lächelnd ein und dabei blitzten seine perfekten Zähne auf. Mein Blick wanderte zu seinen schönen Augen, doch dies entpuppte sich als großer Fehler, denn sie zogen mich sofort ihn ihren Bann. Schwuppdiwupp kam mir auch mein Tagtraum von gestern wieder in den Sinn. Ob ich ihn nicht doch mal auf das Ereignis ansprechen sollte? Nein, wer weiß, ob ich mir das alles nicht bloß eingebildet hatte; dachte ich.
»Das wäre wirklich nett«, erwiderte ich freundlich, damit er nicht noch Verdacht schöpfen konnte.
Nick grinste als Bestätigung und ging los. Mit langsamen Schritten folgte ich ihm, dabei musterte ich ihn eingehend. Er trug ein haselnussbraun-weiß kariertes Hemd, welches er bis zu seinen Ellenbogen hochgekrempelt hatte, dazu eine dunkelblaue Jeans und braune Turnschuhe, die an der Spitze allerdings weiß waren. Seine Statur wies Ähnlichkeiten zu der von Terry auf, allerdings besaß Nick mehr Muskeln.
»Was wolltest du von mir?«, fragte ich ihn schließlich, während wir die Treppen zum Eingang hinaufstiegen.
»Ich wollte dir nur sagen wie toll ich es finde, dass du die gleiche Schule wie ich besuchst.« Er grinste aufs Neue und ich spürte wie meine Wangen aufgrund dessen rot wurden.
Verlegen sah ich auf den Boden und konnte so auch nicht das Mädchen sehen, gegen das ich lief. Ihre gesamten Bücher fielen sofort auf den Grund nachdem wir zusammengestoßen waren.
»Kannst du nicht aufpassen!?«, maulte sie mich direkt genervt an.
Ihre Stimme ließ mich in ihre Richtung blicken, da mein Blick zuvor noch den Dielen zugewandt war. Sie hatte lange blonde Haare, grüne Augen und trug ein pinkes Kleid, welches so kurz war, dass man bestimmt ihren Hintern sehen konnte. Das war dann wohl die Schulschlampe, alias First Cheerleader.
»Sorry, hab dich nicht gesehen«, gab ich entschuldigend zurück.
Sie schnaubte nur und hob ihre Bücher auf. Wow, wahrscheinlich war sie es nicht gewohnt, dass man sie übersah. Und ich hatte recht, denn man konnte wirklich ihren Po sehen. Angewidert verzog ich das Gesicht.
»Du solltest aufpassen, dass dir keine Fliegen in den Arsch fliegen. So falsch wie du riechst dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis sie dich interessanter finden als Pferdemist«, bemerkte ich mit rümpfender Nase.
Wütend blickte sie mich an, aber bevor sie sich in Rage reden konnte zog Nick mich weiter. Diesmal war da kein Stromschlag, der von seiner Berührung durch meinen Körper jagte. Du drehst noch durch, Amelia; sagte ich zu mir selbst. Wahrscheinlich war ich gestern einfach noch zu aufgewühlt wegen dem Flug und allem gewesen.
Verstohlen checkte ich erneut mein Handy, doch Terry hatte mir noch nicht geantwortet.
»Das war echt beeindruckend«, meinte Nick begeistert.
Ich zuckte mit den Schultern, ehe ich ihm antwortete: »Ich komme aus New York. Da muss man solche Sprüche drauf haben.«
»Finde ich gut.« Er grinste mal wieder, doch diesmal musste ich auch schmunzeln.
So schlimm war er ja doch nicht; dachte ich. Immerhin ließ er sich von der Tussi nicht beeindrucken so wie die anderen Jungs an der Schule. Ich wollte ihn schon auf sie ansprechen, doch da blieb er vor einer Tür stehen auf der "Sekretariat" stand.
»So, da wären wir«, entgegnete Nick.
Ich lächelte ihn dankend an. »Danke, Nick.«
»Gerne doch. Ich hoffe, du kommst in meine Klasse.« Er zwinkerte mir noch zu und ging dann den Gang entlang. Nachdem er weg war, klopfte ich an die Tür und trat ins Sekretariat.
»Guten Morgen«, begrüßte ich die ältere Frau hinter der Information und sah sie freundlich an.
Sie hatte ein rundliches Gesicht, das von Falten überzogen war, kurze graue lockige Haare und braune große Augen die so gar nicht in das Gesicht zu passen schienen.
»Morgen. Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie schlecht gelaunt.
Welche Laus war der denn über die Leber gelaufen? Einen Moment zögerte ich ,trat dann jedoch nach vorne zu ihr an den Tresen und reichte ihr mein Anmeldeformular. Sie las ihn sich durch, anschließend ging sie an ein Fach hinten an der Wand und suchte etwas. Nach kurzer Zeit drückte die Sekretärin mir einen Stundenplan in die Hand und nannte mir den Raum, in dem ich meine erste Stunde hatte. Dankend wandte ich mich von ihr ab, verließ das Sekretariat und machte mich auf die Suche nach dem Klassenraum.
»Kann ich dir helfen?«, fragte mich eine weibliche Stimme.
Ich sah auf, da mein Blick noch dem Plan der Schule galt und sah das Mädchen an. Sie hatte braune, lange Haare, braune Augen und war einige Zentimeter größer als ich. Außerdem trug sie ein Paramore T-Shirt, das war meine absolute Lieblings Band. Als ich sie genauer betrachtete fiel mir auf, dass sie es war mit der sich Nick noch vor der Schule unterhalten hatte.
»Ja. Ich suche den Klassenraum in dem Englisch unterrichtet wird«, antwortete ich ihr und lächelte leicht.
»Bei Mrs Louvers?«, fragte sie nach.
Ich sah auf meinen Plan und nickte. »Ja, genau.«
»Dann komm mal mit, ich habe jetzt auch bei ihr Unterricht«, erwiderte sie lächelnd und ging los. Ohne zu zögern folgte ich ihr.
»Ich heiße Amelia«, stellte ich mich vor.
»Freut mich, Amelia. Ich heiße Hannah. Deine Haare finde ich richtig toll«, bemerkte sie grinsend.
Überrascht sah ich sie an. Noch nie sagte jemand zu mir, dass er meine roten Haare mochte. Bis auf Terry natürlich, aber der war eine Ausnahme.
»Danke. Ich mag dein Shirt«, gab ich ebenfalls grinsend zurück.
Hannah fand ich sofort von Anfang an sympathisch. Anscheinend waren die meisten Teens hier doch nicht so eingebildet wie an meiner alten Schule.
»Du magst Paramore?«, fragte sie überrascht und ich konnte schwören, dass ich so etwas wie eine Flamme in ihren Augen aufblitzen sah.
»Natürlich. Ich liebe sie. Immer wenn ein Konzert am Madison Square Garden war, bin ich dort mit meiner Mutter hingegangen«, erzählte ich ihr und bei dem Gedanken an meine Mutter wurde mein Herz schwer, daher versuchte ich schnell an etwas anderes zu denken.
»Du kommst aus New York? Das muss bestimmt toll dort sein«, plapperte Hannah weiter.
»Na ja ich bin froh, dass hier nicht so viele Menschen leben. In New York war immer alles so voll«, entgegnete ich woraufhin Hannah anfing zu lachen.
»Du müsstest doch daran gewöhnt sein, wenn du dort aufgewachsen bist«, warf sie ein.
»Ähm, ja.« Ich sagte ihr noch nicht, dass ich bis zu meinem siebten Lebensjahr hier gelebt hatte. »Ich mag es trotzdem nicht wenn zu viele Menschen um mich herum sind. An den ganz schlimmen Tagen musste man sich wortwörtlich durch die Menge prügeln.«
»Uh, das klingt ja ätzend. Da brauchst du dir hier keine Sorgen zu machen«, erwiderte Hannah und zwinkerte mir zu.
Hinterher blieb sie plötzlich vor einer Tür stehen und öffnete diese. Es waren noch nicht viele Schüler in der Klasse, doch als ich sie betrat, warfen mir alle neugierige Blicke zu. Ich sah mich in der Klasse um und entdeckte sofort Nick. Er lächelte mich an, nachdem er auch mich bemerkte. Ich wollte schon zurück lächeln, aber dann würden bestimmt die meisten etwas Falsches denken, also nickte ich ihm nur kurz zu. Hannah setzte sich auf ihren Platz deshalb setzte ich mich einfach auf den freien Stuhl daneben. Ich spürte immer noch alle Blicke auf mir, also hob ich mein Kinn und lächelte einige von ihnen an.
»Was ist? Habt ihr noch nie einen anderen Menschen gesehen? Also wirklich, ist euch dieses Anstarren nicht peinlich?«, fragte ich scherzend und lachte leicht.
Sofort sahen alle woanders hin und beschäftigten sich mit etwas anderem. Ich sah zu Hannah, die mich genauso beeindruckend ansah, wie es zuvor schon Nick getan hatte.
»Wow. Ich kam vor zwei Jahren von Phoenix hierher und da haben mich auch alle angestarrt, aber ich habe mich nicht getraut, ihnen die Meinung zu sagen.«
»Meine Mutter hat mir beigebracht, dass ich mir nichts gefallen lassen soll. Ich habe schon immer meine Meinung gesagt«, gab ich zurück und packte meine Schulsachen aus.
»Du redest oft von deiner Mutter. Magst du sie sehr?«
»Sie war immerhin meine Mom.« Ich biss mir auf die Lippe. Das wollte ich nicht sagen.
»War? Also...«
»Ich will nicht darüber reden«, unterbrach ich sie.
Hannah nickte verstehend und packte ebenfalls ihre Sachen aus, während ich nur auf die Tischplatte starrte und schwieg. Wieso war ich auch so dumm und musste immer wieder Mom erwähnen? Im Endeffekt tat ich mir damit nur selbst weh. Doch auf der anderen Seite fühlte es sich einfach noch nicht so an als ob sie wirklich … Tief atmete ich durch und wandte meinen Blick aus dem Fenster. Ich wollte nicht schon wieder anfangen zu weinen, vor allem nicht vor meinen neuen Mitschülern. Sie würden sonst nur denken ich wäre eine Heulsuse.
Kurze Zeit später klingelte es schon und die restlichen Schüler kamen in die Klasse geströmt. Erneut spürte ich ihre Blicke auf mir, aber ich ignorierte sie so gut es ging. Erst als Mrs Louvers die Klasse betrat, sah ich wieder nach vorne.
»Guten Morgen«, begrüßte sie alle und es kam ein einstimmiges "Guten Morgen" zurück.
Mrs Louvers war schon etwas älter, das verrieten ihre grauen Haare. Sie trug eine Brille mit runden Gläsern und sie war sehr klein und zierlich.
Aufmerksam sah sich die Lehrerin in der Klasse um und blieb mit ihren hellgrauen Augen schließlich bei mir hängen.
»Ein neues Gesicht sehen wir nicht oft hier. Komm doch bitte nach vorne und stelle dich kurz der Klasse vor«, sagte sie bestimmend.
Wieso wusste ich nur, dass das jetzt kam? Langsam stand ich auf und ging nach vorne.
»Mein Name ist Amelia Watson, ich bin 17 Jahre alt und von New York hierher gezogen«, fing ich an.
»Watson? Bist du mit Georg Watson verwandt?«, unterbrach Mrs Louvers mich und sah mich neugierig an.
»Er ist mein Dad«, erklärte ich ihr.
»Zum Glück hat er dieses Flittchen vor elf Jahren verlassen«, murmelte sie daraufhin, aber ich hatte sie trotzdem verstanden. Wut machte sich in mir breit und ich ballte die Hände zu Fäusten.
»Meine Mutter war kein Flittchen!«, erwiderte ich hitzig.
Wie konnte sie nur so von ihr reden? Sie kannte sie noch nicht mal. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals und die ersten Tränen liefen über meine Wangen. Meinen Vorsatz, nicht vor der Klasse zu weinen, hielt ich ja wirklich super ein. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, rannte ich einfach aus dem Raum. Mrs Louvers rief mir noch nach, dass ich bleiben sollte aber ich dachte gar nicht daran.
Wir beide würden nicht gut miteinander klarkommen, dessen war ich mir jetzt schon bewusst.
2
Ich rannte auf den Schulhof und sah mich um. Dann ging ich einfach hinter das Gebäude und entdeckte einen kleinen Garten. Bei einer Bank blieb ich stehen und setzte mich hin, anschließend vergrub ich mein Gesicht in meinen Händen und ließ den Tränen freien Lauf.
Was war das nur für eine Lehrerin? Sie war ja noch schlimmer als der strengste Lehrer auf meiner alten Schule. Er hatte immer hart durchgegriffen, doch er wäre nie auf die Idee gekommen einen Schüler vor der Klasse zu demütigen und vor allem nicht die Eltern zu beleidigen. Wie sollte ich das nur bis zum Abschluss aushalten? Aber vielleicht interpretierte ich auch gerade zu viel in die Sache hinein und sah es so extrem, weil ich im Moment sowieso noch empfindlich reagierte wenn es um Mom ging.
Keine Ahnung, wie lange ich hier schon saß, aber mein klingelndes Handy ließ mich plötzlich zusammenzucken. Schnell fischte ich es aus meiner Hosentasche und sah auf das Display. Die vertrauten Buchstaben von Terrys Namen blinkten mir entgegen, also nahm ich hastig ab und hielt das Handy an mein Ohr.
»Terry!«, sagte ich heiser und wischte mir mit dem Handrücken über mein Gesicht.
»Hey, Kleines. Was ist los?«, fragte er besorgt und ich konnte seine gerunzelte Stirn genau vor mir sehen.
So sah er immer aus, wenn sich Terry Sorgen machte. Also nahm ich tief Luft und erzählte ihm alles, was bisher passiert war. Meine Ankunft in der Stadt, die Sache mit Nick und wie sehr ich meine Englischlehrerin jetzt schon hasste. Nachdem ich geendet hatte musste ich schwer schlucken und atmete tief durch, da ich nicht schon wieder in Tränen ausbrechen wollte.
»Ich wünschte, ich wäre bei dir«, gab Terry zu und seufzte tief. »- aber du bist eine starke Person, Ames. Du wirst das alles schaffen. Der Anfang ist immer hart, aber mit der Zeit wird es besser. Vertrau mir, okay?«
Ich wollte schon etwas darauf erwidern, doch ich hörte auf einmal Schritte von weitem, also schluckte ich mein Ego hinunter und erwiderte: »Okay. Ich muss jetzt aufhören, da kommt jemand. Wahrscheinlich suchen sie schon nach mir.«
»Pass auf dich auf, ja?«, sagte Terry noch und bevor ich ihm antworten konnte, legte er schon auf.
Gerade als ich mein Handy wieder eingesteckt hatte, kam schon Nick um die Ecke gebogen und entdeckte mich auf der Bank.
»Mrs Louvers hat mich geschickt, um nach dir zu sehen. Ist alles in Ordnung?«, fragte er und musterte mich besorgt. Ich schluckte erneut und versuchte mich zu beruhigen.
»Sehe ich etwa so aus, als wäre alles okay?«, erwiderte ich patzig und sah ihn an.
Im nächsten Moment bereute ich allerdings schon meine Aussage, doch er schien es mir nicht böse zu nehmen. Nick schüttelte den Kopf und reichte mir ein Taschentuch. Dankend nahm ich es an und putzte meine Nase.
»Willst du mir erzählen, wieso du hier sitzt und weinst?«, wollte er wissen und sah mich mitfühlend an.
»Vor einem Monat ist meine Mom gestorben«, antwortete ich leise und sah auf meine Hände.
Ich wollte es eigentlich noch keinem hier erzählen, aber es fühlte sich richtig an. Nick sagte nichts, sondern zog mich einfach in eine Umarmung. Überrascht schlang ich meine Arme um seine Taille und drückte mich fest an ihn. Es tat gut, von jemandem in den Arm genommen zu werden, der nicht nur sich selbst trösten wollte.
»Es wird alles gut«, flüsterte Nick und strich mir über den Arm.
Ich dachte, meine Tränen wären versiegt, aber nach ein paar Minuten musste ich schon wieder weinen. Es war einfach alles zu viel im Moment. Moms Tod, die Trennung von Terry, der Umzug, die neue Schule, diese blöde Lehrerin.
Wenige Zeit später hatte ich mich dann tatsächlich beruhigt und ließ Nick langsam los.
»Danke«, sagte ich leise und sah ihn an.
»Gern geschehen«, entgegnete er sanft und erwiderte meinen Blick.
Ein warmes Gefühl machte sich in mir breit, also stand ich schnell auf und sagte: »Wir sollten zurück in die Klasse gehen. Ich will nicht, dass auch noch Gerüchte wegen uns aufkommen.«
Nick nickte verstehend und erhob sich ebenfalls. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg in das Gebäude und schlugen den Gang zu unserem Unterrichtsraum ein. Als wir die Klasse betraten, sahen uns sofort alle verwirrt oder mitleidig an, während Mrs Louvers nur schadenfroh grinste. Ich ignorierte die ganzen Blicke und setzte mich schnell wieder auf meinen Platz.
Nach den ersten Stunden verließ ich zusammen mit Nick und Hannah den Klassenraum. Wie sich herausstellte, waren die beiden schon seit Hannah nach Broken Village gezogen war gute Freunde. Nur Freunde, mehr nicht. Ich mochte die beiden von Anfang an, denn sie waren nett und behandelten mich nicht wie einen Freak, so wie es einige andere Schüler schon taten.
»Und hier ist die Cafeteria«, meinte Nick, als wir besagte Räumlichkeit betraten. »Ich hoffe, dir hat unsere kleine Führung gefallen.«
»Sie war sehr lehrreich«, antwortete ich grinsend.
Wir drei sahen uns an und brachen dann in Gelächter aus. Es war schon so lange her, dass ich mal wieder ausgelassen Lachen konnte und es tat wirklich gut. Das letzte Mal war zusammen mit meiner Mutter. Terry hatte zwar immer wieder versucht, mich zum Lachen zu bringen doch ich war so in meiner Trauer versunken, dass ich immer nur ein müdes Lächeln zustande bringen konnte. Sofort verstummte ich, als ich an Mom denken musste und atmete tief durch.
»Was ist los, Amelia?«, wollte Hannah wissen und sah mich an.
»Es ist nichts. Wirklich nicht!«, fügte ich noch ernst hinzu, als Hannah mich vorwurfsvoll ansah.
»Ist ja gut«, erwiderte sie und hob abwehrend die Hände.
Ich seufzte und stellte mich in die lange Schlange vor der Essensausgabe. Nick gesellte sich zu mir und lächelte mich an. Ich lächelte zurück und als ich mich wieder nach vorne drehen wollte, wurde mir Saft auf mein schönes Top geschüttet.
»Das passiert, wenn man sich mit mir anlegt, du Bitch!«, rief die blonde Tussi von vorhin und grinste mich fies an.
Ich wollte schon etwas dagegen sagen, wurde aber von Nick und Hannah aus der Cafeteria gezogen.
»Hey! Ich wollte ihr gerade meine Meinung sagen.« Beleidigt sah ich die beiden an.
»Tut mir leid, Schätzchen. Ich konnte nicht riskieren, dass die gesamte Cafeteria dein Top-Dilemma miterlebt«, entgegnete Hannah nur und deutete auf mein Shirt.
»Wovon redest du?«, fragte ich sie verwirrt und sah an mir runter, um geschockt festzustellen, dass mein hellblaues Top komplett durchsichtig war. Außerdem klebte es an meinen Brüsten wie eine zweite Haut und mein weißer BH war auch fast durchscheinend, sodass man meine Nippel sehen konnte, die durch die Kälte steif geworden waren. Mit hochrotem Kopf hielt ich die Arme vor meine Brust.
»Keine Panik, ich habe nicht hingesehen«, sagte Nick und sah mir, ganz wie ein Gentleman, in die Augen. Doch lange hielt ich seinem Blick nicht stand und sah zu Hannah.
»Mach dir keine Sorgen. Ich habe ein Ersatzshirt in meinem Spind«, beruhigte sie mich, lächelte kurz und ging los.
Nick und ich folgten ihr schweigend. Nach kurzer Zeit blieb Hannah vor einem Spind stehen und machte ihn auf. Dann zog sie ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Rock on" heraus.
»Das müsste dir passen.«
»Danke.« Ich lächelte sie an und nahm es in die Hand. Angrenzend ging ich zu den Damen Toiletten um mir das Oberteil anzuziehen. Meinen nassen BH versuchte ich verzweifelt am Handtrockner etwas trocken zu kriegen, jedoch ohne Erfolg, also gab ich es nach ein paar Minuten auf und zog die Kluft über.
Das war ja ein toller erster Schultag; dachte ich mir und trat wieder aus dem WC.
»Super, passt doch wie angegossen«, sagte Hannah fröhlich als sie mich erblickte und grinste mich an.
»Danke nochmal«, gab ich lächelnd zurück.
»Kein Problem. Lasst uns ein wenig frische Luft schnappen«, warf sie ein und zu dritt liefen wir auf den Schulhof.
»Wo bekomme ich denn jetzt was zu essen her?«, fragte ich verzweifelt und im nächsten Moment knurrte schon mein Magen.
»Hier in der Nähe gibt es einen McDonalds«, erwiderte Hannah.
»Hannah, der ist 20 Minuten entfernt«, wehrte Nick sofort ab.
»Hast du etwa Angst, Nicki?«, stichelte Hannah und sah ihn herausfordernd an.
»Also ich bin dabei!«, rief ich schnell, bevor Hannah noch mehr auf seinem Ego herum trampeln konnte.
Wenn ich eines aus meiner einzigen Beziehung gelernt hatte, dann, dass man nie das Ego eines Mannes verletzen sollte. Am Ende sitzt du dann alleine in einem Café, ohne Geld und musst der Bedienung peinlich berührt erklären, wieso du nicht bezahlen kannst. Das Gleiche erklärst du dann auch deiner Mutter, die dann völlig aufgelöst in das Café gerannt kommt und dich vor den ganzen Gästen bloß stellt, die dich nur mitleidig ansehen.