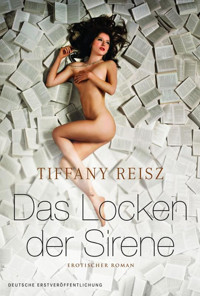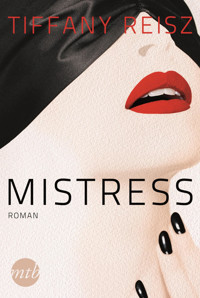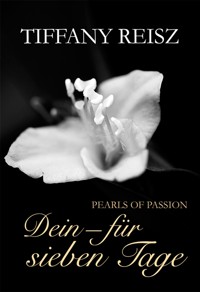8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Sutherlin
- Sprache: Deutsch
Schon als Teenager hat Nora den dominanten Priester Søren geliebt. Er ist derjenige, der ihr die größten Schmerzen bereitet hat - und die besten Orgasmen ihres Lebens. Doch eine richtige Beziehung mit Søren wird nie möglich sein, solange er im Dienst der Kirche steht. Nora kann und will sich nicht mehr verstecken. Deshalb bricht sie aus ihrer Sklavenrolle aus und flieht zu Wes, dem Mann, den sie nie vergessen konnte. Ihr ehemaliger Mitbewohner ist zwar immer noch Jungfrau, aber verführerischer als je zuvor. Hemmungslos gibt sie sich ihrer Lust hin und verbringt eine heiße Nacht mit ihm ? Eine Herausforderung! Denn trotz ihrer tiefen Gefühle für Wes stellt sich Nora die Frage: Kann "normaler" Sex sie wirklich befriedigen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alle Rechte, einschließlich das der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung, des Ab- oder Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten und bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Verlages.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Tiffany Reisz:
Sklaven der Begierde
Aus dem Amerikanischen von Mara Deters
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER erscheinen in der Harlequin Enterprises GmbH, Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2013 by MIRA Taschenbuch in der Harlequin Enterprises GmbH Deutsche Erstveröffentlichung
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe: The Prince Copyright © 2012 by Tiffany Reisz erschienen bei: MIRA Books, Toronto
Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln Redaktion: Maya Gause Titelabbildung: Autorenfoto: © Harlequin Enterprises S.A., Schweiz Satz: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN eBook 978-3-86278-928-3
www.mira-taschenbuch.de
Für Miranda Baker, die mich immer zu der Frage überredet: „Was würde Nora tun?“, wenn ich doch eigentlich fragen will: „Was würde Miranda Baker tun?“
Viel größer als alles auf dieser Erde
Sind Frauen und Krieg
Und Macht und Pferde.
Rudyard Kipling
PROLOG
Aktenzeichen 1312 – dem Archiv entnommen
SUTHERLIN, NORA
Geburtsname: Eleanor Louise Schreiber
Geboren am 15. März 1977 (hütet euch vor den Iden des März)
Vater: William Gregory Schreiber, verstorben (keine Ursache, meine Liebe), saß davor wegen mehrfachen schweren Diebstahls (Autos) und des Besitzes von Diebesgut (Autos) in Attica im Gefängnis. Hatte Verbindungen zum organisierten Verbrechen – siehe Aktenzeichen 1382.
Mutter: Margaret Delores Schreiber, geborene Kohl, 56 Jahre alt. Lebt derzeit zurückgezogen in der Nähe von Guildford, New York, im Kloster der Schwestern der Heiligen Monika, unter dem Namen Schwester Mary John.
Tochter und Mutter sind nicht gerade ein Herz und eine Seele, momentan ist die Situation zwischen den beiden aber entspannt.
Werdegang: Knackte als Teenager fünf Luxusautos in einer Nacht, um ihrem Vater dabei zu helfen, Schulden zurückzuzahlen, und musste als Strafe gemeinnützige Arbeit in der Kirche leisten. Traf hier auf den Priester Father Marcus Lennox Stearns (Søren, Sohn von Gisela Magnussen). Wurde mit achtzehn seine Sub und trug sein Halsband. Mit 28 Jahren verließ sie ihn nach einem Schwangerschaftsabbruch (ich war der Vater). Ein Jahr lang lebte sie bei ihrer Mutter auf dem Gelände des Klosters, kehrte dann in die City zurück und arbeitete im Dienst des umwerfend gut aussehenden Kingsley Edge, Inhaber von Edge Enterprises, als Domina. Zum Zeitpunkt der Aktenerstellung hatte sie zudem fünf Bücher veröffentlicht, von denen vier Bestseller wurden (Aufstellung der Finanzdaten siehe Anlage. Ihr Lektor bei Royal House ist Zachary Easton. Für weitere Auskünfte zu seiner Person siehe Aktenzeichen 2112, Registerfach sieben). Fünf Jahre später, mit 33 Jahren, kehrte sie zu ihrem Besitzer, Søren, zurück und trägt seitdem wieder ihr Sklavenhalsband.
Sexuelle Vorlieben: Sutherlin ist bisexuell, favorisiert Männer. Sie ist eine echte Switch, dominiert aber normalerweise jeden außer ihren Besitzer (weil der sie, wie jeder weiß, zerstören würde, wenn sie es auch nur versuchte). Unterwirft sich nur Søren.
Schwächen: Blondinen, jüngere Männer, Tiramisu.
Ultimative Schwäche: John Wesley Railey, geboren am 19. September in Versailles, Kentucky. Reicher Erbe des Railey-Vermögens (geschätzte 930 Millionen Dollar) und des Gestüts (Rennpferde und Saddlebreds). Railey, genannt Wes oder Wesley, lebte von Januar 2008 bis April 2009 mit Sutherlin zusammen. Der Alleinerbe des größten Gestüts der Welt ist auch als „Prinz von Kentucky“ bekannt. 1,80 Meter groß, Diabetiker, sehr attraktiv, steht nur auf Vanilla-Sex. War zum Zeitpunkt als seine Akte angelegt wurde nicht sexuell aktiv (für weitere Auskünfte zu seiner Person siehe Aktenzeichen 561, Registerfach vier). Sutherlin hat gegenüber Railey starke Emotionen, Zuneigung und Loyalität demonstriert (man kann wahrscheinlich von Liebe sprechen).
Stärken: Mit ihrer extremen Intelligenz (IQ 167) und außergewöhnlichen Schönheit (Fotos siehe Anlage) ist Sutherlin weitaus gefährlicher, als es den Anschein hat.
Die letzte Zeile des Akteneintrags las der Dieb wieder und wieder.
Wann immer Nora Sutherlin im Spiel ist, ist Vorsicht geboten.
Drei Monate … drei lange und nahezu schlaflose Monate lang plagte der Dieb sich mit der Akte, die in einem höchst komplizierten, vielschichtigen Code verschlüsselt war. Der Dieb konnte Französisch und haitianisches Kreolisch, aber allein die Kenntnis der Sprachen würde ihm nicht weiterhelfen. Man musste auch Kingsley Edge kennen, und glücklicherweise kannte der Dieb Kingsley Edge – und zwar sehr gut …
Der Dieb der Akte las die vier Seiten Aufzeichnungen über Nora Sutherlin Tausende Male – so oft, bis die Seiten fast auseinanderfielen und die Worte ihm so vertraut waren wie sein eigener Name. Während dieser Beschäftigung reifte eine Idee in ihm, wurde immer konkreter und schließlich zu einem Plan.
Als der Dieb den Aktendeckel zum allerletzten Mal zuklappte, hatte er sich bezüglich seines weiteren Vorgehens entschieden.
Er würde vorsichtig sein.
NORDEN
DIE VERGANGENHEIT
Sie hatten ihn hierher geschickt, um sein Leben zu retten.
Zumindest war das die Ausrede, die seine Großeltern ihm unterzujubeln versuchten, als sie beschlossen, ihn aus der Privatschule zu nehmen und in dieses Jesuiteninternat zu schicken: mitten im Nirgendwo, an der gottverlassensten Ecke zwischen Kanada und Maine – und nur für Jungs.
Sie hätten ihn sterben lassen sollen.
Er warf sich seine Reistasche über die Schulter, hob den schon arg mitgenommenen braunen Lederkoffer hoch und marschierte über den menschenleeren Campus auf ein Gemäuer zu, das er für das Hauptgebäude hielt. Wohin auch immer er schaute, sah er Kirchen oder zumindest kirchenartige Gebäude. Jedes Dach war von einem Kreuz gekrönt, vor jedem Fenster prangte ein gotisches Eisengitter. Man hatte ihn – ohne ein Wort der Entschuldigung – der Zivilisation entrissen und mitten im feuchten Traum eines mittelalterlichen Mönchs abgesetzt.
Er betrat das Gebäude durch eine schwere eisenbeschlagene Holztür, deren uralte Angeln aufschrien, als würden sie gefoltert. Er konnte das nachfühlen. Ihm war selbst nach Schreien zumute. Ein flackernder Kamin, in dem sich die Holzscheite stapelten, brachte etwas Licht und Wärme in die trostlose graue Eingangshalle. Er kauerte sich davor und schlang die Arme um seinen Oberkörper, eine Bewegung, die ihn leicht zusammenzucken ließ. Sein linkes Handgelenk tat immer noch weh. Er war vor drei Wochen zusammengeschlagen worden. Aufgrund dieser Prügelei waren seine Großeltern davon überzeugt, dass er nur in einer reinen Jungenschule seines Lebens sicher wäre.
Hinter ihm erklang eine joviale Stimme. „Ah, das ist also unser Franzose?“
Er drehte sich um. Ein rundlicher, ganz in Schwarz gekleideter Mann kam auf ihn zu und strahlte von einem Ohr zum anderen. Nein, er war gar nicht komplett in Schwarz, korrigierte er sich. Um den Hals trug der Mann einen weißen Kragen, ein Kollar. Der Priester streckte ihm die Hand entgegen, aber er zögerte, bevor er sie ergriff. Keuschheit kam ihm wie eine Krankheit vor, und er wollte sich nicht anstecken. „Herzlich willkommen in St. Ignatius. Kommen Sie mit in mein Büro. Hier geht’s lang.“
Er sah den Priester mit leerem Blick an, folgte aber der Aufforderung.
Im Büro setzte er sich auf den Stuhl, der dem Kamin am nächsten war. Der Priester nahm hinter einem großen Eichentisch Platz.
„Ich bin übrigens Father Henry“, stellte er sich vor. „Der Monsignore hier. Ich habe gehört, dass Sie an Ihrer alten Schule ein paar Probleme hatten. Irgendwas über eine Prügelei … Ein paar Mitschülern hat nicht gefallen, wie Sie sich ihren Freundinnen gegenüber verhalten haben?“
Statt einer Antwort zuckte er nur mit den Schultern.
„Großer Gott. Man hat mir gesagt, dass Sie ein bisschen Englisch können.“ Father Henry seufzte. „Ich nehme an, mit „ein bisschen“ meinten sie „gar nicht“. Anglais?“
Er schüttelte den Kopf. „Je ne parle pas l’anglais.“
Father Henry seufzte noch einmal.
„Franzose. Natürlich. Warum müssen Sie ausgerechnet ein Franzose sein? Kein Italiener. Kein Deutscher. Ich könnte sogar mit ein bisschen Altgriechisch dienen. Aber nein, es muss Französisch sein. Und der arme Father Pierre ist vor sechs Monaten gestorben. Ach, was soll’s, c’est la vie.“ Er musste über seinen eigenen Scherz lachen. „Macht nichts“, fuhr er dann fort. „Wir kriegen das schon hin.“ Father Henry stützte sich mit seinem Doppelkinn auf seine Hand und starrte, offensichtlich tief in Gedanken versunken, in die Flammen.
Er folgte dem Beispiel des Priesters. Langsam sickerte die Wärme des Kaminfeuers durch seine Kleidung und seine kalte Haut in seinen Körper. Er wollte nur noch schlafen, tagelang, am liebsten sogar jahrelang. Vielleicht würde er dann als erwachsener Mann aufwachen, und niemand könnte ihn je wieder irgendwohin schicken. Der Tag würde kommen, an dem er keine Befehle mehr befolgen würde, von keinem. Und dieser Tag würde der beste seines Lebens sein. Wenn er nur schon da wäre!
Ein leises Klopfen riss ihn aus seinen Träumen.
Ein Junge öffnete die Tür, blieb dann stehen und wartete. Er war etwa zwölf Jahre alt, hatte rotes Haar und trug die Schuluniform: schwarze Hose, schwarze Weste, schwarzes Jackett, schwarzer Schlips und blütenweißes Hemd.
Sein ganzes Leben lang war er stolz auf sein Erscheinungsbild gewesen, seine Kleidung war sorgfältig zusammengestellt, jedes Detail stimmte, bis hin zu den Schuhen. Doch jetzt würde man ihn zwingen, dieselben langweiligen Sachen zu tragen wie jeder andere Junge hier an diesem erbärmlichen Ort. In seinem letzten Jahr am Lycée in Paris hatte er ein bisschen Dante gelesen. Und wenn er sich richtig erinnerte, dann bestand der innerste Höllenkreis aus Eis. Er sah aus dem Fenster von Father Henrys Büro. Es schneite wieder, die Flocken fielen auf den gefrorenen Boden. Vielleicht hatte sein Großvater doch recht. Vielleicht war er ja wirklich ein Sünder. Das würde zumindest erklären, warum er, mit gerade mal sechzehn Jahren und bei lebendigem Leibe, in die Hölle auf Erden geschickt worden war.
„Vielen Dank, Matthew. Komm bitte rein.“ Father Henry winkte den Jungen zu sich heran. Der Junge, Matthew, warf ihm neugierige Blicke zu, während er vor dem Schreibtisch so etwas wie Haltung annahm. „Wie lange hattest du Französischunterricht bei Father Pierre, bevor er starb?“
Matthew trat nervös von einem Fuß auf den anderen. „Une année?“
Father Henry lächelte ihn freundlich an. „Das ist kein Test, Matthew. Nur eine Frage. Du darfst Englisch sprechen.“
Der Junge stieß einen erleichterten Seufzer aus.
„Ein Jahr, Father. Und ich war nicht besonders gut.“
„Matthew, das ist Kingsley …“, Father Henry unterbrach sich und schaute auf die Akte, die vor ihm lag, „… Boissonneault?“
Kingsley wiederholte seinen Nachnamen und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie schrecklich Father Henry ihn verstümmelt hatte. Dämliche Amerikaner.
„Ja, Kingsley Boissonneault. Ein neuer Mitschüler. Aus Portland.“
Kingsley musste seine ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um den Father nicht zu korrigieren und darauf hinzuweisen, dass er nur sechs Monate in Portland gelebt hatte. Paris. Nicht Portland. Er war aus Paris. Aber wenn er das tat, dann würde er offenbaren, dass er Englisch nicht nur verstehen konnte, sondern sogar perfekt sprach. Und er hatte nicht die geringste Absicht, mit den Bewohnern dieses grässlichen Höllenlochs auf irgendeine Weise zu kommunizieren.
Matthew lächelte ihn zaghaft an. Kingsley erwiderte das Lächeln nicht.
„Nun ja, Matthew, selbst wenn dein Französisch doppelt so gut ist wie meins, bringt uns das nicht wirklich weiter.“ Zum ersten Mal während des Gesprächs verging Father Henry sein fröhliches Grinsen. Er wirkte plötzlich angespannt, besorgt und genau so nervös wie Matthew. „Du wirst wohl zu Mr Stearns gehen müssen und ihn darum bitten, hierherzukommen.“
Als er den Namen „Mr Stearns“ hörte, riss Matthew seine Augen so weit auf, dass sie ihm aus dem Gesicht zu plumpsen drohten. Kingsley hätte beinahe laut losgelacht. Doch als er feststellte, dass Father Henry Matthews Reaktion offenbar nicht so lustig fand wie er, wurde auch ihm etwas mulmig zumute.
„Muss ich wirklich?“, fragte Matthew kläglich.
Father Henry atmete schnaubend aus. „Er wird dich schon nicht beißen“, sagte er dann, aber es klang nicht besonders überzeugt.
„Aber es ist jetzt 4:27 Uhr“, gab Matthew zu bedenken.
Der Priester zog eine gequälte Grimasse. „Oh, tatsächlich? Nein, dann dürfen wir die Sphärenmusik natürlich nicht stören. Das heißt, du wirst diese Aufgabe jetzt wohl oder übel übernehmen müssen. Vielleicht können wir Mr Stearns ja später dazu überreden, sich mit unserem neuen Schüler zu unterhalten. Führ Kingsley herum, zeige ihm alles. Gib einfach dein Bestes.“
Matthew nickte und forderte Kingsley mit einer Geste auf, ihm zu folgen. Im trostlosen Foyer blieben sie stehen. Der Junge wickelte einen Schal um seinen Hals und zog Handschuhe an. Dann sah er Kingsley an und wirkte dabei hoch konzentriert.
„Ich kenne das französische Wort für Foyer nicht.“
Kingsley unterdrückte ein Lächeln. Das französische Wort für „Foyer“ war foyer.
Draußen im Schnee drehte Matthew sich um und zeigte auf das Gebäude, das sie gerade verlassen hatten. „Da drin haben alle Fathers ihre Büros. Les pères … bureau?“
„Bureau, oui“, wiederholte Kingsley, und Matthew strahlte ihn an, sichtlich beglückt darüber, ihm eine Äußerung entlockt zu haben.
Kingsley folgte dem Jungen in die Bibliothek, wo Matthew verzweifelt nach dem französischen Wort für diesen Ort suchte. Dass die unendlichen Reihen von Bücherregalen eigentlich gar keinen Zweifel daran ließen, in was für einer Art Raum sie sich befanden, schien ihm gar nicht aufzufallen.
„Bibliothek …“, sagte er. „Trois …“ Offenbar wollte er erklären, dass das Gebäude drei Stockwerke hatte. Allerdings kannte er das Wort für „Stockwerke“ genau so wenig wie das für „Bibliothek“, daher behalf er sich damit, seine Hände dreimal aufeinanderzulegen. Kingsley nickte, als verstehe er, was der Junge meinte, obwohl das Ganze eher so aussah, als ob Matthew ein ungewöhnlich großes Sandwich beschrieb.
Ein paar der Sessel waren besetzt, und die anwesenden Schüler musterten Kingsley mit unverhohlener Neugier. Sein Großvater hatte ihm erzählt, dass St. Ignatius nur vierzig bis fünfzig Schüler hatte. Einige von ihnen kamen aus reichen katholischen Familien, die eine traditionelle jesuitische Erziehung für ihren Nachwuchs wünschten. Die anderen waren junge Männer, die schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Sie waren auf Anordnung des Richters hier, um in der Obhut der Priester zu gesetzestreuen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen zu werden. Da alle die gleiche Schuluniform und die gleichen zottigen Frisuren trugen, konnte Kingsley die Söhne aus gutem Hause nicht von den Problemfällen unterscheiden.
Matthew führte ihn aus der Bibliothek heraus. Das nächste Gebäude auf seiner Liste war die Kapelle. Er zögerte kurz, bevor er zum Türknauf griff, und legte den Zeigefinger auf die Lippen. Dann öffnete er die Tür so vorsichtig, als wäre sie aus Glas, und schlüpfte hindurch. Kingsley spitzte die Ohren, als er die Pianoklänge vernahm. Wer immer da spielte, war zweifellos ein Virtuose.
Matthew schlich auf Zehenspitzen in die Kapelle und näherte sich nahezu lautlos der Tür zum Altarraum. Kingsley folgte ihm entschieden weniger ehrfürchtig und spähte hinein.
Am Klavier saß ein junger Mann … sehr schlank, fast schon hager, hellblond. Sein Haarschnitt war sehr viel konservativer als Kingsleys eigene schulterlange Mähne.
Kingsley sah zu, wie die Hände des blonden Pianisten über die Tasten tanzten und dem Instrument dabei die wunderbarsten Töne entlockten, die er je gehört hatte.
„Ravel …“, flüsterte er. Ravel, der größte aller französischen Komponisten.
Matthew schaute ihn erschrocken an und forderte ihn erneut mit einer unmissverständlichen Geste zum Schweigen auf. Kingsley konnte nur verächtlich den Kopf schütteln. Was war sein Begleiter doch für ein elender kleiner Feigling. Dabei verbot Feigheit sich doch von selbst bei dieser Musik.
Ravel war der Lieblingskomponist seines Vaters gewesen, und er war auch zu Kingsleys Lieblingskomponisten geworden. Er hatte die Leidenschaft, die Sehnsucht, das Verlangen in jeder Note gehört, sogar durch die Kratzer auf den Vinylplatten seines Vaters hindurch. Ein Teil von ihm wollte jetzt nichts anderes, als die Augen zu schließen und die zauberhaften Klänge zu genießen.
Doch ein anderer Teil von ihm konnte sich einfach nicht vom Anblick des jungen Mannes am Klavier losreißen, der das Stück spielte – Ravels Klavierkonzert in G-Dur. Er hatte es sofort erkannt. Wenn es in kompletter Instrumentation aufgeführt wurde, begann es mit einem Peitschenknall.
Aber er hatte es noch nie so intensiv wahrgenommen wie in diesem Moment. So intim, so nah. Als müsste er nur die Hand ausstrecken, um die Noten aus der Luft zu fangen, sie in den Mund stecken und hinunterschlucken. So schön … die Musik und der junge Mann, der sie spielte. Kingsley lauschte den Klängen und betrachtete den Pianisten. Er konnte nicht sagen, was ihn mehr berührte.
Der Pianist war ohne jede Frage der attraktivste junge Mann, den Kingsley in seinen sechzehn Lebensjahren gesehen hatte. So eitel er auch war, er musste doch anerkennen, dass hier tatsächlich jemand saß, der mindestens genauso gut aussah wie er selbst. Dabei war der Pianist nicht einfach nur extrem attraktiv, er war in gewisser Weise so schön wie die Musik, die er spielte. Er trug zwar die Schuluniform – das Jackett hatte er abgelegt, wohl, um die Arme freier bewegen zu können –, aber er glich den anderen Jungs nicht im Geringsten. Er kam Kingsley vor wie eine Statue, die ein Zauberer zum Leben erweckt hatte. Seine blasse Haut war glatt und makellos, seine Nase elegant geschwungen, sein Gesicht blieb vollkommen ruhig, während er dem schwarzen Kasten vor ihm die prächtigsten, herrlichsten Töne entrang.
Wenn nur … wenn nur Kingsleys Vater hier wäre, um diese Musik zu hören. Wenn nur seine Schwester, Marie-Laure, hier wäre, um dazu zu tanzen. Für einen kurzen Moment gestattete Kingsley es sich, um seinen Vater zu trauern und seine Schwester zu vermissen. Doch die Musik dämpfte den Schmerz, und Kingsley merkte, dass er lächelte.
Das hatte er dem jungen Mann, dem schönen blonden Pianisten, zu verdanken. Der ihm diese Musik geschenkt hatte und damit die Möglichkeit, einmal an seinen Vater zu denken, ohne vom Schmerz überwältigt zu werden. Kingsley machte Anstalten, den Altarraum zu betreten, doch Matthew packte seinen Arm und schüttelte warnend den Kopf.
Die Musik verstummte. Der blonde Pianist senkte die Arme und starrte ein paar Sekunden lang auf die Tastatur, fast wie im Gebet, bevor er den Deckel schloss. Als er aufstand, konnte Kingsley erkennen, dass er mindestens einen Meter achtzig groß war. Vielleicht sogar noch größer.
Matthew schien wie gelähmt vor Angst. Der blonde junge Mann zog sein schwarzes Jackett an und kam mit langsamen Schritten auf sie zu. Aus der Nähe betrachtet sah er noch besser aus, wirkte aber gleichzeitig seltsam undurchschaubar. Er kam Kingsley vor wie ein geheimnisvolles Buch, das in einem gläsernen Kasten eingeschlossen war, und er hätte alles darum gegeben, den Schlüssel zu besitzen. Der junge Mann sah ihn an, und in seinen stahlgrauen Augen war keine Spur von Freundlichkeit zu erkennen. Keine Freundlichkeit … aber auch keine Grausamkeit. Er atmete nervös ein, als der Pianist an ihm vorbeiging, und roch den unverkennbaren Duft des Winters.
Ohne ein Wort an ihn oder Matthew zu richten, verließ der junge Mann die Kirche.
„Stearns“, flüsterte Matthew, als er weg war.
Sieh an. Das war also der mysteriöse Mr Stearns, der seinen Mitschülern und Father Henry so viel Furcht und Respekt einflößte. Faszinierend … Kingsley war noch niemals jemandem begegnet, der auf Anhieb so furchterregend wirkte. Kein Lehrer, kein Eltern- oder Großelternteil, kein Polizist und kein Priester hatte ihn jemals fühlen lassen, was er gefühlt hatte, als er sich im selben Raum aufhielt wie der Pianospieler, Mr Stearns.
Kingsley schaute nach unten und sah, dass seine Hand ganz leicht zitterte. Matthew sah es auch.
„Du brauchst dich nicht zu schämen.“ Der Junge nickte ihm verschwörerisch zu. „Das geht jedem so.“
NORDEN
DIE GEGENWART
Die Angst war das Beste gewesen. Diese Angst, die ihn verfolgt hatte wie die Schritte, die er plötzlich hinter sich hörte. Er hatte sich in den Wald geflüchtet, um seinen seltsamen Gefühlen zu entkommen – und dort etwas viel Besseres als Sicherheit gefunden. Die Schritte – wie hatte sein Herz gerast, als sie lauter wurden, näher kamen. Er hatte Angst gehabt, weiterzulaufen, Angst, dass er dann entkommen würde. Er war weggelaufen, um gefangen zu werden. Das war der einzige Grund.
Kingsley erinnerte sich, wie er nach Luft geschnappt hatte, als sich eine unnachgiebig starke Hand um seinen Hals legte … Die raue Rinde des Baumstamms an seinem Rücken … Der Geruch von Nadelhölzern, so überwältigend, dass er auch heute noch, dreißig Jahre später, hart wurde, sobald er das Aroma von Kiefern roch. Und danach, als er auf dem Waldboden wieder zu sich gekommen war, nahm er einen neuen Duft auf seiner Haut wahr – Blut, sein Blut … und … Winter.
Drei Jahrzehnte später war er noch immer außerstande, Sex von Angst zu trennen. Beides war in seinem Herzen untrennbar miteinander verwoben, für alle Ewigkeit. Und er bereute es nicht. Er hatte an jenem Tag die Macht der Angst kennengelernt, aber auch das Vergnügen, das sie schenken konnte, und heute, dreißig Jahre später, war Angst Kingsleys Spezialität.
Leider war seine Juliette im Moment nicht verängstigt.
Aber das konnte er ändern.
Kingsley beobachtete sie aus den Augenwinkeln, während er einen Schluck Wein trank. Sie stand zwischen Griffin und dem jungen Michael und lächelte mal den einen, mal den anderen an. Die beiden kauten ihr gerade eines ihrer zauberhaften Ohren ab, mit der tollen Geschichte, wie Nora Sutherlin sie zusammengebracht hatte. Für einen einzigen wunderbaren Tag, an dem er nichts über die erstaunliche Nora Sutherlin hören musste, würde er sein halbes Vermögen geben. Er würde es mitten auf der Fifth Avenue auf einen Scheiterhaufen legen, anzünden und zusehen, wie es zu Asche zerfiel. Ach, wenn es nur so einfach wäre, das Monster, das er erschaffen hatte, zu zerstören.
Nein, korrigierte er sich. Das Monster, das wir erschaffen haben.
Juliette blickte in seine Richtung und schenkte ihm ein heimliches Lächeln, eines, das keiner Übersetzung bedurfte. Aber er würde noch warten, sich alle Zeit der Welt nehmen. Sollte sie ruhig denken, dass er heute Abend nicht in der richtigen Stimmung war. So würde ihre erwartungsvolle Vorfreude sich immer mehr steigern – um dann der Angst zu weichen. Wie wunderbar seiner Juliette die Angst stand, wie unwiderstehlich sie in ihren braunen Augen schimmerte, wie erregend sie über ihre ebenholzschwarze Haut zitterte, wie hinreißend sie sich in ihrer Kehle fing, wenn er ihren Schrei mit der Hand erstickte …
Kingsleys Lenden zogen sich zusammen, sein Herzschlag beschleunigte sich. Er stellte sein Weinglas ab und schlenderte von der Bar durch den Lagerraum ins Vorzimmer des achten Zirkels. Gleich hinter der Tür stieß sein Fuß an ein unerwartetes Hindernis. Neugierig bückte er sich. Schuhe. Ein Paar Schuhe. Er hob sie auf. Weiße Lack-Stilettos, Größe siebenunddreißig.
Diese Schuhe hatte er zuletzt an den Füßen von Nora Sutherlin gesehen.
Kingsley starrte die Stilettos an und fragte sich, wie und warum sie hier im Flur hinter der Bar gelandet waren. Nora brachte in ihren High Heels so ziemlich alles fertig. Er hatte sie darin schon die abgebrühtesten Masochisten beherrschen sehen. Sie hatte sie geschlagen, mit der Neunschwänzigen traktiert, getreten … Sie konnte mit diesen hohen Absätzen auf dem Hals eines Mannes stehen, über seinen blau geschlagenen Rücken laufen oder auf einem Bein balancieren, während der Sub ihren anderen Fuß leckte.
Er wusste nur von einer Sache, die Nora in ihren schwindelerregend hohen Stilettos nicht konnte: weglaufen.
Er nahm die Schuhe mit in die unterste Etage, wo er und ein paar andere VIPs ihre privaten Dungeons hatten. Vor der letzten Tür auf der linken Seite zögerte er kurz, trat dann aber ein, ohne anzuklopfen.
Ein großer blonder Mann stand neben einem Bett. Er schien tief in Gedanken versunken, die Stirn gerunzelt, die Arme vor der Brust verschränkt.
„Schon mal was von Anklopfen gehört?“ Søren ließ die Arme sinken und lehnte sich an den Bettpfosten. Kingsleys Kiefermuskeln verkrampften sich.
„Ich habe Gerüchte darüber gehört, aber nie wirklich ans Anklopfen geglaubt.“ Er machte ein paar weitere Schritte ins Zimmer. Kein anderer Dungeon im Zirkel verdeutlichte das Konzept des Minimalismus besser als Sørens: ein Andreaskreuz in der Mitte des Raums, ein eisernes Himmelbett in einer Wandnische, ein Schrankkoffer mit diversen Folterutensilien – das war’s. Sørens sadistisches Genie war legendär, nicht nur im Zirkel, sondern im gesamten Untergrund. Er brauchte keine tausend Varianten von Riemenpeitschen und Floggern, nicht mehrere Dutzend Paddel, Gerten, Rohrstöcke. Derlei Spielzeug hatte Søren nicht nötig. Der Mistkerl konnte einen Sub mit einem Wort brechen, mit einem Blick, mit ein paar scharfen, passenden Befehlen. Seine kalte ruhige Dominanz ließ selbst die Stärksten zu seinen Füßen erbeben. Er schüchterte sie erst mit seiner Attraktivität ein und dann mit seiner Brutalität. Der Schöne war ein Biest.
„Ich habe dir etwas mitgebracht.“ Kingsley hielt ihm die Schuhe entgegen.
Søren hob missbilligend seine Augenbrauen. „Das ist nicht meine Größe.“
„Die gehören deinem Haustier.“ Kingsley warf die Stilettos aufs Bett. „Wie du sehr wohl weißt. Schließlich musst du drüber gestolpert sein, als du aus der Bar gegangen bist.“
„Ich habe sie dorthin gelegt, damit sie sie findet, falls sie zurückkommt.“
Kingsley lachte freudlos. „Wenn ich mich nicht verhört habe, hast du sie doch gebeten, dich – sofern sie noch einen Hauch von Barmherzigkeit in ihrem schwarzen Herzen hat – nicht für ihren Wesley zu verlassen.“
Statt einer Antwort starrte Søren Kingsley nur an, mit Augen wie aus flüssigem Stahl. Kingsley unterdrückte ein Grinsen. Schadenfreude war so ein unkleidsames Gefühl. Er nahm sich zusammen, solange er konnte. Dann drehte er sich auf dem Absatz um, rauschte aus dem Zimmer und ließ Søren in seinem Dungeon sitzen, mit Noras Schuhen auf dem Bett als einziger Gesellschaft. Dabei rezitierte er ein altes Gedicht.
„Sah Könige blass und Königskind,
todbleiche Ritter, Mann an Mann,
die schrien: ‚Die schöne Dame ohne Gnade
hält dich in ihrem Bann!‘“
Kingsley begab sich in seinen eigenen Dungeon und ging unruhig auf und ab, während er wartete. Hier stand, anders als bei dem Priester, das Bett im Mittelpunkt des Raumes. Für Søren war Schmerz Sex. Vermutlich könnte er ohne Weiteres enthaltsam leben, wie die Kirche es von ihm verlangte, wenn da nicht Nora wäre, seine Eleanor, die das Fleischliche so sehr brauchte wie Kingsley die Angst. Er wollte sich gar nicht erst vorstellen, was für einen Wutanfall sie bekäme, wenn ihr Besitzer beschließen würde, ihre sexuellen Bedürfnisse zu ignorieren. Natürlich würde Søren so etwas niemals tun. Er kam zum Höhepunkt, indem er ihr Schmerz zufügte … der Sex war für ihn reines Nachspiel. Und wer genoss nicht gern ein gepflegtes Nachspiel?
Als er die Dielen im Flur draußen vor seinem Zimmer knarren hörte, blieb Kingsley stehen und schlich lautlos zur Tür. Er war, nachdem er die Schule verlassen hatte, zwei Jahre lang in der Fremdenlegion gewesen, und fünf weitere Jahre hatte er so getan, als sei er immer noch dort, während er seinem Land auf andere, unauffälligere Weise gedient hatte. Er hatte seine Spionage-Lektionen gut gelernt. Sieh alles, aber lass dich niemals sehen. Höre alles, aber lass dich niemals hören. Als Juliette durch die Tür schlüpfte, in der sicheren Erwartung, ihn im Bett anzutreffen, packte er ihren Arm. Sie schnappte erschrocken nach Luft.
Perfekt.
Er legte seine Hand auf ihren Mund und erstickte so ihren Schrei. Dann stieß er sie gegen die Wand und warf die Tür mit einem gezielten Fußtritt ins Schloss. Juliette versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. Zwar hatte seine zierliche Geliebte mit ihren knapp ein Meter sechzig keine Chance gegen ihn, aber das hielt sie nicht davon ab, sich wie eine Löwin zu wehren. Sie grub ihre Absätze in den Parkettboden, als er sie zum Bett schleifte, wand sich in seinen Armen und wimmerte laut hinter seiner Hand. Mein Gott, sie war genauso gut in diesem Spiel wie er. Obwohl sie schon ganz verrückt war vor Verlangen, lieferte sie einen unglaublich beeindruckenden Kampf ab. Dabei wusste er doch ganz genau, dass sie ihn ebenso sehr begehrte wie er sie, vielleicht sogar mehr.
Er lockerte seinen Griff um ihre Handgelenke gerade lange genug, um sie umzudrehen. Heute Nacht wollte er sie mit dem Gesicht nach unten, über das Bett gebeugt, ihm hilflos ausgeliefert. Spreizeisen, Handschellen, Fußfesseln und Stricke blieben unbeachtet an den Wänden hängen. Er hielt sie lieber mit seinem Körper fest als mit irgendwelchen Hilfsmitteln.
„Monsieur …“, keuchte sie, als er ihr einen Stoß versetzte, sodass sie quer über das Bett flog. Ihre Augen waren furchtsam aufgerissen, auf ihrer Haut breitete sich der Duft nach Angst und Schweiß aus, berauschender als jedes Parfum. „Non … s’il vous plaît …“
Ihre flehende Stimme brach, und Kingsley hätte fast gelacht. Die knallharten Verfechter der These „Nein heißt nein“ kannten seine Juliette nicht. Das hier war nicht nur sein Lieblingsspiel, es war auch ihres.
Kingsley packte sie am Nacken und drückte ihr Gesicht ins Kissen, um sie zum Schweigen zu bringen. Mit der freien Hand riss er ihr Kleid auf. Sie sah so hübsch aus in Weiß, der Stoff leuchtete geradezu auf ihrer dunklen Haut. Er hatte sie vor Jahren an einem Strand in Haiti kennengelernt. Sie war achtzehn gewesen, fast noch ein Kind, aber sie hatte bereits großes Elend durchlitten. Er nahm sie mit zurück und machte sie zu seinem Besitz. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie jemals vergessen sollte, wem sie jetzt gehörte … frischte er eben regelmäßig ihr Gedächtnis auf. So wie jetzt.
Er spreizte ihre Beine mit seinen Knien und öffnete den Reißverschluss seiner Hose. Als er in sie hineinstieß, schrie sie so laut auf, dass jeder auf dieser Etage sie gehört haben musste. Aber das spielte keine Rolle. Keiner würde ihr zu Hilfe kommen.
Er ritt sie hart, mit brutalen Stößen. Sein Herz raste, und er versuchte sich mit tiefen Atemzügen zu einem ruhigeren Rhythmus zu zwingen. Kingsley wollte diesen Augenblick auskosten, ihre exquisite Angst genießen wie einen edlen Wein. Niemals stürzte er sich sofort auf diese Angst. Nein, er dekantierte sie, ließ sie atmen, bevor er sie in tiefen Zügen in sich aufnahm.
Denn manchmal vergaß Juliette, dass er es war, ihr Kingsley, und verlor sich in Erinnerungen an den Mann, der ihr ebenfalls so etwas angetan hatte – aber aus Hass, nicht aus Liebe. Und wenn sie dann unter ihm erstarrte und aufhörte, sich zu wehren, wusste Kingsley, dass sie reif war für ihn.
Er lebte für diese Momente.
Ihre Schmerzensschreie waren die süßesten Klänge, die er sich vorstellen konnte. Sie allein konnten die Musik übertönen, die er im Kopf hatte, sobald er aufwachte. Und die erst wieder verstummte, wenn der Schlaf ihm glückliche Bewusstlosigkeit schenkte. Ein Klavierkonzert, vor dreißig Jahren gehört, ein einziges Mal – aber er konnte es bis heute nicht vergessen.
Juliettes Atem beschleunigte sich. Sie machte einen letzten tapferen Fluchtversuch, doch Kingsley riss ihre Arme hinter ihren Rücken, hielt sie dort fest und raubte ihr so jede Bewegungsfreiheit. Er stieß noch einmal in sie hinein, hart, und noch einmal, und als Juliette sich schließlich dem Orgasmus ergab, den sie so lange bekämpft hatte, und ihre inneren Muskeln ihn fest umschlossen, kam auch Kingsley mit einem lustvollen Schauer.
Er blieb in ihr und genoss die wundervolle Leere nach dem Höhepunkt. Seine Landsleute hatten ja so recht, wenn sie von la petite morte sprachen, vom kleinen Tod. Er starb in ihr, und er genoss diesen Tod, diese Freiheit, diese paar Sekunden, in denen er von dem Zauber erlöst war, den der einzige Mann im Untergrund, der niemandem gehörte, auf ihn ausübte.
Juliettes leises Lachen riss ihn aus seinen Gedanken. Er stimmte ein, gab ihre Hände frei, zog sich aus ihr zurück und legte sich entspannt auf den Rücken. Sie ordnete ihre Kleidung, so gut es eben ging, und kuschelte sich an seine Brust.
„Du hast mir Angst eingejagt, Monsieur. Ich dachte, du wärst noch bei le père.“
„Ich wollte dir Angst einjagen. Und, nein, er betet, je pense.“
„Worum betet er denn?“ Juliette hob den Kopf und sah Kingsley an. Er streichelte ihre Wange. Seine schöne Juliette, seine Jules, sein Juwel. Er liebte sie über alles. Fast über alles … Es gab nur einen Menschen, den er noch mehr liebte als sie. Aber diesen einen Menschen hasste er gleichzeitig mit ebensolcher Inbrunst. Wenn doch nur die Liebe nach den Gesetzen der Mathematik funktionieren würde – dann würden sein Hass und seine Liebe einander ausgleichen. Er würde nichts fühlen. Statt doppelten Schmerz.
„Darum, dass sein entlaufenes Haustier bald zu ihm zurückkommt, nehme ich an.“
Juliette seufzte und legte sich wieder hin.
„Aber sie ist nicht verloren.“ Sie küsste seine Brust. „Sie ist nur ohne Leine unterwegs.“
Kingsley lachte.
„Oh nein, es ist viel schlimmer, mon amour. Sein Haustier ist wieder mal weggelaufen, und diesmal ohne ihr Halsband.“
SÜDEN
Hoffentlich hatten Wesleys Eltern noch nie etwas von ihr gehört. Dann wäre alles gut. Warum hätten sie auch von ihr gehört haben sollen, einer New Yorker Erotikautorin, Spezialgebiet BDSM? Konnte man ihre Bücher überhaupt in Kentucky kaufen? Allein die Vorstellung war schon absurd. Alles würde Friede, Freude, Eierkuchen sein. Bestimmt.
Als sie die Mason-Dixon-Linie überquerten und damit offiziell im Süden waren, seufzte Nora. Als sie Stunden später die Grenze zu Kentucky passierten, krampfte sich ihr Magen zusammen.
Was zum Teufel machte sie in Kentucky?
Nachdem der erste Schock des Wiedersehens überwunden war, hatte sie versucht, Wesley dazu zu überreden, mit ihr in Connecticut zu bleiben. Aber er war ungewohnt beharrlich gewesen.
„Kentucky“, sagte er.
„Bitte“, sagte er.
„Ich habe in deiner Welt gelebt. Jetzt möchte ich, dass du eine Weile in meiner Welt lebst“, sagte er.
Schließlich hatte sie nachgegeben. Sie konnte und wollte einfach nie mehr Traurigkeit in seinen großen braunen Augen sehen. Aber immerhin schaffte sie es, ihren Wunsch durchsetzen, mit getrennten Autos anzureisen. Er fuhr seinen Mustang, sie ihren Aston Martin, den Griffin ihr zurückgebracht hatte. Nora begab sich niemals ohne Fluchtmöglichkeit in eine unbekannte Situation. Diese Lektion hatte sie während ihrer Jahre als professionelle Domina gelernt. Sie konnte ihre Dienste nicht einfach nur deshalb so unglaublich teuer verkaufen, weil sie schöner und strenger als die Konkurrenz war. Sondern weil sie machte, was die meisten Professionellen niemals taten: Sie arbeitete nicht in einem gut behüteten Dungeon mit viel Sicherheitspersonal, sondern sie besuchte ihre Kunden zu Hause oder im Hotel.
Rückblickend nannte sie diese Zeit im Scherz „Mistress Noras Lehr- und Wanderjahre“. Tatsächlich war sie viel gereist. Von New York nach New Orleans, von Midtown Manhattan in den Nahen Osten oder wohin auch immer Kingsley sie sonst geschickt hatte. Ihre persönliche Sicherheit beruhte im Wesentlichen auf zwei Dingen: Sie galt als gefährlichste Domina der Welt und Kingsley als der letzte Mann, mit dem man sich in Amerika anlegen würde. Sie brauchte nur ihren oder seinen Namen zu nennen, und die gesamte Unterwelt stand stramm.
Doch jetzt betete Nora darum, dass dort, wohin sie unterwegs war, keiner je von ihr gehört hatte. Vor allem Wesleys Eltern nicht. Doch wenn die wirklich so konservativ waren, wie Wesley sie hinstellte, hatten sie garantiert noch niemals in der Erotikabteilung eines Buchladens gestöbert. Geschweige denn den Namen Nora Sutherlin gehört.
Aber fragen kostete ja nichts. Sie angelte ihr Handy aus der Handtasche und rief Wesley an.
„Ja, wir sind gleich da“, antwortete er, bevor sie noch Hallo sagen konnte. Nora hatte ihn jede volle Stunde angerufen, um zu fragen: „Sind wir bald da?“
„Darum rufe ich gar nicht an.“
„Bist du sicher?“
„Nö. Sag mal, du hast mir noch gar nicht erzählt, was deine Eltern eigentlich davon halten, dass ich zu Besuch komme.“
„Sie haben nie was dagegen, wenn ich Besuch bekomme. Viele meiner Collegefreunde waren im Sommer da.“
Nora presste ihre Lippen zusammen. Wäre Wesley nicht in dem gelben Mustang zwei Autos vor ihr gewesen, hätte sie ihn jetzt mit einem strafenden Blick bedacht.
„Das ist eine klassische Nichtantwort, Kleiner.“
„Nein, es ist wirklich alles in Ordnung.“ Er lachte, und Nora musste unwillkürlich lächeln. Gott, wie hatte sie in den fünfzehn Monaten, in denen sie sich nicht gesehen und nicht gesprochen hatten, das Lachen dieses Jungen vermisst. Wesley hatte in ihrem Leben eine Leere hinterlassen, die weder Sex noch Geld, weder Laster noch Ruhm hatten füllen können.
„Im Ernst, Nor. Meine Eltern sind nett. Sie mögen meine Freunde.“
„Freunde. Gut. Dann sind wir eben für den Anfang einfach nur Freunde. Wir können das ja mal üben: Du sagst: ‚Ma, Pa …‘“
„Du verwechselst meine Familie schon wieder mit den Waltons.“
„Ruhe, John-Boy, wir üben jetzt. Also, du sagst: ‚Mutter, Vater, das ist meine Freundin Nora. Ich habe in Connecticut für sie gearbeitet. Jetzt will sie mich einfach nur besuchen und auch bestimmt keinen Ärger machen.‘“
„Ich glaube nicht, dass ich dabei ernst bleiben kann.“
„Genau deshalb üben wir das ja auch, Euer Gnaden.“
Wesley stöhnte, und jetzt war Nora mit dem Auslachen dran.
„Das wirst du mir immer vorhalten, oder?“
Nora konnte sich genau vorstellen, wie er sich gerade seine Stirn rieb – frustriert und gleichzeitig amüsiert.
„Dein Titel gefällt mir halt. Der Prinz von Kentucky. Klingt sehr sexy.“
„Nur weil ein dämlicher Journalist mich vor drei Jahren in einem Artikel so genannt hat …“
„Ja, ja, in einem Artikel über dich und Prinz Harry beim Kentucky Derby. Schon total verrückt, dass Harry inzwischen der sexy Royal ist. Kannst du mir seine Nummer geben?“
„Der Kontakt ist abgerissen.“
„Also, wenn du der Prinz von Kentucky bist“, fuhr Nora fort, nicht im Geringsten geneigt, ein Thema fallen zu lassen, das Wesley so wunderbar verlegen machte, „wer ist dann die Prinzessin? Bist du der Tochter des Gouverneurs versprochen oder so was?“
„Oh Gott, hoffentlich nicht.“
„Warum? Ist sie so hässlich?“
„Sie ist eine sehr süße Neunjährige.“ Am Himmel zeigten sich jetzt die ersten Sterne. Wenn sie die Geschwindigkeit beibehielten, würden sie in einer Stunde am Ziel sein. „Außerdem ist sie meine Cousine.“
Nora stöhnte auf. War ja klar, dass Wesley nicht einfach nur der Sohn reicher Pferdezüchter sein konnte. Nein, er musste außerdem noch mit dem Gouverneur verwandt sein. Ihr armer kleiner Praktikant … von dem sie angenommen hatte, er besäße kein Geld, keine Verbindungen, nichts. Was hatte er ihr sonst noch verschwiegen?
„Hey, du weißt doch, was man über Kentucky sagt …“
„Du bist geschmacklos.“
„Das stimmt. Außerdem gewinne ich.“ Nora trat aufs Gaspedal und überholte den Mustang. Wesley fand es offenbar gar nicht lustig, auf seinem eigenen Territorium den Kürzeren zu ziehen. Im Rückspiegel sah sie, dass er ebenfalls Gas gab. „Keine Angst, Kleiner, ich habe keine Ahnung, wo’s langgeht. Du gewinnst das Rennen also auf jeden … Oh, du heiliger Strohsack. War das mal ein Schloss?“
Nora verdrehte den Hals, um das Gebäude mit den vielen Türmen, an dem sie gerade vorbeifuhren, in seiner ganzen Pracht zu sehen.
„Nein. Na ja, doch, irgendwie schon. Jetzt ist es ein Hotel. Aber es war tatsächlich mal so was wie ein Schloss. Ein Verrückter hat es vor Jahren für seine Frau gebaut. Sie träumte davon, in einem Schloss zu leben. Aber dazu kam es nicht mehr.“
Nora runzelte die Stirn. „Wie traurig. Sie ist gestorben, bevor das Schloss fertig war?“
„Nee. Sie hat sich scheiden lassen.“
Nora lachte und gönnte sich im Rückspiegel noch einmal den seltsamen Anblick eines Schlosses mitten in der Prärie.
„Manchen Frauen kann man es aber auch nie recht machen. Ich glaube, ich wäre mit einem Mann, der mir ein so hübsches Anwesen baut, zusammengeblieben.“
Sie hörte Wesleys Lachen. Hatte sie ihn schon jemals so lachen hören? Ein bisschen kehlig, ein bisschen arrogant und sehr, sehr sexy …
„Warte nur, bis du mein Schloss siehst.“
„Sind wir bald da?“, fragte sie und legte schnell auf.
Nora folgte den Rücklichtern des Mustangs bis in eine Stadt namens Versailles, was Wesley wahrscheinlich zu „Ver-sales“ verstümmeln würde. Sie bogen in eine dunkle kurvenreiche Straße ein und drosselten das Tempo. Während der gesamten Fahrt hatte Nora versucht, ihre Nerven unter Kontrolle zu bringen. Alles war gut. Alles würde noch besser werden. Sie hatte ihren Wesley wieder.
Dabei hatte sie sich schon damit abgefunden, auf ihn verzichten zu müssen. Während des Sommers war ihr klar geworden, dass sie nicht gleichzeitig Sørens Besitz und Wesleys … was auch immer sein konnte. Das Leben mit Søren kam ihr oft vor wie ein schönes Gefängnis – ein Gefängnis, das sie sich selbst ausgesucht hatte und niemals verlassen würde. Doch etwas fehlte dort: Wesley!
„Verdammte Scheiße.“ Nora schnappte entgeistert nach Luft. „Das ist ja ein Palast.“
Vor ihr prangte, beleuchtet wie der Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center, das wahnsinnigste Haus, das sie je im Leben gesehen hatte. Verglichen mit dieser herrschaftlichen Schlossanlage wirkten Kingsleys elegantes dreistöckiges Stadthaus, Griffins ausgedehntes Anwesen, ja sogar das Herrenhaus von Sørens Vater in New Hampshire wie mittelprächtige Vorstadtarchitektur. Allein an der vorderen Fassade zählte sie nicht weniger als achtundzwanzig Fenster, dazu Türen, Terrassen, Balkone … Nora hatte in Europa kleinere Schlösser gesehen – und das waren immerhin echte Paläste, bewohnt von echten Aristokraten, nicht von Amerikas Geldadel.
Wesley bog in die kreisförmige Kopfsteinpflaster-Auffahrt ein und stellte den Motor ab. Nora folgte seinem Beispiel. Sie hoffte im Stillen, dass zu dieser späten Stunde keiner der Bewohner mehr auf war und mitkriegte, wie sehr der Anblick von Wesleys Haus sie beeindruckte.
Beim Aussteigen blieb sie mit dem Absatz an einem Pflasterstein hängen. Wesley fing sie auf und zog sie an sich.
„Ich bin nur gestolpert, damit du mich festhalten kannst“, schwindelte sie und legte ihre Arme um ihn.
„Ich habe den Stein extra schräg hingelegt, damit du stolperst.“ Er lächelte sie zärtlich an, und ihr stockte der Atem.
Dann hob er die Hand und zerwühlte ihr Haar, eine so vertrauliche, intime Geste, dass die anderthalb Jahre der Trennung sich urplötzlich in Wohlgefallen auflösten. Nora kamen die Sehnsucht und Einsamkeit jener Monate auf einmal vor wie die Nachwehen eines Albtraums, aus dem sie gerade erwacht war. In diesem Traum hatte sie ihren besten Freund in einem Labyrinth verloren, und welchen Weg sie auch nahm, sie konnte ihm nicht näher kommen. Doch jetzt, da sie endlich von ihren eigenen Schreien geweckt worden war, sah sie, dass er neben ihr im Bett lag. Und wenn sie in seine großen braunen Augen blickte und er sie so süß anlächelte wie eben, war ihr die Antwort auf ihre Frage „Wie geht es weiter?“ völlig unwichtig. Sie hatte ihren Wesley wieder. Vielleicht nur für einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, aber sie waren zusammen, und sie würde überallhin gehen, solange er mitkam.
„Was nun? Wir gehen rein und besorgen uns was zu essen …“
„Ein guter Plan. Ich verhungere sonst.“
„Dann gehen wir zu meinem Haus …“
„Moment mal. Wie bitte? Was? Du hast dein eigenes Haus? Ist da etwa noch ein Haus im Haus, das dir gehört?“
„Gästehaus. Hinten im Park. Allerdings gibt’s da im Moment nichts zu essen. Das ändern wir morgen.“ Wesley nahm ihre Hand und führte Nora zum Eingang des Palastes.
„Und dann?“ Nora wollte herausfinden, was genau er von ihr erwartete. Würde es sein wie damals? Unter einem Dach leben und verzweifelt versuchen, nicht miteinander im Bett zu landen? Oder wollte er jetzt mehr von ihr?
Wesley grinste, und ihr Magen zog sich zusammen. Oh Gott, wie hatte sie den Kleinen vermisst. So verdammt vermisst, dass es jetzt beinahe ebenso wehtat, wieder mit ihm zusammen zu sein, wie es damals geschmerzt hatte, ihn gehen zu lassen.
„Und dann …“ Wesley ließ seine Hand an ihrem Arm entlanggleiten, und Nora zitterte, als sie eine Sehnsucht spürte, die sie längst tot und begraben geglaubt hatte: die Sehnsucht nach Händen, deren Berührung immer sanft und zärtlich war. Sie schüttelte das ungewohnte Verlangen energisch ab. Nach anderthalb Jahren hatten sich Wesleys Gefühle für sie doch sicher geändert. Schließlich hatte er sich verändert, sie konnte immer noch nicht glauben, wie sehr. Er kam ihr größer vor, sein Südstaatendialekt war ein bisschen auffälliger geworden, das längere Haar ließ ihn älter wirken. Er sah jetzt aus wie ein Mann, nicht wie der Junge, den sie gekannt und geliebt, geneckt und gequält hatte.
Nora hatte keine Lust mehr auf das Frage-und-Antwort-Spiel. Zum Teufel damit. Sie würde ihn einfach küssen und abwarten, was dann passierte. Sie reckte sich auf die Zehenspitzen, legte die Hand in seinen Nacken und zog seinen Mund zu ihrem. Er protestierte nicht.
Die Eingangstür von Wesleys Schloss öffnete sich, und aus dem Inneren ertönte eine Männerstimme. „John Wesley! Du weißt doch, dass du Bridget auch im Haus küssen darfst.“
Wesley trat einen Schritt zurück und wandte sich der Stimme zu. Der Mann, der in der geöffneten Tür stand, war der typische gut aussehende reiche weiße Südstaatler, ganz so, wie Nora ihn aus Film und Fernsehen kannte. Grau meliertes Haar, breite Schultern, ein noch breiteres Lächeln … jedenfalls so lange, bis er Nora näher in Augenschein nahm und feststellte, dass sie nicht Bridget war.
Nora hoffte, dass ihr eigenes Lächeln harmlos und freundlich wirkte, also ganz anders als ihr übliches Lächeln, das man eher als „verführerisch“ und „gefährlich“ bezeichnen würde.
„Hallo, Dad.“ Wesley packte Noras Hand und führte, nein zog sie weiter.
Wesleys Vater kniff die Augen zusammen. „Wen hast du denn da mitgebracht, J. W.?“
Nora schaute Wesley an. Ihre Lippen formten ein lautloses „J. W.?“
„Eleanor“, gab Wesley ebenso lautlos zurück.
„Das ist meine Freundin, Nora Sutherlin.“
Nora riss ihre Augen verblüfft auf. Freundin? Wer? Sie?
Sie bemühte sich, nicht schockiert zu wirken, und lächelte Wesleys gut aussehenden Vater noch strahlender an als vorher.
Der Blick, den Wesleys Vater ihr daraufhin zuwarf, war voll abgrundtiefer und unmissverständlicher Ablehnung.
„Oh ja“, seufzte sie, als ihr aufging, dass ihre Gebete offenbar nicht erhört worden waren. „Er hat schon mal von mir gehört.“
NORDEN
DIE VERGANGENHEIT
Beim Abendessen schwieg Kingsley und hörte den anderen Jungen zu. Er kaute emsig, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, sich durch Grinsen und Feixen zu verraten. Er wusste nicht, wie lange er die Täuschung aufrechterhalten konnte, wusste nicht mal, warum er überhaupt versuchte, seine Englischkenntnisse zu verbergen. Doch als er jetzt mit den anderen an der Tafel aus geschnitztem Eichenholz saß – die Schüler links, die Priester rechts – zählte Kingsley seine Sünden. Was hatte er nur getan, um diese Hölle auf Erden zu verdienen?
Er könnte Carol die Schuld geben, der hübschesten Cheerleaderin an seiner alten Schule. Er hatte eine Schwäche für Blondinen … Oder Janice, die vor jedem Heimspiel die Nationalhymne sang. Er hatte auch eine Schwäche für rothaarige Sopranistinnen. Susan … Alice … und Mandolin mit den blauen Augen und den langen Haaren, deren Eltern überzeugte Althippies waren … Er war im August an die kleine Highschool in Portland gekommen, und bis Thanksgiving hatte er drei Dutzend Mädchen gefickt. Aber im Grunde konnte er keine von ihnen für sein aktuelles Elend verantwortlich machen.
Er gab ihren Freunden die Schuld.
Kingsley wusste, dass er schnell und stark genug war, um es mit jedem Jungen an der Schule aufzunehmen. Aber sieben auf einmal? Da wäre keiner ungeschoren davongekommen. Auch er nicht.
Er war davongekrochen.
Zumindest hatte er es versucht. Aber nach ein paar Metern war er in einer Blutlache zusammengebrochen. Das Blut kam von einer Schnittwunde über seinem Herzen. Der Schnitt hatte ihm vermutlich das Leben gerettet. Zwar hatte er nur verschwommene Erinnerungen daran, wie er hinter dem Stadion zusammengeschlagen worden war, aber an das Messer erinnerte er sich genau. Als einer seiner Angreifer es ins Spiel brachte, gingen die anderen, die ihn eben noch getreten und geschlagen und angespuckt hatten, als er versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, auf Abstand. Troy, der Junge mit dem Messer, war nicht der Freund, sondern der Bruder eines der Mädchen – und die Ehre seiner Schwester war eine todernste Sache für ihn. Also zog er das Messer und zielte auf Kingsleys Herz. Die anderen kriegten es mit der Angst zu tun, zerrten Troy davon und ließen Kingsley liegen, blutend, verwundet, mit blauen Flecken übersät, aber lebendig.
Doch als er sich jetzt im Speisesaal umschaute und nur auf Jungen blickte – große und kleine, dicke und dünne, gut aussehende und unscheinbare, allesamt zwischen zehn und achtzehn Jahren –, wäre er gern wieder hinter dem Stadion seiner alten Highschool gewesen und hätte sich verprügeln lassen. Diesmal würde er ins Messer laufen, statt ihm auszuweichen.
Er seufzte tief auf und trank einen Schluck von seinem Tee. Was für ein scheußliches Gesöff. Bei seinen Eltern hatte es immer Wein zum Abendessen gegeben. Schöne Zeiten …
„Das Zeug schmeckt wie Katzenpisse, stimmt’s“, fragte Father Henry, der plötzlich hinter ihm stand.
Kingsley hätte fast genickt, erinnerte sich aber gerade noch rechtzeitig, dass er ja kein Englisch konnte. Also drehte er sich mit fragender Miene zu Father Henry um.
Der deutete auf Kingsleys Tee, zog eine angewiderte Grimasse und würgte. Jetzt ließ Kingsley sich zu einem Lachen herab. Schließlich verstand jeder die internationale Zeichensprache des Ekels.
„Kommen Sie mit, Mr Boissonneault“, sagte Father Henry, zog Kingsleys Stuhl zurück und gab ihm mit einer Geste zu verstehen, dass er ihm folgen möge. „Mal sehen, ob wir einen Übersetzer für Sie finden.“
Einen Übersetzer? Kingsleys Herz klopfte wie wild, als er sich von seinem Platz erhob. Father Henry hatte gesagt, dass keiner außer Mr Stearns französisch sprach. Und obwohl sich momentan sämtliche Mitschüler hier im Saal über ihre Tomaten-Basilikum-Suppe zu beugen schienen, fehlte doch einer: Mr Stearns. Nicht dass Kingsley nach ihm Ausschau gehalten hätte – oh nein, er hatte nicht ständig das Kommen und Gehen an der Tür beobachtet und auch nicht nach jedem Schluck Katzenpisse-Tee seinen Blick suchend durch den Raum schweifen lassen.
Father Henry führte ihn in die Küche, durch eine Wand aus Dampfschwaden. Vor einem riesigen schwarzen Herd stand ein junger Priester und wedelte mit dem Pfannenwender, während er immer wieder einen Satz wiederholte. Es sah aus, als ob er sich selbst dirigieren würde, seine Worte waren die Musik, sein Pfannenwender der Taktstock.
„Und jetzt sind Sie dran: Você não terá nenhum outro deus antes de mim.“
„Si, Father Aldo.“ Die Worte kamen von einem Tisch, der etwa einen Meter entfernt stand. „Você não terá nenhum outro deus antes de mim.“
Kingsley erbebte beinahe beim Klang dieser Stimme – ein eleganter Tenor, wohltönend und gebildet, aber gleichzeitig kalt, distanziert und unnahbar. Er machte zwei Schritte vorwärts und spähte an einem sperrigen Kühlschrank vorbei, um den Besitzer der Stimme zu sehen. Es war Stearns, der blonde Pianist. Zu seinen Füßen lag eine schwarze Katze, die sich zu einem geschmeidigen Ball zusammenrollte und Kingsley anstarrte. Ihre Augen waren grün und klug und boshaft. Stearns rieb ihren Kopf sanft mit der Spitze seines Schuhs und wiederholte die Worte einer Sprache, die Kingsley nicht kannte.
„Muito bom“, sagte der Priester, hielt sich den Pfannenwender schräg vor die Brust und verbeugte sich. „Father Henry, was machen Sie schon wieder in meiner Küche? Wir haben doch darüber gesprochen, dass das aufhören muss.“
„Es tut mir leid, dass ich Sie unterbreche, Father Aldo, Mr Stearns.“
„Nein. Es tut Ihnen nicht leid. Sie lieben es, andere zu unterbrechen. Darin sind Sie richtig gut.“ Father Aldo begleitete seine Schimpftirade mit einem breiten Lächeln. Kingsley versuchte, den Akzent einzuordnen. War er vielleicht Brasilianer? Wenn das stimmte, wäre die Sprache, die er Stearns beibrachte, Portugiesisch. Aber warum wollte irgendwer hier am Arsch der Welt ausgerechnet Portugiesisch lernen?
„Father Aldo, ich unterbreche Sie nur, weil Sie so viel reden. Ich muss Sie einfach unterbrechen, wenn ich vor Sonnenuntergang zu Wort kommen will.“
„Die Sonne ist bereits untergegangen, und Sie reden immer noch.“
„Jetzt unterbrechen Sie meine Unterbrechung, Aldo. Und es tut mir wirklich sehr leid, Mr Stearns Unterricht zu stören. Aber es ist gerade sein Sprachtalent, das wir jetzt brauchen. Das hier ist unser neuer Schüler Kingsley Boissonneault. Er spricht leider kein Englisch. Wir hoffen, Mr Stearns kann uns da helfen. Wenn er so freundlich wäre …“
„Selbstverständlich, Father.“ Stearns klappt das Buch zu, das vor ihm lag, und erhob sich. Erneut war Kingsley überwältigt von der Größe des blonden Pianisten – und von seinem beinahe unerträglich attraktiven Gesicht. „Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen behilflich zu sein, soweit ich kann. Allerdings benötigt Monsieur Boissonneault meine Hilfe gar nicht. Immerhin spricht er perfekt Englisch. Nicht wahr?“
Die letzten beiden Worte waren an Kingsley gerichtet. Er erstarrte.
Father Aldo und Father Henry sahen ihn mit erhobenen Brauen an.
„Stimmt das, Mr Boissonneault?“ fragte Father Aldo.
„Natürlich stimmt das.“ Stearns machte einen Schritt über die schwarze Katze hinweg und blieb vor Kingsley stehen.
Kingsley hätte jetzt Angst haben oder zumindest peinlich berührt sein sollen. Doch dieser eine Schritt auf ihn zu und dieser scharfsichtige, durchdringende Blick lösten ganz andere Empfindungen in ihm aus. Empfindungen, die er sofort wieder vergessen wollte.
„Er hat gelacht, als Sie sich eben gestritten haben. Er wusste also ganz genau, was Sie sagen. Und als französischer Muttersprachler in Maine stammt er entweder aus Frankreich, wo er mit sieben oder acht Jahren angefangen hätte, Englisch zu lernen. Oder er ist aus Quebec und damit zumindest einigermaßen zweisprachig aufgewachsen.“
Father Aldo und Father Henry starrten ihn weiter an. Stearns kühle graue Augen musterten ihn prüfend.
Schließlich besiegte Kingsleys Stolz auf seine Herkunft jedes Bedürfnis nach Anonymität. „Ich komme ganz bestimmt nicht aus Quebec“, stellte er indigniert richtig. „Ich bin in Paris geboren.“
Stearns Lächeln traf Kingsley wie ein Eissplitter ins Herz.
„Ein Lügner und ein Snob. Willkommen in St. Ignatius, Monsieur Boissonneault“, sagte er. „Wir freuen uns, dass Sie da sind.“
Zum zweiten Mal an diesem Tag dachte Kingsley sehnsüchtig an Troys Messer. Wie gern würde er jetzt das blanke Metall in seiner Brust spüren. Das wäre garantiert nicht so schmerzhaft wie die Verachtung in Stearns stählernem Blick.
„Ich wollte nicht herkommen“, protestierte er. „Ich bin also gegen meinen Willen hier. Ich muss nicht reden, wenn mir nicht danach ist.“
„Du hättest gute Chancen bei den Zisterziensern“, bemerkte Stearns und verschränkte die Arme vor der Brust. „Sie legen ebenfalls Schweigegelübde ab. Allerdings aus religiösen Gründen und nicht, um auf widerliche Art um Aufmerksamkeit zu buhlen.“
„Mr Stearns“, sagte Father Aldo mit sanftem Tadel. „Wir sind zwar Jesuiten, aber wir halten uns hier an die Regel des Heiligen Benedikt.“
Stearns holte tief Luft. „Selbstverständlich, Father. Ich bitte um Vergebung.“
Für Kingsley klang er nicht besonders reumütig, aber weder Father Aldo noch Father Henry erhoben weiter Einspruch. Die beiden Priester wirkten genauso eingeschüchtert wie der kleine Matthew vorhin. Wer war dieser Stearns?
„Vielleicht sind Sie so freundlich, Mr Boissonneault die Schlafräume zu zeigen. Sie könnten ihn auch etwas gründlicher mit den Gegebenheiten unserer Schule vertraut machen als der kleine Matthew heute Nachmittag“, bat Father Henry. „Falls Sie gerade Zeit haben“, fügte er hinzu.
Stearns nickte, machte einen weiteren Schritt auf Kingsley zu und schaute auf ihn herab. Herab? Kingsley war nach seiner Prügelei im Krankenhaus gemessen worden, er wusste also ganz genau, dass er exakt einen Meter achtzig groß war. Das hieß, dass Stearns ungefähr einen Meter neunzig groß sein musste. Mindestens.
„Ich habe Zeit.“ Auch dieses Lächeln traf ihn mitten ins Herz. „Wollen wir?“
Kingsley erwog, höflich abzulehnen, mit dem Hinweis, dass Matthew ihm schon alles gezeigt habe, er also keine zweite Führung benötige, aber merci beaucoup für das Angebot. Doch obwohl Stearns unmissverständlich klargemacht hatte, dass er ihn nicht leiden konnte, dass er ihn sogar geradezu verabscheute, konnte Kingsley nicht leugnen, dass er sich im Augenblick nichts mehr wünschte, als mit diesem mysteriösen jungen Mann, den sogar die Priester fürchteten, eine Zeit lang allein zu sein.
„Oui“, flüsterte er, und Stearns presste seine perfekten Lippen zusammen.
Er ging los, und Kingsley folgte ihm. Sobald sie die Küche hinter sich gelassen hatten, drehte Stearns sich um und sah ihm direkt ins Gesicht.
„Père Henry est un héro“, sagte er in makellosem Französisch. Father Henry ist ein Held. „Du musst ihm nachsehen, dass er nicht besonders viel über Frankreich weiß. Während des Zweiten Weltkriegs war er in Polen und hat Juden in Sicherheit gebracht und Frauen und Mädchen vor den russischen Soldaten versteckt. Das weiß ich nur, weil ein anderer Priester es mir erzählt hat. Father Henry spricht nicht über die Hunderte von Menschenleben, die er gerettet hat. Er spricht über italienisches Essen und Krimis. Father Aldo ist Brasilianer. 1969 wurde er mit zwölf anderen von Guerillas entführt. Er war damals neunundzwanzig Jahre alt, und obwohl er aus reichem Hause stammt und seine Familie gute Verbindungen hat, war er der Letzte, der befreit wurde. Es war seine Entscheidung. Er weigerte sich zu gehen, bevor alle anderen in Sicherheit waren. Als er dann frei war, verzieh er seinen Entführern und bat öffentlich um mildernde Umstände für sie. Jetzt kocht er für uns.“
„Warum erzählst du mir das alles?“, fragte Kingsley. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Eltern war er den Tränen nah.
„Father Henry hat mich darum gebeten, dich auf St. Ignatius vorzubereiten. Und das mache ich jetzt“, erwiderte Stearns. „Kommst du?“
Kingsley folgte ihm schweigend.
Vor der Tür zum Speisesaal blieb Stearns stehen. An der Tafel saßen nur noch zwei Jungen. Sie aßen und redeten.
„Ton ami Matthew.“ Stearns deutete mit einer Kopfbewegung auf den kleinen Rotschopf, der ihn vor ein paar Stunden durch die Schule geführt hatte. Er saß neben einem etwas größeren Jungen mit schwarzem Haar und Brille. „Er ist vor eineinhalb Jahren hergekommen. Damals war er elf, sah aber aus wie acht. Seine Eltern haben ihn fast verhungern lassen. Er wurde dabei erwischt, wie er in Mülltonnen nach Essbarem wühlte. Eine reiche katholische Familie zahlt seine Schulgebühren hier. Der Junge neben ihm ist der Sohn dieser Familie. Keiner von beiden weiß das. Sie sind unabhängig davon Freunde geworden.“
Kingsley schluckte und folgte Stearns aus dem Speisesaal.
„Ich glaube, Father Henry meinte, dass du mir sagen sollst, wann der Unterricht beginnt und so.“
„Frühstück um sieben. Andacht um acht. Der Unterricht beginnt um neun. Morgen wirst du Father Martin kennenlernen, der gibt dir dann deinen Stundenplan.“
„Ich nehme an, Father Martin ist auch ein Held.“
„Father Martin ist Astronom. Er hat drei Kometen entdeckt und eine Formel entwickelt, mit der man die Ausdehnung des Universums berechnen kann. Jetzt ist er im Ruhestand. Seine Augen sind nicht mehr scharf genug, um den Himmel abzusuchen. Also unterrichtet er uns in Mathematik und Naturwissenschaften.“
Stearns führte ihn über den Hof zur Bibliothek. Im großen Lesesaal war jetzt nicht viel los, nur drei Jungen ungefähr in Kingsleys Alter hatten sich an der Wand vor dem Kamin niedergelassen. Stearns sah auf einem der Tische ein vergessenes Buch, nahm es an sich, warf einen prüfenden Blick auf den Buchrücken und trug seinen Fund zu einem Regal in der Nähe des Kamins.
„Stanley Horngren, das ist der mit dem Jackett …“ Stearns senkte sein majestätisches blondes Haupt und wies damit in Richtung eines der Jungen. „Er hat zwölf Geschwister und schuftet, um seine Familie finanziell zu entlasten. Jeden Sommer nimmt er zwei Ferienjobs an, um seine Schulgebühren hier selbst bezahlen zu können. Neben ihm sitzt James Mitchell, er hat ein Stipendium bekommen, wirklich beeindruckend – vor allem angesichts der Tatsache, dass er komplett taub ist und niemals eine Gehörlosenschule besucht hat. Wenn du mit ihm reden willst, sprich deutlich und achte darauf, dass er deine Lippen sehen kann.“ Er warf Kingsley einen finsteren Blick zu. „Und sprich Englisch.“ Er schob das Buch ins Regal, zweifellos genau an die richtige Stelle. „Der Junge auf dem Sofa heißt Kenneth Stowe. Er war zwei Jahre in der Sonderschule, weil seine Lehrer ihn für geistig behindert hielten. Dabei hat er nur eine leichte Lernschwäche und den IQ eines Genies. Heute ist er einer unserer besten Schüler. Die Bibliothek schließt um neun, wenn du sie mal länger brauchst, kannst du Father Martin um einen entsprechenden Ausweis bitten.“
Stearns drehte sich auf dem Absatz um und marschierte wieder nach draußen. Vor der Kirchentür blieb er stehen.
„Gottesdienst ist samstags um siebzehn Uhr und sonntags um zehn Uhr. Katholisch, selbstverständlich. Bist du Katholik?“
Kingsley schüttelte den Kopf. „Wir stammen von Hugenotten ab.“
Stearns stieß missbilligend Luft durch die Nase aus. „Calvinisten.“ Es klang wie ein Fluch. „Es wird gern gesehen, wenn du am Gottesdienst teilnimmst“, fuhr er dann fort. „Es ist aber keine Pflicht. Du darfst dein Haar auch weiter lang tragen. Die Schuluniform hingegen ist Pflicht, allerdings nur deshalb, um an der Schule ein gleichberechtigtes Umfeld zu schaffen. Hier bei uns ist keiner was Besseres. Hast du das inzwischen kapiert?“
Kingsley senkte den Blick. „Ja.“
Stearns brachte ihn zum Gebäude mit den Schlafsälen. Bevor er eintrat, bückte er sich, um einen Armvoll Holzscheite einzusammeln. Kingsley folgte seinem Beispiel, in der Annahme, dass sie das Feuerholz in ihren eigenen Schlafsaal im zweiten Stock tragen würden. Doch Stearns ging in den Raum, in dem die jüngsten Schüler schliefen, und stapelte das Holz ordentlich neben dem Kamin. Dann nahm er Kingsley die Scheite ab und stapelte sie ebenfalls.
Etliche Jungen hockten auf ihren Betten und lasen. Nur einer brachte ein fast unhörbares „Danke“ über die Lippen. Stearns sagte nichts, tippte dem Kleinen aber mit einer beinahe brüderlichen Geste an die Stirn. Als er den Raum verließ, blickten ihm alle Jungen im Zimmer mit weit aufgerissenen Augen ehrfürchtig nach.