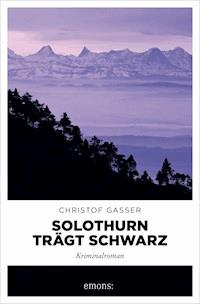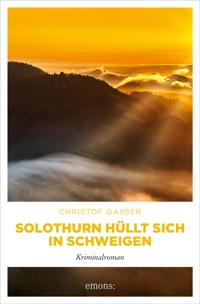
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Ambassadorenstadt im Netz der Mafia. Ein temporeicher Kriminalroman, bei dem Lokalkolorit auf globales Verbrechen trifft. Eine Informantin der Polizei erscheint nicht zu einem vereinbarten Treffen. Wenige Stunden später ist sie tot. Am Tag darauf wird am Aareufer die Leiche eines Mannes gefunden. Das einzig verbindende Element ist der Solothurner Ableger eines deutscharabischen Familienclans. Doch dieser hüllt sich in Schweigen. Um die Fälle zu lösen, muss Hauptmann Dominik Dornach auf die Hilfe bewährter Verbündeter zurückgreifen. Ausgerechnet jetzt holt ihn eine Affäre aus der Vergangenheit ein, die tragisch endete ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang befindet sich ein Glossar.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: stock.adobe.com/Christian Bieri
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-106-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Für Katrin, »Signora Brunetti«,ihre Stärke und ihren Mutzum Neuanfang
Die zehn Grundsätze:Stell dich dem Kampf!Führe andere in den Kampf!Handle umsichtig!Halte dich an die Tatsachen!Sei auf das Schlimmste vorbereitet!Handle rasch und unkompliziert!Brich die Brücken hinter dir ab!Sei innovativ!Sei kooperativ!Lass dir nicht in die Karten sehen!
Sunzi (544–496 vor Christus)
Den inneren Frieden dir nicht zu stören,in andrer Achtung stets zu steigen,habe den Mut, die Wahrheit zu hören,und die Klugheit, sie zu verschweigen.
Heinrich Leuthold (1827–1879)
Prolog
Berlin, Bezirk Mitte, Charité
Er fühlte ihre Wärme auf seiner Haut, hörte ihr wie ein Glasperlenspiel klingendes Lachen. Sein Gedächtnis spulte die Erinnerungen an ihr erstes Wochenende am Wannsee ab. Bis spät in die Nacht hinein hatten sie am Strand gesessen und Wein aus der Flasche getrunken, einen süßen Rosé, er war eiskalt, sodass das Kondenswasser auf der Flasche Schlieren zog. Sie hatten gelacht, geredet und sich geliebt.
Die Hand, die sich auf seine Schulter legte, ließ den Film reißen.
»Herr Schröter?«
Die Realität drängte sich ins Bewusstsein wie das grelle Licht im Kinosaal, sobald die Vorstellung beendet ist. Nur die Wärme ihrer Hand, die er immer noch in der seinen hielt, erinnerte an die Nacht am Wannsee. Ihr Körper versank beinahe im Spitalbett. Ihre Augen waren geschlossen. Das Summen der Monitore und das stoßweise Hissen der Herz-Lungen-Maschine, die ihren Körper am Leben erhielt, überlagerten die Stille.
»Entschuldigen Sie, Herr Schröter«, sagte die Schwester leise. »Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
Er stand auf und schob den Stuhl zur Seite. Die Schwester war nicht allein. Der Arzt war mit ihr hereingekommen. »Sind Sie bereit?«
»Noch eine Minute. Bitte?« Es hörte sich an wie ein Flehen. Er schämte sich nicht dafür.
Der Arzt und die Schwester warteten bei der Tür, während er sich über sie beugte und zum Abschied ihre Stirn küsste. »Es tut mir leid, Heike.«
Er nickte dem Arzt und der Schwester zu. Der Arzt trat vor die Herz-Lungen-Maschine und schaltete sie ab.
Sie warteten, bis die Linien auf dem Monitor flach verliefen.
»Todeszeit: einundzwanzig Uhr siebenunddreißig«, sagte der Arzt mit leiser Stimme. Die Pflegerin trug sie in ihren mobilen Rechner ein. Dann begann sie, die Intubation zu entfernen und die Elektroden vom Körper zu lösen.
Er verließ das Zimmer.
EINS
Solothurn – fünf Monate später
»Komm schon!«
Maja Hartmann klingelte Sturm. Sie hoffte, endlich das Schnarren des Türöffners zu vernehmen. Sie machte sich Sorgen. Vanessa Kurth war nicht am vereinbarten Treffpunkt bei der Loretokapelle erschienen. Nachdem sie eine Viertelstunde gewartet und Vanessa nicht auf ihre Anrufe geantwortet hatte, war Maja zu ihrer Wohnung am Rossmarktplatz in der Solothurner Vorstadt gefahren. Im Erdgeschoss des Mietshauses hatte sich einst das Tea-Room Vorstadt befunden. Später war daraus ein Club geworden, der seit geraumer Zeit das Schicksal seines Vorgängers teilte. Einer der vielen Tribute, welche die Pandemie von der Gastronomie gefordert hatte. Nur das Logo an der Hausfassade zeugte von lebhafteren Zeiten. Hinter zwei Fenstern direkt unter dem Dachgeschoss brannte Licht. Das musste Vanessas Wohnung sein. Maja trat ein paar Schritte zurück und spähte nach oben. Hinter den Fenstern tat sich nichts.
Sie war drauf und dran, alle Klingelknöpfe auf dem Brett zu drücken, als sie den Widerschein eines Blaulichtes an der Fassade des Nachbarhauses bemerkte. Eine Ambulanz fuhr auf den Platz und stoppte vor dem Hauseingang. Maja legte ihre orange Armbinde an, die sie als Zivilpolizistin im Einsatz erkennbar machte.
Ein Rettungssanitäter stieg aus dem Fahrzeug. »Haben Sie den Notruf gewählt?«
Maja verneinte. »Hartmann, Kriminalpolizei.«
Der Sanitäter nannte ebenfalls seinen Namen. »Sie sind schnell hier. Schicken die jetzt immer gleich die Kripo?«
Maja sah ihn verständnislos an.
»Der Notruf kam vor zehn Minuten über die Alarmzentrale rein.« Der Sanitäter zeigte auf das Haus. »Eine Frau mit Stichverletzung im Unterleib wurde an dieser Adresse gemeldet.«
»Vor zehn Minuten?« Das Bürgerspital befand sich sozusagen um die Ecke.
Der Sanitäter hatte den leisen Vorwurf verstanden. »Können Sie sich vorstellen, was heute Abend los ist? Freitagabend, HESO, dazu ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 5 im Birchitunnel. Wir tun, was wir können. Wie kommen wir ins Haus?«
»So.« Maja legte die Hand aufs Klingelbrett, bis sich ein Fenster öffnete.
»Wenn ihr Idioten nicht sofort damit aufhört, rufe ich die Polizei, verstanden?«
»Die ist schon da.« Maja trat vor, dass man sie von oben sehen konnte. »Öffnen Sie bitte, das ist ein Notfall.«
***
Zwei Gin Tonic, eine Margarita und zwei Aperol Spritz. Pia nahm das Tablett auf. Sie erschrak, als sie eine Hand auf ihrer Taille spürte. Eine andere ergriff geschickt das Tablett mit den Getränken, bevor es zu Boden fiel. Sie fuhr herum, bereit, einen übergriffigen Gast harsch zurechtzuweisen. Die Empörung verflog. Die Hand gehörte Silvano. Sie fühlte sich plötzlich gut an.
»Ich übernehme das«, sagte er. »Du kannst zurück hinter die Theke.«
»Wo warst du?« Obschon Pia erleichtert war, gab sie sich Mühe, vorwurfsvoll zu klingen. Das »Berna«-Barzelt im Schanzengraben begann sich zu füllen. Das war erst der Anfang. In knapp einer Stunde schlossen die Restaurationsbetriebe in den Messehallen der HESO, der Solothurner Herbstmesse. »Hier wird gleich der Teufel los sein. Erika hat dich gesucht.«
»Ich war draußen mit ein paar Stammkunden. Tut mir leid, dass ich euch so lang allein gelassen habe.«
Pia würde nie zugeben, dass ihr Silvano Moretti, der Besitzer der »Berna Bar« im Schöngrünquartier, gefiel, geschweige sich in ihn verguckt zu haben. Würde man sie fragen, was sie ausgerechnet an ihm anziehend fand, wüsste sie nicht einmal, was sie antworten sollte. Bestimmt sah er gut aus, scharf geschnittene Gesichtszüge, warme dunkelbraune Augen, an den Schläfen silbern schimmerndes Haar und ein dichter, kurzer Vollbart. Ohne wäre er ihr lieber gewesen. Wenigstens kratzte er bei den Begrüßungsküssen nicht so wie die Stoppeln ihres Vaters. Pia hatte Silvano nie nach seinem Alter gefragt. Sie schätzte ihn auf Mitte dreißig, knapp zehn Jahre älter als sie. Gerüchten zufolge war er verheiratet, lebte aber von seiner Frau getrennt. Er hatte mal eine Tochter im Teenageralter erwähnt. Für Pia war das unerheblich. Silvano hatte etwas in ihr geweckt, das sie als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen würde. Der letzte Mann, dem das gelungen war, war Rafik gewesen. Silvano strahlte dieselbe Sicherheit und Wärme aus und verfügte über denselben Witz und Scharfsinn, mit denen der Vater ihres knapp dreijährigen Sohnes ihr einen Spiegel hatte vorhalten können. Vermutlich konnte Silvano sie ebenso zur Weißglut bringen wie Rafik. Jedenfalls hatte er es geschafft, die Schmetterlinge in ihrem Bauch aus ihrem jahrelangen Tiefschlaf zu wecken.
Silvano wies mit dem Kopf zum Tisch, den Pia bedienen wollte. »Das sind Freunde von mir. Ich bringe ihnen die Getränke. Setz dich einen Moment zu uns, ich stelle dich vor.«
»Machst du Witze? Schau dich um.« Sie ließ den Arm über das Lokal kreisen. »Da kommt ein Tsunami auf uns zu.«
»Schön.« Silvano krempelte die Ärmel hoch. »Alle Mann an Deck, die Kumpel müssen warten.«
Das Team war jetzt vollzählig. Es dauerte eine Weile, bis Pia die angestauten Bestellungen abgearbeitet hatte. Wenn jeweils der Ansturm an Heftigkeit nachließ, gönnte sie sich ein Glas Rivella oder Apfelschorle, Alkohol gab es nach Feierabend. Silvano nutzte eine Atempause, um seine Freunde in der Lounge-Ecke zu begrüßen.
Eine neue Flut hereinströmender Gäste hinderte sie daran, ihr Glas auszutrinken. Darunter fielen ihr zwei besonders auf, beides Männer. Der eine hatte die durchschnittlichen Maße eines erwachsenen Mannes der westlichen Hemisphäre. Dagegen erinnerte sein Begleiter an den obligaten kolossartigen Bösewicht aus einem Superheldenfilm des Marvel-Universums. Er überragte den anderen um gut zwei Köpfe und sah so aus, wie sich Pia einen wandelnden Kleiderschrank am ehesten vorgestellt hätte. Gang und Körperhaltung machten klar, wer von beiden das Sagen hatte, es war der Kleinere. Der Kleiderschrank steuerte auf die Theke zu.
»Hoi, was darf es sein?«, fragte Pia routiniert. Im »Berna«-Barzelt an der HESO galten dieselben Gepflogenheiten wie im Stammbetrieb in Biberist. Man duzte sich.
»Dein Boss, wo ist er?«
Keine Begrüßung, das klärte die Fronten. Der Unsympath entsprach dem gängigen Klischee des Türstehers. Ein buschiger Kinnbart machte sein brutales, breitflächiges Gesicht zivilisierter. Sein Herr und Meister war gepflegter. Pia tippte auf mittelöstliche Herkunft, die schwarzen Haare waren getrimmt und gegelt. In seinen Augen lag der lauernde Glanz des Mannes, der sich seiner Macht bewusst war, der arrogante Zug um den Mund ein Zeichen dafür, dass er gewohnt war zu bekommen, was er wollte. Was konnte Silvano mit solchen Leuten zu tun haben? Er war in ein Gespräch mit seinen Bekannten vertieft und hatte die neuen Gäste nicht bemerkt.
»Dahinten.« Pia zeigte in die Richtung.
Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, steuerten die beiden Männer die Lounge-Ecke an.
Pia stupste Erika an, die gerade eine Stange zapfte. »Kennst du die beiden Rüpel?«
Erika sah kurz hin und zuckte mit den Achseln. »Kennen nicht, gesehen schon. Waren schon mal bei uns oben im Schöngrün. Es sind Geschäftspartner von Silvano.«
Welche Art Geschäfte konnten das sein? Die Kerle passten nicht zu Silvano.
»Hallo? Erde an Pia.«
Pia hatte Nadal nicht hereinkommen sehen. Diese setzte sich auf einen Barhocker.
»Alles gut bei dir?«
»Mega. Warum fragst du?«
»Darum.« Mit erhobenen Augenbrauen neigte Nadal den Kopf in Richtung Silvano. »Starren ist nicht höflich. Gibst du mir ein Schorle?«
»Keine Ahnung, was du meinst.« Pia stellte eine Flasche Schorle und ein Glas vor ihrer Quasi-Schwägerin hin.
Nadal grinste abgründig. »Du kannst abstreiten, so viel und solange du willst.«
»Du hörst mal wieder das Gras wachsen, aber schön, dass du doch noch gekommen bist.«
»Ich war kurz in der Villa, mich von meinem Neffen verabschieden.«
»Wann geht dein Flug?«
»Morgen gegen Mittag, vorher muss ich Mama abholen.«
»Kommt sie nun doch mit?«
Nadal wollte die Familie ihres Onkels in England besuchen. Seit dem Begräbnis ihres Bruders Rafik hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Sie hatte sogar ihren Vater überzeugen können, dass ihre Mutter sie begleitete.
»Du kennst mich. Am Ende kann baba mir nichts verwehren.« Eine Eigenschaft, die sie mit Rafik geteilt hatte. Pia bewunderte die Hartnäckigkeit, mit der sich Nadal ihrem Vater, einem traditionellen Muslim, entgegenstellte. Nach Rafiks Tod hätte er sie um ein Haar verstoßen, nachdem sie durchgesetzt hatte, dass Rafiks Leichnam vom Irak in die Schweiz überführt und nach islamischem Ritual in Olten beigesetzt wurde.
»Mein Onkel holt uns in Heathrow ab, dann sind wir in zwei Stunden per Auto in Birmingham.«
Pia zog eine Schnute und umarmte sie über die Theke hinweg. »Ich werde dich vermissen, Sis, Mirio auch.«
»Und ich erst, in zehn Tagen bin ich zurück.«
Drüben in der Lounge-Ecke begrüßte Silvano die beiden Männer mit Handschlag, bevor er mit ihnen etwas zur Seite ging. Der Kleinere begann auf ihn einzureden, der Schrank stand mit verschränkten Armen daneben.
Nadal folgte Pias Blick und erstarrte.
»Hast du ein Gespenst gesehen?«, fragte Pia.
»Wenn’s nur das wäre, eher ein Ungeheuer.«
»Wen meinst du?«
»Den kleinen Dunklen mit der Gelfrisur. Das ist Boran Baddour.«
»Muss ich den kennen?«
»Besser nicht. Ich bin ihm mal begegnet, war nicht schön.« Nadals Blick ruhte auf der abseitsstehenden Gruppe.
»Was ist?«, fragte Pia. »Erzählst du’s mir von dir aus, oder muss ich es aus dir herauskitzeln?«
»Ich habe mich doch mal für diese Wohnung in der Vorstadt beworben.«
»Die am Rossmarktplatz, ich erinnere mich.« Nadal war die Wohnung in der Rathausgasse zu klein geworden. Sie hatte sich beworben, sobald sie das Inserat entdeckt hatte.
»Die Wohnung wäre okay gewesen, auch die Miete.«
»Aber?«
»Dieser Baddour wollte sie mir geben, gegen einen Bonus.«
»Lass mich raten. In Naturalien?«
Eine steile Falte hob sich auf Nadals Stirn hervor. »Weil ich Muslima bin und alleinstehend, meinte er, man müsse mich ›beschützen‹.« Nadal malte Anführungszeichen in die Luft. »Er wolle nicht, dass ich zum Freiwild für die Ungläubigen werde. Kannst du dir das vorstellen?«
Pia konnte, leider. »Sauhund.«
Nadal stellte ihr Glas auf die Theke. »Ich verziehe mich besser, bevor er mich erkennt. Muss eh früh raus.« Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung. »Versuch ausnahmsweise nicht zu viele Dummheiten zu machen, wenn ich weg bin«, sagte Nadal, bevor sie zum Ausgang ging.
»Dummheiten? Ich, die Vernunft in Person?«, rief Pia ihr nach. Beim Hinausgehen kreuzte Nadal einen hageren Mann in einer Militärjacke mit aufgenähter deutscher Flagge am Oberarm. Er wirkte gehetzt und blickte sich hastig um, bevor er sich an die Theke setzte.
»Was darf’s denn sein für dich?«, rief sie, um die rockige Musik zu übertönen, welche die Playlist in diesem Moment abspulte.
»Ich bekomme ein kleines Helles … also … eine Stange«, bestellte er auf Hochdeutsch.
»Natürlich bekommst du das.« Pia betonte das »bekommst du« mit einem Schmunzeln und füllte ein schlankes Drei-Deziliter-Glas. »Zum Wohl.« Sie stellte die Stange vor ihm hin.
Er nickte und wandte sich mit dem Glas in der Hand ab.
Komischer Typ. Sie vergaß ihn in der nächsten Sekunde, als ein Halbwüchsiger vier Bier bestellte.
»Für wen? Deine Eltern?«
»Sicher nicht, meine Kollegen.« Er wies auf eine Gruppe Gleichaltriger, die erwartungsvoll herüberschauten.
»Weißt du was?« Pia sah über die Theke auf ihn hinab. »Cola, Apfelschorle oder Grenadinesirup, du kannst wählen.« Sie zeigte auf ein Schild an der Wand, das den Ausschank von Wein und Bier für unter Sechzehnjährige sowie Spirituosen für unter Achtzehnjährige untersagte. »Ich habe auch Rivella.«
»Wir sind im Fall über achtzehn.«
Pia mimte einen anerkennenden Ausdruck. »Kompliment, das würde man euch gar nicht geben.« Sie hielt die Hand auf. »Ausweis, von allen vieren.«
»Blöde Bitch!«
Pia verzog keine Miene, als sie sich zu ihm vorbeugte. »Pass auf, unter dem Tresen ist ein Knopf. Wenn ich auf den drücke, kommen ein paar kräftig gebaute Freunde von mir. Die begleiten dich und deine Kumpels mit Nachdruck nach draußen. – Jetzt sag mir bitte noch mal, wie du mich genannt hast. Ich hab’s nicht richtig verstanden.«
»Ähm nichts, ’tschuldigung.« Beim Rausgehen nahm der Jungspund seine nicht weniger belämmert dreinblickenden Kameraden ins Schlepptau.
»Was war mit denen?«, wollte Erika wissen.
»Nichts weiter, die wollten mich verarschen, haben wohl gedacht, ich sehe die Eierschalen nicht, die ihnen noch am Hintern kleben.«
Aus der Ecke, wo Pia Silvano und Baddour zuletzt gesehen hatte, war plötzlich Lärm zu hören. Silvano hatte Baddour am Kragen gepackt und schrie ihm ins Gesicht. Worum es ging, konnte Pia aus der Entfernung nicht verstehen. Baddour brüllte lauter zurück. Pia stieß scharf die Luft aus, als sie ein Springmesser in seiner Hand aufblitzen sah. Damit war er gegenüber Silvano im Vorteil, was wohl der Grund war, weshalb sein Leibwächter nicht eingriff.
»Scheiße!«, sagte Erika neben ihr. »Fängt das schon wieder an.«
»Wieso, ist das schon mal vorgekommen?«
»Die beiden haben sich schon mal fast geprügelt, keine Ahnung, weshalb.«
Pia nahm ihr Handy aus der Umhängetasche unter der Theke. Sie wollte die Notrufnummer eintippen, als der Deutsche, dem sie eben noch sein Bier serviert hatte, sich zwischen die Streithähne stellte. Das veranlasste den Kleiderschrank zu intervenieren. Er wollte den Deutschen wegstoßen. Der wich ihm aus und konterte mit einem rechten Haken. Es war ein präziser und wirksamer Hieb. Der Riese ging zu Boden. Bevor Baddour reagieren konnte, hatte der Deutsche ihm das Messer abgenommen. Er ließ die Klinge einschnappen. Anstatt es Baddour zurückzugeben, steckte er es ein. Dann flüsterte er ihm etwas ins Ohr und machte sich davon. Inzwischen hatte sich der Kleiderschrank aufgerappelt und rannte hinter ihm her. Pia stellte sich ihm in den Weg. Sie hielt ihm ihr Handy entgegen. Auf dem Display war zu sehen, dass sie die 117 gewählt hatte. »Es reicht. Die Polizei ist auf dem Weg.«
Der Riese schien schwer von Begriff zu sein. Er ging auf Pia zu, die sich hinter die Theke zurückzog. In ihrer Tasche lag eine Dose Pfefferspray.
»Sascha!« Das war Baddour. »Wir sind hier fertig.« Er drehte sich zu Silvano um. »Du weißt Bescheid, letzte Chance.«
Pia sah den beiden nach, bis sie das Zelt verlassen hatten. Dann ging sie zu Silvano. »Was war das eben?«
Er winkte ab. »Nicht der Rede wert, unzufriedener Geschäftspartner. Hast du wirklich die Polizei gerufen?«
»Nein, aber die Drohung hat gewirkt.«
Er drückte sie an sich und küsste sie auf die Wange.
Es tat gut.
***
»Pass auf, Depp!«
Der Radfahrer hätte ihn um ein Haar von rechts erwischt. Wenn ihn sein Orientierungssinn nicht täuschte, stand er auf dem Klosterplatz. Er könnte sich nach rechts wenden, über die Kreuzackerbrücke, woher der Radfahrer gekommen war, und dann zum Bahnhof. Er verwarf den Gedanken. Er wusste nicht, wie viele hinter ihm her waren. War es nur die eine Person, die er im Gewirr der Gassen abgehängt zu haben hoffte, oder waren irgendwo noch andere Verfolger? Gerade deshalb konnte er nicht auf dem üblichen Weg aus der Stadt heraus. Er warf einen hastigen Blick zurück auf die Theatergasse, woher er gekommen war. Niemand zu sehen. Es gab nur eine Richtung: geradeaus vorwärts.
Endspurt. Vor der Solheure-Bar spurtete er im Slalom um die Menschen herum, die vor dem Lokal tranken und rauchten. Das brachte ihm den einen oder anderen unfreundlichen Kommentar ein.
Sein Ziel war in Sicht, der Bootsanleger bei der Rötibrücke. Das bedeutete keineswegs, dass er in Sicherheit war.
Er rannte die paar Stufen von der Straße zum Anleger hinunter und blickte nach rechts. Das Boot war noch da, wo er es am frühen Abend festgemacht hatte. Es war ein offenes Holzboot mit Außenbordmotor. Weit musste er damit ja nicht kommen.
Er löste das Seil vom Beschlag, an dem es vertäut war. Der Außenborder sprang nach dem zweiten Versuch an. Das hatte ihn Zeit gekostet und abgelenkt. Jemand stand hinter ihm.
Er schaffte eine halbe Drehung. In der Millisekunde zwischen dem Schlag und dem Fall in den dunklen Abgrund blitzte der Gedanke auf.
Es tut mir leid.
***
Dominik Dornach setzte sich neben Maja auf den Sockel des Brunnenbeckens. »Wie fühlst du dich?«
Sie reagierte wie immer, wenn sie etwas mitnahm: mit Achselzucken und Themenwechsel. Sie zeigte mit dem Daumen hinter sich. »Wart ihr dabei, ich meine, deine Vorfahren?«
Was sie meinte, begriff er erst, als er den Kopf drehte und nach oben schaute. Der Dornacherbrunnen mit der Statue des Solothurner Bannerträgers war im Gedenken an die Schlacht von Dornach im Jahr 1499 errichtet worden. Solothurner Truppen behaupteten sich mit Hilfe der Berner, Zürcher, Luzerner und Zuger Miteidgenossen gegen das kaiserliche Heer. Der anschließende Frieden von Basel löste die Eidgenossenschaft vom Deutschen Reich und legte den Grundstein für ihre staatliche Entwicklung. Heute war das solothurnische Dornach ein Vorort der Stadt Basel.
»Keine Ahnung«, sagte Dornach. »Wenn die Geschichten stimmen, die mein Großvater erzählte, dann ja. Ich hab’s nie überprüft.«
Maja rieb sich das Gesicht mit beiden Händen. »Muss ein komisches Gefühl sein.«
»Was?«
Sie zeigte zum Dornacherplatz schräg gegenüber. »Ein ganzer Platz, eine Straße und dieses Denkmal. All das verbindet dich und deine Familie mit dieser Heldenlegende. Du musstest nicht mal was dafür tun, hast es einfach mit der Muttermilch eingesogen, während …« Sie schüttelte den Kopf. Ihre Augen waren feucht. Sie deutete auf das Wohnhaus. »Die Frau da oben wurde gerade mal fünfundzwanzig. Sie hatte nichts für sich. Sie wollte uns nur helfen.«
»Was ist geschehen?«, fragte er.
»Sie ist tot.«
»Tot? Ich dachte –«
»Sie haben angerufen, grad vorhin, bevor du gekommen bist. Vanessa ist in der Notaufnahme gestorben.« Maja schniefte. »Warst du schon in der Wohnung?«
»Noch nicht. Ich lasse erst mal die Spusi machen.«
Majas Schultern bebten. Sie beherrschte die Kunst des lautlosen Weinens. Zuletzt hatte er sie in diesem Zustand erlebt, als ihre Freundin und Kollegin Karin Jäggi lebensgefährlich verletzt worden war. Ebenfalls durch einen Messerstich. Auch da war es Maja gewesen, die die Kollegin gefunden hatte. Gegen Bezeugungen von Mitgefühl war sie allergisch und reagierte meistens bissig.
»Warum bist du eigentlich hier?«, fragte sie. »Du bist doch gar nicht Pikettoffizier.«
»Lukas wäre heute dran gewesen. Er hat mich angerufen. Warum erzählst du mir nicht, was vorgefallen ist? Wie kommt es, dass du als Erste da warst?«
»Das weißt du auch schon?«
»Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Sollte ich nicht?« Sein Blick ruhte auf ihr.
»Doch, schon, aber ich wollte zuerst …« Sie verwarf die Hände.
»Vanessa Kurth war deine Informantin. Du hast mir nicht gesagt, dass du sie heute treffen wirst.« Das sollte nicht vorwurfsvoll klingen. Gelang vielleicht nicht ganz.
»Was hätte das …« Sie hatte ihn doch verstanden. »Vanessa rief mich am Nachmittag an«, fuhr sie mit ruhigerer Stimme fort. »Sagte, sie wolle mich dringend sprechen.«
»Worum ging es?«
»Wollte sie am Telefon nicht sagen. Ich denke, es ging um Baddour.«
»Boran Baddour?«
Maja nickte. »Wir hatten uns beim üblichen Treffpunkt verabredet, bei der Loretokapelle. Ich habe eine halbe Stunde gewartet. Es kam auch schon mal vor, dass sie sich verspätet hatte. Sie antwortete nicht auf meine Anrufe. Ich kam her, um nachzusehen. Da rückte auch schon die Ambulanz an. Den Rest kennst du.« Maja zog die Nase hoch und tastete ihre Taschen ab. Dornach gab ihr ein Papiertaschentuch. »Danke. – Sie lebte noch, als wir reinkamen. Stichverletzung am Bauch. Irgendwie hat sie es geschafft, ein Frotteetuch als notdürftigen Druckverband auf die Wunde zu pressen. Trotzdem hat sie zu viel Blut verloren. Wenn ich nur ein paar Minuten früher hier gewesen wäre, wenn ich meine Zeit nicht mit der Warterei verplempert hätte, dann …«
Was sollte Dornach ihr sagen? Dass Selbstvorwürfe nichts brachten? Maja wusste das. Hatte sie es nicht selbst den Rookies, den frisch ausgebildeten Kollegen, immer wieder gepredigt? Sie hätte ihn informieren müssen.
Hätte das etwas geändert?
»Wie stand das Opfer … Vanessa Kurth mit Boran Baddour in Verbindung?«
»Sie war Jurastudentin an der Uni Bern und finanzierte sich den Lebensunterhalt mit Jobs als Kellnerin und Barfrau. Sie hat in einem von Baddours Schuppen gearbeitet, im ›Lioness‹ in Bellach.«
»Im ›Lioness‹, dem Puff?«
»Vanessa hat nur an der Bar gearbeitet. Für die Freier waren die Hostessen da.«
»Wie kommen wir dazu, eine Fünfundzwanzigjährige als Informantin zu führen?«
»Vanessa ist zu mir gekommen. Sie hatte Informationen über Boran Baddour.«
»Welcher Art? Wir wissen selbst eine Menge über seine Aktivitäten.«
»Nicht zuletzt dank Vanessa.«
»Worum ging es heute?«
Maja massierte sich den Nasenrücken. »Keine Ahnung. Deshalb sollten wir uns ja treffen. Am Telefon wollte sie nichts sagen. Es sei was Großes, meinte sie.«
Das konnte viel bedeuten, dachte Dornach. Boran Baddour war vielseitig tätig. Im Kanton Solothurn wurde er der Zuhälterei, des Drogenhandels und des Betruges verdächtigt. Seine Bars und Pubs, in der Regel waren es verkappte Bordelle, dienten im Wesentlichen zur Geldwäscherei. Was fehlte, waren die Beweise. »Hat sie wenigstens angetönt, was es sein könnte?«
»Mit keiner Silbe.«
»Ist es möglich, dass sie aufgeflogen ist? Leute wie Baddour machen mit Verrätern kurzen Prozess.«
»Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Vanessa hat nichts dergleichen erwähnt. Am Telefon schien sie arglos. Wie immer halt.«
»Was hat sie dazu gebracht, unsere Informantin zu werden?«
»Ihr Bruder ist an einer Überdosis Crystal Meth gestorben. Sie wollte etwas gegen die Drogenhändler unternehmen.«
»Haben wir das überprüft?«
»Habe ich persönlich gemacht«, sagte Maja gereizt. »Sie ist beim QVM vermerkt. Vanessa wollte nur mit mir arbeiten.«
Wie überall in der Schweiz behalf sich auch die Solothurner Kriminalpolizei mit externen Informanten. Dafür war der Dienstbereich Quellenführung und verdeckte Ermittlungen zuständig.
Maja stand auf. »Ich kaufe mir jetzt den Kerl.«
Dornach erhob sich ebenfalls. »Damit willst du bestimmt sagen, dass wir Hinweise und Fakten zusammentragen und auswerten, in alle Richtungen ermitteln und mögliche Zeugen und Verdachtspersonen befragen, nicht wahr?«
»Habe ich doch gerade gesagt.« Maja wies mit dem Finger zur Prisongasse, die im spitzen Winkel zum Patriotenweg in Richtung Aare führte. »Baddour betreibt dahinten eine Shisha-Bar. Wenn er nicht im ›Lioness‹ ist, sitzt er dort.«
Einen Steinwurf von Vanessas Wohnung entfernt. War sich die Frau ernsthaft bewusst gewesen, welche Risiken sie eingegangen war? Maja las Dornachs Gedanken. »Ich habe ihr oft genug gesagt, sie soll sich eine neue Wohnung suchen. Ich hätte ihr sogar dabei geholfen. Sie wollte partout nicht.« Sie deutete zum Wohnhaus. »Vor knapp vier Wochen ist sie dort eingezogen.«
Leichtsinn oder Sturheit, am Ende des Tages spielte es keine Rolle, welches von beiden einem das Leben kostete.
Die Shisha-Bar »Leila« war zu. Durch das Fenster war im hinteren Teil Licht zu sehen. Vorne standen vereinzelt Wasserpfeifen auf niedrigen Tischen.
»Früher wäre Baddour hier in bester Gesellschaft gewesen«, bemerkte Maja.
Gegenüber dem Gebäude, in dem sich die Shisha-Bar befand, lag das ehemalige Prison, ein aus Kalksteinquadern gemauerter dreigeschoßiger Bau mit schmalen vergitterten Fenstern aus dem 18. Jahrhundert. Bis Ende der 1970er Jahre diente er als Untersuchungsgefängnis. Später war es der Amtssitz der Untersuchungsrichter, bis eine Justizreform die nun im Franziskanerhof domizilierte Staatsanwaltschaft schaffte.
»Ich werde nie begreifen, was man daran findet.« Maja zeigte auf die Wasserpfeifen, die man durch das Fenster sehen konnte. »Was stimmt mit einem gepflegten Bier in einer stinknormalen Beiz nicht mehr?«
»Willkommen in der Multikulti-Gesellschaft.« Dornach klopfte an die Scheibe.
»Verstehe«, sagte Maja. »Weiße, die Wasserpfeifen blubbern, sind okay, westliche Rasta-Musiker, die ein Konzert geben, gehen dagegen gar nicht. So viel zu kultureller Aneignung. Es lebe die Beliebigkeit.«
Die Erweiterung der A 5 und die Fertigstellung der Westtangente hatten zu einer Entlastung des Verkehrs in Solothurn geführt, vor allem die bis dahin vom Durchgangsverkehr geplagte Vorstadt wurde aufgewertet. Auch wenn die »Mindere Stadt« am südlichen Aareufer nicht dieselbe aristokratische Aura hatte wie die Altstadt auf der Nordseite, verfügte sie über ein spezielles Cachet. Die verwachsenen und verwinkelten Gassen zwischen Krummturm und Kreuzacker bargen historische Bauten wie die Bastion Sainte-Croix oder Krummturmschanze, das Alte Spital und das Prison. Neben Boutiquen und Spezialitätenläden gab es eine Vielzahl von Bars, Take-aways und Restaurants.
Maja übernahm das Anklopfen auf ihre Art. Sie hämmerte mit beiden Fäusten auf die Glastür ein, bis sich im hinteren Teil des Lokals etwas regte. Ein Hüne von einem Mann trat aus einem Hinterzimmer und kam schulterrollend nach vorne. »Geschlossen!«, blaffte er durch die zugesperrte Tür und zeigte auf ein Schild. Mit einer unmissverständlichen Geste gab er ihnen zu verstehen, was sie seines Erachtens anstellen sollten.
Maja knallte ihren Dienstausweis gegen das Fenster. »Kantonspolizei. Aufmachen, sofort!«
Die nahe beieinanderliegenden Augenbrauen des Hünen wuchsen geradezu zusammen. Nach ein paar Sekunden Bedenkzeit entschloss er sich, der Aufforderung Folge zu leisten. Er schloss die Glastür auf. »Was wollt ihr?«
»Ihnen auch einen guten Abend.« Maja stellte sich und Dornach vor. »Wir würden gern Boran Baddour sprechen.«
»Den Boss?«
»Sofern die beiden eine Personalunion darstellen, gern.«
»Ist nicht da.«
»War Herr Baddour denn heute Abend hier?«, fragte Dornach.
Die Frage wurde mit einem Schulterzucken beantwortet.
»Was jetzt? War er hier oder nicht?« Majas Blick schweifte über das Lokal. »Hier drin dürfte er schwer zu übersehen sein.«
»Weiß nicht, ich war nicht den ganzen Abend hier.«
»Ach? Wo waren Sie denn zwischen halb neun und elf?«
Die furchenreiche Landschaft unter seinem Haaransatz zog sich noch mehr zusammen. »HESO.«
»Allein?«
»Mit Boran und ein paar Kumpeln was trinken.«
»Gut.« Maja zückte ihr Notizbuch. »Dann sagen Sie mir zuerst Ihren Namen und dann diejenigen Ihrer Kumpel.«
»Sascha«, brummte der Hüne. »Ich bin der Geschäftsführer.«
»Können wir Ihren Ausweis sehen und die Aufenthaltsgenehmigung?«
»Wieso?«
»Weil die Polizei nett danach fragt.«
»Habe ich nicht dabei.«
»Macht nichts.« Maja steckte das Notizbuch ein und holte stattdessen ihre Handschellen hervor. »Wir nehmen Sie mit auf den Posten, damit wir Ihre Personalien feststellen können.«
»Wieso, was habe ich getan?«
»Keine Papiere. Bei uns besteht Ausweispflicht für Ausländer. Ihrem Akzent entnehme ich, dass Sie einer sind.«
Der Mann fluchte in einer unbekannten Sprache. Er trottete nach hinten und kehrte kurzum mit einem rostroten Büchlein und der Ausländerausweiskarte zurück.
»Wie schön, doch gefunden.« Maja blätterte im Büchlein, einem Reisepass der Russischen Föderation. »Sie heißen Aslan Pawlowitsch Poljakow, geboren 1985 in Grosny, Republik Tschetschenien.«
»Meine Freunde nennen mich Sascha.« Er grinste frech.
»Schön für Sie, Herr Poljakow, Sie gestatten.« Maja machte ein Foto des Passes und des Ausländerausweises.
»Dürfen Sie das überhaupt?«, fragte Sascha empört.
»Wir dürfen«, sagte Dornach. »Kennen Sie eine Vanessa Kurth?«
Sascha nickte. »Sie arbeitet in der Bar in Bellach.«
»Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
»Gestern. Heute war ich nicht dort.«
»Wo finden wir Boran Baddour?«, wiederholte Dornach Majas Frage.
Saschas Schultern hoben sich erneut. »Ich war mit ihm an der HESO. Dann haben wir uns getrennt.«
»Von wann bis wann waren Sie zusammen?«
»Bis nach elf, etwa.«
Maja hielt ihm noch mal ihr Notizbuch hin. »Dann bitte noch die Namen der Personen aufschreiben, die das bezeugen können.«
Zwei Kriminaltechniker packten die Ausrüstung und die sichergestellten Asservate zusammen.
»Dürfen wir rein?«, fragte Dornach von der Eingangstür her.
»Kein Problem«, sagte der eine. Er hieß Florian, auf seinen Nachnamen kam Dornach gerade nicht. »Besondere Erkenntnisse?«
»Nichts Weltbewegendes, bis auf die Tatsache, dass wir nicht die Ersten waren. Entweder die Täterschaft oder jemand davor oder danach hat alles gründlich durchwühlt, Schränke, Schubladen, Matratzen. Hat wohl was gesucht.«
»Dürfte schwierig sein, herauszufinden, ob was fehlt«, sagte Dornach. »Die Frau ist im Spital verstorben.«
»Das tut mir leid. Sie war noch jung, nicht?« Florian klang betroffen. Er hatte eine Tochter, die etwa im selben Alter sein musste wie Vanessa Kurth.
»Fünfundzwanzig. Könnte es Raubmord gewesen sein?«
Florian machte ein skeptisches Gesicht. »Es lagen ein paar hundert Franken Bargeld herum. Eine Uhr haben wir auch gefunden. Glaube nicht, dass ein simpler Einbrecher so was liegen lässt.«
Maja hielt die Nase in die Luft.
»Riechst du was?«, fragte Dornach.
»Das Parfüm«, sagte Maja. »Riechst du’s nicht?«
Dornach schnupperte. Er brauchte einen Moment, bis er schwach eine würzige Holznote wahrnahm.
»Was ist damit?«
»Ich bin nicht sicher. Vanessa verwendete kein Parfüm, glaube ich jedenfalls.«
»Vielleicht hatte sie ein galantes Rendez-vous«, sagte Florian. »Wir haben ihre Wässerchen, Tübchen und Töpfchen eingetütet. Kannst ja mal dran riechen.«
Maja winkte ab. »Später. Hatte sie ein Handy oder ein Notebook?«
»›Hatte‹ ist der richtige Ausdruck«, sagte Florian. »Anschlusskabel und Lader sind vorhanden, keine Geräte, sogar die WLAN-Box ist weg.«
»Wertsachen sind noch da, Handy und PC verschwunden«, sagte Maja. »Das war kein Einbruch, der aus dem Ruder gelaufen ist. Der oder die Täter wollten Vanessa nicht nur zum Schweigen bringen. Sie wollten sicherstellen, dass wir nichts finden.«
»Scheint so«, sagte Dornach. »Tatwaffe?«
Florian reichte ihm eine Tüte. Sie enthielt ein Messer mit schwarzem Kunststoffschaft. Dornach betrachtete es im Licht. »Sieht aus wie ein gewöhnliches Küchenmesser.«
»Ist es wohl auch. In der Küche steht ein Messerblock mit identischen Klingen verschiedener Größe. Eine fehlt.« Florian tippte auf die Tüte.
»Eigenartig«, sagte Maja. »Jemand, der Vanessa töten will, bringt doch eher seine Mordwaffe mit. Zumindest lässt er sie nach der Tat nicht liegen.«
»Also wurde sie im Affekt getötet«, sagte Dornach. »Spricht nicht unbedingt für Baddour als Täter.«
»Warum nicht? Möglicherweise stellte er sie nur zur Rede. Sie hat sich gewehrt. Es kommt zum Handgemenge, und plötzlich ist da das Messer.«
»Hat jemand im Haus etwas gehört oder gesehen?«
Maja zuckte mit den Achseln. »Die Kollegen haben überall geklingelt. Bis jetzt negativ, niemand will etwas bemerkt haben. Wir kommen morgen oder am Sonntag noch mal wieder.«
»Wer ist der Vermieter?«
»Karin und Google checken das. Morgen wissen wir mehr, vielleicht erst am Montag. Es ist Wochenende.«
Mit Google meinte sie nicht die Suchmaschine, sondern ihren digitalaffinen Kollegen Rolf Gubler. Dornach hatte eine weitere Frage auf der Zunge gehabt. Sie fiel ihm gerade nicht ein.
»Wir haben alles beisammen«, verkündete Florian. »Dokumente, Fotos, ein Tagebuch und ihre Post sind auf dem Weg in die Schanzmühle.«
»Gut. Kümmert ihr euch um die Verbindungsnachweise ihres Handys? Maja hat die Nummer. War jemand von der Staatsanwaltschaft hier?«, fragte Dornach.
»Frau Wirz hat angerufen. Sie war an einem anderen Tatort und deswegen verhindert. Du sollst ihr morgen Bericht erstatten.«
Dornach hatte bisher wenig mit Hannah Wirz zu tun gehabt. Ihm schien, dass sie ihm aus dem Weg ging. Die Zusammenarbeit hatte definitiv Luft nach oben. »Ich melde mich morgen bei ihr. Ansonsten machen wir Feierabend.« Beim Wort Anruf fiel ihm ein, was er noch wissen wollte. »Wer hat eigentlich den Notruf abgesetzt?«
»War anonym mit nicht registriertem Handy, wahrscheinlich prepaid«, sagte Maja. »Die Stimme war verzerrt.«
Eine Frau? Eine Nachbarin? Aus welchem Grund würde jemand aus dem Haus anonym anrufen? Sie waren bei der Wohnungstür, als Florian sie zurückrief. »Da ist noch eine Kleinigkeit. Bringst du mal die Kiste, Kari«, sagte er zu seinem Kollegen.
Kari brachte ihnen eine vorne vergitterte Plastikbox. »Wir mussten das Viech einsperren, damit es uns nicht ständig um die Beine streicht.«
»Ist das eine Katze?«, fragte Dornach. Diese Gattung Vierbeiner gehörte nicht zu seinen Lieblingstieren.
Florian grinste. »Wenn es aussieht wie eine Katze und miaut wie eine Katze, ist es in der Regel eine Katze.« Ein klägliches Miauen aus dem Innern der Box bekräftigte die Aussage. Jetzt bemerkte Dornach auch den Katzenbaum in einer Ecke des Wohnzimmers.
»Was macht ihr mit ihr?«
»Wir? Gar nichts«, sagte Florian. »Die Tierheime haben zu.«
»Kann man sie nicht über Nacht hierlassen? Die Wohnung wird doch abgeschlossen und versiegelt.«
Erneutes anklagendes Miauen kommentierte Dornachs Vorschlag.
Maja schnalzte vorwurfsvoll mit der Zunge. »Also wirklich, Dominik.« Sie klopfte sanft mit den Fingerspitzen ans Gitter. Ein grün-graues Augenpaar beobachtete sie aufmerksam. »Das arme Ding musste bestimmt mit ansehen, was seinem Frauchen angetan wurde, und du willst es hier zurücklassen?«
Dornach schwante nichts Gutes. »Kann nicht einer von euch die Katze mit nach Hause nehmen, bis ein Platz für sie gefunden ist?«
Florian schüttelte vehement den Kopf. »Meine Kids sind allergisch.«
»Und wir haben zu Hause einen Hund«, sagte Kari. »Dazu zwei extrem eifersüchtige Meerschweinchen. Ich könnte für nichts garantieren.«
Dornach sah Maja an. Sie hob abwehrend beide Hände. »Nichts zu machen, Chef. Meine Wohnung ist zu klein. Außerdem gehe ich gleich noch ins Büro, Bericht schreiben.«
Alle Blicke richteten sich erwartungsvoll auf Dornach. Er seufzte. »Ihr seid mir schöne Kollegen.«
»Was denn«, erwiderte Maja. »Die Villa Dornach ist groß, und der Umschwung bietet genug Auslauf für eine Katze. Außerdem kann sich Frau Reinhard um sie kümmern. Als Bauersfrau hat sie Erfahrung damit.«
Dornach waren die valablen Gegenargumente ausgegangen. »Na schön.« Er übernahm die Box von Kari, der ihm zwei Plastiktüten dazugab.
»Futter und Katzenstreu«, sagte er. »Ein Kistchen oder einen Karton wirst du wohl zu Hause haben.«
»Braucht’s das alles? Morgen kommt das Viech ins Tierheim.« Wobei er sich das wahrscheinlich nur einredete. Jahrelang war es ihm gelungen, Pias Wunsch nach einer Katze erfolgreich abzublocken. Das hier würde seinen Widerstand brechen.
»Na dann, viel Glück«, sagte Kari. »Hast du eine Ahnung, wie voll die Tierheime momentan sind?«
Wenigstens war klar, wer sich im Haus Dornach um das Katzenviech kümmern würde.
Pia war noch nicht im Bett. Sie saß in der Küche vor einem Glas Milch und beschäftigte sich mit ihrem Handy.
»Kannst du nicht schlafen?«, fragte Dornach, nachdem sie sich begrüßt hatten.
»Wo kommst du her?«, gab sie zurück. Sie war sichtlich müde. Gleichzeitig hatten ihre Augen einen Glanz, den er seit Langem nicht bei ihr gesehen hatte. Hatte sie sich etwa verliebt? Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, sie das zu fragen. »Einsatz. Und du? Ereignisreiche Nacht gehabt? Wo warst du eigentlich?«
»Arbeiten, hab ich dir doch gesagt.«
»Richtig, hast du.« Dornach füllte ein Glas mit Leitungswasser. »Was war das gleich noch mal?«
»Hörst du auch mal zu, wenn ich was erzähle?«
»Du erzählst mir vieles. Hilf mir auf die Sprünge.« Er leerte das Glas in einem Zug.
»Ehrlich, nächstes Mal sag ich’s der Wand. Das Barzelt des ›Berna Kebab & Tapas‹ an der HESO. Es gehört Silvano Moretti. Sein Lokal liegt in der neuen Schöngrün-Überbauung in Biberist. Klingelt’s?«
»Ja, du hast ihn mir mal gezeigt. Groß, sportlich, dunkelhaarig. Dein Beuteschema.«
»Eine seiner Barfrauen ist ausgefallen. Und da ich mal diesen Barkeeper-Kurs gemacht habe, der …« Sie stockte. »Was soll das heißen, mein Beuteschema?«
»Ich dachte nur. So wie du von ihm schwärmst.«
Pia schnaubte. »Whatever.« Sie trank ihre Milch aus. »Ich gehe ins Bett. Morgen ist Samstagsmarkt.« Sie bemerkte die Box, die er auf dem Boden abgestellt hatte. »Was ist das? Verhaftet ihr neuerdings Katzen?« Sie stellte die Box auf den Küchentisch und spähte durch die Gitteröffnung. Prompt schlug ihr protestierendes Miauen entgegen. Sie öffnete das Gitter und hob ein wohlgenährtes Prachtexemplar heraus. Bis auf den weißen Bauch und die Pfoten war das Fell rostrot. In der Mitte der Stirn hatte sie einen weiteren weißen Fleck. »Na du. Was bist du denn?« Pia hob die Katze hoch und warf einen prüfenden Blick zwischen die Hinterbeine. »Ein Kerl. Wie heißt er?«
»Keine Ahnung, er hat keinen Ausweis bei sich.«
»Hat er wohl, hier.« Pia zeigte auf das Lederhalsband mit einem Namensschild aus Messing.
Dornach entzifferte die Gravur. »King Louie? Komischer Name für einen Kater. Kommt mir bekannt vor.«
»Ist aus dem Dschungelbuch.« Als kleines Kind hatte Pia den Disney-Trickfilm unzählige Male gesehen. »King Louie, das ist der Orang-Utan, der Anführer der Affenbande, die das Menschenkind Mogli entführt hat.«
»Das da ist aber ein Kater.«
Pia sah ihn kopfschüttelnd an. »Manchmal bist du echt vernagelt. Sieh dir sein Fell an, rostrot wie der König der Affen im Film.«
Wenn sie meinte. Die Art, wie der Kater in der Küche herumstolzierte und alles beschnupperte, hatte tatsächlich etwas Erhabenes. »Er ist das Haustier eines Tatopfers. Wir versuchen, ihn morgen in einem Tierheim unterzubringen.«
King Louie setzte sich vor sie hin und miaute fordernd.
»Er hat Hunger«, sagte Pia. »Habt ihr ihm nichts gegeben?«
»Wir?«
»Wer denn sonst? Jeder, der von euch über Nacht eingebuchtet wird, kriegt mindestens ein Sandwich. Dieses arme Viech lasst ihr verhungern.«
Dornach deutete auf die Plastiktüten. »Da hat’s Futter drin.«
King Louie strich ruhelos um Pias Beine, bis sie den Inhalt einer Futterdose mangels eines Fressnapfs in eine Müeslischüssel befördert und zusammen mit einem Schälchen Milch auf den Boden gestellt hatte. Der Kater machte sich sofort darüber her.
Sie beobachteten ihn beim Fressen. Pia runzelte die Stirn. »Mir ist, ich habe den schon mal gesehen. Wo, sagst du, habt ihr ihn gefunden?«
»In der Wohnung einer jungen Frau beim Rossmarktplatz.«
»Am Rossmarktplatz? Etwa dort, wo vorher das Tea-Room Vorstadt drin war?«
»Genau. Warum fragst du?«
»Eine Kommilitonin wohnt dort, Vanessa. Ich war mal kurz bei ihr zu Hause. Sie hat so eine Katze …« Pia sah ihren Vater an. »Heißt das … ist Vanessa das Opfer?«
»Tut mir leid.«
»Was ist passiert?«
»Sie wurde schwer verletzt aufgefunden. Leider ist sie auf dem Weg ins Spital gestorben.«
»Vanessa? Tot?« Pia brauchte einen Moment, um die Nachricht zu verarbeiten.
»Hast du sie gut gekannt?«, fragte Dornach.
King Louie hatte seine Mahlzeit beendet. Pia hob ihn hoch und kraulte nachdenklich seinen Kopf. »Ich war nicht eng mit ihr wie mit Nadal und Manu. Wir haben manchmal zusammen gelernt und geredet. Wie … wie ist sie gestorben?«
»Darf ich dir leider nicht sagen. Wir gehen von Dritteinwirkung aus.«
»Mord?«
»Ist noch zu früh, Pia. Kannst du mir etwas zu Vanessa sagen? Wie war sie als Mensch? Hatte sie einen Freund – oder eine Freundin?«
»Darüber haben wir nie gesprochen. Ich habe sie mal mit einem Typ gesehen. Ist aber schon ein paar Monate her. Es war bestimmt keiner von unserer Fakultät. Ist auch schon wieder vorbei, glaub ich wenigstens.«
»Kennst du seinen Namen?«
»Keine Ahnung? Wie gesagt, Vanessa und ich waren nicht so eng. Sie hat eine BFF, glaube ich, die müsste eigentlich mehr wissen.«
»BFF?«
»Best friend forever. Eine allerbeste Freundin.«
»Wie du und Nadal oder Manu?«
»Willkommen im dritten Jahrtausend, Paps.« Pia hatte eine unnachahmliche Art, ihm das Gefühl zu geben, alt zu werden.
»Danke, wie heißt diese BFF?«
»Keine Ahnung. Anja, Anna oder so. Ich erkundige mich und gebe dir Bescheid.«
»Hat Vanessa Angehörige, Eltern, Geschwister?«
»Die Mutter ist, glaub ich, früh gestorben, Krebs oder so was. Der Vater ist Auslandschweizer und lebt in Asien, Singapur oder Malaysia, in der Ecke. Geschwister hat sie keine. Vanessa hat mal erzählt, dass sie einige Jahre bei ihrer Großmutter gewohnt hat. Sie ist gestorben, als Vanessa zwanzig war.«
»Heißt, sie war allein auf sich gestellt. Wer finanziert ihr Studium?«
»Ihr Vater schickt ihr regelmäßig etwas Geld. Dazu kommt ein Stipendium. Daneben jobbte sie als Kellnerin in Restaurants oder Bars.«
»Wann hast du sie zuletzt gesehen? War sie da anders als sonst?«
»Das muss etwa zwei Wochen her sein. Ob sie anders war? Keine Ahnung. Sie war schon ein wenig eigen. Hat immer mal wieder mit ihrer Geheimnistuerei genervt.« Pia schmiegte ihren Kopf an den Kater, was der mit einem zufriedenen Schnurren quittierte. »Armer King Louie, was machen wir jetzt mit dir?«
Vor diesem Moment hatte Dornach sich gefürchtet.
»Du kannst den armen Kerl nicht in einem Tierheim versauern lassen, Paps. Wir behalten ihn hier.«
Pias Bestimmtheit erhöhte die Messlatte für jegliches Gegenargument. »Wer soll sich um ihn kümmern, ich arbeite, du studierst, Frau Reinhard ist nicht mehr in der Lage, sich um alles zu kümmern. Mirio ist zu klein.«
»King Louie ist ein Kater, Paps, kein Hund. Er braucht niemanden, der sich den ganzen Tag mit ihm abgibt und Gassi geht. Bei Vanessa war er wahrscheinlich tagelang allein zu Hause. Daria kann sich um ihn kümmern. Ihre Mädchen würden sich bestimmt über einen Spielkameraden freuen, nachdem sie ihre Katze in ihrer Heimat zurücklassen mussten.«
Frau Reinhard, die langjährige Haushälterin der Dornachs, war weit über siebzig. Die Dinge gingen ihr nicht mehr so leicht von der Hand. Nachdem Dornach ihr vor einigen Monaten nahegelegt hatte, sie brauche Unterstützung, hatte sie ihnen Daria Bondarenko vorgestellt. Die Ukrainerin war mit ihren beiden Töchtern von neun und sieben Jahren aus ihrem Dorf bei Kiew geflüchtet, bevor es von Putins Truppen überrannt worden war. Ihr Mann hatte nicht ausreisen dürfen und war kurz darauf eingezogen worden. Das Letzte, was Daria von ihm gehört hatte, war, dass er in einem russischen Kriegsgefangenenlager in der Südukraine war. Niemand wusste, wie es ihm ging und ob er noch am Leben war. Dornach hatte das »Stöckli« über der Garage für sie herrichten lassen. Seine Eltern würden bei ihrem nächsten Heimatbesuch im Gästezimmer wohnen.
Pia hatte gewonnen. Der Kater würde bleiben.
Dornach nahm es sportlich.
ZWEI
Die Bürotür stand offen. Dornach klopfte kurz an den Türrahmen und trat ein. Der Hauch eines blumigen Parfüms hing in der Luft, vermischte sich mit dem Aroma frisch gebrauten Kaffees.
»Guten Morgen, Katrin.«
»Dominik.« Kripochefin Katrin Friis zeigte zum Sitzungstisch. »Setz dich.« Gewöhnlich gehörten die Wochenenden ihr und ihrer Familie. Wenn es die Umstände erforderten, war sie vor Ort. »Kaffee?«, fragte sie.
»Danke, hatte ich bereits.«
Sie setzte sich ihm gegenüber an den Tisch. »Ich habe Majas Bericht gelesen. Tragisch. Wie ist die Spurenlage?« Friis hatte es gern kurz und bündig.
»Wir gehen davon aus, dass in der Wohnung ein Kampf stattgefunden hat. Anscheinend wurde Frau Kurth mit ihrem eigenen Küchenmesser niedergestochen.«
»Erste Vermutungen?«
»Keine Anzeichen, dass sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hat. Vermutlich hatte Frau Kurth die Person gekannt.«
»Nur ein Täter?«
»Die Spuren lassen den Schluss zu. Es könnte eine Tat im Affekt gewesen sein, vielleicht aus einem Streit heraus. Frau Kurth könnte sich mit dem Messer gewehrt haben. Die Täterin oder der Täter entwaffnet sie und verletzt sie damit, absichtlich oder aus Versehen.«
»Dafür spricht, was im Bericht der Rechtsmedizin steht. Es gibt Abwehrverletzungen an den Oberarmen und an der Schulter.« Friis schob die Unterlippe vor. »Kann auch sein, dass der oder die Täterin ihr von Anfang an Gewalt antun wollte.«
»Möglich. Aber wenn es eine geplante Tat war, frage ich mich, weshalb die Täterschaft die Tatwaffe dagelassen hat. Maja und Karin gehen einem Hinweis aus der Nachbarschaft nach.«
»Was für ein Hinweis?«
»Ein uniformierter Kollege hat heute Morgen die Aussage einer älteren Dame aufgenommen, die gestern im Lauf des Nachmittags einen Streit aus der Wohnung von Vanessa Kurth gehört haben will. Wir suchen weitere Zeugen, die das bestätigen und eventuell etwas gesehen haben.«
»Frau Kurth könnte die Tatperson also gekannt haben. Hinweise auf sexuellen Missbrauch?« Hinter der Frage verbarg sich nicht nur fachliches Interesse. Friis hatte zwei Kinder. Das ältere, eine Tochter, feierte in diesem Jahr seinen achtzehnten Geburtstag. Dornach konnte die Sorge seiner Chefin nachvollziehen. Er hatte dasselbe mit Pia durchgemacht und tat es noch heute. Angst um ihre Kinder verfolgte Eltern ein Leben lang. »Die Legalinspektion ergab keine Anzeichen.«
»Zumindest das wurde ihr erspart«, sagte Friis. »Arme Frau, wurde mit gerade mal fünfundzwanzig aus dem Leben gerissen.« Einen Moment saßen beide schweigend da, ein kurzes stilles Gedenken an den sinnlosen Verlust eines jungen Lebens.
»Frau Kurth soll eine unserer Informantinnen gewesen sein?«, nahm Friis den Faden wieder auf.
»Das ist richtig. Sie hat uns mit Insiderwissen aus dem Dunstkreis von Boran Baddour versorgt.«
»Boran Baddour? Der Kronprinz von Akim Baddour, Chef des gleichnamigen Clans?«
»Frau Kurth arbeitete in einem seiner Etablissements, dem ›Lioness Pub‹ in Bellach. Sie ist von sich aus zu uns gekommen. Ihr Bruder ist an einer Überdosis Drogen gestorben, die angeblich aus Baddours Küche stammten.«
Friis lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und richtete den Blick an die Decke. »Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Boran Baddour befragen wollt? Weil er dahintergekommen sein könnte, dass Frau Kurth uns mit Informationen über seine Machenschaften versorgt?«
»Ich denke, wir sollten ihm auf den Zahn fühlen.«
Friis überlegte kurz. »Einverstanden, aber bitte mit Feingefühl. Ich habe keine Zeit, mich mit einem Heer wild gewordener Anwälte herumzuschlagen. Die lassen sich von ihrem Mandanten jede Minute bezahlen, wir können das nicht.«
Dornach stand auf. »Keine Sorge. Wir ziehen Glacéhandschuhe an.«
»Klärst du das mit Staatsanwältin Wirz?«
Dornach ließ sich zurück auf den Stuhl fallen. »Ich kann es noch mal probieren.« Er hatte heute bereits zweimal vergebens versucht, sie zu erreichen, obwohl sie angeblich auf seinen Bescheid wartete.
»Sie hat mich angerufen«, sagte Friis.
»Wirz?« Das klang nicht gut.
»Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, Hannah Wirz ziehe es vor, mit mir zu reden anstatt mit dir. Ist was zwischen euch beiden, wovon ich wissen sollte? Hattet ihr mal –«
»Nein, hatten wir nicht«, schnitt er ihr das Wort ab. »Soweit es mich betrifft, habe ich gegenüber Frau Wirz keinerlei Vorbehalte. Warum sie mir die kalte Schulter zeigt, ist mir ein Rätsel.«
Friis schürzte die Lippen. »Angela Casagrandes Weggang hat Wellen geschlagen, Dominik. Dass ihr beide ein Verhältnis hattet, wurde im Franziskanerhof nicht von allen goutiert.« Friis verriet mit keiner Miene, ob sie selbst es missbilligte oder nicht.
»Das ist bedauerlich. Gab es je oder gibt es Beanstandungen unserer fachlichen Zusammenarbeit?«
»Mir ist nichts zu Ohren gekommen. Der Oberstaatsanwalt hat sich nie negativ geäußert, weder zum einen noch zum andern.«
Das musste reichen. Dornach kannte Mosimann. Bei ihm galt die Devise: Nicht geschimpft ist genug gelobt.
»Am besten sprichst du mal mit Hannah Wirz. Einer von euch beiden muss den Anfang machen.«
Auf seine Anrufe und Nachrichten zu reagieren wäre ein guter Anfang. »Kein Problem, an mir soll’s nicht liegen.«
Damit war die Sache für Friis erledigt. »Hatte Frau Kurth Angehörige, die wir verständigen müssen?«
Dornach erklärte ihr, dass der Vater in Thailand lebte. »Die Adresse ist unbekannt. Karin versucht, ihn über die Botschaft in Singapur ausfindig zu machen. Wegen des Wochenendes wird das nicht vor Montag der Fall sein. Klärst du das wegen Baddour mit Frau Wirz?«
Friis’ Mundwinkel zuckten. »Okay, ich rede mit ihr. Du siehst aber zu, dass ihr eure Zusammenarbeit auf die Reihe bringt.«
»Natürlich, danke.« Eine ankommende Nachricht auf seinem Handy hinderte ihn ein weiteres Mal am Aufstehen. Sie war von Karin und kam wie gerufen. »Gerade ist ein weiterer triftiger Grund eingetroffen, weshalb wir Boran Baddour befragen sollten.«
»Der wäre?«
»Boran Baddour ist der Besitzer der Liegenschaft am Patriotenweg. Er ist nicht nur der Arbeitgeber von Vanessa Kurth, sondern auch ihr Vermieter.«
***
Nadine blinzelte.
Selbst mit aufgesetzter Sonnenbrille fühlte es sich an, als würden die Netzhäute das UV-Licht ungefiltert aufnehmen. Das trug nicht zur Linderung ihrer Kopfschmerzen bei.
Ein stechender Schmerz in der Seite ließ sie zusammenzucken. »Mach das noch mal, und du schläfst heute Nacht an einem sehr kalten, harten Ort«, fuhr sie Cédric an, der sie gekniffen hatte. Es hatte eine liebevoll neckende Geste sein sollen. Nach kaum anderthalb Stunden Schlaf und mit der Mutter aller Kater war es nur eine Pein.
Cédric grinste. »Wollte nur sehen, ob du aus deinem Schnapskoma erwacht bist. Kannst du die Fahrt nicht wenigstens ein klein wenig genießen?«
Sie wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. »Ich kotze gleich das Boot voll, wenn du nicht aufhörst, an mir rumzufummeln.«
»Aber –«
Nadine deutete einen Kehlschnitt an. »Sendepause, ich will nichts hören.«
Sie war nicht fair zu ihm, das war ihr bewusst. An ihrem Brummschädel war sie selbst schuld. Sie hätte darauf bestehen sollen, nach Kneipenschluss an der HESO gleich nach Hause zu gehen, mit oder ohne Cédric. Stattdessen hatte sie sich breitschlagen lassen, zur Wohnung eines seiner Kumpels zu fahren und weiterzufeiern. Der Jahrestag ihrer Verlobung musste gefeiert werden, hatte er gemeint. Sie waren um halb sieben Uhr morgens ins Bett gekommen.
Das wäre so weit kein Problem gewesen, wenn sie nicht schon um elf Uhr beim Schiffsanleger bei der Rötibrücke hätten sein müssen. Es war der Geburtstag ihres zukünftigen Schwiegervaters. Er hatte Familie und Verwandte, zu denen Nadine auch gehörte, dorthin bestellt. Auf dem Programm zu seinem Siebzigsten stand eine Apéro-Fahrt mit der MS »Pisoni«, einem der drei Ausflugsboote der Öufi-Flotte. Nadine hasste Boote, erst recht, wenn sie einen Kater hatte. Sie hatte sich an die Reling gesetzt, für den Fall, unfreiwillig die Fische füttern zu müssen. Ziel der Flussreise war der Uferpark Attisholz, wo sie im Restaurant 1881, einer ehemaligen Fabrikkantine, mittagessen wollten. Allein beim Gedanken an feste Nahrung verknoteten sich Nadines Magennerven. Sie lehnte den Kopf an Cédrics Schulter und schloss die Augen.
Das Schiffshorn riss sie aus ihrem Dämmerzustand. Sie hatte fast die ganze Fahrt verschlafen. Die gemächliche Fahrt durch die herbstliche Flusslandschaft, die Unterhaltungen und das Geschwätz der anderen Gäste hatten sie eingelullt. Das Boot steuerte den Anleger des Uferparks an. Auf der linken Seite glitten die mit bunten Graffiti bemalten Gebäude der Industriebrache und der historische Säureturm vorbei. Nadine war froh, bald aus der Nussschale aussteigen zu können. Sie hoffte, ihr Magen würde die anstehende Nahrungsaufnahme zulassen. Sie hatte sich vorgenommen, bis auf Weiteres auf Alkohol zu verzichten. Ihr Blick glitt über das mit Bäumen und Buschwerk überwachsene Ufer. Zwischen dem Herbstlaub schimmerte die weiße Fassade des Fabrikneubaus eines amerikanischen Pharmamultis hindurch. Auf einer dem Ufer vorgelagerten Kiesbank sah sie ein verlassenes Holzboot mit Außenbordmotor. Anscheinend war es leckgeschlagen. Der Bug war im Trockenen, das Heck war vollgelaufen. Den Kahn hatte wohl einer im Suff auf Grund gesetzt. Die »Pisoni« fuhr in wenigen Metern Distanz daran vorbei. Nadine konnte ins Innere sehen.
Sie hatte sich lange beherrschen können, doch dieser Anblick war zu viel. Ihr Mageninhalt ergoss sich über den Schoß ihres Verlobten.
***
»Welchem Säuli willst du helfen?«, fragte Pia ihren Sohn.
Auf dem Monitor über der Arena wurden die vierbeinigen Athleten des traditionellen HESO-Säulirennens auf Video vorgestellt. Die Jungschweine trugen Mäntelchen in den Farben und mit den Logos der Sponsoren, nach denen sie jeweils benannt waren. Mirio entschied sich für dasjenige, dessen Patenschaft ein lokaler Radiosender übernommen hatte. Er versuchte, die Aufmerksamkeit seines Favoriten im Stall auf sich zu lenken, derweil sich Pia in die Schlange beim Wettstand einreihte. Sie war kurz abgelenkt, um die Wettkarte entgegenzunehmen und zu bezahlen. Als sie wieder zu den Ställen hinübersah, fand sie Mirio nicht mehr, nur noch eine Gruppe älterer Jungen, die miteinander um etwas rangelten. Sie hastete hinüber und war genau in dem Moment zur Stelle, als ein schlaksiger Mann im schwarzen Hoodie den weinenden Mirio hochhob. Aus Pias Sorge wurde Panik.
»Lass ihn los!«, brüllte sie, bereit, auf den Mann loszugehen.
Der Mann, er schien kaum zwanzig zu sein, sah ihr arglos entgegen. Pia blieb stehen.
»Mami!« Mirio streckte seine Arme nach ihr aus.
Pia entriss ihn dem Unbekannten. »Was soll das? Was wolltest du mit ihm?«
»Nichts, ich …«
Pia hörte nicht hin. Sie war woanders. Ihr Gedächtnis spulte Bilder ab, die sie noch heute zuweilen in ihren Alpträumen verfolgten. Die Hütte in Samarra. Rafik, der sich den Angreifern entgegenstellte, um sie zu schützen, und es mit dem Leben bezahlte. Sie hatte ihm nicht einmal sagen können, dass sie schwanger war. Dann die Kinder, die allein in der Hütte wohnten. Pia warf sich über sie, um sie vor den Kugeln der Angreifer zu bewahren.
»Das ist ein Missverständnis.« Die Stimme eines fremden Mannes mit einem Buben an der Hand holte sie in die Gegenwart zurück.
»Was?«, fragte sie verwirrt.
»Der junge Mann wollte nur helfen. Die Racker hier«, der Fremde zeigte auf den kleinen Jungen an seiner Hand und drei weitere, die danebenstanden, »haben sich vorgedrängelt und Ihren Sohn geschubst, dabei ist er gestürzt. Der junge Mann hat ihn hochgehoben, damit ihm nichts passiert bei den vielen Leuten hier. Ich muss mich für meinen Jungen entschuldigen.«
»Ist das wahr?«, fragte Pia den jungen Mann mit dem Hoodie.
»Ja, echt, sorry«, sagte er.