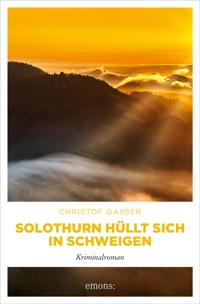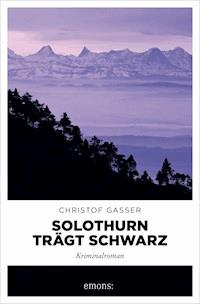
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Solothurner Kantonspolizei Teil 1
- Sprache: Deutsch
Ein Zürcher Journalist wird tot am Aare-Ufer aufgefunden. Steckt die Balkan-Mafia, über die der Reporter recherchiert hat, hinter dem Anschlag? Bevor Dominik Dornach von der Solothurner Kantonspolizei und Staatsanwältin Angela Casagrande die brisanten Zusammenhänge aufdecken können, geschieht ein weiterer Mord - und Dornachs Tochter Pia gerät in tödliche Gefahr . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christof Gasser, geboren 1960 in Solothurn, war als Betriebswirtschafter lange in leitender Funktion in der Uhrenindustrie tätig und arbeitete zwölf Jahre in Asien. Heute ist er selbstständig und unterrichtet nebenamtlich als Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Vor einem Jahr entschloss er sich, seinen Jugendtraum zu verwirklichen, und hat seinen ersten Roman «Solothurn trägt Schwarz» geschrieben. Christof Gasser lebt mit seiner Frau in der Nähe von Solothurn, Schweiz.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen und realen Handlungen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/Alamy Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne(CH) eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-960-8 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für meine Mutter, sie lehrte mich die Liebe zu Büchern; und für meinen Vater, er lehrte mich die Liebe zu Geschichten.
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Friedrich Nietzsche, «Jenseits von Gut und Böse»
In der griechischen Mythologie verkörpert Nemesis die Göttin des gerechten Zorns oder der ausgleichenden Gerechtigkeit. Oft vereinfacht als Rachegöttin dargestellt, symbolisiert sie die Kraft des Gleichmasses und bestraft die menschliche Selbstüberschätzung und Arroganz(Hybris). Sie tritt in Erscheinung, wenn das göttliche Recht und die Sittlichkeit
Prolog
Recherswil bei Solothurn
Als die ersten Strahlen der Morgensonne in sein Gesicht schienen, wusste Luca, dass es der schönste Tag in seinem Leben sein würde. Mit einem stillen Jauchzer schlug er seine blaue Bettdecke mit dem Aufdruck seines Lieblingshelden Spiderman zurück, hüpfte mit einem Satz aus dem Bett und streifte sich hastig die Kleider vom Vortag über. Es war noch früh, erst sieben Uhr. Seine Eltern waren sicher noch nicht wach. Leise schlich er vor ihre Schlafzimmertür und horchte. Er konnte seine Mutter hören. Sie kicherte und zwischendurch seufzte sie tief. Auch der Vater lachte und keuchte laut.
Eigentlich könnte er reingehen und sie bitten, aufzustehen. Sie waren ja wach. Aber etwas an dem, was er hörte, hielt ihn zurück. Vielleicht spielten sie dieses komische Spiel, bei dem die Grossen im Bett allein sein wollten.
Er ging hinunter ins Wohnzimmer. Ihm war langweilig. Ausgerechnet heute, an seinem achten Geburtstag, spielten seine Eltern dieses doofe Spiel. Er hatte so lange gewartet und wollte endlich sein Geschenk, sein eigenes ganz neues Velo mit den vierundzwanzig Gängen. Sein altes Rad hatte nur zwölf, und er hatte es gebraucht von seinem Cousin Sven gekriegt, weil der zu gross dafür geworden war.
Kurz entschlossen ging Luca in die Garage. Er wusste, dass es dort sein musste. Die Eltern wollten ihn überraschen, aber er hatte es schon lange gesehen, versteckt unter einer Plane hinter dem Gestell, wo sein Vater die Winterpneus, Schneeketten, Kindersitze und andere Dinge aufbewahrte.
In der Mitte des Abstellraumes, unter einer durchsichtigen Plastikfolie, stand es vor ihm, sein neues Velo. Der Rahmen in Spiderman-Blau leuchtete durch die klare Hülle. Eigentlich hatte er es sich nur ansehen wollen. Aber als er es so sah, gab es für Luca kein Halten mehr. Die Plastikhülle liess sich leicht abstreifen. Mit glänzenden Augen inspizierte er das Velo. Er fuhr mit seinen Händen über den glänzenden blauen Lack und strich über das Leder des rot-schwarzen Sattels. Er prüfte die Bremsen und die Luft in den Reifen, wie es ihm sein Vater gezeigt hatte.
Schliesslich stieg er auf. Es passte. Der Händler hatte alles schon eingestellt. Er musste es unbedingt sofort ausprobieren. In der Garage war zu wenig Platz. Er drückte auf den elektrischen Toröffner und schob das Rad auf den Vorplatz. Dort stand der schwarze 3erBMW des Vaters hinter dem roten Mini seiner Mutter. Kein Platz mehr für eine Proberunde. Vorsichtig lenkte er sich und das Velo an den beiden Fahrzeugen vorbei.
Keine Menschenseele war auf dem Quartiersträsschen zu sehen. Nur ein paar Autos waren am Rand abgestellt. Luca überlegte. Seine Eltern hatten ihm verboten, ausserhalb des Grundstücks allein zu fahren. Aber was konnte schon passieren, wenn er vorsichtig war und vorne nicht auf die grosse Strasse rausfuhr? Er schaute zum Zimmer seiner Eltern hinauf. Die Jalousien waren immer noch unten. Er setzte sich auf den Sattel, stiess sich mit den Füssen ab und trat in die Pedale. Nach einigen Umdrehungen übersetzte er in einen höheren Gang. Er rollte, und es war nichts im Vergleich zu Svens altem Velo.
Behutsam fuhr er die ersten Meter zum oberen Ende des Strässchens, das in einer Sackgasse endete. Dann wendete er. Er hatte es im Griff. Der Weg zurück war lang genug, um alle Gänge auszuprobieren, bevor er bei der Einmündung in die Hauptstrasse anhalten musste. Er fuhr an und wurde rasch immer schneller. Er schaltete höher. Mit jedem Gang gewann er an Geschwindigkeit. Als er am Elternhaus vorbeirauschte, hatte er etwa die Hälfte der Strecke hinter sich und ein Drittel aller Gänge durchgeschaltet. Er war euphorisch. Es war, als würde er fliegen. Wie Spiderman, der sich an seinen Spinnfäden durch die Häuserschluchten der grossen Stadt hangelte. Seine Freunde würden staunen, wenn er ihnen an der Geburtstagsfeier am Nachmittag sein Spider-Bike vorführte. Er fuhr immer schneller und schaltete höher und höher.
Luca wusste, dass man bei diesen Übersetzungen beim Gangwechsel immer treten musste. Der höchste Gang schaltete sich etwas hart, und er hielt kurz inne. Die blockierende Kette lenkte ihn ab, sodass er nach unten blickte und vergass, rechtzeitig zu bremsen. Er sah den blauen VW
EINS
Ein Jahr später, Wien
Das Steak war perfekt auf den Punkt gegrillt gewesen und eines der besten, das Petar je gegessen hatte. Ganz zu schweigen vom Château Mouton Rothschild Réserve, den sie dazu getrunken hatten. Der Abend und das Essen im Dachrestaurant des «Do&Co Hotels» waren stimmig mit dem, was sie den Tag hindurch zusammen besprochen hatten. Darko hatte ihm die Nachricht von Slavko überbracht, der sich äusserst zufrieden mit den Fortschritten zeigte, die Petar in der Schweiz erzielt hatte. Er gab ihm freie Hand und die notwendigen Mittel, damit sie die Expansionsziele der Organisation bis Ende Jahr erreichen konnten. Das war ein Grund zum Feiern.
Das musste er allerdings alleine, ein Stockwerk tiefer, in der «Onyx Bar», begleitet von einigen Gin Tonic und der spektakulären Aussicht auf den Stephansdom und den Platz davor. Darko war bereits auf der Rückreise nach Belgrad.
Die angestaubte imperiale Eleganz der Donaustadt war Petar immer eine Reise nach Wien wert. Aber Drinks waren Drinks, und schöne Städte hatte er schon viele gesehen. Auch die zugegebenermassen ausnehmend hübschen und kontaktfreudigen Kellnerinnen liessen ihn kalt. Schliesslich hatten ihn schon Heerscharen von schönen Frauen beglückt, willige und weniger willige. Heute Abend suchte er den speziellen Kick.
Die Bardame reichte ihm seinen vierten Gin Tonic, und als er sich mit dem vollen Glas in der Hand umdrehte, sah er sie allein an einem Tisch für zwei.
Flammend rote schulterlange Haare umspielten ein blasses Gesicht. Ein dezent aufgetragenes Rouge hob hohe Wangenknochen hervor. Der volle Mund mit sinnlichen Lippen war halb geöffnet, und ein smaragdgrünes Augenpaar zog ihn direkt in seinen Bann. Das unaufdringliche Rot des Kleides passte hervorragend zur Haarfarbe, den Augen und dem blassen Teint. Ihre Figur war zierlich. Das Dekolleté verhiess keine üppige, dafür eine perfekt geformte Weiblichkeit.
Als wäre sein Blick eine Aufforderung, schlug sie die Beine übereinander. Das Kleid rutschte dabei hoch, sodass er die Strumpfhalter sehen konnte, die die fein gemusterten weissen Nylonstrümpfe über den schlanken Beinen strafften. Sie drehte einen Zigarettenhalter aus Elfenbein zwischen ihren Fingern und lächelte ihn erwartungsvoll an. Petar war sich zunächst nicht sicher, ob sie tatsächlich ihn fixierte. Er war nicht, was man gemeinhin als schönen Mann bezeichnete. Seine scharf geschnittenen Gesichtszüge waren von einigen Narben aus lange vergangenen Abenteuern gezeichnet, die ihm eine verwegene Ausstrahlung gaben. Mit zwei raschen Blicken nach links und rechts vergewisserte er sich, dass ihre Aufmerksamkeit ausschliesslich ihm galt. Da ihr Lächeln strahlender wurde, ging er zu ihr hin und bot ihr Feuer.
«Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Ich fürchte, ich habe mein Feuerzeug vergessen.» Sie hatte einen leichten Akzent, den er als ungarisch vermischt mit wienerisch einschätzte. In Verbindung mit dem Klang ihrer Stimme verlieh er ihr einen unwiderstehlichen Sex-Appeal.
Auf seine Frage, ob sie alleine hier sei, schenkte sie ihm ein strahlendes Lächeln, das zwei Reihen makellos weisser Zähne freigab, und fragte, warum er das wissen wolle.
«Eine schöne Frau wie Sie, alleine an diesem Ort. Das ist aussergewöhnlich.»
Die Anmache war nicht originell, Petar hatte keine Übung in solchen Dingen. In der Regel nahm er sich, was er brauchte, ohne zu fragen. Ihr schien es nichts auszumachen.
«Ach wissen Sie, mein Mann ist verreist, und ich musste mal wieder raus, bevor mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.»
Sie stellte sich als Cara Andrazy vor und erzählte ihm, dass sie gebürtige Ungarin sei und ihr Mann Österreicher. Leider sei dieser oft geschäftlich unterwegs. Normalerweise fahre sie bei diesen Gelegenheiten nach Budapest, um Freunde zu treffen. Dieses Mal sei dies nicht möglich, da sie morgen einen wichtigen geschäftlichen Termin in St.Pölten habe. Sie arbeite zum Zeitvertreib als Immobilienmaklerin.
Begleitet von einer Flasche Dom Pérignon ging das Gespräch zu den verschiedenen Spielarten des Wiener Nachtlebens über. Als die Flasche leer war, flüsterte Cara ihm ins Ohr, welche Spiele sie besonders mochte.
Im Taxi zu seinem Hotel am Parkring gab sie ihm ungeniert einen praktischen Ausblick auf das, was ihn erwartete.
Im Hotel angekommen, war er so erregt, dass er die Schlüsselkarte dreimal in den Schlitz stecken musste, bevor sich die Zimmertür endlich öffnen liess. Drinnen stiess sie ihn rücklings auf das Bett, zog ihren Rock hoch und setzte sich auf ihn. Der Anblick dessen, was sie unter ihrem Kleid trug, liess die Kadenz seines Blutdrucks rapide ansteigen. Als sie sich küssten, wurde sein Atem schwer. Er versuchte, mit einer Hand den Reissverschluss am Rücken ihres Kleides zu öffnen, bis sie sie wegstiess und auf das Laken drückte. Als er es mit der anderen versuchte, wurde auch diese mit festem Druck auf das Bett gepresst. Er war überrascht, welche Kraft die schmale Frau entwickelte. Während sie seinen Hals küsste, fixierte sie ihn mit dem Druck ihrer Arme und Beine auf der Matratze. Mit der Kraft von Schraubstöcken pressten ihre Schenkel seine Beine zusammen. Sie hielt inne. Ihre Augen verharrten nur wenige Zentimeter über seinem Gesicht.
«Gefällt dir das Spiel?»
«Bis jetzt bist du die Aktive», stiess er hervor.
«Das ist der Sinn der Sache», gurrte sie ihm ins Ohr. Sie lockerte ihren Griff und wies ihn an, zum Kopfende des Bettes hochzurutschen. Dabei versuchte er, sie abzuwerfen. Sofort erhöhte sie den Druck ihrer Schenkel, sodass er augenblicklich abbrach.
«Warte», sagte sie und legte mit einer Hand seine Arme über seinen Kopf, während sie mit der anderen in ihre grosse Handtasche griff, die sie neben sich auf das Bett gelegt hatte. Ein Paar samtbezogene Handschellen kam zum Vorschein. Bevor er reagieren konnte, hatte sie ihm die Fesseln angelegt und am Bettgestell befestigt.
«So», sagte sie aufatmend, «jetzt kann das Spiel richtig beginnen.»
Er keuchte vor Erregung. Sie öffnete seinen Hosenbund und streifte seine Hose und Unterhose bis zu den Knien hinunter. Er stöhnte und schloss seine Augen, während sie ihren Unterleib an seinem rieb. So sah er nicht, wie sie nochmals in ihre Tasche griff und eine lange, dünne Nadel hervorzog.
Er riss die Augen auf, als er den Schmerz spürte. Es war, als würde glühende Kohle über ihm ausgeschüttet. Er wollte schreien, brachte jedoch keinen Ton hervor. Reflexartig versuchte er erneut, die Frau abzuwerfen. Eine neue Welle des Schmerzes lähmte ihn. Er lag nur da, seine Augen weit aufgerissen, den Mund offen wie ein Fisch, der nach Luft schnappte. Wie durch eine rote Wolke nahm er Caras Gesicht dicht über seinem wahr.
«Stich in die Niere. Nicht tödlich, doch qualvoll. Liebst du das Spiel immer noch?» Ihre Stimme klang zärtlich, ihr Blick war kalt.
Sie stand auf und zog einen gefalteten Schutzüberzug aus Plastik aus ihrer Tasche. Sie schlüpfte hinein und stülpte die Kapuze über ihre Haare. Dann legte sie einen Mundschutz an, sodass nur noch ihre Augen erkennbar waren. Schliesslich streifte sie blaue Schuhschoner über ihre Füsse und Latexhandschuhe über ihre Hände.
«Ich geniesse es. Weisst du, was das ist, Petar?» Sie hatte ein weiteres Utensil aus ihrer Tasche gezogen. Es war ein etwa dreissig Zentimeter langer und schmaler Pfahl aus Edelstahl mit einer gehärteten, extrem scharfen Spitze. Er wollte schreien. Wieder war es ein stummer Schrei, der nur in seinen aufgerissenen Augen zu lesen war. Er spürte, sah und hörte nur brüllenden Schmerz. Sie setzte den Pfahl auf der Brust über seinem Herzen an, dann schloss sie die Augen und murmelte einige Worte, als ob sie ein Gebet sprechen würde.
ZWEI
Eine Woche später, Solothurn
Lötscher schwankte, als er aus der Bar an die frische Luft trat. Er lehnte sich an eine Hauswand. Die kühle Steinmauer in seinem Rücken vertrieb den Alkoholnebel etwas. Mit beiden Händen stützte er sich an einem schräg stehenden Eckpfeiler ab.
Warum zum Teufel hatte er nur so viel in sich hineingeschüttet? Und warum war die blöde Kuh nicht gekommen? Schliesslich hatte sie das Treffen vorgeschlagen und ihm die Story seiner Karriere angeboten.
Er hätte heute Abend etwas Besseres vorgehabt, als sich in diesem Provinznest zu betrinken. Die neue Praktikantin auf der Redaktion, wie hiess sie noch gleich? Susanna, Sanna oder so. Er nannte sie immer nur Susi. Auf jeden Fall war sie ein heisser Feger und ganz scharf darauf, alles vom grossen Enthüllungsjournalisten WalterH. Lötscher zu lernen. Es hätte ein schöner Abend in Zürich werden können. Ein gutes Essen im «Bindella» beim Fraumünster, und später hätte man weitergesehen. Scheisse! Nach dem Anruf aus Solothurn hatte er die süsse Susi sausen lassen.
Die Atmosphäre war noch feucht von den Regenfällen der vergangenen Tage, und der nahe Fluss schickte die ersten Nebelschwaden durch die Gassen der unteren Altstadt. Es war ruhig. Nur aus der Bar waren die gedämpften Gespräche der Gäste und zwischendurch lautes Gelächter zu vernehmen. Die frische Luft tat ihm gut. Er versuchte sich zu erinnern, wie er am schnellsten zurück zum Hotel kam, das nicht so weit weg sein konnte. Es lag auch direkt am Fluss, bei der grossen Brücke. Er stakste die Gasse hinab und steuerte auf einen wuchtigen mittelalterlichen Bau zu, der wie eine Festung am Ufer der Aare lag. Das musste dieses Landhaus sein, das man ihm an der Rezeption beschrieben hatte, als er nach dem Weg gefragt hatte. In alten Zeiten war es der Umschlagplatz der Aareschiffer, welche die Solothurner Patrizier und die Ambassadoren der französischen Krone, die bis zur Französischen Revolution in Solothurn residierten, mit landwirtschaftlichen Gütern, vor allem mit Wein aus den Rebbergen des Bieler-, Neuenburger- und Genfersees, versorgten. Heute beherbergte es ein Kongress- und Tagungszentrum.
Sein Hotel lag auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, also musste er nach links über die kleinere, verkehrsfreie Brücke. Seine Gedanken waren wieder klarer, und er fühlte sich sicherer auf den Füssen. Im Schatten des Landhauses parkierte ein weisser Transporter mit laufendem Motor. Was für ein Idiot, dachte Lötscher, als er bei dem Fahrzeug war. Es war nicht so kalt, dass man ein Auto mit laufendem Motor heizen musste. Plötzlich verspürte er Lust auf eine Zigarette. Er tastete seine Jacketttaschen ab und fand ein halb volles Päckchen. Allerdings suchte er vergeblich nach seinem Feuerzeug. Das Fenster auf der Fahrerseite des Transporters war eine Handbreit heruntergelassen. Weisse Rauchschwaden quollen heraus. Lötscher konnte die Person am Steuer nicht erkennen. Der Mensch musste wirklich frieren. Das Gesicht war fast komplett unter der Kapuze einer dunklen Jacke verborgen. Lötscher klopfte an die Scheibe. Langsam wandte die Person hinter dem Steuer den Kopf. Lötscher konnte im schwachen Lichtschein der Strassenlampe das Gesicht sehen. Den Arm, der sich plötzlich um seinen Hals schlang, aber nicht. Er spürte nur noch das weiche Tuch mit dem scharfen, süsslich-penetranten Geruch, der sich seinen Weg durch seine Atemkanäle bahnte und wie ein grauer Schleier sein Bewusstsein einhüllte.
* * *
«Dominik!»
Dornach öffnete die Augen. Auf dem schmalen Grat zwischen Schlafen und Wachen verhallte die helle Frauenstimme, die seinen Namen rief. Er horchte in die Stille seines Hauses, bevor er sich im Bett aufrichtete.
Es dauerte eine Weile, bis er klar denken konnte und realisierte, dass er nicht alleine war. Er sah zu der Frau, die neben ihm schlief. Bea lag nackt und halb zugedeckt auf der Seite und hatte ihm den Rücken zugewandt. Das fahle Mondlicht, das durch die Vorhänge schimmerte, wurde von ihrem blonden Haar reflektiert. Die dünne Bettdecke schmiegte sich eng an die sanft geschwungene Kurve ihrer Hüfte. Das Tattoo auf ihrer rechten Schulter war nur schwach zu erkennen, aber Dornach wusste, was es darstellte. Es war eine Rose, um deren Stiel sich eine Schlange zwischen den Dornen nach oben wand. Darunter stand in geschwungener Schrift «Love Poison». Er beugte sich über sie und zog die Bettdecke vorsichtig über ihre Schultern.
Bea war, wie er, bei der Polizei: Sie jedoch war in Biel stationiert. Sektionsleiterin Fahndung in der Regionalabteilung Seeland-Jura der Berner Kantonspolizei. Dornach hatte sie vor etwa einem Jahr kennengelernt, als sie gemeinsam einen Fall bearbeiteten, und sich von ihrer Energie und Durchsetzungskraft beeindrucken lassen. Interesse und Sympathie waren gegenseitig gewesen. Seither pflegten sie eine lockere Beziehung. Bea war zu ehrgeizig, um sich auf mehr einzulassen, was auch ihm entgegenkam. Heute war ihre letzte gemeinsame Nacht. Um die Mittagszeit würde ihr Flieger in Richtung USA abheben, wo sie an einem sechsmonatigen Lehrgang beim FBI teilnehmen sollte. Danach hatte sie sich für ein Praktikum bei der amerikanischen Bundespolizei angemeldet, das von drüben noch zu bestätigen war. Wenn es klappte, würde sie für längere Zeit dortbleiben. Beide wussten, dass ihre Beziehung, wenn man sie als solche bezeichnen wollte, das nicht überleben konnte. Dafür waren sie beide nicht gemacht.
Dornach suchte keine feste Bindung. Pia, seine achtzehnjährige Tochter, die bei ihm wohnte, reagierte empfindlich auf seine flüchtigen Frauenbekanntschaften. Deshalb blieben seine Freundinnen in der Regel auch nicht bis zum Morgen bei ihm. Diese Nacht bildete eine Ausnahme.
Die Vibration seines Handys riss ihn aus seinen Gedanken. Er schaute auf das Display: vier Uhr drei– Alarmzentrale. Er drückte rasch den Antwortknopf, bevor Bea erwachte.
«Dornach.»
«Dominik? Einsatz.» Die Stimme von Rita Gubser, der diensthabenden Beamtin, klang wach und klar.
«Was ist los?» Er hatte sich von Bea weggedreht und sprach so leise wie möglich.
«Schwerverletzter. Männlich. Fundort Aareufer am Ritterquai gegenüber dem Tennisplatz Schützenmatt.»
«Ich bin nicht auf Pikett.»
«Sorry, Dominik, ich weiss, aber Staatsanwältin Casagrande ist vor Ort und hat nach dir gefragt.– Sag mal, warum flüsterst du eigentlich?»
Dornach stand auf und schlich aus dem Schlafzimmer. «Immer dienstlich bleiben, Gefreiter Gubser.– Was ist denn los?»
«Scheint eine schöne Sauerei zu sein. Die Staatsanwältin bezweifelt, dass es sich um einen Suizidversuch oder einen Unfall handelt. Deshalb–»
«Bin schon unterwegs.»
Fünf Minuten später steuerte er seinen Volvo XC60 vom Grundstück der Villa Dornach auf den Grafenfelsweg hinaus in Richtung Stadt. Er fuhr ohne Blaulicht über die Untere Steingrubenstrasse in die Werkhofstrasse, vorbei am Schanzmühle-Komplex, wo das Polizeikommando untergebracht war. Als er auf den Baseltorkreisel zusteuerte, dachte er an Bea, die wohl noch immer in seinem Bett schlief. Er hatte ihr einen Zettel hinterlassen. Sie würde nicht glücklich sein, aber er setzte darauf, dass sie verstand.
Dornach konzentrierte sich auf das, was vor ihm lag. Wenn die Stellvertretende Leitende Staatsanwältin Angela Casagrande sich zu solch unchristlicher Zeit zu einem Tatort rufen liess und überdies verlangte, dass der Chefermittler der Kantonspolizei dabei sein sollte, musste ein triftiger Grund vorliegen. Abgesehen davon, dass der Zeitpunkt unglücklich war, störte ihn das nicht sonderlich. Er arbeitete gern mit Casagrande zusammen, was er in Bezug auf ihren Chef, Martin Hofmann, nicht behaupten konnte. Diese Antipathie war gegenseitig.
Casagrande war erst knapp ein Jahr als Stellvertretende Leitende Staatsanwältin für Wirtschaftsdelikte und Organisierte Kriminalität bei der Solothurner Staatsanwaltschaft und bereits zur Anwärterin für den Posten als Leitende Staatsanwältin für die Abteilung Solothurn avanciert. Amtsinhaber Hofmann strebte seine Berufung als Bundesanwalt an und war deshalb häufig in der Bundeshauptstadt absorbiert. Sein potenzieller Nachfolger näherte sich bereits dem Rentenalter. Eine weitere Anwärterin wollte aus familiären Gründen ihr Pensum reduzieren und kam daher nicht mehr in Frage. So war Angela Casagrande mit ihren unbestrittenen Kompetenzen in den Startlöchern. Dornach und seine Kollegen bezeichneten diesen Umstand, milde ausgedrückt, als aussergewöhnlich.
Der Wechsel wurde von allen Seiten, insbesondere von den Ermittlern der Kriminalabteilung, die häufig mit Casagrande zu tun hatten, begrüsst. Im Gegensatz zu Hofmann, der glaubte, sich in jedes Ermittlungsdetail einmischen zu müssen, und dabei mit Rückfragen und der knausrigen Freigabe von Mitteln die Abläufe verlangsamte, galt Casagrande als gute und fachlich versierte Zuhörerin, die die Arbeit der Ermittler schätzte und ihnen entsprechenden Handlungsspielraum liess. Leider konnte auch sie nicht immer, wie sie wollte. Vor allem in Fällen, wo es Lorbeeren zu holen gab, stellte sich ihr Chef gerne in den Vordergrund. Aber Hofmann war nicht einer, der für einen Tatort mitten in der Nacht aus dem Bett stieg, und darüber war Dornach alles andere als unglücklich. In der Schanzmühle hoffte man derweil auf eine baldige Mutation im Franziskanerhof, dem Amtssitz der Solothurner Staatsanwaltschaft.
Als er beim Regio-Energie-Gebäude vor der Rötibrücke in die Werkstrasse einbog und den Ritterquai entlangfuhr, hatte der Weichzeichner des Nebels die Umrisse der Gebäude, Bäume und der Brücke ineinander verschwimmen lassen. Die Stunde der Dämmerung und der Dämonen, dachte er. Die passende Zeit für einen Fund. Er fuhr der Aare entlang unter der Brücke hindurch, bis er das Blaulicht der Streifenwagen und der Ambulanz sah. Nachdem er seinen Wagen bei der Absperrung parkiert hatte, begrüsste er den jungen uniformierten Polizisten, der dort auf ihn wartete. Christian Lorer war etwas mehr als ein Jahr beim Korps und hatte sich bei Kollegen und Vorgesetzten bereits einen guten Ruf verschafft.
«Die Staatsanwältin hat schon nach dir gefragt, Dominik.» Christian zeigte zur Ambulanz.
«Wie sieht es aus?»
«Nicht gut. Blutige Angelegenheit, schwer verletzter Mann, etwa Mitte fünfzig.»
Dornach ging auf das Ambulanzfahrzeug zu, wo die Rettungssanitäter gerade eine Bahre verluden. Darauf lag, unter den Rettungsdecken nur schwer erkennbar, eine Person, neben der ein Sanitäter einen Infusionsbeutel hochhielt. Die Staatsanwältin war im Gespräch mit dem Notarzt. Casagrande war Ende dreissig und nur knapp einen halben Kopf kleiner als Dornach. Ihr schulterlanges schwarzes Haar hatte sie nach hinten zu einem Pferdeschwanz gerafft. Die Tochter eines kalabrischen Vaters und einer florentinischen Mutter war eine herbe, durchaus attraktive Erscheinung. Zwei Kerben um die Mundwinkel und die ausgeprägte Kinnpartie machten jedem, der es sehen wollte, klar, dass mit dieser Frau im Zweifelsfall nicht zu spassen war. Die dunkelbraunen, fast schwarzen Augen strahlten Humor und Wärme aus, aber Dornach wusste, dass Casagrande ein schlafender Vulkan war, und hoffte, dass er ihr nie Anlass zu einem Ausbruch geben würde. Sie trug einen dunklen Mantel und darunter offensichtlich ein Kleid, denn anstelle ihres üblichen Hosenanzugs ragten schlanke, dunkel bestrumpfte Beine hervor. Ihre Füsse steckten in hochhackigen, teuer aussehenden Schuhen. Dornach bezweifelte, dass Casagrande sich um vier Uhr morgens so für einen Tatort zurechtmachte, und schloss daraus, dass sie noch nicht ins Bett gekommen war, doch er hütete sich davor, sie vor allen Leuten darauf anzusprechen.
«Danke für den Weckanruf», begrüsste Dornach sie, als sie sich zu ihm wandte.
«Dir auch einen guten Morgen, Dominik. Ich wollte nur nicht, dass du etwas verpasst.»
«Hatte eh schlecht geträumt. Wie geht es ihm?» Er nickte zur Bahre hinüber.
«Kritisch», antwortete der Notarzt. «Er ist stark unterkühlt, hat einige Zeit halb im Wasser gelegen und viel Blut verloren. Beide Arme wurden ihm unterhalb des Ellenbogens abgetrennt, vermutlich mit einer Amputationssäge.»
Der Notarzt demonstrierte die Stelle etwas oberhalb des Handgelenks an seinem eigenen Arm.
«Ist er vernehmungsfähig?»
«Wohl kaum, für einige Zeit. Ausserdem wird es schwierig werden, mit ihm zu sprechen.»
«Wie meinen Sie das?»
«Na ja, er hat keine Zunge mehr.»
«Hat man ihm die Zunge herausgeschnitten?» Dornach verzog das Gesicht zu einer schmerzhaften Grimasse.
«Herausgerissen trifft es besser. Wir sollten jetzt fahren.» Er stieg ein.
«Wohin bringen Sie ihn? Ins Bürgerspital?»
Der Arzt bejahte und schloss die Tür. Dornach blickte dem sich entfernenden Blaulicht nach.
«Gibt es eine Identität?», fragte er Casagrande, als er mit ihr zur Fundstelle an der Böschung des Flusses ging.
«Kein Portemonnaie und kein Handy. Aber Mike hat in einer der Manteltaschen einen Presseausweis gefunden. Er lautet auf WalterH. Lötscher, Journalist beim ‹N.T.›, unserem liebsten Boulevardblatt.»
«Was? Ein Journalist vom ‹Neuen Tag›?» Dornach stiess einen leisen Pfiff aus. «Was zum Teufel hatte der hier zu tun?»
«Ja, mein lieber Dominik. Jetzt weisst du, warum du am frühen Morgen hier bist. Es wäre gut, das so rasch wie möglich herauszufinden. Das wird Schlagzeilen geben.»
Sie blieben oben an der Böschung stehen, um nicht auf der weichen Erde herumzutrampeln und damit der Spurensicherung unnötig die Arbeit zu erschweren. Angesichts ihres Schuhwerks war das Casagrande nur recht.
«Schönen guten Morgen. Dominik, was machst du denn hier?» Dornachs Stellvertreter Michael «Mike» Lüthi hievte sich die Böschung hoch und versuchte dabei, nicht mit seinen Halbschuhen auf dem feuchten Terrain auszurutschen.
«Die Staatsanwältin fand, dass ich bei solch prominenter Kundschaft unbedingt dabei sein sollte.»
Lüthi grinste. «Na ja, wenn die Medien davon Wind bekommen, wird das auf jeden Fall heiss. Ein national bekannter Reporter wird in Solothurn überfallen und schwer verstümmelt. Wir können uns schon mal auf etwas gefasst machen.»
«Habt ihr sonst noch etwas gefunden?» Casagrande fröstelte. Sie vergrub die Hände tief in ihrer Manteltasche. Der Nebel war dichter geworden. Bei Tagesanbruch würde die ganze Stadt in einer wabernden Wolke schwimmen, bevor die erstarkende Frühlingssonne sie hoffentlich im Verlauf des Morgens auflöste.
Lüthi schüttelte den Kopf. «Nichts. Was wir ziemlich sicher sagen können, ist, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Es gibt zu wenig Blut.»
«Er lag ja halb im Fluss», warf Casagrande ein.
«Seine Arme aber nicht.»
«Wer hat den Mann gefunden?», fragte Dornach.
«Ein junges Pärchen, vor etwa anderthalb Stunden.»
Dornach ging einen Schritt näher an die Böschung heran. Dort, wo man Lötscher gefunden hatte, wuchsen Hasel- und Weidensträucher direkt am Wasser. Um einen Körper zu sehen, der halb im Fluss lag, hätte man in die Hocke gehen müssen. Stehend war die Sicht auf das Wasser vom Buschwerk verdeckt.
«Wie konnten die beiden Zeugen den Körper sehen, wenn sie nur vorbeispaziert sind?»
«Von der Sitzbank da.» Lüthi zeigte auf die Bank, die neben dem Gehweg etwa zwei Meter versetzt vom Fundort über der Böschung stand. Dornach setzte sich auf die Bank und blickte auf den Fluss hinunter.
«Was haben die beiden hier gemacht?»
«Du weisst schon. Zwei Teenager halt, auf dem Heimweg. Der Abschiedskuss ist wohl etwas intensiv ausgefallen», sagte Lüthi.
«Verstehe, sind sie noch hier?»
«Nein, ich habe ihre Aussagen und Personalien aufgenommen. Eine Patrouille hat sie nach Hause gefahren. Sorry, Dominik, wenn ich gewusst hätte, dass du noch mit ihnen reden willst, hätte ich–»
«Schon gut.» Dornach stand auf. Es war zu kalt zum Sitzen. «Also, ein Reporter wird überfallen. Die Arme werden ihm amputiert.» Er blickte sich um. «Wie kam er hierher?»
«Der oder die Täter werden ihn nicht einfach hierhergetragen haben. Das wäre zu riskant, trotz der späten Stunde», sagte Casagrande.
Dornach nickte. «Denke ich auch. Haben die Kriminaltechniker Reifenspuren entdeckt?»
«DieKT ist noch dran. Ist ein Stück Arbeit in der Dunkelheit…» Lüthi machte eine Kopfbewegung in Richtung Rötibrücke.
«Die sollen nicht zu weit suchen. Der oder die Täter werden nicht ein Fahrzeug an der Brücke vorne abstellen und den Mann bis hierher schleppen.»
«Schon klar, Chef. Aber sicher ist sicher. Bis zum Rapport haben wir vielleicht ein paar Resultate.»
Dornach nickte wieder. «Gut, wir besprechen das um halb neun. Wie sieht es mit den amputierten Körperteilen aus?»
Lüthi schüttelte den Kopf. «Nichts. Kann natürlich sein, dass sie in die Aare geworfen wurden. Wir suchen das Ufer flussabwärts ab. Die Spezialisten berechnen gerade, bis wohin schwimmende Körperteile aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit getrieben sein könnten. Eine Gruppe sucht bereits das diesseitige Flussufer ab, so gut es geht. Sobald das Licht besser wird, setzen wir Taucher ein. Wahrscheinlich fischen wir die Gliedmassen aus dem Rechen des Kraftwerks Flumenthal, wenn sie nicht vorher von den Welsen gefressen werden.»
Mittlerweile war die feuchte Kälte auch durch Dornachs dünnen Mantel gedrungen. «Mike, kannst du herausfinden, warum Lötscher hier war? Ob er kurz vorher mit jemandem Kontakt hatte und so weiter?»
Lüthi nickte und blickte auf die Uhr. Es war fast halb sechs.
Dornach blickte Casagrande hoffnungsvoll an. «Übernimmst du die Leitung der Untersuchung?»
«Denke schon, vorläufig», sagte sie.
«Die erste gute Nachricht an diesem Morgen.»
«Bemüh dich nicht, Dominik, so unwiderstehlich bist du auch nicht. Aber ich bin pünktlich um halb neun in der Schanzmühle. Denkst du, dass wir bis Mittag etwas für die Fütterung der Medien haben?»
«Für eine Info-PK vielleicht.– Kaffee?»
«Oh ja!»
«Du bist eingeladen. Die Kaffeebar im Bahnhof hat jetzt offen. Fährst du mit mir?»
«Gerne. Ich habe meinen Wagen zu Hause gelassen, wegen Restalkohol. Eine Patrouille hat mich hergefahren.»
«Restalkohol? Bei welchen Ausschweifungen wurden Sie denn unterbrochen, Frau Staatsanwältin?»
Sie zwinkerte ihm zu. «Keine Chance, Dornach.»
Auf dem Weg zum Bahnhof summte sein Handy. Es war über Bluetooth mit der Freisprechanlage seines Wagens verbunden. Das Display am Armaturenbrett kündigte eine eingehende SMS von Bea an.
«Bea?», fragte Casagrande und schaute Dornach mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Dornach warf ihr einen kurzen Blick zu. «Kollegin bei der Kapo Bern. Dienstlich.»
«Aha, um diese Zeit.» Casagrande sah zum Fenster hinaus. «Das sind eifrige Leute, dort bei der Berner Kantonspolizei.» Ein Schmunzeln konnte sie sich nicht verkneifen.
* * *
Dornach war enttäuscht, als er nach Hause kam und feststellte, dass Bea schon weg war. Er hatte gehofft, noch einen zärtlichen Moment mit ihr verbringen zu können. Das Bett war leer, ebenso das Bad, in dem ein Hauch von Parfüm in der Luft hing, das aber nicht Bea gehörte. Pia, deren Zimmer auch an das Badezimmer angrenzte, schien bereits aufgestanden zu sein. Er traf sie in der Küche an. Sie stand an der Theke vor einem Glas Orangensaft. Er streckte ihr einen Papiersack mit frischen Croissants hin.
«Gipfeli! Mega, Paps.» Sie biss in ein Croissant und gab ihrem Vater mit vollem Mund einen schmatzenden Kuss auf die Wange. Er verzog das Gesicht und wischte sich die feuchte Stelle schnell ab.
«Guten Morgen, Pia.» Als Vergeltung für den nassen Kuss verstrubbelte er ihr Haar.
«Mann, Paps, meine Frisur», rief sie und strich sich ihre kurzen kastanienbraunen Haare wieder in die gewünschte Façon, die sie unmöglich ohne Zuhilfenahme einer ganzen Tube Haargel Extra Strong hatte zustande bringen können.
«Ach, das ist eine Frisur?» Er füllte frische Bohnen in die Kaffeemaschine. «Willst du auch einen Kaffee?», fragte er, nachdem er ihre herausgestreckte Zunge mit einem Grinsen und hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis genommen hatte.
«Nein danke, ich habe meinen Saft.» Pia hob ihr Glas. Er nahm zwei Eier aus dem Kühlschrank und legte sie in den Eierkocher. Das entlockte ihr ein Grinsen.
«Zwei Eier, Paps?»
«Ich habe Hunger. Ich bin schon seit vier Uhr auf. Musste an einen Tatort.»
«Schon klar. Ich dachte nur, du müsstest verlorene Proteine ersetzen.»
Dornach drehte sich um und sah sie fragend an.
«Ich meine ja nur, wegen der Blondine im Bad vorhin.»
«Welche Blondine?», fragte er so unschuldig wie möglich und merkte gleich, dass das keine gute Idee war. Das spöttische Lächeln auf Pias Gesicht wurde breiter.
«Hallo? Paps! Eine Frau! Weisst du, lange Haare, in deinem T-Shirt, roter Stringtanga! Sexy! Hübscher Ar…»
«Ist gut.» Er hob die Hand. «Du hast Bea angetroffen? Wann?»
«Vor etwa einer halben Stunde. He, das war voll peinlich. Ich komme aus der Dusche, und da steht so eine halb nackte Tussi vor mir. Hat mir einen schönen Schreck eingejagt. Und wir beide– noch so nackt.»
Nun grinste Dornach. «Warum? Hat sie etwas an dir gesehen, von dem du noch nichts wusstest?– Und…», er machte einen Schritt mit erhobenem Zeigefinger auf seine Tochter zu, «… das mit der Tussi habe ich nicht gehört. Sie heisst–»
«Bea, sorry.» Pia schob seinen Finger aus ihrem Gesicht. «Das war voll daneben. Wir stehen uns gegenüber. So erschrocken, wie sie mich anstarrte, muss sie sicher gedacht haben, ich sei eine andere, mit der du woanders im Haus im Bett warst oder so.»
«Jetzt mach mal halblang. Wofür hältst du mich eigentlich?» Dornach wusste nicht so recht, ob ihre Offenheit ihn empören oder amüsieren sollte. «Ausserdem weiss sie, dass ich eine achtzehnjährige Tochter habe.»
«Ja, ja, ich darf nicht so über meinen Vater denken. Aber du bist schliesslich auch nur ein Kerl.»
«Sag mal, geht’s noch? Und was meinst du mit nur?» Er wollte noch mal ihre Haare zerzausen, aber diesmal gelang es ihr, unter seiner Hand wegzutauchen. «Habt ihr zusammen gesprochen?», fragte er.
«Hm, na ja. Nach dem ersten Schreck war sie recht cool. Hat mir das Handtuch gereicht und sich vorgestellt. Sie hat gemeint, ich sei voll schön und so.» Stolz lächelnd hob Pia den Kopf.
Dornach betrachtete seine Tochter. Zu ihrem achtzehnten Geburtstag vor einigen Wochen hatte sie sich die Haare kurz schneiden lassen. Mit ihrer von der Mutter vererbten hochgewachsenen, schlanken, bereits ansehnlich kurvigen Figur und den grossen braunen Augen mauserte sie sich zu einer Schönheit. Dornach war sicher, dass es an der Kantonsschule eine lange Liste von Jungs geben musste, die um die Gunst von Pia Zenklusen warben.
Das bereitete ihm bisweilen ein wenig Sorgen. Aber seine Tochter hatte nicht nur das sprühende Temperament ihrer Mutter Laure Zenklusen geerbt, sondern auch das abwägende Naturell ihres Vaters, und er vertraute darauf, dass sie die richtigen Entscheidungen traf. Es war schon früh Pias Wunsch gewesen, bei ihrem Vater zu wohnen und in Solothurn zur Schule zu gehen. Sie fand, dass sie sich besser und spannungsfreier mit ihm austauschen konnte als mit ihrer Mutter, die als Oberärztin im Kantonsspital von Sion arbeitete. Ausserdem hatte sie Mühe mit Laures neuem Lebenspartner, der nach ihren Aussagen unter einem noch grösseren Kontrollzwang litt als die Mutter selber. Dornach fand, dass seine Ex-Geliebte aus Studienzeiten gar streng mit ihrer Tochter umging, obwohl sie die Volljährigkeit erreicht hatte. Das mochte daran liegen, dass Mutter und Tochter sich nicht nur äusserlich, sondern auch charakterlich sehr ähnlich waren. Dornach hütete sich, diesen Umstand gegenüber Laure anzusprechen. Er erinnerte sich nur zu gut an eine dahingehende Auseinandersetzung mit ihr, die damit endete, dass Laure ihm in aller Öffentlichkeit beinahe ein Glas Rotwein ins Gesicht geschüttet hatte. Damit war für ihn jede weitere Diskussion mit ihr über den Charakter der gemeinsamen Tochter tabu.
«Wollte Bea nicht zum Frühstück bleiben?»
«Ich hab’s ihr angeboten, aber sie meinte, sie müsse zum Dienst und sie würde dich anrufen. Hat sie?»
«Ja, sie hat mir eine SMS geschickt, aber ich konnte noch nicht mit ihr sprechen.»
«Sie sagte, sie würde heute für längere Zeit verreisen. So etwas wie eine Weiterbildung mit Praktikum oder so.»
Dornach nickte. «Stimmt. Sie geht für mindestens sechs Monate in die Staaten. Zum FBI.»
«Krass! Wie du vor ein paar Jahren.»
Dornach brummte etwas Zustimmendes und trank einen Schluck Kaffee. Pia stand auf und umfasste ihren Vater von hinten mit den Armen.
«Ich misch mich da nicht ein. Schönen Tag, Paps.»
«So früh?»
«Ja, ich muss noch meinen Vortrag vorbereiten. Du weisst schon: Der Islam und sein Einfluss auf die westliche Gesellschaft.»
«Spannendes Thema, viel Glück!»
Als sie sich in der Garderobe ihre Freitag-Tasche umhängte, kündigte ihr Handy mit Vogelgezwitscher eine eingehende SMS an. Sie kam noch mal in die Küche.
«Du-hu, Paps?», sagte sie in dem Ton, den sie immer anschlug, wenn sie ihren Vater einseifen wollte. Dann wusste er jeweils, dass es hart sein würde, Nein zu sagen. «Was ich noch sagen wollte: Es wird heute spät bei mir.»
«Was heisst spät?»
«Manu hat mir gerade eine SMS geschrieben und fragt, ob ich heute Abend mit ihr zur Eröffnung vom ‹Extasy› komme.»
«Extasy? Wenn es so ist, wie es tönt, hält sich meine Begeisterung in Grenzen.»
«Du verstehst das falsch. Das ist der neue Super-Club in der Weststadt. Die bringen einen Megasound. Heute ist der offizielle Opening-Gig. Manu hat von einem Freund zwei VIP-Tickets bekommen. Stell dir vor, die haben dafür extra DJRoca engagiert, meine Lieblings-DJane.»
Manuela Bürki war Pias beste Freundin. Sie übernachtete oft bei Pia, wenn die beiden Party machten. Sonst wohnte sie bei ihrer Mutter, einer Ärztin, in Etziken, im Äusseren Wasseramt. Es war umständlich für Manu, spät in der Nacht oder gar frühmorgens mit einem Nachtbus dorthin zu kommen, ganz zu schweigen von den Kosten für eine Taxifahrt.
«Sag mal, heute ist Donnerstag, und morgen ist Schule. Können die ihre Eröffnungen nicht am Wochenende machen?»
«Das ist was anderes, Paps. Der Gig heute ist speziell, verstehst du? By invitation only.»
«Wie kommt Manuela an VIP-Tickets zur Eröffnung eines Nachtclubs?» Dornach versuchte, so wenig argwöhnisch wie möglich zu klingen.
«Jetzt spiel nicht den Polizisten, Paps. Sie kennt halt so einen von den Typen, die dort arbeiten. Scheint okay zu sein und ist verknallt in Manu. Er hat die Tickets besorgt.»
«Ich spiele nicht den Polizisten, ich bin einer. Du weisst, was ich davon halte.»
«Dominik Dornach, jetzt werd nicht spiessig.» Sie baute sich vor ihrem Vater auf. «Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich ausgehe, und du weisst, wie ich es halte. Ausserdem haben wir morgen erst um halb elf Unterricht. Keine schwierigen Fächer, keine Klausur und keinen Vortrag. Also, sei kein Spielverderber. Schliesslich bin ich jetzt volljährig.»
Dornach seufzte. Sie hatte recht. Trotz ihrer Offenheit war Pia vorsichtig und liess sich nicht leichtsinnig auf Abenteuer ein. Widerstrebend lenkte er ein.
«Und gehst noch zur Schule», ergänzte er ihren Satz. «Um Mitternacht pünktlich seid ihr zurück. Ich nehme an, Manuela übernachtet auch hier.»
«Denke schon. Aber Paps, Mitternacht? Das fängt ja erst um elf Uhr richtig an. Halb zwei, okay?»
«Oh nein, meine Liebe! Um spätestens ein Uhr seid ihr beide im Bett. Und zwar hier.»
Nun fuhr Pia ihr schwerstes Kaliber auf: Schmollmund, Umarmung und Bettelton: «Bitte, bitte, liebster Dominik– Halb zwei. Okay?» Dornach blieb nichts anderes, als resigniert zu nicken.
«Mega! Merci, Paps!» Pia drückte ihm einen schmatzenden Kuss auf die Wange und machte sich auf den Weg zur Tür, bevor er es sich womöglich noch anders überlegte.
«Einen Moment noch, junge Dame.»
«Was denn noch?» Sie fürchtete schon, er würde seine Zustimmung zurücknehmen.
«Halb zwei! Und ihr beide nehmt ein Taxi. Ihr steigt mir in keine fremden Autos ein. Kapiert?» Er drückte ihr eine Fünfzigernote in die Hand. «Die ist für das Taxi, nicht für Drinks. Und ich will keine faulen Ausreden hören, verstanden?»
Pia schaute ihm tief in die Augen, küsste ihn noch einmal auf die Wange. «Alles verstanden und kapiert, Herr Kriminalkommissar. Tschüss!»
* * *
Kurz vor halb neun betrat Dornach den Rapportraum in der Schanzmühle. Angela Casagrande sass bereits dort, telefonierte und nippte an einem Becher Automatenkaffee. Sie hatte sich umgezogen, nachdem er sie bei ihrer Altstadtwohnung am Friedhofplatz abgesetzt hatte. Anstelle des Kleides trug sie einen dunkelgrauen Hosenanzug, der ihre Figur betonte, und eine weisse Bluse. Das Gespräch schien privat zu sein. Ein verträumtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Dornach hörte nur so etwas wie «Ja, ich dich auch». Sie blickte hoch und bemerkte ihn. «Du, ich muss Schluss machen», sagte sie hastig. «Ich rufe dich zurück.»
«Störe ich?», fragte er leichthin, als sie ihr Handy in ihrer Tasche verstaut hatte, und setzte sich neben sie.
«Nein, nein, das war nur… Das war meine Mutter. Sie wollte wissen, ob ich am Sonntag zum Essen komme.»
Er vermutete, dass Angela mit diesem Gesprächspartner stärkere Gefühle teilte als die Zuneigung einer erwachsenen Tochter zu ihrer Mutter. Und dass sie mit ihren italienischen Eltern Deutsch sprach, konnte sie ihm nicht weismachen. Hatte sie sich nach ihrer verpatzten letzten Beziehung etwa wieder verliebt? Es reizte ihn, mehr darüber zu erfahren. Aber jetzt war weder die Zeit noch der richtige Ort dazu. Er wechselte das Thema. «Warum trinkst du dieses unmögliche Automatengebräu, wenn wir hier eine funkelnagelneue Kapselmaschine haben?» Er wies mit einer Bewegung des Kinns in die Ecke des Raumes hinüber, wo auf einer Anrichte eine grosse Nespresso-Maschine stand.
Casagrande verzog den Mund. «Das Monsterdings da drüben kann mich nicht leiden. Jedes Mal, wenn ich nur in seine Nähe komme und es anschaue, fängt es an zu zischen und zu dampfen.» Sie hielt den Pappbecher hoch. «Ausserdem ist der nicht so schlecht. Besser als im Franziskanerhof.»
Dornach konnte sich nicht vorstellen, dass es woanders schlechteren Automatenkaffee geben konnte als bei ihnen.
«Warum bist du nicht bei mir im Büro vorbeigekommen? Ich hätte dir gerne eine kultivierte Tasse angeboten.»
Sie lachte. «Schon gut, Dominik. Ich schaue mir dein Spielzeug ein anderes Mal an. Ich werde den hier wohl überleben.» Sie nahm einen Schluck und verzog das Gesicht. «Hoffentlich», murmelte sie.
Dornach grinste. Er selber hatte sich eine klassische Bezzera-Zweikreis-Espressomaschine angeschafft, die er, wie den dazugehörenden Kaffee, aus der eigenen Tasche bezahlte. Er fand, dass man gewisse Dinge im Leben nur entschleunigt geniessen sollte.
Casagrande musterte ihn. «Sag mal, du siehst im Gegensatz zu mir noch etwas zerknittert aus. Ist dein Rasierer kaputt?»
Er hatte zu Hause rasch geduscht und die Kleider gewechselt und trug jetzt einen anthrazitfarbenen Roy-Robson-Anzug ohne Krawatte. Fürs Rasieren war keine Zeit mehr gewesen.
Er rieb sich das Kinn. «Musste noch telefonieren.»
«Verstehe.» Angelas Mund verzog sich zu einem spitzen Lächeln. «Lass mich raten: dienstliches Gespräch mit einer gewissen Berner Kollegin, nicht wahr?»
Bevor Dornach antworten konnte, kamen Mike Lüthi und Maja Hartmann mit zusammengesteckten Köpfen herein. Lüthi flüsterte Maja etwas ins Ohr. Sie lachte. Als sie ihren Chef und die Staatsanwältin bemerkten, gingen die beiden erschrocken auseinander und grüssten verlegen. Sie versuchten immer noch geheim zu halten, dass sie ein Liebespaar waren. Sie wussten nicht, dass Dornach es wusste. Er hatte zufälligerweise eines Abends beobachtet, wie sie eng umschlungen das Gebäude verliessen. Im Korps wurde es nicht gerne gesehen, wenn sich die Mitglieder eines Teams ineinander verliebten. Dornach war da anderer Meinung.
Rolf Gubler, von allen nur Google genannt, stiess hinzu, setzte sich nach einem knappen Morgengruss an seinen Platz und verschwand sofort wieder hinter seinem Notebook. Google war selten ohne seinen geliebten Rechner zu sehen, was seine Kollegen zur scherzhaften Behauptung veranlasste, er hätte einen Pakt mit der Maschine. Sie würde auf ewig crashen, wenn er sich jemals nach einer Frau umdrehen sollte. Google war der einzige Mensch, den Dornach kannte, der gleichzeitig ein Papier lesen und im Internet surfen konnte. Dafür war er auch ein gewiefter Hacker und ein hervorragender Analytiker.
Karin Jäggi trug einen grossen Sack mit Weggli und Gipfeli herein, die sie auf zwei Brotkörbe verteilte und auf dem Besprechungstisch platzierte. Für die wenigen Gesundheitsbewussten, in der Regel waren es die Frauen, stellte sie eine Schale mit Äpfeln hin. Karin war Ermittlungsassistentin und das jüngste Mitglied in Dornachs Team. Ihr Vater, Urs Jäggi, war der Chef der Kriminalabteilung und Dornachs Vorgesetzter. Als seine Tochter unbedingt zur Kriminalpolizei wechseln wollte, verhalf er ihr zu der Stelle. Insgeheim hoffte Jäggi, dass die Arbeit sie von ihrem Vorhaben abschrecken würde. Zuvor hatte er Dornach in einem vertraulichen Gespräch gebeten, er möge doch seine Tochter entmutigen. Dornach war alles andere als erfreut, denn er hatte keine Lust, Kindermädchen für eine verwöhnte Funktionärstochter zu spielen. Aber die schüchtern wirkende junge Frau, die viele wegen ihrer blauen Augen, den dunkelblonden Haaren und dem puppenhaft wirkenden Gesicht für naiv und unbedarft hielten, gab sich keinen Illusionen über den Beruf eines Kriminalpolizisten hin. Sie war sich für keine noch so pingelige Kontrollarbeit, umständlichen Papierkram, Telefonate oder Überstunden zu schade. Dank ihrem, zum Leidwesen des Vaters, abgebrochenen Jurastudium brachte sie es fertig, innert kurzer Zeit langfädige und komplexe Dokumente durchzuarbeiten, die notwendigen Informationen herauszufiltern und zusammenzufassen.
Dornach merkte, dass Karin Jäggi das Zeug zu einer guten Ermittlerin hatte. Ausserdem verfügte sie trotz ihres zurückhaltenden Wesens über eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, gepaart mit Fröhlichkeit und charmantem Durchsetzungsvermögen. Die Kleine, wie sie in der Abteilung liebevoll genannt wurde, hatte auch Haare auf den Zähnen. Einmal hatte ihr ein frisch promovierter Kollege ins Gesicht gesagt, dass Frauen einfach nicht die Eier hätten, diesen Beruf richtig auszuüben. Karin hatte ihn nur angesehen und kühl erwidert, dass Frauen dafür Gott sei Dank den Vorteil hätten, nicht ständig mit ihren primären Geschlechtsteilen denken zu müssen, woraufhin sich der junge Mann unter allgemeinem Gelächter seiner Kameraden zurückzog. Im nächsten Jahr würde sie die notwendigen Kripo-Ausbildungskurse absolvieren und bis dahin zur Einführung in Dornachs Team bleiben.
Die Mediensprecherin Yvonne Gerber und Christian Lorer betraten den Raum gleichzeitig. Yvonne setzte sich neben Dornach. Christian nahm neben Karin Platz, die er freundlich, wenn auch etwas zurückhaltend grüsste. Täuschte sich Dornach oder nahmen Karins Wangen tatsächlich eine rötliche Färbung an, als sich Christian ihr zuwandte? Christian war bei Kollegen und Vorgesetzten sehr beliebt. Dass Karin eine Schwäche für den blonden, gut aussehenden Hünen entwickelte, war nachvollziehbar.
Kripo-Chef Urs Jäggi und der Chef der Kriminaltechnik, Sebastian «Sebi» Tschanz, kamen als Letzte. Jäggi war bei solchen Rapporten nicht prinzipiell dabei, sondern liess sich in der Regel von seinen Bereichsleitern informieren. Die Medien würden sich wie die Hyänen auf diesen Fall stürzen, und Jäggi würde wohl oder übel zusammen mit dem Polizeikommandanten an vorderster Front Rede und Antwort stehen müssen. Dornach war froh, dass er diese Rolle anderen überlassen konnte.
Nach der Begrüssung bat er Mike Lüthi, anzufangen. Dieser drückte auf die Fernbedienung des digitalen Projektors, worauf das Porträtbild eines Mannes auf der grossen Leinwand erschien.
«Walter Heinrich Lötscher, geboren 1958, Schweizer, ledig, wohnhaft in Wetzikon, Kanton Zürich, Journalist beim ‹Neuen Tag›. Er hat in der Vergangenheit einige grossartig aufgemachte Artikel über das organisierte Verbrechen in der Schweiz veröffentlicht. Vor zwei Jahren flog dank seiner Reportage ein Pu…», er räusperte sich mit einem entschuldigenden Blick zu Jäggi, «… ähm… ein Bordell auf, in dem vor allem junge Frauen aus dem Balkan und anderen osteuropäischen Ländern beschäftigt wurden.»
Auf der Projektionsfläche erschien ein weiteres Bild des Journalisten. Er lag blutverschmiert und verstümmelt an der Uferböschung am Ritterquai. Lüthi schilderte die Umstände des Fundes und Art und Ausmass der Verletzungen.
«Wie ist sein Zustand gegenwärtig?», erkundigte sich Jäggi.
«Kritisch, aber stabil. Aufgrund des hohen Blutverlustes hat er Bluttransfusionen erhalten und wurde in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Das heisst, er ist nicht vernehmungsfähig und wird es auch für einige Zeit nicht sein.»
«Wissen wir etwas mehr über den Tathergang?», fragte Casagrande.
«Irgendwie wurde er dorthin gebracht.» Dornach stand auf und trat an die grosse Projektionswand. «Mitten in der Woche und um diese Uhrzeit ist bei uns nicht viel los.»
«Wir haben Fahrzeugspuren gesichert, die wir noch auswerten», warf Tschanz ein, was Dornach mit einem Kopfnicken quittierte.
Google hob die Hand. «Lötscher war hier für Recherchen.» Er blickte ausnahmsweise von seinem Notebook auf und schien erstaunt zu bemerken, dass aller Augen fragend auf ihn gerichtet waren. «Was ist? Ich habe die Redaktion in Zürich angerufen.»
Dornach nickte. «Also, was weisst du mehr als wir?»
Google heftete seine Augen wieder an den Bildschirm seines Notebooks. «Der Chefredaktor meinte, er wüsste nicht, worum es bei der Reportage ging. Lötscher scheint da eigen zu sein. Er informiert erst über die Story, wenn er sie fertig hat.»
«Etwas ungewöhnlich, meint ihr nicht?» Maja kaute an einem Apfel.
«Es scheint, dass Lötscher das vollste Vertrauen seines Chefs genoss und immer Top-Storys lieferte. Dafür verfügte er über einen grosszügigen Spesenvorschuss. Der Chefredaktor bezeichnet Lötscher als Auflagengoldmine.» Google blickte in die Runde. «Wenn ihr mich fragt, Serge Mumenthaler, so heisst der Chefredaktor, mochte Lötscher nicht sehr.»
«Wie kommst du darauf?», fragte Dornach.
«Er fragte mich, wie lange Lötscher im Spital bleiben müsse und wann er seine Geschichte abliefern werde. Kein Wort von Sorge und Betroffenheit. Als ich ihm gesagt habe, dass Lötscher wohl für eine sehr, sehr lange Zeit ausfallen würde, hat er geflucht wie ein Wald voller Affen.»
«Nicht sehr empathische Leute, die Fahnenhalter der Pressefreiheit beim ‹N.T.›», bemerkte Maja lakonisch.
«Mist zu schreiben, der wenig mit Wahrheit, aber viel mit einer hohen Auflage zu tun hat, stumpft eben ab», warf Mike Lüthi ein.
«Könnte auch sein, dass Lötscher einfach ein Arschloch ist», sagte Google grinsend. Er räusperte sich, als er Jäggis tadelnden Blick bemerkte. «Ich meine, er war wohl ein wenig angenehmer Arbeitskollege.»
Dornach beauftragte Google, sich noch mal an den Chefredaktor zu hängen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dort niemand eine Ahnung hatte, was Lötscher wirklich vorhatte. War er mit seinen früheren Reportagen jemandem auf die Füsse getreten, der sich jetzt an ihm rächte? Oder war er jetzt an etwas dran, das jemandem nicht passte? Vielleicht im Zusammenhang mit den organisierten Banden, gegen die er in der Vergangenheit schon recherchiert hatte?
Es klopfte und eine uniformierte Polizistin kam mit einem Zettel herein, den sie Dornach reichte.
«Okay», sagte er, nachdem er die Nachricht kurz überflogen hatte. «Das ist wenigstens etwas. Unser Herr Lötscher hat gestern Nachmittag um vier Uhr im ‹Ramada› für eine Nacht eingecheckt.– Maja und Karin, ihr geht hin und seht euch dort mal um.»
Bevor er die Sitzung schloss, hatte Urs Jäggi noch einen Einwand. «Wir dürfen das private Umfeld von Lötscher nicht ausser Acht lassen. Die Zürcher Kollegen sollen uns da helfen.»
«Stimmt», pflichtete ihm Dornach bei. «Ich zweifle zwar daran, dass ein Angehöriger, eine Freundin, eine Geliebte oder wer auch immer sich die Mühe macht, ihn nach Solothurn zu verfolgen, nur um ihn hier auf so riskante und spektakuläre Weise aus dem Weg zu räumen. Aber klar, wir bitten die Zürcher Kollegen um Amtshilfe.»
«Ich mache das über die Staatsanwaltschaft», bot Casagrande an.
Yvonne Gerber meldete sich zu Wort. «Was sagen wir den Medien? Wir wissen ja noch nichts.»
«Dann sagen wir eben genau das. Gut für dich, Yvonne?»
«Schon gut, Dominik. Ich komme klar. Sorgt einfach dafür, dass ich euren Infos nicht nachrennen muss.»
Dornach grinste. «Keine Angst. Wir sagen es dir, bevor du es aus der Zeitung erfährst.»
Yvonne Gerber rauschte aus dem Raum.
«Was war denn das jetzt?», fragte Casagrande überrascht.
«Keine Ahnung. Yvonne ist etwas empfindlich in letzter Zeit.» Dornach vermutete, dass sie ihm immer noch übel nahm, dass er sie einmal hatte sitzen lassen, obwohl sie verabredet waren.
Dornach wollte den Raum ebenfalls verlassen, als Jäggi ihn zurückhielt.
«Dominik, hast du noch eine Minute? Da ist noch ein Punkt, den wir besprechen müssen.»
DREI
Das Mädchen schien etwas verloren im Bett auf der Intensivstation des Bürgerspitals. Kabel und Drähte verbanden es mit den Maschinen und Geräten, die seine Lebenszeichen und Körperfunktionen aufzeichneten und kontrollierten. Hinter der Glasscheibe, die die Patientin von den Besuchern abschirmte, standen drei Personen und beobachteten das zarte Wesen.
Dr.Nadja Bürki legte die Hand auf die Schulter der weinenden Mutter. «Ich versichere Ihnen, Frau Galatay, dass wir unser Möglichstes tun, Ihrer Tochter zu helfen. Aber im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten», versuchte sie die Mutter zu trösten, deren sanftes Gesicht von Schmerz und Trauer gezeichnet war.
Nayla Galatay litt am Laurell-Eriksson-Syndrom, einer Stoffwechselkrankheit, die vor allem Leber und Lungen angreift und die bei ihr derart fortgeschritten war, dass die Leber nicht mehr mitmachte. Nayla brauchte dringend ein neues Organ. Wie sollte Dr.Bürki einer Mutter erklären, dass ihre Tochter auf der Warteliste von Swisstransplant stand und dass es Wochen, wenn nicht Monate dauern konnte, bis sich eine geeignete Spenderleber finden liess.
Idil Galatay wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Der Vater stand reglos daneben, auch seine Augen füllten sich mit Tränen. Emir Galatay hatte seine Tochter vor zwei Tagen in die Notaufnahme gebracht, nachdem sie zu Hause kollabiert war, und war seither nicht von Naylas Seite gewichen.
Als die Eltern erfuhren, wie lange die Wartezeit für eine Spenderleber dauerte, hatte Emir Galatay sein Checkheft gezückt und der Ärztin einen Check über hunderttausend Franken ausstellen wollen, in der Hoffnung, die Operation zu beschleunigen. Das war für ihn, als Besitzer von Imperial Döner, einer der bekanntesten türkischen Imbissketten der Nordwestschweiz, kein Problem. Die Ärztin konnte ihm nur schwer klarmachen, dass es nichts nützte.
Die Situation ging auch Bürki sehr nahe, denn die Tochter der Galatays war nur knapp zwei Jahre jünger als ihre eigene Tochter Manuela. Sie selber würde auch alle Hebel in Bewegung setzen, um ihrem Kind zu helfen. Was sie dabei als Ärztin am meisten frustrierte, war die Tatsache, dass mehr Spenderlebern zur Verfügung stehen würden, wenn alle, die könnten, sich als Spender registrieren liessen. Aus diesem Grund engagierte sie sich innerhalb der Ärztegesellschaft für die Einführung der Widerspruchslösung, die es ermöglichen sollte, dass jeder Mensch grundsätzlich als Organspender zur Verfügung stand, ausser er lehnt explizit ab.
Jetzt aber musste sie Nayla Galatay helfen, koste es, was es wolle. Sie verabschiedete sich von den Eltern mit dem Versprechen, sich zu melden, sobald sich eine neue Situation ergab. Sie hatte eine Idee.
Unterwegs zu ihrem nächsten Patienten klingelte ihr Handy. Es war ihre Tochter Manuela.
«Hoi, Spatz. Was ist?»
«Hast du einen Moment, Mami?», flötete es heiter aus dem Apparat.
«Ja, aber nur kurz. Ich muss gleich weiter. Ein Patient wartet.»
«Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute Abend bei Pia übernachte.»
Bürki runzelte die Stirn. «Bei Pia? Schon wieder? Du warst doch erst letztes Wochenende…»
«Für Pia ist das überhaupt kein Problem. Und ihr Daddy ist auch cool damit. Du weisst, die haben ja so ein riesiges Haus. Pia hat da praktisch ihre eigene Wohnung.»
Bürki kannte die Villa Dornach in Solothurn, den Familiensitz der angesehenen Industriellenfamilie Dornach. Nachdem sich der einzige Sohn, Dominik, für eine Juristenkarriere entschieden hatte und später zur Polizei ging, verkauften die Eltern ihr Unternehmen für einen sehr hohen Preis an einen internationalen Konzern. Sie zogen sich auf ihren Landsitz in Andalusien zurück und überliessen die Villa ihrem Sohn Dominik und ihrer Enkeltochter Pia.
Bürki war kürzlich einmal dort gewesen, zusammen mit ihrer Tochter, an der Feier zu Pias achtzehntem Geburtstag. Viele der Gäste waren aus der Walliser Verwandtschaft von Pias Mutter. Bürki hatte sich lange mit Laure Zenklusen unterhalten und versucht, sie in Bezug auf die Widerspruchslösung auf ihre Seite zu ziehen. Sie musste aber schnell begreifen, dass ihre Ansichten weit divergierten. Pias Mutter war bei diesem Thema, untypisch für ihre Zunft, sehr zurückhaltend.
Den Vater hingegen fand Bürki interessant. Gerne hätte sie das angeregte Gespräch mit ihm ausgedehnt und den attraktiven Single näher kennengelernt. Aber es wäre aufgefallen, wenn sie den Gastgeber zu sehr in Beschlag genommen hätte. Sie sehnte sich danach, wieder einen Mann zur Seite zu haben. Vielleicht konnte sie die häufigen Übernachtungen ihrer Tochter in seinem Haus als Vorwand benutzen, sich erkenntlich zu zeigen. Die Idee gefiel ihr.
«Bist du sicher, dass Herr Dornach nichts dagegen hat, wenn du schon wieder in seinem Haus übernachtest?»
«Ganz sicher, Mami, glaub mir, Dominik ist ganz cool. Ausserdem, wo könnte ich sicherer sein als beim Chef der Kriminalpolizei.»
«Du nennst ihn Dominik?» Nadja spürte einen eifersüchtigen Stich.
«Ich sage dir doch, der ist total cool. Und überhaupt: Er ist fast nie zu Hause. Sie haben eine Haushälterin, die fast zur Familie gehört. Noch wenn wir es wollten, könnten wir ihn nicht stören.»
«Also gut, Spatz. Von mir aus. Aber bleibt nicht zu lange aus. Du hast morgen Schule, vergiss das nicht.»
«Versprochen, Mami.» Am anderen Ende kreuzte Manuela die Finger und zwinkerte Pia, die neben ihr stand, zu.
«Hör mal, noch etwas», schob Bürki nach, bevor Manuela aufhängte. «Wenn du Herrn Dornach siehst, sag ihm, dass ich mich für deine Übernachtungen in seinem Haus revanchieren möchte und ihn zum Nachtessen einlade. Ich rufe ihn dann mal an.»
«Mach ich, wenn ich ihn sehe. Und ich sage es Pia, okay?»
Bürki lächelte zufrieden in sich hinein. «Ich muss weiter, Spatz. Mach’s gut, grüsse mir Pia und Dom… ähm… Herrn Dornach. Und melde dich mal.» Sie hängte auf. Jetzt hatte sie dringend einen Anruf zu erledigen.
* * *
Manuela zog in Siegerpose die Faust ein. Pia schüttelte den Kopf.
«Mann, Manu, wenn ich meinen Paps so anschwindeln würde wie du deine Mutter, das würde ich keine zwei Wochen überstehen, und dann wäre ich für einige Zeit gegroundet.»
«No worries, Schatz. Die ist so beschäftigt, dass sie das morgen wieder vergessen hat. Übrigens, schönen Gruss, und du sollst Dominik ausrichten, dass sie ihn zum Nachtessen einlädt.»
Pia runzelte die Stirn. «Deine Mutter lädt meinen Paps zum Nachtessen ein? Wozu?»
«Weiss nicht! Als Revanche für meine Übernachtungen, keine Ahnung. Egal, vielleicht ist sie in deinen Daddy verknallt. Sie hat ein paarmal von ihm gesprochen. Könnte ich auch verstehen. Dominik ist schon irgendwie sexy. Mindestens für alte Frauen.»
Pia prustete los. «Da soll sich deine Mutter mal hinten anstellen. Weisst du, wie viele Tussis was von meinem Paps möchten? Stell dir vor, was ich heute Morgen erlebt habe…»
BRIEFE AN VLADA – FRÜHLING
Geliebte Vlada!
Das Gras ist feucht und kühl von der Nacht. Wie kleine Diamanten glänzen die Tautropfen auf den grünen Halmen, die meine Füsse kitzeln und meine Haut streicheln, als würden Ameisen in Seidenschuhen auf mir krabbeln. Die Sonne schickt ihre goldenen Strahlen. Ich lasse mich fallen, und der feuchte Boden fängt mich auf. Er ist weich, wie der Teppich in der Moschee. Die Kühle der Nacht spielt mit der Wärme der Frühlingssonne. Ich schliesse die Augen. Wärme und Kälte fliessen in wechselnden Farben von Gelb, Grün, Blau, Rosa und Weiss ineinander. Ich höre ein anderes Kind lachen. Es klingt so hell wie die Glocken in der Kapelle der Christen. Wie das Lachen der kleinen Fee in dem Märchen von dem fernen Land, das du mir immer erzählt hast. Weisst du noch, Vlada? Dem Land, wo die Engel wohnen. Engelland. Du hast mir erzählt, dass mich die Engel zu dir geschickt haben. Ich bin dein Engel, denn mein Lachen klingt wie die Glöcklein des Himmels im Frühling, wenn die Sonne scheint. Ich blinzle in die Sonne. Dann schaue ich durch die Tautropfen auf den Halmen hindurch in den Himmel. Sie blinken und funkeln wie Edelsteine in tausend Farben. Die Glöcklein tönen heller, und ich höre deine Stimme, die singt und meinen Namen ruft: «Moj anđele, mein Engel! Wo bist du?» Ich richte mich auf und jauchze in die Sonne. Ein helles goldenes Licht kommt auf mich zu. Dein Gesicht beugt sich über mich und lächelt– heller als die Sonne oder der volle silberne Mond in der Nacht und alle Sterne.
In meinem Traum hast du viel gelacht, majka, meine Mutter.
Im Frühling, bevor die Wölfe kamen.
VIER
Jäggi hielt Dornach ein Papier unter die Nase. «Bevor ich loslege und es vergesse: Du solltest endlich deine Anmeldung für die Erneuerung deines Scharfschützen-Brevets machen, Dominik. Die rufen ständig mich an, weil sie dich nie erreichen können.»
Dornach kannte das Formular. Ein Exemplar lag irgendwo zuunterst in seinem Pendenzenstapel. Er hatte sich ursprünglich anmelden wollen, weil ihn das Schiessen aus weiter Distanz interessierte. Er galt als sehr guter Schütze und wollte sein scharfes Auge weiter dafür trainieren.
«Ich fülle den Wisch nachher gleich aus», versprach er. «Du willst mich sicher nicht nur deswegen sprechen.»
«Du kriegst Verstärkung, Dominik.»
«Ah ja. Wozu? Ich habe keine angefordert.»
«Ich habe das arrangiert», sagte Jäggi. «Ein Major Cranach.»
«Ein Major?» Dornach lachte trocken. «Steht es so schlimm um uns, dass wir jetzt einen ausgewachsenen Major zur Verstärkung kriegen? Wobei soll er uns denn helfen? Akten abstauben?»
Jäggi ignorierte den Sarkasmus. «Nein, Dominik. Major Cranach ist keiner von uns, sondern vom österreichischen Bundesinnenministerium.»
«Von den Österreichern? Das ist ein Witz, oder, Urs? Was sollen wir mit einem österreichischen Polizeimajor?»
«Folgendes: Du erinnerst dich an die Sitzung mit den beiden Menschen von der Bundeskriminalpolizei vor zwei Wochen, nicht wahr?»
Dornach nickte. «Die BKP