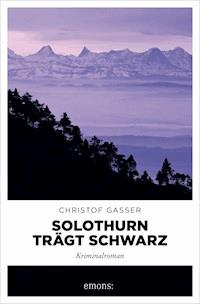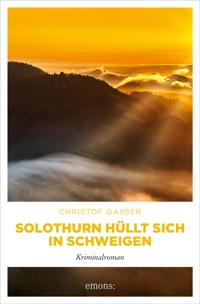Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Solothurner Kantonspolizei
- Sprache: Deutsch
Eine Ordensschwester wird mit einem Aschenkreuz auf der Stirn tot in der Solothurner Einsiedelei aufgefunden. Die Spur führt die Ermittler zu einer obskuren katholischen Gemeinschaft, die Beziehungen zu rechtsextremen Kreisen pflegt. Kantonspolizist Dominik Dornach und Staatsanwältin Angela Casagrande versuchen die Fäden zu entwirren – und kommen dabei einem mörderischen Komplott auf die Spur . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christof Gasser, geboren 1960 in Zuchwil bei Solothurn, war als Betriebswirtschafter lange in leitender Funktion in der Uhrenindustrie tätig und arbeitete zwölf Jahre in Asien. Heute ist er selbstständig und unterrichtet nebenamtlich als Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Vor einem Jahr entschloss er sich, seinen Jugendtraum zu verwirklichen, und hat seinen ersten Roman «Solothurn trägt Schwarz» geschrieben. Christof Gasser lebt mit seiner Frau in der Nähe von Solothurn, Schweiz.
Mehr zu Christof Gasser unter:
www.christofgasser.ch
www.facebook.com/solothurnkrimi
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
© 2017 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/age/Greg Stechishin Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne(CH) eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-185-7 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für alle Opfer von Missbrauch,Misshandlung und sexueller Gewalt
Men are mere mortals who
Are not worth going to your grave for.
Männer sind lediglich Sterbliche, die esnicht wert sind, für sie ins Grab zu gehen.
Text aus dem Titellied des James-Bond-Films «Diamonds Are Forever» von John Barry und Don Black
All das nur wegen ein paar
grössenwahnsinniger Typen, die sich
von ihrer Körpermitte steuern lassen
anstatt von Herz und Hirn.
EINS
Schwester Felicitas stand vor der offenen Toreinfahrt und starrte zum Haus hinüber, das in der blassen Dämmerung des milden Novembermorgens einen verlassenen Eindruck machte. Nur über dem Portal mit der schweren Türe brannte eine Lampe.
Sie hätte ohne Weiteres klingeln können. Etwas hielt sie ab. Waren es ihre Zweifel oder die abweisenden dunklen Fenster, hinter denen die Schatten der vergangenen Nacht lauerten?
Nervös fuhr sie mit der Hand über ihren braunen Schleier und schob ihre Brille zurecht. Sie fasste sich mit beiden Händen an die Brust, als ob sie sich vor dem nächsten Schritt ein Herz fassen müsste.
Ihr ganzer Fokus war auf das Haus gerichtet. Sie nahm die Gestalt erst wahr, als sie neben ihr stand. Mit einem unterdrückten Aufschrei fuhr Schwester Felicitas herum.
«Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken», sagte die Person und schob die Kapuze ihres Hoodies zurück. Es war eine junge Frau. Sie war sichtlich ausser Atem, und ihr Gesicht war verschwitzt. Einige Strähnen ihrer Bubikopf-Frisur klebten an der Stirn. Offenbar war sie den Grafenfelsweg hochgejoggt.
«Kann ich Ihnen helfen. Möchten Sie zu uns?», fragte die junge Frau.
Schwester Felicitas sah die Joggerin verständnislos an.
«Ich wohne hier. Ich heisse Pia Zenklusen.»
«Zenklusen?», fragte Schwester Felicitas verwirrt. «Wohnt hier nicht die Familie Dornach?»
«Ja, sorry. Dominik Dornach ist mein Vater. Zenklusen ist der Name meiner Mutter.»
«Verstehe.» Schwester Felicitas musterte die hochgewachsene und schlanke junge Frau, die sie mit ihren grossen, beinahe schwarzen Augen freundlich ansah und deren Erscheinung sie an die Fotomodelle in einem dieser bunten Gesellschaftsmagazine erinnerte, welche im Wartezimmer ihres Arztes auflagen. Sie räusperte sich, bevor sie weitersprach. «Ist Herr Dornach denn zu Hause?»
«Tut mir leid, nein. Er ist dienstlich im Ausland und kommt erst morgen Nachmittag zurück. Aber wenn–»
«Dienstlich?»
«Ja, er arbeitet bei der Polizei.»
«Polizei?» Schwester Felicitas hielt sich verblüfft die Hand vor den Mund.
«Wollen Sie, dass ich ihm etwas ausrichte? Sie können mir Ihre Telefonnummer geben, damit er Sie anrufen kann. Oder jemand anders von der Polizei kann Ihnen–»
«Nein, nein!», sagte Schwester Felicitas in milder Panik. «Ich muss es ihm selbst sagen, nur ihm.» Sie wollte sich entfernen.
Pia hielt sie zurück. «Wie ist denn Ihr Name?»
Schwester Felicitas hob abwehrend die Hände. «Das spielt keine Rolle. Ich… ich komme ein anderes Mal.»
ZWEI
Horacek stoppte die weisse Limousine mit dem CD-Nummernschild vor dem Eingangstor zum Kovaci Märtyrerfriedhof Sarajevo und stieg aus. In einem Ohr steckte ein Funkstöpsel, den er kurz berührte, um sicherzustellen, dass er richtig sass. Er blickte in die Richtung des Toyota Land Cruisers, der hinter der Limousine angehalten hatte, und nickte. Die beiden Agenten der bosnischen Staats- und Sicherheitspolizei, welche die Limousine aufgrund ihres Status als Geleitschutz eskortierten, erwiderten die Geste. Sein Blick schweifte über die Umgebung, bevor er die Fondtüre der Limousine öffnete und einen Mann aussteigen liess. Dieser war ebenso gross wie Horacek, wenn auch schmaler. Er trug einen schwarzen, italienisch geschnittenen Anzug ohne Krawatte, der seine schlanke Figur betonte. Beide Männer hatten einen Trauerflor in Weiss um den Oberarm gebunden, der Farbe der Trauer im Islam.
Der Dunkelhaarige setzte seine Sonnenbrille kurz ab. Seine grauen Augen, die mit dem an den Schläfen silbern schimmernden Haar kontrastierten, scannten ebenfalls das Gelände. Er blickte über den Wald von Grabsteinen, die sich gegen den azurblauen Himmel über den Hügeln der Stadt abhoben. Er nickte Horacek kurz zu und beugte sich in den Fond des Wagens. Wenig später erhob er sich wieder und liess eine Frau in einem eng taillierten Hosenanzug aussteigen. Eine dunkle Sonnenbrille bedeckte fast die Hälfte ihres blassen Gesichts. Der Dunkelhaarige nahm sie am Arm, als sie den Friedhof betraten. Die Frau schob ihn mit einer freundlichen, aber bestimmten Geste weg. Horacek folgte den beiden mit einigen Schritten Abstand, wobei sein Blick nicht aufhörte, die Umgebung abzutasten.
Im Vergleich zu ihren Begleitern wirkte die Frau klein und schmal. Ihr kastanienbraunes Haar war am Hinterkopf zu einem straffen Knoten zusammengefasst. Sie entnahm ihrer Tasche ein weisses Tuch und bedeckte damit ihren Kopf. Trotz ihrer zierlichen Erscheinung strahlte sie Autorität und Kontrolle über ihr Umfeld, einschliesslich der beiden Männer, aus. Mit energischem und gleichwohl entspanntem Gang schritt sie die Reihe der Grabsteine ab.
Als sie den Bereich gefunden hatte, den sie suchte, drehte sich Jana Cranach zu Horacek um. «Es ist gut, Stephan. Von hier aus gehen wir alleine weiter.»
Horacek blickte auf die Armbanduhr. «Es bleibt nur wenig Zeit, Oberstleutnant. Wir müssen pünktlich am Flughafen sein, sonst verlieren wir das Startfenster.»
«Zehn Minuten», sagte sie.
Als sie wenig später vor dem gesuchten Grabstein standen, berührte Dominik Dornach sie sanft an den Schultern.
«Willst du alleine sein, Jana?»
Sie nahm die Sonnenbrille ab. Ihre indigofarbenen Augen blickten zu ihm auf. «Bitte bleib, Dominik. Vlada will dich kennenlernen.»
Er blieb einen Schritt hinter ihr, als sie vor dem Grab ihrer Mutter Vlada Spahic niederkniete. Sie nahm ein flaches, versiegeltes und in weisses Tuch gewickeltes Kistchen aus ihrer Tasche und legte es in eine kleine Mulde, die der Friedhofswärter zuvor in ihrem Auftrag und gegen ein grosszügiges Trinkgeld gegraben hatte. Das Kistchen enthielt vier Briefe, die Jana als junges Mädchen an ihre im Bosnienkrieg von serbischen Milizen ermordete Mutter geschrieben hatte, und ein Stück eines Tischtuches mit aufgedruckten Rosen und den Flecken von Vladas Blut. Die damals neunjährige Jana hatte damit den geschändeten Körper ihrer sterbenden Mutter bedeckt.
Jana hatte die Mulde mit blossen Händen zugeschüttet und verharrte in kniender Position vor dem Grab. Sie murmelte etwas in einer Sprache, die Dornach nicht verstand. Er vermutete, dass sie betete. Als Jana sich schliesslich gegen Osten richtete und ein Allahu akbar aussprach, verstand er, dass sie ihrer Mutter mit einem muslimischen Gebet eine letzte Ehre erwiesen hatte.
«Danke, dass du mitgekommen bist, Dominik», sagte sie, als sie gemeinsam zum wartenden Auto gingen. Sie berührte die Stelle an ihrer Brust, wo sie die Kugel vor einem halben Jahr getroffen hatte.
«Spürst du die Wunde?», fragte Dornach besorgt. «Hast du Schmerzen?»
Niemand hätte geglaubt, dass Jana die Verletzung überleben würde. Die Ärzte im Solothurner Bürgerspital hatten es als Wunder bezeichnet, als sie aus ihrem Koma erwacht war und sich relativ schnell erholt hatte.
Sie wandte sich zu ihm um. Es war bei Weitem nicht das erste Mal, dass er tief in ihre Augen blickte. Trotzdem liess Dornach sich von der Intensität ihres Blickes fesseln.
«Nichts, worüber du dir Sorgen machen musst», sagte sie. «Ich bin froh, dass ich Vladas Grab sehen konnte. Ich werde nicht mehr hierherkommen.»
«Wirst du dein altes Leben vergessen können?»
«Ich will vorwärtsschauen. So gelingt es mir, mich von den Dämonen der Vergangenheit zu befreien.»
Als ob sie diese Aussage bekräftigen wollte, wandte sie sich an Horacek. «Schaffen wir es, Stephan?»
«Wir werden rechtzeitig in Schwechat landen und pünktlich zur Zeremonie in der Hofburg sein, Oberstleutnant.» Jana lehnte sich in ihrem Sitz zurück.
«Ich muss mich daran gewöhnen, dich mit ‹Oberstleutnant› anzusprechen», sagte Dornach. «Es tönt so–»
«Alt, willst sagen, stimmt’s?», sagte sie und lachte. «Immerhin holst du mit deiner Beförderung zum Hauptmann auf. Und du hast ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als ich.»
«Die haben mich nicht gefragt», brummte Dornach. «Als der Kadi das neue Organigramm erklärte, erwähnte er so nebenbei, dass ich die Leitung ‹Ermittlungen› mit gleichzeitiger Beförderung zum Hauptmann übernehmen werde.»
Im Zug einer Reorganisation der Solothurner Kantonspolizei wurden die Bereiche Fahndung, Ermittlungsdienst und Jugendpolizei innerhalb der Kriminalabteilung zu einem Bereich «Ermittlungen» zusammengefasst, der neu von einem Offizier geleitet wurde. Die Wahl war rasch getroffen. Kripo-Chef Urs Jäggi hatte aus seiner Präferenz für Dornach keinen Hehl gemacht und wurde vom Polizeikommandanten unterstützt.
Als Horacek den Wagen auf das Empfangsgebäude des Flughafens von Sarajevo zusteuerte, blickte Jana ein letztes Mal zu den Hügeln über der Stadt, welche ihr die Kindheit und die Liebe einer Mutter gestohlen hatte. Sie schmiegte sich an Dornach.
«Schön komfortabel, eure Limousinen», bemerkte er. «Ich wusste gar nicht, dass du Diplomatenstatus hast.»
Jana sah ihn verlegen an. «Darüber wollte ich vor der Zeremonie heute Abend mit dir reden. Ich muss dir etwas beichten, Dominik.»
«Ich hab’s geahnt», stöhnte er. «Ich muss heute Abend im Smoking dastehen, wenn dir euer Bundespräsident das goldene Verdienstkreuz der Republik an die Brust heftet.»
DREI
Der Klammergriff um ihren Hals drückte Pia beinahe die Luft ab. Sie hatte gewusst, dass der Angriff kommen würde, und sich trotzdem überrumpeln lassen. Ihre Reaktion war zu langsam. Als sie versuchte, ihre Schulter hochzureissen, wurde sie brutal nach hinten gezogen. Ihre Füsse verloren den Halt, sodass der Angreifer sie zu Boden drücken konnte.
«Gibst du auf?», hörte sie eine gepresste Stimme an ihrem Ohr. Die Klammer um ihren Hals war so stark, dass Pia nicht antworten konnte. Sie versuchte, den Kopf nach links und rechts zu drehen, der Druck verstärkte sich sogleich. Schliesslich klopfte sie dreimal mit der flachen Hand auf die Matte.
Maja Hartmann lockerte ihren Griff. «Schon besser», sagte sie anerkennend und löste sich von Pia. Sie reichte ihr die Hand, damit sie sie hochhieven konnte. «Immerhin fiel es mir dieses Mal nicht mehr so leicht, dich auf den Rücken zu legen.» Sie klopfte ihrer Sparringpartnerin auf die Schultern.
«Mega, wirklich», brummte Pia. Sie rieb sich den Hals. «Dafür hast du mich fast erwürgt.»
«Habe ich dir wehgetan?»
«Der Hals ist okay, es ist mein Ego, das schmerzt.»
Maja lachte. «Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hast du wenigstens begriffen, wo dein Problem liegt?»
Pia wischte sich mit dem Handtuch den Schweiss von der Stirn. Dieses Training, zu dem ihr Vater sie verknurrt hatte, war manchmal nur anstrengend. Allerdings fühlte sie sich dank dem Kampfsport- und Selbstverteidigungsunterricht so kräftig wie nie zuvor und hatte an Selbstsicherheit gewonnen. Maja war Ermittlerin im Team ihres Vaters und unterrichtete in ihrer Freizeit Kampfsport für Frauen.
«Du warst zu schnell für mich», sagte Pia.
«Nein, du hattest Angst vor dem Angriff.»
«Ich kann ja nicht ständig in Abwehrstellung darauf warten, dass mir einer von hinten an die Gurgel geht.»
«Nicht ständig, aber nachts auf einer einsamen Strasse oder in einer Unterführung musst du deine Antennen ausfahren und trotzdem locker und entspannt bleiben.»
«Und wenn der Kerl stärker ist als ich, stürzt er sich ganz einfach auf mich, sodass ich zu Boden gehe.»
«Nicht, wenn du schnell genug reagierst. Ich zeige es dir noch einmal.» Maja schlenderte langsam auf der grossen Matte von Pia weg und blickte geradeaus. «Greif mich von hinten an, wann du willst.»
Pia zögerte einen Moment. Dann schnellte sie vor und legte ihre Arme um Majas Hals, so wie diese es vorher bei ihr getan hatte. Bevor Pia richtig zudrücken konnte, hatte Maja das Kinn angezogen und die Schultern hochschnellen lassen. Sie wuchtete sich nach vorne und brachte damit ihre Angreiferin aus dem Gleichgewicht. Mit dem Schwung ihres eigenen Gewichts schleuderte sie Pia mit einem Schulterüberwurf zu Boden und nagelte sie mit einem angedeuteten Tritt in den Unterleib fest.
«Autsch!»
«Sorry.» Maja half Pia auf die Beine. «Siehst du? Du wusstest, dass ich mich wehren würde, und hast trotzdem nicht mit dieser Reaktion gerechnet.»
«Super!», seufzte Pia resigniert. «Da kann ich jahrelang trainieren, bis ich so weit bin.»
«Damit liegst du eben falsch. Du bist geschickt und flink, Pia. Das Einzige, was dir im Weg steht, ist dein Kopf. Du musst umprogrammieren. Wenn dein Umfeld gefährlich wird, soll nicht dein Angstprogramm anlaufen, sondern dein Abwehrmechanismus. Du musst bereit sein, einem Kerl kräftig in den Unterleib zu treten, wenn er auf dich losgeht.»
«Was, wenn ich ihn dabei verletze?»
Maja starrte sie fassungslos an. «Das glaube ich jetzt nicht. Solche Typen haben dich zweimal brutal angegriffen und beinahe umgebracht. Und du hast wirklich Angst, ihnen Schmerzen zuzufügen?» Sie tippte auf Pias Stirn. «Zum Mitschreiben, Fräulein: Dein Ziel ist es, aus einer Attacke heil herauszukommen. Der Typ wird nur von dir ablassen, wenn es ihm wehtut– sehr weh. Wenn nötig, trittst du nach, und zwar dorthin, wo es am meisten schmerzt, du weisst, wo. Du kannst ihm auch mit den Fingern die Augen in die Höhlen drücken oder ihm ein Ohr abreissen. Erst wenn er blutend und winselnd am Boden liegt, bist du vor ihm sicher. Ist das angekommen?» Maja unterstrich jede Silbe des letzten Satzes mit einem Stups ihres Zeigefingers zwischen Pias Augenbrauen.
«Alles klar», sagte Pia. «Du willst, dass ich ihm richtig wehtue, was?»
Maja griff in ihre Sporttasche, zog zwei Wasserflaschen hervor und reichte eine Pia. «Männer sind für das Eine gut, wenn ich es auch will. Im Übrigen weiss ich, wo ich hinzielen muss. Wenn du sie richtig triffst, wälzen sie sich im Nullkommanichts im Dreck und wollen nichts anderes als heim zu Mama.» Sie packte Pia an den Schultern und sah sie eindringlich an. «Das Einzige, was zählt, ist: du oder er. Ich mache das mit dir, weil ich will, dass du gewinnst.» Sie blickte auf die Wanduhr über der Eingangstür. «Feierabend für heute.»
Als Pia von der Dusche in die Garderobe zurückkam, unterhielt sich Maja mit einer anderen Frau. Sie war etwa Mitte vierzig, gross gewachsen und kräftig gebaut. Ihr blondes, mit grauen Strähnen durchzogenes Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, was ihr attraktives, energisches Gesicht etwas hart machte. Sie hatte es offenbar eilig, denn sie packte hastig ihre Trainingskleider in eine Tasche. «Bis demnächst, Maja.– Hallo, ich bin Lori Palmer», sagte sie zu Pia und reichte ihr die Hand.
«Pia Zenklusen», erwiderte Pia.
«Ach ja, du bist Majas begabte Schülerin, nicht wahr?»
Pia wedelte mit den Händen. «Na ja, geht so.»
«Wenn Maja sagt, dass du gut bist, ist es in der Regel so.» Sie blickte auf die Uhr. «Sorry, ich muss leider. Wir sehen uns sicher ein andermal.»
«Wer war das?», fragte Pia, nachdem Palmer gegangen war.
«Lori Palmer ist Anwältin. Sie setzt sich für die Rechte von Flüchtlingen und Asylbewerbern ein. Eine gute Frau, auch wenn sie manchmal nervt.»
«Wie nervt und wen?»
«Vor allem die Kollegen von der Sicherheitsabteilung», sagte Maja. «Lori hat die ‹Aktion Maitag› gegründet, ein Verein, der sich um Asylsuchende kümmert, vor allem um diejenigen, die abgewiesen wurden und sich illegal im Land aufhalten, weil sie nicht in ihr Heimatland zurückkehren können oder wollen. Für diese Leute organisiert der Verein Mittagstische, kostenlose Rechtsberatung und wenn nötig juristischen Beistand.»
«Und was nervt euch daran, respektive deine Kollegen?»
«Es vergeht praktisch keine Woche, in der nicht eine Beschwerde von Lori Palmer reinkommt, weil einige der Kollegen angeblich übergriffig waren.»
«Warum geben wir diesen Leuten nicht Arbeit und eine Wohnung?», fragte Pia, als sie sich die Jacke anzog. «Die sind sicher nicht hergekommen, nur um rumzuhängen, und wollen sich gern nützlich machen.»
«Wäre schön, wenn es so funktionierte. Es ist halt etwas komplizierter.»
«Man kann’s auch kompliziert machen», erwiderte Pia, als sie aus dem lang gezogenen Gebäudekomplex «Perron1» gleich neben dem Bahnhof traten, wo sich Majas Trainingsraum befand.
* * *
Sobald Schwester Felicitas die Verenaschlucht von der Stadt kommend betreten hatte, überkam sie das Gefühl, in einer anderen, besseren Welt zu sein. Wie jedes Mal, wenn sie an diesen Ort kam, durchflutete sie ein Gefühl von tiefer Ruhe, das sich verstärkte, je tiefer sie in die Schlucht hineinging.
Schwester Felicitas liebte diesen Ort, den der Verenabach in Jahrmillionen in den ehemaligen Moränenhügel des Aaregletschers gegraben hatte. Im Grunde war die kürzeste Verbindung zu Fuss zwischen der Stadt und der Nachbargemeinde Rüttenen ein düsterer Pfad. Die Legende der heiligen Verena, der ersten Einsiedlerin, verlieh dem Ort eine friedliche und liebevolle Aura. In der Überlieferung begleitete die Jungfrau aus Theben im 3.Jahrhundert nach Christus ihren Verlobten, den Legionär Viktor, und die elfte römische Legion von Ägypten in die damalige Provinz Helvetien zum VicusSalodurum, der die heutige Stadt Solothurn begründete. Über Jahrhunderte hatte der Kapuzinerorden die ausschliesslich männlichen Einsiedler gestellt. Heute lebte bereits die zweite Frau nach der heiligen Verena als Einsiedlerin an diesem Ort.
In der Schlucht war die Nacht dunkler als ausserhalb. Der gelbe Kalksteinkies des Fusspfades hatte das Licht des Tages in sich aufgesogen. Wie ein helles Band wies er Schwester Felicitas den Weg.
Bei der Einsiedelei, am nördlichen Ausgang der Schlucht, wo Kreuzenweg und Verenaweg zusammentrafen, war der vereinbarte Treffpunkt. Schwester Felicitas blickte auf ihre Uhr, die kurz nach zweiundzwanzig Uhr anzeigte. Es blieb ihr etwas Zeit, und sie beschloss, diese im Gebet in der Verenakapelle bei der heiligen Grotte zu verbringen. Von der Treppe, die zur Kapelle hochführte, sah sie eine Gestalt aus der Dunkelheit auf sich zukommen, und sie schürzte verärgert die Lippen. Das war zu früh. Trotzdem bemühte sie sich, sich nichts anmerken zu lassen, und ging auf die Person zu, deren Gesicht sie im trüben Licht der Weglaterne nicht sehen konnte.
«Es freut mich, dass wir uns endlich treffen», sagte Schwester Felicitas, als knapp eine Armlänge zwischen ihr und der Person lag.
* * *
Die Glocke der nahen St.-Ursen-Kathedrale schlug zehnmal. Die Tische der Aussenbar des «Solheure» an der Aare waren dank der von Heizpilzen verströmten Wärme voll besetzt. Pia und Manuela hatten sich kurzerhand zwei dicke Sitzkissen geschnappt und sich auf die breite Quaimauer gesetzt.
Die geerdeten und gleichzeitig sphärischen Klänge des Stückes «Melodrom» von Julian Le Play harmonierten mit der Atmosphäre der Herbstnacht und schwebten über der träge dahinfliessenden Aare.
Pia hörte die Musik nicht. Ihre Aufmerksamkeit galt Manu, die gedankenverloren in den Fluss blickte und ihren bisherigen Versuchen, sie mit unbefangenem Tratsch abzulenken, mit einer für sie bemerkenswerten Resilienz begegnete. Ihr hübsches rundes Gesicht, das sonst stets Fröhlichkeit ausstrahlte, wirkte verhärmt und verschlossen. Ihre Therapie schlug zwar gut an. Rückfälle wie dieser zeigten, dass Manu den Selbstmord ihrer Mutter nicht vollständig überwunden hatte.
«Manu?» Sanft umfasste Pia sie mit beiden Armen, bis Manu sie anblickte. «Denkst du wieder an Nadja?»
Manu nickte. Ihre Augen glänzten. An sich ein gutes Zeichen, dachte Pia. Wenigstens flossen Tränen.
«Scheisse, ich hab’s wieder getan, Pia.»
«Was?»
«Ich hab mir die letzten gemeinsamen Ferienfotos angeschaut, als ich mit Nadja auf Sardinien war.» Die Tränen hatten sich von Manus Wimpern gelöst und strömten über ihre Wangen. Pia wollte etwas sagen. Manu machte eine abwehrende Geste. «Ich weiss, dass ich das nicht hätte tun sollen. Ich dachte, ich wäre so weit, und heute Nachmittag ging es mir gut. Ich hatte sogar wieder Lust, einen Kerl aufzureissen.» Sie nickte mit dem Kopf zur Bar hinüber. «Der Dunkelhaarige an der Bar wäre mir gerade recht.»
Pia folgte ihrem Blick. Am Bartresen standen drei dunkelhaarige Männer und hatten ihnen den Rücken zugekehrt.
«Dann ist mir die Schachtel mit den Fotos zwischen die Finger geraten, und es ist über mich gekommen.» Sie schluchzte leise. «Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Wegen mir hat sie sich umgebracht. Es wird mich mein Leben lang verfolgen.»
Pia streichelte ihren Rücken. Sie erinnerte sich, was ihr Vater zu ihr gesagt hatte, als sie sich die Schuld am Tod einer Mitschülerin gegeben hatte.
«Du wirst das nicht vergessen, Manu, aber du kommst darüber hinweg. Du kannst nichts dafür. Nadja hat die Wahl getroffen.»
Manu hörte auf zu schluchzen und umarmte Pia. Sie verharrten lange, bis Manu sich löste und Pia schniefend einen tränenfeuchten Kuss auf die Wange drückte.
«Danke. Ich weiss wirklich nicht, was ich ohne dich täte. Ich glaube, ich würde von der Brücke springen.» Sie nickte zur Kreuzackerbrücke hin.
Pia schnaubte. «Wenn schon, spring von der Rötibrücke. Die ist höher, du dummes Huhn.» Sie knuffte Manu in die Seite, sodass diese so etwas wie einen lachenden Schluchzer von sich gab. «Ist doch wahr. Du machst mir Angst, wenn du solchen Stuss von dir gibst, ehrlich.»
«’tschuldige, ich hab’s nicht so gemeint. Vor ein paar Monaten, vor der Therapie, ja. Jetzt nicht mehr.»
Pia folgte Manus Blick, der sich wieder an die drei Männer an der Bar geheftet hatte. Mit einem betont lauten erleichterten Seufzer erhob sie sich und legte sich ihre Jacke um die Schultern. «Ich glaube, wir brauchen wieder was zu trinken. Was willst du? Meine Runde.»
An der Bar stellte sie sich neben die drei orientalisch aussehenden Männer. Derjenige unmittelbar neben ihr sass halb von ihr abgewandt. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen. Seine Stimme hatte ein weiches, angenehmes Timbre, dessen Klang in ihr die Sehnsucht nach Sonne, Sand und süssen Datteln weckte.
Die Barbedienung riss sie mit der Frage nach ihrer Bestellung aus ihren romantischen Gedanken.
Als Pia mit einem Gin Tonic für Manu und einer Stange für sich zu ihrem Platz zurückkehren wollte, erhob sich der junge Mann, der ihr den Rücken zugewandt hatte, ohne sich umzublicken, und stiess mit ihr zusammen. Pia entfuhr ein wütender Aufschrei, als ihre Jacke von der Schulter rutschte und sich ein Gemisch aus Bier, Gin Tonic und Eiswürfeln über ihr T-Shirt ergoss.
«Shit, Mann, kannst du nicht aufpassen?»
Erschrocken wandte sich der Angesprochene um und blickte auf das Desaster, das er angerichtet hatte.
«Verd… sorry. Ich hab dich nicht gesehen. Bist du okay?», fragte er besorgt und hob ihre Jacke auf.
«Sehe ich etwa okay aus?», blaffte Pia zurück, ohne ihn anzusehen, und wischte mit blossen Händen das nasse T-Shirt ab. Sie war froh, ihren Sportbüstenhalter anbehalten zu haben, der ihre ausgeprägten Rundungen bedeckte, die sich sonst allzu deutlich durch den nassen Stoff des Leibchens gedrückt hätten.
«Tut mir leid, wirklich», sagte der junge Mann hilflos. Er hatte sich eine Serviette geschnappt und wollte ihr Shirt trocknen.
«Hey! Schleift’s oder was? Pfoten weg!» Heftig stiess sie ihn von sich und wollte ihn gerade mit einer weiteren Schimpftirade eindecken, als sie ihm in die Augen sah. Sie hielt in ihrer Bewegung inne, und ein eigenartiges kribbelndes Gefühl breitete sich in ihrem Bauch aus. Sie sah nichts mehr ausser einem Paar sanfter, fast schwarzer Augen in einem Gesicht, dessen Hautfarbe sie an hellen Mokka erinnerte. Eine widerspenstige schwarze Locke bedeckte eine Augenbraue. Die fein gemeisselte Nase und der sinnlich geschwungene Mund vervollständigten ein Bild, das ihr schier den Atem nahm.
Besorgt über ihr Verstummen und ihren starren Blick mit halb geöffnetem Mund, machte er scheu einen Schritt auf sie zu.
«Bist du wirklich in Ordnung? Fehlt dir was? Habe ich dir wehgetan?» Er zeigte auf die beiden halb vollen Gläser in ihrer Hand. «Ich ersetze natürlich die Getränke.»
Das brachte Pia zurück in die Realität. «Schon gut. Ist ja nichts passiert.» Sie trat zurück an die Bar und wollte erneut bestellen.
Er insistierte. «Kommt nicht in Frage. Ich mache das», sagte er, und seine Stimme erhöhte Pias Herzschlag um eine Kadenz.
«Wenn du meinst», sagte sie abwesend.
«Und wie ich das meine. Das Mindeste, was ich tun kann. Ich bin übrigens Rafik.»
Pia sagte nichts. Sie war gerade dabei, in seinen Augen zu versinken.
«Ich heisse Rafik… und du bist?»
«Oh, okay… ja, Pia», kam es schliesslich aus ihr heraus.
«Sorry nochmals», sagte er, als er ihr die Ersatzdrinks reichte. «Darf ich mich mal richtig revanchieren?»
«J… ja… sicher… weiss nicht», stotterte sie, nahm ihm die Gläser ab und drehte ihm ohne Verabschiedung den Rücken zu.
Bevor sie sich wieder zu Manu gesetzt hatte, schalt sie sich, ihm nicht wenigstens die Chance gegeben zu haben, sie um ihre Handynummer zu bitten. Sie hätte sicher abgelehnt, möglicherweise auch nicht.
Manu grinste vielsagend, als Pia ihr den Gin Tonic reichte. «Soso, du verguckst dich ausgerechnet in den Kerl, den ich für mich reserviert hatte.»
Pia starrte sie verständnislos an. «Wen meinst du mit ‹für mich reserviert›?»
«Na, der schöne Prinz Ali Baba da drüben, den du so raffiniert angemacht hast. Den habe ich schon den ganzen Abend für mich ausgespäht, und du gehst gleich mit ihm auf Tuchfühlung. Ganz und gar nicht schwesterlich von dir.» Manu setzte eine derart ernste Miene auf, dass sich bei Pia das schlechte Gewissen regte.
«Hey, der Typ hat mich angerempelt, das hast du hoffentlich von hier aus gesehen. Ausserdem, was heisst hier ‹vergucken›?» Sie zeigte zur Bar hinüber. «Bitte, er gehört dir, bediene dich.»
Manus Grinsen wurde breiter, und sie gab Pia einen Klaps auf den Rücken. «Und riskiere, dass du monatelang nicht mehr mit mir sprichst? Nein danke. Der Prinz passt besser zu dir. Ich suche mir lieber einen schönen Bettler, arm, dafür gut ausgerüstet.»
Pia verdrehte die Augen. «Kannst du nur an das eine denken?»
«Woran soll man denn sonst denken, wenn man einen gut aussehenden Typen sieht?»
«Du kannst es mal damit versuchen, aus der Ferne zu geniessen, anstatt ständig zu überlegen, wie du ihn rumkriegen kannst.»
«Rumkriegen lenkt ab und hilft bei Trauerphasen und Depressionen.»
«Sagt wer?»
Manu dachte kurz nach. Sie machte eine gleichgültige Grimasse. «Irgendwer wird’s schon gesagt haben. Muss ich mal googeln.»
Pia schüttelte verständnislos den Kopf und trank einen grossen Schluck. «Du bist ein hoffnungsloser Fall. Bitte, von mir aus darfst du sofort mit dem dort–»
Sie wollte eine betont lässige Handbewegung zu den drei Männern an der Bar machen und merkte, dass die drei Hocker leer waren. Sein Rücken verschwand gerade durch die Tür im Innern der Bar. Er hatte sie nicht einmal mehr eines Blickes gewürdigt, geschweige denn sich bemerkbar gemacht. Pia spürte einen kleinen, heftigen Stich in ihrer Brust. «Er ist weg!»
«Geh ihm nach!», rief Manu und schubste sie an.
«Sicher nicht! Ich mache mich nicht vor allen hier zum Affen.»
«Ja, genau. Dabei sind dir vorhin fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Wenn du so weitermachst, kannst du dich gleich einfrieren lassen, bis alle Typen zu treuen, ehrlichen und fürsorglichen Rittern werden, die uns stets auf Händen tragen. Das dürfte so etwa um den Sankt-Nimmerleins-Tag herum der Fall sein. Vergiss nicht, dir bis dahin einen schönen grossen Dildo in den Sarg legen zu lassen.»
Pia leerte ihr Glas. «Mir reicht’s. Ich gehe nach Hause, bevor du mich ernsthaft verkuppelst. Kommst du auch?»
«Ja, gehen wir, bevor meine moralische Integrität Schaden nimmt.»
Als sie an der Theke vorbeigingen, wurde Pia von der Bardame zurückgerufen. «Der Junge, mit dem du vorhin zusammengestossen bist, hat mir gesagt, ich soll dir das geben.» Sie drückte Pia einen Zettel in die Hand. Ein Seufzer der Erleichterung ging über Pias Lippen, als sie eine Handynummer sah. Darunter stand: «Sorry wegen vorhin. Ruf mich an. Rafik» Neben dem Namen hatte er einen Smiley gezeichnet. Mit einem triumphierenden Grinsen reichte sie Manu den Zettel und hob die Hand zu einem High five.
* * *
Die Verleihung des Verdienstkreuzes für besonders wertvolle Verdienste für die Republik Österreich an Oberstleutnant Jana Cranach durch den Bundespräsidenten Franziskus Ortenberg und der anschliessende Empfang im Spiegelsaal der Hofburg hatten sich ewig hingezogen. Dornach glaubte, nie in seinem Leben so viele Hände geschüttelt zu haben. Er brachte es trotzdem fertig, den Abend zu geniessen, insbesondere die Attraktivität und die lockere Eleganz der anwesenden Wienerinnen, von denen sich einige für ihn interessierten, sodass sich Jana immer mal wieder demonstrativ neben ihn stellte und damit ihr Territorium für den Abend markierte.
In der Limousine lehnte sich Jana mit einem tiefen Seufzer im Ledersitz zurück. Sie fuhren durch das nächtliche Wien zu ihrer Wohnung an der Prinz-Eugen-Strasse im vierten Bezirk.
«Müde?», fragte Dornach, fasste sie sanft an den Hüften und drehte ihren Rücken zu sich, sodass er ihren Nacken massieren konnte.
Sie seufzte wohlig. «Die Wiener Hautevolee kann ganz schön anstrengend sein.»
«Gott sei Dank hast du mir vor der Zeremonie schonend beigebracht, dass der Bundespräsident dein Patenonkel ist», sagte Dornach. «Ich hätte sonst dumm aus der Wäsche geguckt.»
«Ich wollte dich nicht damit überrumpeln. Onkel Franz ist nun mal der Bruder meiner Adoptivmutter.»
«Schon gut, solange deine Patentante nicht die Bundeskanzlerin ist.»
«Die Schwester meines Adoptivvaters war leider verhindert. Als UNO-Botschafterin musste sie heute an einer Sitzung in New York teilnehmen.»
Dornach hatte aufgehört, sie zu massieren. Als sie sich zu ihm umdrehte, sah er sie so verdutzt an, dass sie laut herauslachen musste. «Was ist?» Sie zog ihre Uniformjacke aus und lockerte die Krawatte.
«Warum hast du nie erzählt, dass du zur ersten Familie Österreichs gehörst?»
«Weil es für meine Arbeit irrelevant ist.»
«Ich hätte damals schon gerne von Anfang an gewusst, mit wem ich es zu tun habe, wenn wir schon zusammenarbeiten sollten», entgegnete er etwas pikiert.
Jana streichelte sein Gesicht. «Geh, Dominik, sei ned grantig.» Sie küsste ihn auf den Mund.
«Sind es deine Eltern und dein Onkel, die wollen, dass du den Job bei Europol annimmst? Macht man sich Sorgen um deine Sicherheit, wenn du in Wien bleibst?»
«Wenn ich den Job in Den Haag nicht wollte, hätt ich ihn ned g’nommen. Ein Tapetenwechsel wird mir guttun. Und um deine Frage zu beantworten: Meine Verwundung hat vor allem meiner Adoptivmutter zugesetzt. Sie hat bei meinem Onkel und bei meinem Chef, Oberst Redl, ein paar Hebel in Bewegung gesetzt, damit ich eine Zeit lang nicht an vorderster Front stehe.»
Dornach warf ihr einen prüfenden Seitenblick zu. «‹Deputy Director of Operations›, direkt dem Europol-Direktor unterstellt», sagte er. «Nicht schlecht. Trotzdem ein Schreibtischjob.» Dornach hatte Mühe, sich Jana aktenwälzend in einem Büro vorzustellen.
«Geh, du glaubst wohl, dass du mich durch und durch kennst», sagte sie spöttisch. «Wart’s ab, was ich draus mach. Ausserdem ist das Ganze befristet auf maximal zwei Jahre. So lange, bis wir die Situation mit der Paneuropäischen Front einigermassen im Griff haben.»
Dornach hatte schon von dieser Organisation gehört, konnte sie jedoch nicht richtig einordnen. «Was genau ist diese Paneuropäische Front?»
«Ich hab die Kollegen in Den Haag schon eine Zeit lang bei den Ermittlungen gegen diese Vereinigung unterstützt. Bisher stecken wir im Stadium der Vermutungen. Es gibt starke Indizien, die darauf hinweisen, dass es sich um eine Bewegung handelt, in der sich einige rechtsextreme europäische Parteien und christlich-fundamentalistische Gruppierungen zusammengetan haben, um für die Verteidigung des Abendlandes zu kämpfen.»
«Ist das nicht die Angelegenheit des Verfassungsschutzes der betroffenen Staaten?»
«Nicht nur. Mit der Flüchtlingskrise und der Bedrohung durch den islamistischen Terror ist die politische Situation in den EU-Staaten weniger stabil als auch schon. Dabei stellen die Europafrontisten eine grössere Bedrohung für unsere Gesellschaft dar als die Jihadisten. Dazu kommen die Finanzkrisen in den südeuropäischen Ländern. Rechtsnationale Parteien und christliche Fundamentalisten machen sich das zunutze, um die Wähler in ihren Staaten gegen ihr gemeinsames Feindbild, die Europäische Union, aufzuhetzen. Die Paneuropäische Front dient ihnen als Plattform, ihre Ziele wirksamer erreichen zu können. Die ersten Folgen sind bereits deutlich in Frankreich erkennbar, wo der Front National immer mehr an Einfluss gewinnt. Auch in Deutschland und Holland sind solche Tendenzen bemerkbar. Leider gewinnen sie auch hier in Österreich wieder Oberwasser.»
«Da seid ihr nicht alleine. Bei uns ist es die ‹Patriotische Fortschrittspartei der Schweiz›. Sie hat in den letzten Jahren zulasten der etablierten Bürgerlichen und Linksparteien viel Boden gutgemacht. Wie konkret beurteilt Europol denn die Bedrohung durch diese Europafront in derEU?»
«Das können wir bisher nur schätzen. Es zeichnet sich eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen ansonsten voneinander unabhängig operierenden Organisationen ab. Ihr Ziel ist es, mit verschiedenen Aktionen und Provokationen die Sicherheits- und Asylpolitik der EU-Mitgliedstaaten zu destabilisieren. Diese sind, wenn nicht unbedingt illegal, zumindest äusserst fragwürdig. Wenn die nationalen Regierungen dieses Problem nicht in den Griff bekommen, hat dieEU als Ganzes ein nachhaltiges Problem.»
«Das hat sie bereits, wenn man sieht, was an den EU-Aussengrenzen mit den Flüchtlingen abgeht.» Dornach dachte an den politischen Lärm, den die Rechten in der Schweiz deswegen bereits veranstalteten.
«Sicher, und der Austrittsentscheid des Vereinigten Königreichs verschärft den Druck auf dieEU.»
«Die Briten sind eh nur ein halbherziges EU-Mitglied.»
«Mag sein, trotzdem befürchtet man, dass der Brexit-Entscheid Signalwirkung für Europas Rechtsnationalisten hat. Das britische Beispiel könnte Schule machen und weitere nationale EU-Referenden nach sich ziehen. Du weisst ja: Nichts vermag die Bürokraten in ihrer Brüsseler Komfortzone so sehr zu beunruhigen wie zu viel Demokratie, die ihre Machtpfründe beschneidet.»
Dornach streckte sich in seinem Sitz. «Es gibt halt nichts Besseres als eine schöne Volksabstimmung, um einige Sesselfurzer in Regierung und Parlament aus den Stühlen zu heben.»
«Ihr Schweizer müsst’s ja wissen.» Sie massierte sich die Schläfen. «Mein Job wird es sein, diese Entwicklung genau zu beobachten und festzustellen, wie weit die Zusammenarbeit der Rechtsparteien mit den religiösen Fundamentalisten innerhalb der Paneuropäischen Front gediehen ist und was die Auswirkungen sein können.» Sie unterdrückte ein Gähnen.
«Zeit, dir etwas Schlaf angedeihen zu lassen», sagte Dornach, als der Wagen vor Janas luxuriösem Wohngebäude beim Belvedere Schlosspark anhielt.
«Nachher», sagte sie und schmiegte sich an ihn.
«Wie, nachher? Hast du heute Nacht noch was vor?»
Trotz ihrer Müdigkeit hatten ihre Augen einen dunklen Glanz, als sie zu ihm aufblickte und ein Lächeln über ihre Lippen huschte.
* * *
Pia und Manu beschleunigten ihre Schritte, als sie das Geschrei hörten, das vom hinteren Ende des Klosterplatzes zu ihnen herüberdrang, gerade bevor sie den Kronenstutz in Angriff nahmen. Sie sahen eine Gruppe junger Männer, die grölend zusammenstanden. Dem Lärm nach waren die Typen nicht mehr nüchtern und aggressiv unterwegs.
Manu und Pia hatten keine Lust, herauszufinden, worum es ging. Sie gingen schneller, bis Pia ein weiches Timbre heraushörte, dessen Resonanz das Kribbeln in ihrer Magengegend von vorhin weckte. Sie blickte hinüber zu der Stelle, wo sich die Männer zusammengerottet hatten, bevor sie sich in Richtung der Gruppe in Bewegung setzte.
«Pia!», rief Manu hinter ihr her. «Was machst du? Lass die Typen in Ruhe. Die können ihre Probleme alleine lösen.»
Pia hörte nicht auf sie und näherte sich der Rotte bis auf einige Meter. Bis dahin hatte keiner der Männer sie bemerkt. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, verbal und mit blossen Händen auf einen anderen in ihrer Mitte einzudreschen. Sie trieben ihn über das Klopfsteinpflaster, wo der Klosterplatz in die Probsteigasse mündete. Pia sah das lockige schwarze Haar des drangsalierten Mannes. Es war tatsächlich Rafik, auf den es die Schläger abgesehen hatten. Sie sah sich nach Manu um, die ihr vorsichtig gefolgt war.
«Pia», sagte Manu eindringlich, «wir rufen die Polizei, sonst vermöbeln die uns auch noch oder schlimmer.»
«Bis die Tschuggerei kommt, haben die Arschlöcher Rafik zu Mus geprügelt.» Pia hielt Manu am Arm fest. «Bleib hier und ruf die117 an.»
«Pia, geh nicht! Die machen Kleinholz aus d…»
Pia schritt bereits entschlossen auf die Männer zu, die dazu übergegangen waren, Rafik mit Füssen zu traktieren.
Die Schläger waren mit ihrem Opfer derart beschäftigt, dass sie Pia keine Aufmerksamkeit schenkten. Sie schloss kurz die Augen, versuchte sich an das zu erinnern, was Maja ihr eingetrichtert hatte, und holte tief Luft.
«Lasst den Mann in Ruhe und macht, dass ihr fortkommt. Er hat euch nichts getan», rief sie, selber erstaunt über den festen Ton ihrer Stimme.
Das Gejohle und Gelächter verstummte augenblicklich. Das Gute daran war, dass sich keiner mehr um den am Boden kauernden Rafik kümmerte. Pia konnte nicht sehen, ob und wie stark er verletzt war. Weniger günstig für sie war, dass sie nun die ungeteilte Aufmerksamkeit dieser ausschliesslich alkohol- und testosterongesteuerten Meute hatte. Es waren vier und alle bis auf einen kahl geschoren. Sie waren einheitlich gekleidet in schwarze T-Shirts und Lederjacken, auf deren Rückseite ein Schweizerkreuz prangte, das von einem weissen Totenkopf überlagert wurde. Darunter stand in gotischer Schrift «SchutzfrontCH». Dazu trugen sie schwarze Cargohosen, deren Stösse in schweren Kampfstiefeln steckten. Derjenige mit den Haaren auf dem Kopf war älter als seine Kumpane und hob sich von den anderen ab. Im Gegensatz zu seinen wohlgenährten Kameraden, die Pia mit bösartigem Blick fixierten, hatte er ein scharf geschnittenes Gesicht und sah ganz passabel aus. Etwas an ihm war merkwürdig, denn er hielt sich etwas abseits.
Dafür tat sich ein anderer hervor. «He, Kameltreiber, schau mal, deine Freundin ist da, um dich zu retten», rief er und näherte sich Pia, die stehen geblieben war, um Sicherheitsabstand zu wahren. Dem Gegröle seiner Kumpane entnahm sie, dass der Kerl Fipu heissen musste. Er war mit seiner untersetzten Gestalt, dem massigen Bierbauch und einem asymmetrischen Kahlschädel eine unsympathische Erscheinung.
«Ja, hallo!», rief Fipu und musterte Pia anzüglich von oben bis unten. Allein dafür hätte sie ihm liebend gern zwischen die Beine getreten. Sie sagte kein Wort und erwiderte seinen Blick. Sie warf einen Blick zu dem Typen mit den Haaren auf dem Kopf, der noch kein Wort gesagt hatte.
«Hätte ich dir gar nicht zugetraut, Ali», feixte Fipu zu Rafik gewandt. «Seht mal, die hat ja alles, was es braucht. Ich dachte, ihr Araber fickt nur Kamele.» Sein Blick blieb an Pias Oberweite hängen. «Ihre Höcker können sich auf jeden Fall sehen lassen.» Seine Kumpane grölten.
Pia schluckte ihre Angst hinunter. «Lasst ihn in Ruhe, ihr Feiglinge», sagte sie. Es kostete sie Anstrengung, ihre Stimme fest und ruhig klingen zu lassen. Innerlich hatte sie bereits mehrere Stossgebete gesprochen, dass die Polizei bald kommen möge.
Fipu trat einen Schritt näher, und Pia bot ihre ganze Willenskraft auf, um nicht zurückzuweichen.
«Hast wohl Angst, dass du deinen Kerl nicht mehr gebrauchen kannst, was? Keine Sorge, ist noch alles dran. Oder hast du ihm etwa schon in die Eier getreten, Röschu?», rief er einem anderen zu.
«Alles noch da. Vielleicht nicht mehr lange. Sie sollte ihm einen blasen, solange was davon übrig ist.»
«Gute Idee!» Fipu streckte die Hand nach Pia aus. «Komm, tu ihm den Gefallen. Verwöhn sein bestes Stück. Er wird dir ewig dankbar sein.»
Energisch hob Pia die Hand. «Ein Schritt weiter und du kannst später dankbar sein, wenn du überhaupt je wieder mal geradeaus pinkeln kannst», sagte sie scharf.
«Habt ihr das gehört? Die Alte droht mir. Jetzt krieg ich wirklich Angst.» Er grinste sie an.
«Lass sie ein bisschen bei dir lutschen, Fipu. So kriegt sie mal wieder was Anständiges in den Mund.»
Pia scannte mit einem schnellen Seitenblick die Umgebung. Ausser ihr und den Rabauken war kein Mensch zu sehen. Manu hatte sich wohl hinter einer Hausecke versteckt. Der Typ mit den Haaren stand nun etwas seitlich von ihr. Wenn der andere Idiot ihr näher kam, musste sie handeln.
Die Meute feuerte Fipu an. «Besorg es ihr durch den Hintereingang, Fipu. Dann spürt sie mal, was ein echter Schweizer so draufhat. Kann ja sein, dass sie dabei Kreuzchen sieht statt Sterne.» Die anderen hielten sich die Bäuche vor Lachen. Fipu kam feixend und an seinem Hosenladen nestelnd auf sie zu.
Pia wurde klar, dass sie einem Zweikampf nicht ausweichen konnte. Sie musste das Überraschungsmoment auf ihrer Seite haben. In einer blitzschnellen Bewegung stellte sie sich so hin, dass sie seitlich zu ihrem Angreifer stand. Bevor Fipu richtig begriff, was vorging, zog sie ihr Knie hoch und versetzte ihm einen heftigen Schnapptritt in den Genitalbereich. Mit einem Aufschrei klappte er wie ein Sackmesser zusammen. Pia wartete nicht ab, bis er sich wieder erhob, sondern legte gleich nach, indem sie ihn mit beiden Händen an den Ohren packte und seinen Kopf derart heftig hochriss, dass ein Ohrläppchen anriss. Sie versetzte ihm mit dem Knie einen Schlag unter den Kiefer. Wie vom Donner gerührt, ging er rücklings auf das Klopfsteinpflaster und blieb reglos liegen.
Pia war geschockt und gleichzeitig verblüfft. Es hatte funktioniert: Der Kerl war ihr voll in den Hammer gelaufen. Dafür tat er ihr schon wieder ein wenig leid. Sie blickte zu den drei Kumpanen hinüber, die mit offenen Mündern zuerst den ausgeknockten Fipu und dann sie anstarrten. Der Erste, der sich rührte, war der mit den Haaren. Er kam mit drohender Gestik auf sie zu.
Pia ging sofort in Abwehrposition und sah ihn hart an. «Na los, worauf wartest du? Mir ist gerade nach Eiersalat.»
Es musste die kalte Entschlossenheit in ihren Augen sein, die ihn veranlasste, stehen zu bleiben. Abwechselnd sah er seinen am Boden liegenden Kumpan und Pia an. Schliesslich liess er die Arme fallen. «Wir ziehen ab», rief er den anderen zu und zu Pia: «Freu dich nicht zu früh, Schlampe. Du kriegst dein Fett weg.»
Pia wollte etwas erwidern, aber sie biss sich auf die Lippen. Sie wollte die Kerle nicht unnötig weiter provozieren.
Erst als die Typen weg waren, fühlte sie, wie ihr der kalte Schweiss über die Stirn lief und sie zu zittern begann, sodass sie sich an einer Hauswand abstützen musste.
Inzwischen hatte sich Rafik aufgerappelt. Seine Lippen bluteten, und er hielt sich mit beiden Händen und schmerzverzerrtem Gesicht die Rippen.
«Bist du in Ordnung?», fragte Pia.
«Die haben mir sicher eine Rippe geprellt», presste Rafik hervor und blickte auf seinen am Boden liegenden Peiniger hinunter, den seine sogenannten Kameraden zurückgelassen hatten. Es schien ihm nichts auszumachen, dass ihn eine Frau herausgehauen hatte. «Hey, danke», sagte er aufrichtig und fasste ihre Hand. «Ohne dich hätten die Kerle mich spitalreif geschlagen.»
Inzwischen war Manu dazugekommen. «Mann, Pia, wie du den flachgelegt hast. Hat Maja dir das beigebracht?»
«Dieser Arsch wollte mich gleich hier vergewaltigen. Das hat mich so was von wütend gemacht.» Besorgt sah sie auf den Reglosen hinunter. «Hoffentlich habe ich ihn nicht schwer verletzt.»
«Wenn schon, das war Notwehr», sagte Manu bestimmt.
«Hoffentlich sieht das die Polizei auch so», sagte Pia nachdenklich.
«Die kommen schon.» Manu wies mit dem Daumen hinter sich, wo das Blaulicht eines Patrouillenfahrzeuges von den Gebäuden um den Friedhofplatz reflektiert wurde.
Als der Wagen bei ihnen anhielt, kam Fipu stöhnend zu sich. Er blutete aus dem Mund und hielt seine Genitalien mit beiden Händen.
Die Polizisten machten sich ein Bild von der Lage und stützten sich dabei vorerst auf Pias und Manus Schilderung der Ereignisse. Einer half dem Verletzten, sich aufzurichten. Sein Kollege forderte über die Alarmzentrale eine Ambulanz an.
«Sie haben ganz schön zugelangt, Frau Zenklusen», sagte Stadtpolizist Mülchi zu Pia. «Der Mann hat wahrscheinlich eine Kieferprellung. War das nötig? Der Tritt in den Unterleib müsste gereicht haben, ihn ausser Gefecht zu setzen.»
«Wie konnte ich das wissen?», entgegnete Pia. «Die waren zu viert, und dieser Typ wollte mich eindeutig vergewaltigen.» Sie zeigte auf seinen Hosenbund. «Sehen Sie, sein Hosenschlitz ist schon offen.»
Die Polizisten nahmen den Tatbestand auf und luden alle Beteiligten für den nächsten Tag vor, um die Protokolle zu unterschreiben und allenfalls Anzeige zu erstatten.
«Hatte trotz allem was Gutes für mich, dich heute angerempelt zu haben», sagte Rafik zu Pia.
«Ich weiss nicht, was ich gut finden soll», erwiderte Pia betont mürrisch. «Erst duschst du mich mit Bier, und zu guter Letzt werde ich deinetwegen beinahe vergewaltigt. Obendrein riskiere ich eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Und das ist alles gar nichts gegen die Kopfwäsche, die mir mein Vater verpassen wird, wenn er davon erfährt. Ich habe wirklich allen Grund zum Jubeln.» Mit verschränkten Armen drehte sie ihm den Rücken zu.
«Mach dir nichts draus», raunte Manu Rafik zu. «Sie hat manchmal nur Mühe, sich richtig auszudrücken.»
HÖLLE
Letzte Nacht träumte sie wieder vom finsteren Tal. Ich wurde wach, als sie im Schlaf meinen Namen schrie.
«Sie kommen und holen uns. Wir müssen weg, mein Kleines. Sie dürfen uns nicht finden.»
Ich darf sie dabei nie wecken, weil sie sonst nicht wieder einschlafen kann und stattdessen die ganze Nacht im Zimmer hin und her geht.
Ich lege mich zu ihr und decke mich mit der Wolldecke zu, die ich zu diesem Zweck über die Lehne des Stuhles neben ihrem Bett gelegt habe.
Wenn sie sich im Bett wälzt, streichle ich ihr schweissnasses Haar. Wenn sie schreit und mit den Zähnen knirscht, flüstere ich ihr tröstende Worte ins Ohr. Wenn nichts anderes hilft, drücke ich sie fest an mich. Meine Tränen vermischen sich mit ihrem Schweiss.
Es sind die Nächte, in denen sie zurück in diese Hölle geht. Die ersten Male, als es passierte, habe ich sie geweckt, bis sie mich bat, es nicht mehr zu tun.
«Es ist mein Fegefeuer, ich muss da durch», sagte sie. Als ich widersprechen wollte, hatte sie mein Gesicht in beide Hände genommen und mich auf die Stirn geküsst. «Lass nur, es hilft mir, wenn ich weiss, dass du bei mir bleibst und mich nicht alleine lässt.»
«Wie könnte ich das?», habe ich geantwortet. «Wir haben so viele Jahre nachzuholen, du und ich. Uns bleibt nur wenig Zeit. Ich werde immer für dich da sein.»
In den letzten Monaten sind die Träume weniger häufig geworden, dafür umso heftiger.
Wenn sie sich beruhigt hat und wieder eingeschlafen ist, warte ich jeweils eine Weile, bis ich sicher bin, dass es vorüber ist. Sie hat es nicht gern, dass ich neben ihr liege, wenn sie erwacht. «Wir sind erwachsen. Jeder gehört in sein eigenes Bett», sagt sie immer.
VIER
In ihrem Büro im Franziskanerhof erhob sich Angela Casagrande von ihrem Stuhl und streckte sich. Sie trat ans Fenster und blickte auf den Vorhof des ehemaligen Klosters, welches die Staatsanwaltschaft für den oberen Kantonsteil sowie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beherbergte.
Es war erst kurz vor acht und schon erstaunlich hell, was sie der Abwesenheit des Nebels zurechnete, der normalerweise in dieser Jahreszeit die Stadt fast den ganzen Tag in dunstiges Zwielicht hüllte. Trotzdem fühlte sie sich nicht wohl in ihrer Haut und konnte nicht mal sagen, warum. War es das ungewöhnlich milde Wetter mit der dazugehörenden Föhnlage? Bisher hatte kein Klima vermocht, ihr Befinden negativ zu beeinträchtigen. Oder machte ihr der Umstand zu schaffen, dass Dornach zu Jana Cranach nach Wien gefahren war? Wenn sie nur daran dachte, schlich sich ein Gefühl in ihre Brust, das sie sich selbst nicht zugeben mochte. Eine Angela Casagrande war nicht eifersüchtig. Mit Dornach verband sie eine gute persönliche Freundschaft, mehr nicht– bis die Cranach auf den Plan getreten war und Casagrandes sorgfältig kontrolliertes Verhältniskonstrukt zu ihm wie ein Kartenhaus hatte einstürzen lassen. Diese Gedanken verursachten ihr ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer Geliebten, Ines Degonda, mit der sie seit bald einem Jahr zusammen war. In den letzten Wochen hatte sich bei Casagrande eine leise und doch immer lauter werdende Stimme eingenistet, die sie fragte, wie lange sie sich die Frivolitäten mit der quirligen Engadiner Juristin leisten wollte, wenn sie sich gleichzeitig nach dem Mann sehnte, den sie nicht haben konnte. Im Grunde durfte sie sich nichts vormachen. Dornach bedeutete ihr mehr, als sie wahrhaben wollte, und sie sperrte sich dagegen, weil sie nicht aus ihrem aus Berufsethik gemauerten und mit Professionalität vergitterten Gefängnis ausbrechen konnte.
Sie wandte sich wieder dem Dossier zu, dessen Studium sie den grössten Teil der vergangenen Nacht gekostet hatte. Sie wollte alles ein weiteres Mal durchgehen, bevor sie Erich Marber in einer halben Stunde im Untersuchungsgefängnis erneut gegenübersitzen würde, um ihn zum Tod von Masud Bhutto zu befragen.
Sie setzte sich wieder an ihren Arbeitstisch, der mit den Fallakten Bhutto und mehreren Tageszeitungen übersät war. Die Schlagzeilen behandelten alle dasselbe Thema, wenngleich unterschiedlich in Stil und Sprache: den Tod eines sechzehnjährigen Immigranten, der von dem Hausherrn brutal zu Tode geprügelt worden war, weil er am vergangenen Sonntagabend in das Haus der Familie in Grenchen eingebrochen war und die hochschwangere Frau niedergeschlagen hatte.
Die Lokalredaktorin Doro Schubiger vom Solothurner Tagblatt ortete ein Dilemma, in dem die zuständige Staatsanwältin steckte, wenn sie einen bisher unbescholtenen Mann des Mordes anklagte, obwohl er lediglich sein Haus und seine Familie verteidigt hatte.
Casagrande konnte sich vorstellen, dass sich Doro Schubiger selber in einem Dilemma befunden haben musste, als sie den Artikel verfasst hatte, der im Grossen und Ganzen wohlwollend mit Casagrande umging. Das musste daran liegen, dass die Redaktorin zu ihr ein gutes Verhältnis pflegte. Casagrande hatte ihr bei ihrem Amtsantritt das erste Interview gewährt, das sich als offenes und ausgewogenes Gespräch erwiesen hatte.
Doros Vater, dem prominenten Rechtsanwalt Norbert Schubiger, hingegen dürfte der Artikel seines Sprösslings weniger gut gefallen haben. Für den Präsidenten der rechtsradikalen Patriotischen Fortschrittspartei mit grossen Ambitionen für die kommenden kantonalen Wahlen ging er vermutlich zu wenig hart ins Gericht mit der etablierten Politik und den Behörden, die nach seiner Ansicht und der seiner Parteigenossen seit Jahren Verrat am Schweizer Volk und seinen Werten begingen. In den Medien, die seiner Politik eher entsprachen, sprach Schubiger unverhohlen von einem Hexenprozess, den Casagrande gegen einen Helden anstrengte, der sein Heim und seine Familie gegen das nichtsnutzige ausländische Ungeziefer verteidigte, weil der Staat es nicht fertigbrachte, seine Bürger zu schützen.
Der Artikel im Boulevardblatt «N.T.», dem «Neuen Tag», dürfte damit eher seinem Gusto und dem seiner Mitstreiter entsprechen: «GEFÄNGNIS FÜR EINEN HELDEN!– Familienvater verteidigt seine Familie– Solothurner Staatsanwältin als Inquisitorin. Ist das Gerechtigkeit?»
Casagrande faltete die Zeitung zusammen und warf sie auf den Altpapierstapel. Natürlich hatte sie Verständnis für Marbers Reaktion, als er seine hochschwangere Frau regungslos am Boden liegen sah. Sie hatte das Bewusstsein bereits wiedererlangt, als die erste Polizeipatrouille am Tatort eingetroffen war. Der herbeigerufene Notarzt stellte bei ihr lediglich eine leichte Gehirnerschütterung fest. Julia Marber hatte Glück im Unglück. Ein dicker Faserteppich hatte die Wucht des Aufschlags erheblich gemindert. Dem Ungeborenen war nichts geschehen, und der Vorfall würde den Verlauf der Schwangerschaft aus medizinischer Sicht nicht beeinträchtigen. Masud Bhutto hingegen war tot, erschlagen vom Hausherrn.
Ein vorläufiger Obduktionsbericht des Instituts für Rechtsmedizin in Bern, den sie angefordert hatte, stellte in nüchternen Worten die Verletzungen dar, die dem Sechzehnjährigen zugefügt worden waren. Der Junge hatte mehrere Schläge mit einem Baseballschläger an Beinen und Rumpf erlitten, die sicher schmerzhaft, jedoch nicht tödlich waren. Ferner wies sein Schädel zwei Schlagverletzungen auf, wovon eine zu einem schweren Schädelbruch mit Gehirnblutung geführt hatte und somit todesursächlich war. Er war regelrecht zu Tode geprügelt worden. Ein toxikologisches Gutachten und der abschliessende Bericht standen noch aus. Aufgrund der Spurenlage und der Aussage von Erich Marber hatte Casagrande einen Haftbefehl gegen ihn wegen exzessiver Notwehr und Tötung im Affekt veranlasst.
Casagrande war sich bewusst, dass sie damit alleine stand. Ein schwerer Sturm zog gegen sie auf. Im Hinblick auf die Wahlen im Frühjahr witterte die Fortschrittspartei Morgenluft und zögerte nicht, das Drama für ihren Stimmenfang auszuweiden.
Die Vibration ihres Handys riss sie aus ihren Gedanken. Die Anrufer-ID kündigte Maja Hartmann an, Dornachs vorübergehende Stellvertreterin.
«Aussergewöhnlicher Todesfall in der Einsiedelei, Angela», sagte Maja ohne Umschweife, sobald sich Casagrande gemeldet hatte. «Nicht identifizierte Frauenleiche. Die solltest du dir ansehen.»
Casagrande war Maja dankbar, dass sie ihr eine Gelegenheit bot, den Fall Masud Bhutto auf die Seite zu legen. Sie nahm ihre Tasche und liess die verbale Kraftmeierei der Politiker und die verkorksten Ergüsse der Medienfritzen in ihrem Büro zurück, das sie zweimal hinter sich abschloss.
Casagrande stellte ihren VWBeetle auf dem Parkplatz des Restaurants Einsiedelei ab und ging die kurze Strecke zum nördlichen Eingang der Verenaschlucht zu Fuss. Vor der Polizeiabsperrung befanden sich ein paar Neugierige und Spaziergänger, die versuchten, dem dort stehenden Polizisten die Würmer aus der Nase zu ziehen. Unter den Schaulustigen erkannte Casagrande Doro Schubiger. Sie wollte nicht über etwas ausgefragt werden, worüber sie selbst nicht Bescheid wusste, und versuchte, rasch unter dem Absperrband durchzuschlüpfen, das der Beamte für sie hochhielt. Vergebens.
«Frau Casagrande, Frau Casagrande, können Sie sagen, was dahinten passiert ist?»
Genervt schloss Casagrande kurz die Augen, bevor sie sich umdrehte und an die Absperrung trat, wo die Journalistin sich neben den Polizisten gedrängt hatte. Nach Doros massvollem Artikel zum Fall Masud Bhutto wollte sie es sich nicht mit ihr verderben. Wer wusste schon, wann sie wieder einmal das Wohlwollen des Tagblatts brauchte.
«Guten Tag, Frau Schubiger. Sie sind ja schneller da als ich. Wie soll ich da mehr wissen als Sie?»
«Können Sie mir nicht wenigstens einen kleinen Hinweis geben?»
Casagrande war bewusst, dass die Lokalzeitungen auf die Verbreitung von News angewiesen waren, die sich in ihrem Einzugsgebiet ereigneten, um sich im Medienwesen des digitalen Zeitalters behaupten zu können. Sie bedeutete dem Polizisten, die Journalistin durchzulassen.
«Ich danke Ihnen für Ihren fairen Kommentar zum Fall Masud Bhutto», sagte Casagrande.
Doro antwortete mit einem Schulterzucken, das schlecht verbergen konnte, wie gut ihr die Anerkennung der Staatsanwältin tat. «Ich versuche nur, meinen Job als Journalistin zu machen: Fakten schildern und ausgewogen kommentieren. Die Leser haben ein Recht auf fundierte Information und brauchen keine Polemik. Für die sorgt bereits die grosse Konkurrenz», sagte sie und verzog den Mund, um deutlich zu machen, was sie davon hielt.
Casagrande nickte. «Deshalb biete ich Ihnen Folgendes an.» Sie zeigte zum Ende des Felsenkessels der Einsiedelei, wo die Spurensicherer herumwuselten. «Ich kann Ihnen jetzt noch nichts sagen. Sollten wir etwas Erwähnenswertes finden, verspreche ich Ihnen, dass Sie die Erste sind, die davon erfährt. Ich rufe Sie persönlich an, versprochen.»
Doro sah Casagrande prüfend an und nagte kurz an ihrer Oberlippe, bevor sie sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht wischte.
«Ich verlasse mich auf Sie, Frau Casagrande.»
Die beiden reichten sich die Hand. Casagrande blickte ihr nach, als sie Richtung Parkplatz ging. Doro Schubiger war jung, keine dreissig. Sie hatte das Zeug zu einer guten Journalistin, und Casagrande hoffte, dass es ihr gelingen würde, sich vom unappetitlichen Mief fernzuhalten, den ihr Vater mit seiner Partei verbreitete.
Bevor sie zum Fundort ging, blieb Casagrande einen Moment stehen und liess die Stimmung der Einsiedelei auf sich wirken. Trotz ihrer italienischen Wurzeln war sie stets auf Distanz zur römisch-katholischen Konfession geblieben. Wahrscheinlich würden ihre Eltern sich dreimal bekreuzigen und zehn Rosenkränze für sie beten, sollten sie je erfahren, dass ihre Tochter eine Frau liebte.
Mit einem Ruck machte sie sich von diesem Gedanken los und schritt durch einen kleinen Torbogen und dem Bach entlang, der Richtung Stadt floss. Sie sah zur Einsiedlerklause hinüber, wo eine Ordensfrau im Habit der Kapuzinerinnen auf einer Bank vor dem Häuschen sass und betete. Casagrande kannte Schwester Johanna, die seit zwei Jahren die Position der Einsiedlerin innehatte, nur von den Bildern in den Medien. Sie vermutete, dass sie für das Seelenheil des armen Geschöpfes betete, das an diesem heiligen Ort dem Tod begegnet war.
Bevor der Verenaweg sich in südlicher Richtung durch die Schlucht schlängelte, führte er an einer Felsnische vorbei, in der sich gerade profanere Dinge abspielten. Der Zugang zur Nische sowie eine in den Fels gehauene Fensteröffnung waren mit einer weissen Zeltplane abgedeckt. Ein Kriminaltechniker machte Fotos. Ein anderer in weissem Schutzanzug beugte sich über einen leblosen Körper. Da sie keine Schutzkleidung trug, sah Casagrande aus der Distanz zu, bis jemand ihr von hinten auf die Schulter klopfte.
«Dein Anzug, Angela», sagte Maja Hartmann und reichte ihr einen säuberlich gefalteten weissen Plastik-Overall. «Hallo übrigens.» Der Anflug eines Lächelns huschte über ihr kantiges, mit Sommersprossen übersätes Gesicht.
«Hallo, Maja. Was habt ihr?» Casagrande band ihr dichtes, schulterlanges dunkelbraunes Haar mit einem Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammen, bevor sie den Overall überstreifte.
«Weibliche Leiche, circa Anfang bis Mitte sechzig, keine äusserlichen Anzeichen von Gewalteinwirkung ausser einem frischen Einstich am Hals, Injektion mit einer grossen Spritze. So weit lässt sich der Amtsarzt auf die Äste hinaus.» Sie zeigte auf die weisse Gestalt, die sich über die tote Frau beugte. «Er will, dass sich die Rechtsmedizin die Tote ansieht.»
«Kennt ihr den Namen?»
Maja schüttelte den Kopf, sodass ihr brauner kurzer Zopf links und rechts um den Nacken schlug.
«Sie hatte keine Papiere, kein Handy oder so was bei sich. Wir suchen noch.»
«Wer hat sie gefunden?»
Maja nickte mit dem Kopf zur Klause. «Die Einsiedlerin hat sie entdeckt und uns sofort alarmiert.»
«Todesursache?»
«Das musst du den Doc fragen, da kommt er schon.»
Casagrande drehte sich um, als Amtsarzt Dr.Schmetzer aus der Nische trat und auf sie zukam. Im Gehen streifte er die Handschuhe und die Kapuze seines Anzuges ab und zog den Reissverschluss bis auf Nabelhöhe seines beträchtlichen Bauches herunter.
«Es ist immer wieder schön, Ihnen zu begegnen, Frau Casagrande», sagte er und gab Casagrande die Hand. «Schade nur, dass es stets unter solch traurigen Umständen passiert.»
«Ganz meinerseits, Dr.Schmetzer», erwiderte Casagrande kurz angebunden. «Kann ich die Tote sehen?»
«Bitte sehr.» Er liess sie vor sich in die Nische treten. Casagrande wusste nicht so recht, was sie erwartete, und war erleichtert, ein Bild des Friedens vorzufinden. Auf einer in den Felsen gehauenen, schmalen Sitzfläche lag eine mittelgrosse Frau mit Brille. Sie war zierlich und fand auf der felsigen Unterlage Platz. Augen und Mund waren geschlossen. Es sah aus, als ob sie schliefe. Das graue Haar lag offen über ihrer Brust. Ihre Hände waren auf dem Bauch gefaltet. Hätte sie nicht an diesem Ort gelegen, Casagrande hätte daran gezweifelt, dass es sich um einen aussergewöhnlichen Todesfall handelte. «Die Einsiedlerin hat die Tote so aufgefunden?», vergewisserte sie sich.
«Schwester Johanna schwört, dass sie die Tote weder berührt noch sonst wie verändert hat», bestätigte Maja. «Ich weiss, was du meinst. Sie sieht aus, als ob sie schläft, nicht wahr?»
«Können Sie den Todeszeitpunkt schon in etwa eingrenzen?»
«Die Totenstarre hat sich noch nicht vollständig über den ganzen Körper ausgebreitet. Angesichts der herrschenden Nachttemperaturen würde ich davon ausgehen, dass sie gestern Nacht zwischen neun und Mitternacht gestorben ist.»
Casagrande ging vor der Toten in die Hocke und betrachtete ihr Gesicht. «Was ist das auf ihrer Stirn?»
«Das ist ein Kreuzzeichen. Vermutlich eine Mischung aus Öl und Asche. Als Italienerin müssten Sie das kennen, Frau Casagrande», sagte Dr.Schmetzer.
«Ich bin seit beinahe zwanzig Jahren Schweizerin, Herr Dr.Schmetzer. Und klar kenne ich den Brauch der Katholiken. Das Aschenkreuz wird am Aschermittwoch den Gläubigen auf die Stirn gezeichnet. Es ist die Asche der verbrannten Palmzweige vom Palmsonntag des Vorjahres. Damit sollen die gläubigen Sünder nach den Ausschweifungen der Fasnacht an ihre Vergänglichkeit erinnert werden und Busse tun. Aus Asche geboren, werden sie im Sterben wieder zu Asche.»
«Amen», sagte Dr.Schmetzer.
«Heute ist Mittwoch. Gestern war dagegen nicht Fasnachtsdienstag.»
Dr.Schmetzer hob beide Schultern und breitete die Hände aus.
«Mich müssen Sie nicht fragen. Ich bin Protestant und mit den Gepflogenheiten der römisch-katholischen Kirche nicht vertraut. Womöglich hatte sie einen besonderen Anlass.»
«Oder die Täterschaft hat das Kreuzzeichen auf ihre Stirn gemalt», sinnierte Maja.
«Auch möglich», sagte Dr.Schmetzer. «Die Kriminaltechnik hat Proben genommen und untersucht sie auf mögliche DNS.»