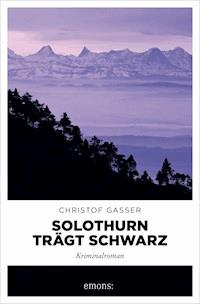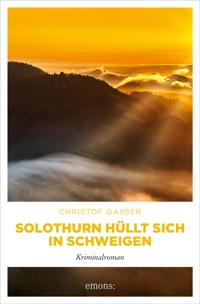Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Zwei Frauen, zwei Epochen – eine Hoffnung. Swiss Noir von Bestsellerautor Christof Gasser. Auf einem herrschaftlichen Schweizer Familiensitz fördern Renovierungsarbeiten den Leichnam einer jungen Frau zutage, die in den 1940er Jahren erschossen wurde. Offiziell ist der Fall verjährt. Doch der aus Deutschland stammenden Becky Kolberg, der das Schloss inzwischen gehört, lässt das rätselhafte Schicksal der Toten keine Ruhe. Die junge Frau arbeitete in einer Waffenfabrik im Ort, die sich im Besitz der Nationalsozialisten befand. Becky stößt auf Tagebücher und Fotos des Opfers aus jener Zeit, als die Schweiz vom Faschismus umzingelt war. Fasziniert taucht sie in das fremde Leben ein – bis die Schatten der Vergangenheit auch nach ihr greifen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
©2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Debra Osborne-Pursglove/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-811-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr.Michael Wenzel (
GEWIDMET
DEN FRAUEN UNDMÄNNERN VONZUCHWIL,
Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
in keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
»Rütlischwur« aus »Wilhelm Tell« von Friedrich Schiller
PROLOG
Das eiskalte Wasser konnte ihr nichts anhaben. Sie schwebte im unendlichen Raum des Meeres über und unter ihr. Der Kampf war zu Ende. Sie wollte nicht mehr, ihre Abwehr, ihre Schlagkraft waren ermattet. Die Augen schließen und sich treiben lassen, bis alles dunkel wurde und sie schlafen konnte. Das war ihre Sehnsucht.
Die Berührung war sanft, warm in der eisigen Tiefe. Sie öffnete die Augen. Das bleiche Gesicht war schön, jung. Blonde Locken umspielten es. Ihre Augen leuchteten blau. Wer war sie? Eine vage Erinnerung aus einer alten Vergangenheit? Die Hand berührte ihre Schultern. Sie stieß ihren Körper nach oben, ins Leben. Sie leistete Widerstand, wollte nicht zurück. Das fremde Wesen lächelte verstehend. Seine Hand deutete zur Wasseroberfläche. Es musste weitergehen…
Die Kälte holte sie ins Bewusstsein zurück. Wo sie der Segelbaum am Kopf getroffen hatte, pochte dumpfer Schmerz. Sie hatte nicht schnell genug reagiert. Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war der runde Balken, der auf sie zuflog. Dann war es dunkel geworden. Sie schaute um sich. Wo war es geblieben, oder sie, die Frau, die ihr geholfen hatte?
Die aufgewühlte See gab keine Sicht frei. Sie spürte das dumpfe Grollen mehr, als es zu sehen. Die Welle türmte sich schier haushoch vor ihr auf, bevor sie über ihr zusammenschlug und sie in die Tiefe riss. Sie drohte erneut das Bewusstsein zu verlieren. Der Auftrieb der Schwimmweste hielt sie an der Oberfläche. Wann hatte sie die angezogen?
Sie hatte gar nicht auf das Boot gewollt. Sie hasste Segeln. Jan hatte sie genötigt. Wenn sie mit ihm reden wollte, musste sie ihn auf den Törn begleiten. Einen Tag und eine Nacht, bis der Sturm kam.
Jan.
Wo steckte er? Das Boot? Sie wusste nichts mehr. Der Schlag, die Tiefe, die Kälte, das Gesicht. Oder war alles nur eine Illusion gewesen?
»Jan!« Das Heulen des Sturmes saugte ihre Stimme auf. Jetzt erinnerte sie sich und begriff. Es war sinnlos.
Der Aufprall auf dem Wasser hatte den Rettungsblitz und das GPS in ihrer Weste ausgelöst.
Adrian.
Der Gedanke kam überfallartig. Sie durfte nicht hierbleiben. Seinetwegen musste sie leben.
Aus den Augenwinkeln nahm sie den Leuchtstrahl am Horizont wahr. Ihr Gedächtnis suchte nach der letzten Position, bevor die Katastrophe über sie hereinbrach– nördlich von Putgarten. Das Leuchtfeuer von Kap Arkona.
Sie würde überleben.
Adrian.
BECKYJULI 2006
1
»Sind das die Alpen, Mama?«
Becky schreckte hoch. Sie musste kurz nach der Abfahrt des Zuges in Olten eingenickt sein. Sie standen erneut, eine andere Station. Sie konnte kein Ortsschild erkennen. Sie sah einen bewaldeten Bergrücken, unterbrochen durch einen tiefen Einschnitt. Auf halber Höhe, an der rechten Flanke, lag eine gut erhaltene Burg mit einem riesigen aufgemalten rot-weißen Wappen am Turm. Sie kannte es von den Schilderungen ihrer Großmutter, es war das Kantonswappen von Solothurn. Sie würden bald dort sein, in ihrem zukünftigen Zuhause und Ausgangspunkt ihres neuen Lebens.
Der Zug fuhr erneut an. Die Anzeige über der Ausgangstür bestätigte es. »Nächster Halt: Solothurn«.
»Mama?«
Adrians wache hellblaue Augen sahen sie fragend an. Becky schluckte leer. Wie ähnlich er seinem Vater war. Der gleiche durchdringende Blick. Was für ein Mann würde in einigen Jahren aus ihm werden? Wie viel von sich hatte Jan seinem Sohn mitgegeben?
»Mama?« Ungeduldig, vorwurfsvoll.
»Entschuldige, mein Schatz, was sagtest du?«
»Sind das die Alpen?« Adrian zeigte zum Bergrücken, von dem sich der Zug in einer lang gestreckten Linkskurve abwandte, bevor er eine bewaldete Talenge durchquerte.
Becky lachte. »Aber nein, die Alpen sind viel höher. Erinnerst du dich nicht mehr? Wir haben nachgeschaut.«
Letzte Woche in Neustadt in Holstein hatten sie einen ganzen Abend auf der Terrasse des Hauses gesessen, das sie gegen ihre neue Heimat eingetauscht hatten, und über einem großen Atlas und Bildbänden gebrütet. Für Becky war die Schweiz ebenso neu wie für ihren Sohn. Vor allem dieser Ort, Solothurn. Sie hatte nie einen Fuß in diese Stadt gesetzt. Ihre Wurzeln lagen dort. Das war das Einzige, was sie davon wusste. Ihre Großmutter, Barbara Felicitas von Colberg, geborene von Aaregg, war Nachfahrin einer der wenigen Familien gewesen, die bis zur französischen Besetzung 1798 die Stadt und die dazugehörenden Gebiete regiert hatten.
Becky stand auf und stellte sich hinter Adrian ans Fenster. Sie beugte sich zu ihm hinunter und umfasste ihn mit beiden Armen.
Sie zeigte mit dem Finger an seinem Gesicht vorbei auf die sich entfernende Bergkette. Sie war kurz aus ihrem Blickfeld verschwunden und wieder aufgetaucht, nachdem die Bahn einen Fluss überquert hatte, von dem sie glaubte, dass es die Aare sein musste, deren Name mit dem ihrer Familie verbunden war.
»Das sind nicht die Alpen, mein Schatz. Dort siehst du bloß Felsen, Eis, Schnee und spitze Gipfel. Das da drüben nennt sich der Jura, an dessen Fuß dein neues Zuhause liegt. Ich hab’s dir im Atlas gezeigt.«
Adrian machte sich von seiner Mutter los. »Wann sind wir endlich dort?«
»In ein paar Minuten, denke ich.« Becky zog die Reisetasche und Adrians Rucksack aus der Nische zwischen den Sitzlehnen hervor. Es befanden sich nur wenige Leute im Zug. Sie hatten ein ganzes Viererabteil für sich. Becky schaute auf ihre Uhr, kurz vor halb fünf. Sie hatten eine lange Reise hinter sich. Um sechs Uhr morgens waren sie in die Regionalbahn nach Lübeck gestiegen. Von dort ging es nach Hamburg und weiter über Hannover und Frankfurt bis Basel. Der Flieger wäre schneller gewesen. Becky hasste Luftreisen ebenso wie Schiffsreisen.
Die Lautsprecheransage kündigte Solothurn an. »Hast du alles, Adi?« Becky schubste ihren Sohn sanft auf seinen Sitz am Fenster. »Bleib da, bis der Zug steht.«
»Da drüben, ein Schloss. Ist das unser neues Zuhause?«, rief Adrian aufgeregt. Sie hatten gerade einen weiteren, kleineren Fluss überquert und fuhren über eine Ebene mit Feldern.
In der Richtung von Adrians Finger lag ein herrschaftliches Gebäude mit zwei Türmen neben einem weitläufigen Bauernhof. Becky wurde schwindlig. Sie setzte sich hin und schloss kurz die Augen. Ihre Ohren summten. Die Stimme war in ihrem Kopf, diejenige einer Frau. Sie verfolgte sie seit Wochen in ihren Träumen. Becky schluckte den Speichel hinunter, der sich in ihrer Mundhöhle gebildet hatte. Eine junge Frau, das Gesicht umrahmt von hellblonden Locken. Sie stand dort draußen auf einem Feld und winkte ihr zu, der Bauernhof, das Schloss, es war–
»Mama, geht’s dir gut?«
Sie öffnete die Augen. Adrians besorgte Miene rührte sie. Sie schaute aus dem Fenster. Die Frau war weg.
»Ja klar. Lange Reise. Gut, dass wir da sind.« Ihre Tabletten. Die letzte hatte sie in Frankfurt genommen. Es wurde Zeit für die nächste.
Adrian sah sie stirnrunzelnd an. Sie wusste, was er dachte. Das Schloss verschwand aus ihrem Blickfeld. Becky kannte es aus ihren Träumen.
Die Besiedlung wurde dichter, der Zug verlangsamte seine Fahrt.
»Wir sind da«, sagte Becky.
Das erwartete Gefühl der Erleichterung stellte sich nicht ein.
Der Mann mit dem Schild »Frau Rebecca Colberg und Sohn« wartete auf dem belebten Bahnhofplatz.
»Frau Colberg?«, fragte er.
»Herr Hürlimann?« Becky reichte ihm die Hand und stellte Adrian vor. Sie zeigte auf das Schild und sagte: »Mit›K‹.«
»Bitte? Ich verstehe nicht.« Sein Hochdeutsch hatte einen schweren Akzent.
»Mein Name, Kolberg, schreibt sich mit›K‹.«
Herr Hürlimann starrte auf sein Schild, als würde er es zum ersten Mal sehen. »Ach so, entschuldigen Sie, Frau Serafini sagte mir, dass Ihre Familie sich mit–«
»Schon gut, das stimmt auch. Die offizielle Schreibweise ist mit›C‹. Ich habe meinen Familiennamen ändern lassen, damit er weniger adelig klingt.«
»Verstehe«, sagte Herr Hürlimann. Seine Haltung verriet, dass das nicht der Fall war. Er deutete auf in Zweierreihe stehende Autos. »Ich wurde zugeparkt, wird sicher nicht lange dauern.«
Fünf Minuten später standen sie im Stau vor einer Baustelle auf der Brücke über die Aare. Becky sah die Solothurner Altstadt zum ersten Mal. Sie wurde überragt von einer im Julitag strahlend weißen Kirche im neoklassizistischen Stil, sofern Beckys baugeschichtliche Kenntnisse sie nicht täuschten. »Ist das die St.-Ursen-Kathedrale?«
»Das ist sie«, sagte Herr Hürlimann. »Sie sind zum ersten Mal in Solothurn?«
»Ja, es ist die Heimatstadt meiner Großmutter. Ich war erst zweimal in der Schweiz, einmal als kleines Mädchen mit meinen Eltern im Tessin und später ein paar Tage bei Freunden der Familie in Luzern. Sonst habe ich nichts vom Land gesehen.«
Hürlimanns Gesichtsausdruck verriet die Frage, die ihm auf den Lippen brannte.
»Ich brauche einen Tapetenwechsel– aus familiären Gründen.«
»Verstehe.« Herr Hürlimann zeigte auf die Autoschlange vor ihnen. »Sie müssen das Chaos entschuldigen. Die Rötibrücke wird seit einem Jahr erneuert, noch bis zum nächsten Jahr, dann sollten wir eine funkelnagelneue Brücke bekommen. Bis in zwei Jahren wird die Westumfahrung fertiggestellt sein, welche die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten soll.«
Becky ließ sich von Herrn Hürlimanns Geplapper berieseln, gedankenverloren schaute sie auf den Fluss hinab, wo sich Menschen in Schlauchbooten und großen Schwimmringen bis zum Anleger kurz vor der Brücke am nördlichen Ufer treiben ließen. Sie waren auch Adrian nicht entgangen.
»Hast du gesehen, Mama? Im Fluss kann man schwimmen. Gehen wir nachher gleich hin?«
Der Gedanke, auf einem Schlauchboot, geschweige denn mit einem Schwimmring im Wasser zu treiben, löste bei Becky Angstschweiß aus. »Mal sehen, lass uns erst ankommen.« Sie hoffte auf einen Wetterumschlag und nasskalte Witterung für den Rest des Sommers.
Einer schmalen, verwinkelten Straße durch ein Villenquartier entlang gelangten sie an ihr Ziel. Es schien, als trotzte der Ort dem Sommertag. Ein von zwei Wohntürmen flankiertes Wohnhaus aus dem 17.Jahrhundert war von hohen Bäumen umgeben, die Gebäude und Grundstück in Schatten tauchten, den die Sommersonne kaum zu durchdringen vermochte. Die düstere Lethargie über dem Anwesen legte sich auf Beckys Gemüt.
»Es ist etwas schattig, nicht wahr?«, sagte Herr Hürlimann. »Wie ich bereits am Telefon erwähnte, hier steckt eine Menge Arbeit drin.«
Als Erstes werden die Bäume gefällt.
»Ganz bestimmt«, sagte Becky.
»Ich habe die Pläne bei mir. Wenn Sie möchten, können wir sie uns gleich ansehen.«
»Machen wir das morgen.« Becky schaute auf ihren Sohn, der auf den letzten Metern zum Ziel im Auto eingeschlafen war.
»Kein Problem. Aber Sie müssen wissen, morgen früh kommen die ersten Handwerker.«
»Schon?« Becky hatte gehofft, sich ein paar Tage in Ruhe einzugewöhnen.
»Sie fangen im Keller an. Sie werden sie praktisch nicht zu Gesicht bekommen. Frau Serafini kümmert sich um alles.«
Auf das Stichwort öffnete sich die massive Haustür. Eine etwa fünfzigjährige Frau von drahtigem Äußeren trat heraus. Sie steuerte direkt auf Becky zu und reichte ihr die Hand. »Giuseppa Serafini, willkommen in Solothurn, Frau Colberg. Ich freue mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen.« Herrn Hürlimanns Präsenz quittierte sie mit einem knappen Kopfnicken.
»Sie schreibt sich übrigens mit›K‹«, bemerkte dieser, was die Haushälterin veranlasste, irritiert innezuhalten.
Becky klärte den Sachverhalt. »Mein Sohn und ich möchten uns ein wenig frisch machen. Ist es in Ordnung, wenn wir uns die Pläne für den Umbau später anschauen, Herr Hürlimann?«
Es war ihm recht, und er verabschiedete sich.
Frau Serafini nahm Beckys Tasche. »Sind Sie allein angereist, Frau Kolberg? Wollten Sie nicht mit Ihrem Sohn kommen?«
Übermannt von den ersten Eindrücken und von der Begrüßung, hatte Becky für einen Moment nicht auf Adrian geachtet. Dieser hatte die Gelegenheit ergriffen, sich abzusetzen. »Vielleicht ist er ins Haus gegangen.«
»Das hätte ich gesehen.« Frau Serafini zeigte zum Ende des Vorplatzes. »Wahrscheinlich ist er auf dem Nachbargrundstück.«
Sie gingen auf das Baum- und Strauchwerk zu, welches ihr Grundstück begrenzte. Frau Serafini erklärte, dass die benachbarte Parzelle ursprünglich zum Schloss Aaregg gehört hatte. »Bevor Ihr Großvater die Schweiz verließ, verkaufte er das Land Ihrem Nachbarn, einem Industriellen, der damit verhindern wollte, dass ihm vor die Nase gebaut wurde. Deshalb mag Ihnen der Umschwung des Schlosses etwas eingeengt vorkommen. Sobald die Fassade renoviert und der Baumbestand ausgedünnt ist, sieht es hier anders aus.«
Beckys Gedanken waren woanders. Sie war wütend auf Adrian. Er wusste genau, dass er sie auf die Palme brachte, wenn er sich ohne ein Wort aus dem Staub machte. Bevor sie richtig böse auf ihn werden konnte, tauchte er hinter einem Gebüsch auf. »Sucht ihr mich?«
Becky zählte langsam bis fünf, bevor sie antwortete: »Wo warst du? Du sollst nicht weggehen, ohne was zu sagen. Das weißt du genau.«
»Gleich da drüben. Ich habe mit dem Mädchen gesprochen.«
»Welches Mädchen? Ich habe keins gesehen«, sagte Becky.
»Sie stand die ganze Zeit dort und hat zu uns rübergeschaut, als ihr geredet habt. Ich bin zu ihr hin.«
Becky ärgerte sich. Das düstere Anwesen hatte sie dermaßen eingenommen, dass sie vergessen hatte, ihre Umgebung wahrzunehmen. »Worüber habt ihr beide gesprochen?«
»Weiß nicht.«
»Wie, du weißt nicht?«
»Sie spricht kein Deutsch, nicht so wie wir. Sie ist noch klein, vielleicht sieben oder acht.«
»Wie alt bist du? Zehn? Großer Unterschied.«
»Ich spreche Deutsch.«
»Wie hat sie denn geredet?«
»Keine Ahnung, Französisch oder so, glaub ich.«
»Französisch?«
»Ihr Sohn hat die kleine Pia getroffen«, sagte Frau Serafini. »Das ist die Tochter unseres Nachbarn. Sie ist acht Jahre alt und erst vor Kurzem nach Solothurn zu ihrem Vater gezogen. Die Mutter ist Welsche, ich meine, sie stammt aus dem französischsprachigen Wallis. Die Kleine ist schüchtern, dafür aber neugierig und sehr nett.«
»Trotzdem«, sagte Becky zu Adrian. »Sag etwas, wenn du weggehst. Ich will nicht, dass du dich verirrst. Für mich ist das alles hier auch neu.«
»Ja, Mama«, sagte Adrian gedehnt, wie immer, wenn er fand, dass seine Mutter ihn behandelte wie ein kleines Kind.
»Sollen wir erst mal reingehen?«, fragte Frau Serafini. »Ihre Zimmer sind bereit, Sie können sich frisch machen. In der Zwischenzeit mache Ihnen gern etwas zu essen.«
***
Die Stimme riss Becky aus dem Schlaf. Sie hatte geträumt, wieder von der Ostsee. Ihr Handy zeigte ein Uhr fünfzig an. Vier Stunden zuvor war sie zu Bett gegangen, nachdem sie eine Tablette zusammen mit einem Schlafmittel genommen hatte. Wessen Stimme war das gewesen? Becky war sich sicher, ihren Namen gehört zu haben. Sie machte die Nachttischlampe an. Das dämmrige Licht erhellte das holzgetäfelte Zimmer kaum. Die uralten, frisch gebohnerten Holzdielen knarrten unter ihren Füßen. In Neustadt war das Geräusch heimelig. In der neuen Umgebung klang es bedrohlich, als verfolgten sie die Schatten der Vergangenheit auf Schritt und Tritt.
Becky fegte die Gedanken beiseite. Was in Neustadt passiert war, sollte in Neustadt bleiben. Sie wollte ein Leben in einer neuen Umgebung, ohne das starre Gewicht der Familie, ohne die Ostsee, ohne Jan. Sie hatte sich vorgenommen, es zu schaffen, die Schuldgefühle zu überwinden. Sie musste es, um Adrians willen.
Die Verbindungstür zu Adrians Zimmer war einen Spalt offen. Er hasste es, bei geschlossener Türe zu schlafen. Licht musste nicht brennen. Adrian hatte keine Angst vor der Dunkelheit, er fürchtete sich vor geschlossenen Türen. War er vorhin in ihr Zimmer gekommen und hatte ihr etwas zugeflüstert? Warum sollte er so was tun?
Becky betrat Adrians Zimmer. Es war etwas kleiner, jedoch gleich ausgestattet. Frau Serafini hatte von dem ihr für die ersten Vorbereitungen zur Verfügung stehenden Budget die Betten renovieren und mit Springboxmatratzen ausstatten lassen.
Die Silhouette ihres Sohnes war unter der leichten Bettdecke erkennbar. Adrian atmete regelmäßig, er schlief tief. Er konnte sie nicht geweckt haben. Sie hatte es geträumt.
Becky setzte sich vorsichtig auf die Bettkante. Adrian lag in Embryostellung da. Obwohl es im Zimmer nicht kühl war, hatte er sich bis zur Nasenspitze zugedeckt, ein Büschel seiner braunen Haare lugte unter dem oberen Rand hervor. Eine Welle der Zärtlichkeit überkam Becky. Wäre es nicht für Adrian gewesen, läge ihre Leiche seit letztem Herbst in einem kalten Grab in den Wassermassen der Ostsee. Außer ihm gab es nichts, wofür es sich für sie zu leben lohnte. In jener Nacht hatte sie ihr komfortables und eintöniges Leben verloren, ihren Mann, einst ihre große Liebe. Adrian war sein Geschenk an sie gewesen.
Becky strich sanft über das Haarbüschel außerhalb der Bettdecke. Adrian drehte sich seufzend im Schlaf auf die andere Seite. Eine wohlige Schwere breitete sich in ihrem Körper aus. Sie schlich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer.
Kaum hatte sie die Verbindungstür hinter sich zugezogen, fiel im Haus eine Tür ins Schloss. Schritte ertönten, sie kamen vom Stockwerk über ihr. Beckys Nackenhaare sträubten sich.
Außer uns ist niemand hier.
Frau Serafini hatte gesagt, das dritte Geschoss sei geräumt. Man wollte dort mit der Renovierung fortfahren, sobald sie im Keller abgeschlossen war, es umbauen in ein Appartement für Becky und Adrian. Frau Serafini wohnte nicht im Schloss. Sie lebte mit ihrem Mann in einer Mietwohnung an der Waisenhausstraße, eine knappe Viertelstunde zu Fuß entfernt.
Becky suchte in ihrer Reisetasche nach der Taschenlampe, die sie vor Jahren dort eingepackt hatte, für den Fall der Fälle. Sie hatte sie kaum benutzt, die Batterien nie gewechselt. Der Lichtstrahl war dürftig, aber ausreichend. Becky ging hinaus auf den Korridor.
Die Freitreppe lag rechts von ihr. Sie fand den Lichtschalter. Ein paar altertümliche Lüster erleuchteten den Korridor. Becky atmete auf. Ein weiterer Schalter an der Wand gegenüber machte Licht sowohl auf der Freitreppe als auch im ersten und zweiten Geschoss, nicht im dritten. Becky leuchtete den Weg so gut aus, wie es die schwächelnde Taschenlampe zuließ. Sie nahm sich vor, am nächsten Tag Batterien oder am besten gleich eine neue Taschenlampe zu besorgen.
Wenn es sein muss, ziehe ich mit Adrian ins Hotel, bis alles fertig ist.
Das hätte sie von Anfang an tun sollen, doch Becky war eine von Colberg, Synonym für Sturheit, was ihr ihre Mutter immer wieder vorgehalten hatte.
Die Dunkelheit im dritten Geschoss hing wie eine schwarze Wolke über ihr.
Mit etwas Glück finde ich oben einen funktionierenden Lichtschalter.
Sie hörte die Schritte erneut, diesmal kamen die Geräusche von unten. Becky war erleichtert. Sie konnte sich den Gang in die Finsternis sparen.
»Ist da jemand?«, rief sie auf halbem Weg auf der Treppe nach unten. Was würde sie tun, wenn jemand antwortete? Die einzige Antwort auf ihren Ruf war eine erneut zuschlagende Tür. Am Morgen sollte die Renovierung des Kellergeschosses beginnen. Möglicherweise hatte jemand eine Tür offen gelassen. Draußen wehte ein schwacher Wind, Vorbote eines nahenden Gewitters. Ein Durchzug konnte die Ursache des Türschlagens sein.
Das Licht im Keller funktionierte, zumindest in den vorderen Räumen. Ein Gefühl der Trostlosigkeit machte sich in Becky breit, während sie durch den kahlen, mit Baulampen beleuchteten Gang ging. Die Räume links und rechts von ihr waren leer. Was hatte sich darin befunden, und wo wurde es gelagert? Vermutlich wusste Frau Serafini das.
Der hintere Teil des Kellers lag im Dunkeln, Becky nahm die Taschenlampe zu Hilfe. Je tiefer sie in die Dunkelheit vordrang, desto bedrückender legte sich die Atmosphäre auf ihr Gemüt. Auch hier waren die Türrahmen gähnende Löcher. Im Kellergeschoss gab es keine einzige Tür mehr. Was hatte Becky gehört? Hatte sie sich die zuschlagenden Türen eingebildet wie die Stimme vorhin?
Am Ende des Korridors lagen drei Räume eng aneinandergereiht.
Fast so wie Gefängniszellen.
Ihre Ohren summten.
»Rebecca.« Die Stimme kam von hinten. Becky fuhr herum. Der Schein ihrer Taschenlampe wanderte über den kahlen Korridor bis zum Lichtkegel der ersten Bauleuchte. »Rebecca.« Wieder hinter ihr und wieder nichts außer der gähnenden Leere der drei Zellen, deren mit grünschwarzem Schimmel bedeckte Mauern das schwindende Licht ihrer Taschenlampe reflektierten.
Beckys Atem wurde schwer. Der Korridor begann sich um sie zu drehen. Ihre Beine knickten ein. Sie rutschte an der Wand entlang zu Boden. Ein Wechselspiel von Licht und Schatten formte sich zu Bildern, die sie sich nicht erklären konnte. Die blonde Frau mit ihren kornblumenblauen Augen lächelte sie an. Außer in ihren Träumen und als sie ins Meer gefallen war, hatte Becky sie nie gesehen.
Ich werde verrückt. Was wird dann aus Adrian?
Mit einem Mal veränderte das Bild der Frau seinen Ausdruck. Das Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse tiefster Todesangst. Der Summton in Beckys Ohren wurde zu einem schrillen Pfeifen.
»Aufhören!«, schrie Becky. Sie krümmte sich auf dem Boden zusammen. »Aufhören!«
2
Auf wackligen Füßen stieg Becky die Treppe hinab. Aus dem kleinen, an die Küche angrenzenden Speiseraum ertönte das Klappern von Geschirr. Adrians Bett war leer gewesen. Hatte er schon gefrühstückt?
Die Kopfschmerzen, die sie beim Erwachen verspürt hatte, flachten ab. Sie versuchte sich zu erinnern, was in der letzten Nacht geschehen war. Verdächtige Geräusche hatten sie in den Keller gelockt, ab dann war alles blank, bis sie vor ein paar Minuten in ihrem Bett aufgewacht war, ohne zu wissen, wie sie zurück in ihr Zimmer gekommen war. Konnte es sein, dass sie wahnsinnig wurde? Der Gedanke drehte ihr den Magen um. Schwindelgefühl stieg in ihr auf.
Bloß nicht umkippen.
Sie hielt sich mit beiden Händen krampfhaft am Treppengeländer fest.
»Frau Kolberg, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Frau Serafini stand am Fuß der Treppe.
»Guten Morgen, Frau Serafini.« Becky gab sich Mühe, unverfänglich zu klingen. »Alles in Ordnung. Ich habe schlecht geschlafen. Ein starker Kaffee, und ich bin wieder voll da.« Becky ließ das Treppengeländer los und versuchte, die letzten Stufen leichtfüßig zu nehmen.
»Ich habe im kleinen Esszimmer für das Frühstück gedeckt. Ich hoffe, das ist Ihnen recht.«
Wie viele Speiseräume gibt es in diesem Haus?
»Das ist schön, danke, aber von mir aus können wir künftig in der Küche essen. Die ist sicher groß genug.«
»Warten Sie, bis Sie den kleinen Essraum sehen.«
Sobald Becky ihn betrat, wurde sie vom Sonnenlicht geblendet, das durch die hohen Fenster hereindrang. Es wurde von der Täfelung und der mit Schnitzereien verzierten Decke gedämpft. In einem Wandschrank mit ziseliertem Rahmen und Glastüren war Porzellangeschirr ausgestellt. Einige Teller waren hochgestellt, damit ihre Bemalung zur Geltung kam.
Frau Serafini war Beckys bewundernder Blick nicht entgangen. »Meißener Porzellan. Ihre Frau Großmutter hat von ihrem Gemahl ein Set zur Hochzeit erhalten. Die anderen Stücke hatte sie später dazugekauft. Ihr Großvater ließ es zurück, als er 1943 nach Deutschland zurückging.«
»Ein weiser Entscheid. Das wertvolle Geschirr hätte das Kriegsende dort nicht unbeschadet überstanden.«
Becky trat durch die französische Tür in den Garten hinaus. Der Rasen mit den sprießenden Kornblumen verdiente eher die Bezeichnung Wiese. Die Rosensträucher, an denen sich Schwärme von Insekten gütlich taten, waren am Verblühen, als wollten sie der reichen Pracht der wilden Blumen weichen, die ihnen die Schau stahl.
»Entschuldigen Sie den Zustand des Gartens. Er muss neu angelegt und bepflanzt werden. Wir wollten damit warten, bis Sie hier sind«, sagte Frau Serafini.
Becky nahm dankend die Tasse Kaffee entgegen. »Das eilt nicht, ich finde ihn schön, wie er ist.«
Becky setzte sich an den gedeckten Tisch im Essraum. Wegen des Gewitters in der Nacht war es am Morgen früh kühl gewesen.
»Wenn Sie möchten, können Sie draußen frühstücken. Inzwischen ist die Temperatur angenehm.«
»Das wäre nett.« Becky sah nur ein Gedeck auf dem Tisch. »Wo ist mein Sohn? Hat er schon gefrühstückt?«
»Vor einer halben Stunde. Dann ist er nach drüben gegangen.«
»Nach drüben?«
»Zum Nachbargrundstück. Ich nehme an, er wollte seine neue Freundin treffen.«
»Sie meinen diese Pia?«
»Es sind Schulferien. Die Kleine fühlt sich wohl etwas einsam. Sie hat noch nicht viele Freunde. Adrian ist für sie ein willkommener Spielkamerad.«
»Da passen sie zusammen. Mein Sohn hat auch keine Freunde hier.«
Das muss ein besonderes Mädel sein.
Normalerweise konnte Adrian nichts mit Mädchen anfangen, erst recht nicht mit solchen, die jünger waren als er.
Becky leerte ihre Tasse. Sie nahm sich ein Croissant und einen Apfel. »Ich gehe mir die Beine vertreten. Wann, haben Sie gesagt, kommen die Handwerker?«
Frau Serafini schaute auf ihre Uhr. »Sie müssten in einer halben Stunde hier sein.«
»Bis dahin bin ich zurück.– Sagen Sie, kann es sein, dass wir letzte Nacht nicht allein im Haus waren, mein Sohn und ich?«
Frau Serafini sah sie verblüfft an. »Unmöglich, außer Ihnen war niemand da. Warum fragen Sie?«
»Ich bin aufgewacht, weil ich glaubte, Geräusche gehört zu haben. Dann vernahm ich Stimmen im Treppenhaus. Ich habe nachgesehen, aber da war nichts.« Becky vermied die Erwähnung des Schwächeanfalls im Keller.
»In der Nacht war es windig«, sagte Frau Serafini. »Vielleicht wurde eine Tür vom Durchzug zugeschlagen.«
Im Keller gibt es keine Türen mehr.
Möglicherweise hatte sich Becky getäuscht, und die Tür hatte es im Erdgeschoss zugeknallt. »Das wird es gewesen sein.« Becky brannte die Frage auf der Zunge, was sich im Keller befunden hatte, bevor er leer geräumt worden war. Die hob sie sich für später auf. »Ich gehe dann mal. Wenn was ist, erreichen Sie mich auf dem Handy. Die Nummer haben Sie?«
»Habe ich. Sie können sich auf mich verlassen, Frau Kolberg.«
***
Heute kamen ihr die hohen Bäume auf dem Vorplatz des Schlosses weniger düster vor. Aber ihr Entschluss stand fest, sie mussten weichen, bis auf einen oder zwei vielleicht.
Mit einem mulmigen Gefühl im Magen betrat Becky das Nachbargrundstück. Das Gelände stieg leicht an. Zuoberst auf der Anhöhe thronte eine stattliche Villa. Sie war kleiner als Schloss Aaregg und später erbaut worden. Im Gegensatz zum Schloss war sie gut in Schuss. Das Ausmaß der Grundstücksfläche ließ Rückschlüsse zu, wie groß das Anwesen der von Aareggs in früheren Zeiten gewesen sein musste. Die Parzelle bot genug Platz für mindestens eine weitere Villa heutigen Zuschnitts. Der untere Teil des Gartens mit Buschwerk und wilden Pflanzen gefiel Becky. Vermutlich diente er einzig als Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Kleintiere.
Wo steckte Adrian? Hier war kein Mensch zu sehen. Becky schaute hinauf zum Haus. Sie kannte diese Leute nicht und wollte auf keinen Fall durch die Hintertür bei ihnen einfallen. In der Schweizer Öffentlichkeit war eine heftige Diskussion über die massive Einwanderung deutscher Staatsbürger im Gang. Seit Einführung der Personenfreizügigkeit und angesichts der schwächelnden deutschen Wirtschaft, welche viele von Beckys Landsleuten auf die Wiedervereinigung zurückführten, waren Deutsche zur größten Einwanderergruppe der Eidgenossenschaft angewachsen. Darüber waren nicht alle glücklich. Becky wollte nicht gleich bei ihrem Antrittsbesuch einen Eklat provozieren. Sie spielte mit dem Gedanken, umzudrehen und über die Straße zum Nachbarhaus zu gelangen.
Kinderlachen drang an ihr Ohr. Es war das eines Mädchens, nicht Adrians. Becky ging über eine besser gepflegte, mit schattigen Eichen und Linden bewachsene Grünfläche auf das Haus zu. Auf der Terrasse war ein Sonnenschirm aufgespannt. Hatte sich Adrian einladen lassen?
Es sähe ihm ähnlich, seinen angeborenen Charme zu versprühen.
Im Gegensatz zu ihr fiel es ihrem Sohn leichter, Menschen für sich zu gewinnen.
Wie sein Vater.
Für den war der Segen zum Fluch geworden. Becky wollte Adrian dieses Schicksal ersparen.
Zu ihrer Rechten war eine Grillstelle angelegt. Sie spähte erneut hinüber zur Terrasse. Sie konnte lediglich die Köpfe eines Mannes und einer Frau erkennen. Sie schienen Becky nicht bemerkt zu haben. Aber wo steckte Adrian? Sie setzte sich Richtung Terrasse in Bewegung. In diesem Moment lachte erneut ein Kind. Dieses Mal hörte Becky ihren Sohn heraus. Es kam von links, von einem kleinen Gewächshaus. Becky warf noch einmal einen Blick zur Villa. Die Frau und der Mann auf der Terrasse redeten miteinander. Sie näherte sich dem Gewächshaus, in dessen offener Tür Adrian mit dem Rücken zu ihr stand und den Anweisungen eines Mädchens folgte, das, obwohl es erst acht Jahre alt war, kaum einen halben Kopf kleiner war als er.
»Non, non, pas comme ça, Adrian. Du musst die Kanne gerade halten, so, tu vois?« Sie nahm ihm die kleine Gießkanne aus der Hand, die er offenbar falsch handhabte, und zeigte ihm, wie die frisch gepflanzten Setzlinge korrekt zu gießen waren.
»Aber ich habe sie richtig gehalten«, protestierte Adrian.
»Non, du musst es machen, wie isch es dir zeige.«
Becky betrat das Gewächshaus. »Hier bist du, Adi. Und du bist wohl Pia, die Nachbarstochter«, sagte sie zu dem Mädchen, das sie mit offenem Mund anstarrte. Unvermittelt fing die Kleine an zu kichern.
»Deine Mutter nennt disch Adi. Darf isch ausch?«
»Untersteh dich«, schnappte Adrian. »Mama, was machst du hier?«
»Nachschauen, was mein Sohn in fremden Gärten treibt, wo wir gerade mal eine Nacht hier verbracht haben.« Sie streckte dem Mädchen die Hand entgegen. »Hallo, ich bin Becky.«
»Enchantée, Madame. Isch bin noch nischt lange hier und spresche leider nicht gut Deutsch.«
»Dein Deutsch ist sehr gut«, antwortete Becky auf Französisch. Ihre Mutter hatte bei ihr darauf bestanden, die Sprache Molières zu erlernen, weil eine junge Dame ihres Ranges »der Sprache des Adels und der Diplomatie mächtig zu sein hatte«.
Pia gefiel es, in ihrer Muttersprache angeredet zu werden. »Ich zeige Adrian, wie man Blumen pflanzt.«
»So was kann man nicht früh genug lernen, n’est-ce pas, Adi?« Becky zwinkerte ihrem Sohn zu.
»Das ist nicht fair«, begehrte er auf. »Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr sagt.«
»Zeit für dich, Französisch zu lernen, mein Lieber.« Becky fuhr Adrian durch die Haare. »Hier ist es die zweitwichtigste Landessprache. Solothurn liegt nahe der Sprachgrenze.«
»Wer hier leben will, soll gefälligst Deutsch lernen«, brummte Adrian.
»Isch spresche Deutsch«, verteidigte sich Pia. »Ist nur nischt parfait.«
Becky gefiel das forsche, etwas mollige Mädchen mit den großen, fast schwarzen Augen, denen keine Kleinigkeit zu entgehen schien.
»Gehen wir«, drängte Adrian. Wie sein Vater verabscheute er Situationen, die er nicht hundertprozentig überblicken konnte. Die Mutter, die ihm in die Parade fuhr, passte ihm nicht in den Kram.
»Das nächste Mal, wenn du fortgehst, gibst du vorher Bescheid. Damit ersparst du dir die Peinlichkeit, von mir gesucht und gefunden zu werden.«
Adrian machte Anstalten zu protestieren. Becky ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Haben wir uns verstanden?«
Er brummte etwas.
»Wie bitte? Ich kann dich nicht hören.«
»Ist gut, Mama. Ja, ich hab’s begriffen.«
»Schön. Ich muss zurück ins Schloss. Die Handwerker kommen gleich.« Sie wandte sich an Pia, die der Diskussion zwischen Mutter und Sohn mit einem maliziösen Lächeln zugehört hatte. »Richtest du deinen Eltern einen schönen Gruß von mir aus? Ich komme sie später besuchen, um mich vorzustellen.«
»Nur mein Papa wohnt hier.«
»Ach so, ich habe zwei Leute auf der Terrasse gesehen und dachte, es sind deine Eltern.«
Die Miene der Kleinen wurde ernst. »Diese Frau ist nicht meine Mutter, nur eine Tante.«
»Eine Tante?«
»Ich habe viele Tanten. Alle paar Monate eine neue.«
Becky erinnerte sich an das Lied von Gilbert Bécaud, das sie bei einem Sprachaufenthalt in Frankreich gehört hatte. »Les Tantes Jeanne« erzählte die Geschichte eines Mannes, der seinen Nichten und Neffen, die bei ihm die Ferien verbrachten, seine häufig wechselnden Freundinnen jeweils als »Tante Jeanne« vorstellte. Im Gegensatz zu den Kindern im Lied, die von den »Tanten« verwöhnt wurden, schien sich Pia darüber nicht zu freuen. »Und deine Mutter?«
»Maman und Papa leben nicht zusammen.«
»Das tut mir leid, sind sie geschieden?«
»Was heißt geschieden?«
»Ich meine, sind sie nicht mehr zusammen?«
»Sie waren nie zusammen. Meine Mutter wohnt im Valais… Wallis. Sie muss viel arbeiten und hat keine Zeit für mich. Ich lebe lieber hier bei Papa. Er arbeitet auch viel, dafür kümmert sich Frau Reinhard um mich.«
Frau Reinhard musste das Kindermädchen oder die Haushälterin sein. Wer so wohnte, konnte sich das leisten. Was der Hausherr wohl arbeitete?
»Papy und Mamie wohnen auch hier«, sagte Pia.
Wenn Becky richtig verstand, meinte die Kleine damit ihre Großeltern. »Schön, ich komme bald bei euch vorbei und stelle mich vor.« Sie verabschiedete sich von den Kindern. »Habt Spaß, ihr beiden.«
Auf dem Rückweg schaute sie noch einmal zum Haus hinüber. Auf der Terrasse war keiner mehr. Becky wandte sich dem Weg zu und stieß mit einem Mann zusammen.
»Hoppla!« Der Mann hielt Becky an den Schultern fest, bevor sie hinfiel. »Geht’s?«
»Geht schon, danke«, sagte Becky. »Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen.«
»Ist ja noch mal gut gegangen.«
Verdammt charmant, dieses Lächeln.
Der Mann war mit Vorsicht zu genießen.
»Ich bin Dominik Dornach und wohne hier. Ich habe Sie vorhin beim Gewächshaus gesehen und wollte mich erkundigen, ob ich Ihnen behilflich sein kann.«
Seine einnehmende Art täuschte nicht über den forschenden Blick seiner grauen Augen hinweg. Becky kam sich vor wie ein Schulmädchen, das von seinem Lieblingslehrer beim unerlaubten Rauchen erwischt wurde.
»Das ist mir furchtbar unangenehm. Es tut mir leid, einfach so bei Ihnen einzudringen. Ich heiße Becky Kolberg. Mein Sohn und ich sind gestern nebenan eingezogen.«
»Im Schloss Aaregg? Dann sind Sie die Enkelin von Barbara von Aaregg.«
»Sie kannten meine Großmutter?«
»Natürlich nicht direkt. Mein Großvater kannte Ihre Großeltern. Er hat viel von ihnen erzählt. Sie mussten interessante Menschen gewesen sein.«
Becky wollte das Thema weder hier noch jetzt ansprechen. »Ich habe das Schloss von meinen Eltern geerbt, die letztes Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind.« Sie winkte ab, bevor Dornach etwas sagen konnte. »Wie dem auch sei, ich war auf der Suche nach meinem Sohn.«
»Der junge Mann, der es fertiggebracht hat, sich mit meiner Tochter anzufreunden? Mit ihm haben Sie einen soliden Jungen an Ihrer Seite, Frau Kolberg. Pia ist wählerisch, was ihren Umgang angeht. Sie hat noch nicht viele Freunde gefunden, seit sie bei mir wohnt.«
»Da scheinen sich zwei gefunden zu haben. Adi ist auch nicht jemand, der sich leichtfertig auf andere einlässt.«
»Ich hoffe, das ist ein gutes Omen für unsere künftige Nachbarschaft.« Dornach machte eine einladende Geste zur Terrasse. »Haben Sie Zeit für einen Kaffee?«
Becky wusste nicht, was sie an diesem Mann anzog, einmal abgesehen von seinem Aussehen, dem kurzen dunklen Haar mit dem Ansatz ergrauender Schläfen und dem attraktiven Dreitagebart.
Vorsicht, Becky. Auf Distanz bleiben.
»Nett von Ihnen, vielen Dank, leider habe ich eine Verabredung mit den Handwerkern. Außerdem haben Sie schon Besuch von Pias Tante.«
Er runzelte die Stirn. »Pias Tante?«
»Ja, das war doch die Frau, die mit Ihnen auf der Terrasse war.«
Dornach lachte. »Hat Pia tatsächlich Tante gesagt?«
»Stimmt das etwa nicht?«
»Das war eine… Freundin aus Basel. Sie übernachtete hier, weil es gestern spät wurde. Sie ist bereits auf dem Weg nach Hause.«
»Verstehe«, sagte Becky. »Trotzdem, ich sollte jetzt. Aber ich komme gern auf Ihr Angebot zurück.« Ihr Handy klingelte. Auf dem Display erschien der Name von Frau Serafini. »Entschuldigen Sie. Man wartet offenbar auf mich. Auf ein andermal?«
In diesem Moment klingelte sein Handy. »Die Pflicht ruft.« Er reichte ihr die Hand. »Auf ein andermal, ganz bestimmt.«
Becky nahm Frau Serafinis Anruf entgegen. Was sie hörte, trieb sie an, schneller zu gehen.
***
Die Handwerker standen auf dem Vorplatz des Schlosses, ein paar von ihnen waren leichenblass. Sie tranken Wasser, das Frau Serafini herumreichte. Eine uniformierte Polizistin stand vor einem Absperrband. Sie stellte sich Becky in den Weg. »Entschuldigen Sie, der Ort ist polizeilich gesperrt. Sie dürfen hier nicht–«
»Ich bin die Eigentümerin des Anwesens.«
»Können Sie sich ausweisen?«
Becky hatte beim Verlassen des Hauses nur ihr Handy dabeigehabt. »Tut mir leid, meine Papiere sind im Haus. Wenn Sie mich–«
»Frau Kolberg, gut sind Sie da.« Frau Serafini kam auf sie zu. »Das ist Frau Kolberg, die Eigentümerin.«
Die Polizistin ließ sie passieren.
»Was ist denn passiert?«, fragte Becky.
»Es ist furchtbar, wer hätte mit so etwas gerechnet? Das wird die Arbeiten um Tage, wenn nicht Wochen aufhalten.«
»Wovon um Himmels willen sprechen Sie?«
»Kommen Sie.« Frau Serafini steuerte auf die Kellertreppe zu. Der Anblick der nach unten führenden Stufen stoppte Becky auf der Stelle. Ihr Atem beschleunigte sich.
Frau Serafini war bereits drei Schritte voraus. Sie drehte sich um. »Frau Kolberg?«
Die Anrede löste die Klammer um Beckys Brust. Es war helllichter Tag, und sie war nicht allein. »Alles in Ordnung, ich war ein wenig außer Atem.«
»Wollen Sie sich nicht etwas ausruhen? Sie sehen mitgenommen aus.«
Becky winkte ab. »Alles gut, wirklich. Was wollten Sie mir zeigen?«
Sie stiegen die Treppe hinunter.
Wieder dieser verfluchte Korridor.
Becky atmete ein paarmal tief ein und aus. Wenigstens war das Licht besser als in der Nacht. Nur die türlosen Öffnungen starrten sie an wie leere Augenhöhlen. Beckys Augen schauten nur geradeaus. An der Stelle, wo sie in der Nacht zuvor zusammengebrochen war, stand ein uniformierter Beamter.
»Das ist Frau Kolberg«, sagte Frau Serafini.
Der Polizist begrüßte Becky mit Handschlag. »Sie sollten den Raum nicht betreten, aber Sie können es von der Türöffnung aus sehen.«
Becky zögerte, die drei Schritte zur bezeichneten Stelle zu machen. Die Türöffnung war mit einem gekreuzten polizeilichen Absperrband markiert. Becky spähte in den von mobilen Leuchten erhellten Raum. Es dauerte einige Sekunden, bevor sie begriff, was sie sah.
»Die Arbeiter wollten die Mauer niederreißen«, sagte der Polizist. »Dabei stellten sie fest, dass es eine Doppelwand war. Der Zwischenraum ist sehr schmal, weniger als ein halber Meter, genug für einen Menschen.«
Der mumifizierte Schädel mit den vereinzelten Strähnen heller Haare rief bei Becky die Bilder der letzten Nacht ins Gedächtnis zurück. Der Raum begann sich zusammen mit den sterblichen Überresten eines Menschen, die an der Wand hingen, zu drehen.
»Rebecca.« Die Stimme von gestern. Sie schluckte mehrmals leer. Der Schädel wurde von einem Gesicht überlagert, die junge blonde Frau.
»Rebecca.«
Becky presste die Hände auf die Ohren. Sie spürte noch, dass der Polizist sie auffing, bevor sie das Bewusstsein verlor.
»Sie kommt zu sich.« Frau Serafinis Stimme. Ein kühlender Umschlag auf der Stirn.
»Frau Kolberg?«
Ein Mann, die Stimme kannte sie, aber von wo? Sie öffnete die Augen. »Herr Dornach?« Becky versuchte, sich aufzurichten. Schwindel packte sie.
»Sachte.« Dornach drückte sie sanft zurück. Sie lag auf einem Sofa in einem Raum mit hohen Wänden mit Bücherregalen. Sie befanden sich in der Bibliothek.
»Was machen Sie hier?«, fragte Becky.
»Arbeiten.« Er nahm dem uniformierten Polizisten aus dem Keller ein Glas Wasser ab. »Danke, Röbi.« Er führte es an Beckys Mund.
Sie wehrte ab. »Ich kann das selbst. Helfen Sie mir hoch, bitte.« Sie trank das Glas in einem Zug leer. »Sind Sie bei der Polizei?«
»Ermittler, bei der Solothurner Kantonspolizei, Kriminalabteilung.« Er zuckte entschuldigend mit den Achseln. »Tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen so schnell wiedersehen. Es fehlte die Gelegenheit, mich richtig bei Ihnen vorzustellen. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.«
»Fragen Sie mich mal. Wo ist mein Sohn? Er darf das nicht sehen.«
»Bei mir zu Hause. Frau Reinhard, unsere Haushälterin, kümmert sich um ihn, bis wir hier fertig sind. Er kann ruhig bis zum Abend bleiben, ist vielleicht besser so. Bis dahin haben wir sicher zusammengepackt.«
»Wer ist das da unten im Keller?«
»Das wissen wir nicht.«
»Wer… ich meine, wie lange hing der Leichnam dort zwischen den Wänden?« Es waren unmögliche Fragen. Becky wusste nicht, was sie sonst sagen sollte.
Dornach blieb geduldig. »Schwer zu sagen, ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte oder länger. Der forensische Anthropologe des Instituts für Rechtsmedizin ist vor ein paar Minuten eingetroffen. Möglicherweise wissen wir bald mehr.«
Becky stand auf. »Ich will ihn noch einmal sehen.«
»Den Leichnam?«
»Ja.«
»Sind Sie sicher?«
»Keine Sorge, da ich weiß, was mich erwartet, klappe ich Ihnen kein zweites Mal zusammen.«
»Wenn Sie meinen. Folgen Sie mir.«
Beim zweiten Augenschein hatte es tatsächlich etwas von seinem Schrecken verloren.
Die Leiche war an zwei gekreuzte Balken gefesselt worden. Das Bild erinnerte an da Vincis vitruvianischen Menschen. Eine Person in einem weißen Schutzanzug untersuchte sie eingehend.
»Haben Sie schon etwas für uns, Dr.Derendinger?«, fragte Dornach. »Das ist der Spezialist vom IRM«, sagte er zu Becky.
Dr.Derendinger, ein Hüne Anfang sechzig, rückte seine Hornbrille zurecht. »Dornach, schön, Sie zu sehen. Der Verwesungsprozess ist dank der Einmauerung nicht so weit fortgeschritten, wie es üblicherweise der Fall sein müsste. Das Mauerwerk muss die Kellerfeuchtigkeit gefiltert haben. Anhand der Beckenstellung, Schädelgröße und Schädelform handelt es sich um eine weibliche Person.«
»Da sind Sie sich sicher?«
»Völlig sicher.« Dr.Derendinger händigte Dornach zwei Plastikbeutel aus. Einer enthielt ein silbernes Armband und der andere ein goldenes Kreuz an einem Kettchen. »Das fand ich an der Toten. Frauenschmuck, würde ich sagen.«
Dornach betrachtete den Beutelinhalt. »Wie lange ist sie tot, glauben Sie?«
Dr.Derendinger fuchtelte in gespielter Drohgebärde mit dem Zeigefinger vor Dornachs Gesicht. »Na, na, mein Lieber, da werden Sie meinen Bericht abwarten müssen. Aber so viel kann ich, Irrtum vorbehalten, vorab sagen: Das riecht nach Verjährung, ein Fall für die Historiker.«
Becky verstand nicht, was er damit meinte. Bevor sie nachfragen konnte, kam ihr Dornach zuvor.
»Können Sie etwas zur Todesursache sagen?«
Dr.Derendinger seufzte. »Sie lassen nie locker, was? Also gut, ich habe mir den Schädel schon mal näher angeschaut. Aufgrund der offenen Nähte und des Gebisszustandes muss die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes recht jung gewesen sein. Ein Weisheitszahn ist nicht ganz durchgebrochen. Demnach schätze ich sie zum Todeszeitpunkt auf nicht älter als fünfundzwanzig Jahre.« Dr.Derendinger hob erneut seinen Drohfinger. »Mehr kriegen Sie für den Moment nicht. Warten Sie auf meinen Bericht.«
»Das werde ich, danke.«
»Noch etwas.« Dr.Derendinger gab Dornach einen weiteren Beutel. »Habe ich am Boden unter der Leiche gefunden.«
Dornach hielt den Beutel ins Licht. »Eine Kugel?«
Dr.Derendinger winkte Dornach heran und zeigte auf den Brustkorb der Leiche. »Sehen Sie die Absplitterung und die Verletzung am Rippenbogen?«
»Sie wurde erschossen«, sagte Dornach.
»Macht man üblicherweise nicht post mortem, könnte also die Todesursache sein.«
»Man hat sie erschossen und dann eingemauert? Weshalb?«
»Tut mir leid, nicht mehr mein Ressort.«
Ein Kriminaltechniker trat zu ihnen. »Wir haben noch was gefunden. Es lag in einer Ritze beim Mauerdurchbruch. Hier.«
Es war der vierte Beutel. Der Inhalt bestand aus einem runden Ansteckknopf. Zeit und Staub hatten die Oberfläche beschädigt. Außen wies er einen Goldrand auf. Der innere Kreis, ein rotes Band, war mit goldenen Lettern beschriftet.
»Hat mal jemand eine Lupe oder ein Vergrößerungsglas?«, rief Dornach.
Der Kriminaltechniker reichte ihm eine Lupe.
»Nati…onal…soz…iali…stische D.A.P.« Was im inneren Kreis stand, brauchte er nicht zu entziffern. »Ein Hakenkreuz. Das ist ein Parteiabzeichen der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.« Er zeigte den Ansteckknopf Becky.
»Die Tote war eine Nazi?«
»Mag sein, keine Ahnung.«
Becky hatte einen schalen Nachgeschmack im Mund. Sie dachte an ihren Großvater. Welches Gespenst hatten sie an diesem Ort geweckt?
***
Der Van des Bestattungsinstituts bog vom Vorplatz auf die Straße hinaus ab. Er überführte die sterblichen Überreste von dem, was einst ein blühendes junges Leben war, ins Institut für Rechtsmedizin nach Bern. Becky schaute ihm nach. Das Bild des gekreuzigten Körpers hatte sich in ihrem Gedächtnis eingebrannt. Wie die Dinge lagen, würde sie nie erfahren, wer die Frau gewesen war und warum sie sterben musste. Dornach hatte ihr diesbezüglich wenig Hoffnungen gemacht.
Becky wollte das nicht hinnehmen. Im Haus ihrer Vorfahren war vor langer Zeit ein grausames Verbrechen passiert, ohne dass in all der Zeit jemand davon Notiz genommen hätte. Becky wollte Licht ins Dunkel zu bringen, sei es nur, um die Schattenzeichen der Vergangenheit und die Vision der Frau und ihre Stimme aus ihren Träumen zu verbannen. Falls sie mit der Toten in Zusammenhang standen, musste sie zumindest versuchen, ihrer Seele Frieden zu geben.
Sie wollte hineingehen, als sie sah, dass Herr Hürlimann auf sein Auto auf dem Vorplatz zusteuerte. Frau Serafini hatte ihn alarmiert, er war vor etwa einer Stunde eingetroffen.
»Gehen Sie schon, Herr Hürlimann?«
»Leider, die Pflicht ruft.«
»Schade, ich hätte Sie gerne auf ein Glas Wein eingeladen.« Becky sah auf ihre Uhr. Mittag war lange vorbei. Sie verspürte keinen Hunger. »Haben Sie Hunger? Ich kann Ihnen etwas zubereiten.«
»Ich sollte eigentlich…« Hürlimann warf einen verlegenen Blick auf seine Armbanduhr. »Nein, mir bleibt etwas Zeit. Danke für das Angebot. Gern ein Glas Wein, kein Essen, nach dem, was ich hier gesehen habe.«
Becky bat Frau Serafini, Adrian gegen Abend in der Villa Dornach abzuholen. Dann setzte sie sich mit Herrn Hürlimann auf die Terrasse.
»Seit wann verwalten Sie den Nachlass der Familie von Aaregg?«, fragte Becky.
»Ihre Frau Mutter hat mich vor ziemlich genau fünfundzwanzig Jahren mit dem Mandat betraut.«
»Wer kümmerte sich davor um das Anwesen und die Verwaltung?«
»Bruno Rüetschli, ein alteingesessener Treuhänder. Er hatte das Mandat von seinem Vater Oskar geerbt, welches ihm von Ihrem Großvater, Freiherr Georg Friedrich von Colberg, übertragen wurde. Bruno verstarb Anfang der achtziger Jahre ohne Nachfolger. So kam ich zum Zug. Das Schloss war zu diesem Zeitpunkt in einem sehr schlechten Zustand. Über Jahrzehnte war jeweils nur das Allernötigste instand gesetzt worden. Mit Einwilligung Ihrer Eltern stellte ich daraufhin Frau Serafini ein, die zum Rechten sehen sollte.«
»Haben Sie alle Bücher und Unterlagen der Liegenschaften von ihm übernommen?«
»Die Liegenschaft.«
»Wie?«
»Lediglich Schloss Aaregg befindet sich noch im Besitz der Familie. Die anderen Immobilien und Grundstücke wurden im Lauf der Jahre verkauft. Sie waren nicht bedeutend. Einzig das landwirtschaftliche Gut Aareggerhof in Zuchwil war vom Umfang her ein ansehnliches Objekt. Kann sein, dass Sie es bei Ihrer Ankunft vom Zug aus gesehen haben, das Schloss mit dem dazugehörenden Bauernhof.«
Becky erinnerte sich an das Schlösschen, auf das Adrian sie aufmerksam gemacht hatte, kurz bevor der Zug in Solothurn einfuhr. »Das gehörte auch unserer Familie?«
»Seien Sie froh, dass Sie es los sind. Ein landwirtschaftlicher Betrieb von dieser Größenordnung ist heutzutage nicht mehr rentabel zu führen.«
Beckys Gedanken waren woanders. »Mir will nicht in den Kopf, wie ein Mensch während Jahrzehnten eingemauert sein kann, ohne von jemandem vermisst zu werden. Gab es keine Hinweise auf einen tragischen Vorfall, ein Unglück oder ein Verbrechen? Erzählte man sich keine Geschichten hinter vorgehaltener Hand oder ähnliche Dinge?«
Hürlimann räusperte sich. Das Ganze war ihm unangenehm.
»Verstehen Sie mich recht, Herr Hürlimann. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Es ist nur… diese furchtbare Geschichte ist so… so surreal.«
Hürlimann wählte seine Worte mit Bedacht. »Wenn die bedauernswerte Frau vor mehr als dreißig Jahren starb, dürfte es schwer sein, die Hintergründe der Tat aufzudecken.«
»Wie wurde das Schloss in all den Jahren seit dem Wegzug meines Großvaters genutzt? Stand es einfach leer?«
»Bis in die sechziger Jahre, soweit mir bekannt ist, dann wurde es an einen Industriellen vermietet. Er hatte ein neuartiges Verfahren für die Oberflächenveredelung entwickelt, das er industrialisieren wollte. Schloss Aaregg sollte der Verwaltungssitz seiner Firma werden. Das Ganze erwies sich als Flop.«
»Inwiefern?«
»Außer vollmundigen Versprechungen brachte der Mann nichts zustande. Am Ende machte er sich aus dem Staub, nicht ohne das Kapital seiner Investoren auf seinem Bankkonto abzuräumen. Wenige Monate später versuchte er den Coup in einem schwarzafrikanischen Land.«
»Mit demselben Resultat?«
»Scheint so, zu seinem Leidwesen hatte er dort eine weniger glückliche Hand. Die Afrikaner waren nicht so nachsichtig wie die Schweizer. Von einem Tag auf den anderen verschwand er spurlos. Man munkelte, er sei verschleppt worden. Später fand man seine sterblichen Überreste in der Wildnis, zumindest das, was die Tiere von ihm übrig gelassen hatten. Es war genug, ihn anhand zahnärztlicher Unterlagen zu identifizieren. Seine afrikanischen Investoren hatten anscheinend beschlossen, ihr Geld unter Umgehung der behördlichen Instanzen zurückzuholen.«
»Und sonst?«
»Was meinen Sie?«
»Wurde Schloss Aaregg für weitere Zwecke genutzt?«
»Sporadisch, für Ausstellungen und Seminare.«
»Verstehe.« Beckys Gedanken waren erneut auf Wanderschaft. »Was befand sich in den Kellerräumen, bevor sie für die Renovierung leer geräumt wurden?«
»Das sollten Sie Frau Serafini fragen. Wenn ich mich recht entsinne, wurden alte Möbelstücke, Schränke, Kommoden, die einen bestimmten Wert darstellen, im Keller gelagert.«
»Wo hat man die Sachen hingebracht?«
»Teilweise auf die oberen Stockwerke oder auf den Dachboden des Schlosses. Es kann sein, dass gewisse Stücke in angemieteten Lagerräumlichkeiten deponiert wurden. Wenn Sie es wünschen, sehe ich in meinen Unterlagen nach.«
»Das wird vorerst nicht nötig sein. Ich schaue mit Frau Serafini.«
Nachdem Hürlimann gegangen war, legte sich Becky eine Weile hin und verbrachte dann die Zeit mit der Sichtung von Unterlagen, die er ihr bereitgelegt hatte. Sie vergaß die Zeit, bis sie hörte, dass die Eingangstüre geöffnet wurde. Kinderstimmen kamen aus dieser Richtung. Schnelle, leichte Schritte hallten durch die Eingangshalle. Becky eilte hinaus und sah, wie Adrian zur Kellertreppe lief. Pia war ihm dicht auf den Fersen.
»Stopp, ihr beiden! Wo wollt ihr hin?«
»Wohin wohl?«, sagte Adrian. »In den Keller.«
»Wozu?«
»Die Leiche sehen.«
Becky warf Frau Serafini einen fragenden Blick zu.
Diese hob ratlos die Schulter. »Ich habe kein Wort gesagt.«
»Woher wisst ihr von einer Leiche im Keller?«
»Der Nachbar hat es Frau Reinhard erzählt.«
»Und Frau Reinhard hat es euch beiden gesagt?«
»Nein«, sagte Adrian. »Pia hat es zufällig gehört.«
Die Kleine sah treuherzig zu Becky auf. »Adrian ist mein Freund. Und Freunden sagt man immer alles.«
Der Grundsatz war diskutabel. »Im Keller gibt’s nichts zu sehen. Pia, weiß dein Vater, dass du bei uns bist?«
Pia zuckte mit den Achseln. »Er ist bei der Arbeit und kommt erst spät nach Hause. Frau Reinhard hat gesagt, ich darf eine Stunde hierbleiben. Dann muss ich durch den Garten nach Hause.«
»Na schön.« Becky sah auf die Uhr. »Es ist jetzt halb sechs. Frau Serafini und ich machen euch etwas zu essen.«
Pia strahlte sie an. Sie schien glücklich zu sein, in Adrian einen Spielkameraden gefunden zu haben. Becky hoffte, dass es ihm mit ihr nicht bald langweilig wurde. »Ihr dürft im Garten spielen, bis ich euch rufe. Aber nicht weglaufen, und der Keller ist tabu, verstanden?«
»Versprochen«, riefen beide im Chor und rannten nach draußen.
***
Nach dem Essen begleitete Frau Serafini Pia zurück zur Villa Dornach, da sie an ihrem Nachhauseweg lag. Adrian hatte Beckys Erlaubnis, vor dem Schlafengehen einen Film auf ihrem Notebook anzuschauen. Das verschaffte ihr Zeit, sich auf dem Dachboden umzusehen.
Eine Holztür führte vom Korridor des dritten Stocks zur Treppe auf den Dachboden. Becky musste heftig daran rütteln, bis sie sich öffnen ließ. Der Treppenaufgang war stockdunkel, Becky tastete die Wand ab, bis sie einen uralten Drehschalter fand. Sobald sie ihn betätigte, flackerte über ihr eine nackte Glühbirne unter einem Metallschirm auf. Das dämmrige Licht vermochte knapp die Treppenstufen zu beleuchten. Becky musste auf ihre Taschenlampe zurückgreifen. Der Zustand der Treppenstufen war nicht vertrauenerweckend. Frau Serafini hatte ihr versichert, dass die Holzkonstruktionen im Haus in tadellosem Zustand waren. Die Stufen waren stabil, obwohl sie bei jeder Belastung laut knarrten. Das Geräusch heimelte Becky. Es erinnerte sie an die Ausflüge auf den Dachboden ihres Elternhauses in Neustadt.
Draußen setzte die Dämmerung ein und tauchte den Dachboden in ein muffiges, staubschwangeres Halbdunkel. Die Taschenlampe blieb unverzichtbar. Der Raum war größer, als Becky ihn sich vorgestellt hatte. Der Dachstuhl mit den massiven Holzbalken über ihr lag frei. Es waren die Originalbalken, die Tristan von Aaregg um 1660 für den Bau des Dachstuhls verwendet hatte, den er mit der großzügigen Apanage finanzierte, mit der ihn König LudwigXIV. für seine treuen Gardedienste ausgestattet hatte. Sie war das Startkapital, auf dem die Familie von Aaregg ihren Reichtum aufbaute. Damit erwarb Tristan Grundstücke und Ländereien in und um Solothurn und am Bielersee. Das war alles, was Becky über die Ursprünge ihrer Familie mütterlicherseits wusste. Die bohrenden Fragen zur jüngeren Vergangenheit, insbesondere über die Umstände des Wegzuges ihres Großvaters aus der heilen Schweiz in das immer mehr in Bedrängnis geratene Deutschland im Jahr 1943, wurden von Beckys Eltern, wenn überhaupt, abweisend beantwortet.
Becky schritt die Länge des Estrichs ab. Massive Holztruhen und Weidenkörbe säumten den Gang über die gesamte Länge des Gebäudes zwischen den beiden Wohntürmen, zu denen eine Tür an den jeweiligen Enden führte. Der Dachboden war auch von den Türmen aus erreichbar, nicht nur über die Haupttreppe.
Ein Geräusch hinter ihr ließ sie erschrocken herumfahren. Die Treppenstufen hatten geknarrt. Ein Schatten entfernte sich rasch, zumindest glaubte Becky, ihn gesehen zu haben. »Ist da wer? Frau Serafini… Adrian?«
Stille.
»Adrian, bist du das?«
Das konnte nur er gewesen sein, obwohl es ihm nicht ähnlich sah, sich von einem Film zu trennen, erst recht, wenn er nicht zu Ende war. Es war keine Viertelstunde her, seit Becky ihn in der Küche zurückgelassen hatte.
Hatte sie sich getäuscht? Die staubige Luft trocknete ihren Mund aus. Leichte Kopfschmerzen schlichen sich ein. Becky setzte sich auf eine Truhe und wartete, bis sie sich beruhigt hatte. Sie hatte versäumt, ihre Tabletten zu nehmen.
Alles nur Einbildung.
Der Arzt in Neustadt hatte sie vor diesen Zuständen gewarnt. Sie brauchte Zeit, das Trauma des Segelunfalls zu verarbeiten. Er hatte ihr die Antidepressiva verschrieben, die sie zwingend regelmäßig nehmen musste. Ob sie je wieder davon loskam? Der Umzug nach Solothurn sollte ihr helfen, über die Horrornacht vor Rügen wegzukommen. Was, wenn es nicht funktionierte?
Becky verscheuchte den Gedanken mit einer wedelnden Handbewegung. Sie waren gerade mal vierundzwanzig Stunden hier. Sie musste sich Zeit lassen. Sie erhob sich mit einem entschlossenen Ruck und ging weiter. Was sie suchte, befand sich auf der Westseite des Dachbodens.
Der Begriff Kammer für das Dienstbotenzimmer war übertrieben. Es war ein besserer Holzverschlag, der einen Raum von etwa drei auf sechs Meter vom restlichen Dachboden abgrenzte. Dort wohnte zuletzt sporadisch die Tochter der Haushälterin ihrer Großeltern, wenn sie ihrer Mutter bei der Arbeit auf dem Schloss zur Hand gehen musste. So zumindest hatte es Frau Serafini ihr erzählt. Der Raum war überstellt mit Kisten von Fotoalben und Ordnern, die aus dem Keller hierhergeschafft worden waren.
Spartanisch, kam Becky in den Sinn, als sie sich im Raum umsah. Ein nacktes hölzernes Bettgestell mit Brettern anstelle eines Lattenrostes lag an der Wand zum Westturm. Vereinzelte dürre Grashalme legten die Vermutung nahe, dass die Bewohnerin auf Heu oder Stroh gelegen hatte, nicht auf einer Matratze. Unterhalb einer winzigen Fensterluke standen ein Tisch und Stuhl, rechts davon eine Waschkommode mit einer Wasserschüssel, von der die Emaille unter der fingerdicken Staubschicht abblätterte. Darüber war eine blinde, in einen Holzrahmen gefasste Spiegelscherbe an die Wand genagelt. Es gab weder eine Toilette noch fließend Wasser. Die Verrichtung der Notdurft musste wohl im unteren Stockwerk erledigt werden. Abgesehen davon dürfte dieser Raum im Winter nicht beheizbar gewesen sein. Es konnte sein, dass die Dienste der Bewohnerin in der kalten Jahreszeit weniger gefragt waren. Damals lebten die Menschen mit Entbehrungen, die heutzutage Skandalschlagzeilen in Boulevardblättern machen würden.
Becky nahm sich eine Kiste vor, die auf dem Bettgestell stand. Sie enthielt Fotobücher, deren Rücken mit Jahreszahlen beschriftet waren. Sie leerte die Kiste, bis sie zuunterst auf eine Holzschatulle stieß. Becky hob vorsichtig den Deckel. Sie enthielt nichts als eine blonde Haarlocke und ein Kärtchen mit der Aufschrift »Emma– 1935«. Wies es auf das Geburts- oder das Sterbejahr hin? War die Locke in diesem Jahr abgeschnitten worden? Bedeutete »1935« etwas anderes als eine Jahreszahl?
Becky legte die Schatulle beiseite. Die Fotobücher waren vielversprechender. Das älteste war mit »1939/40« angeschrieben. Becky begann zu blättern.
Bilder des Schlosses und die verschiedenen Gesichter der Landschaft im Winter und Frühling interessierten sie nicht, es waren die Menschen. Der leichten Kleidung und der üppigen Vegetation auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen zufolge war sie im Sommer angelangt. Eine Aufnahme zeigte eine Gruppe junger Leute bei der Feldarbeit. Die einen wendeten das Heu, welches andere auf einen Wagen luden. Die Zugpferde grasten derweil ein wenig abseits. Ein Foto war während der Mittagspause gemacht worden. Die jungen Leute saßen oder lagen umgeben von Proviantkörben und großen Korbflaschen im Schatten des Heuwagens. Im Vordergrund lag ein dunkelfelliger Hund mit braunen Flecken. Er hatte etwas in seiner weißen Schnauze. Bei genauerem Hinsehen stellte Becky fest, dass es eine Maus war. Halb angeekelt, halb belustigt blätterte sie weiter. Der Fotograf hatte Vorlieben. Die folgende Doppelseite enthielt eine Reihe von Porträtbildern von jungen, meist weiblichen Arbeitern. Welche von denen war Emma mit der Locke? Die meisten Frauen trugen Kopftücher, was die Bestimmung der Haarfarbe auf den für die damalige Zeit typischen kleinformatigen Bildern verunmöglichte. Diejenigen ohne Kopfbedeckung hatten dunkle Haare.
Eines der Bilder war beschriftet. Eine junge Frau lachte unbeschwert in die Kamera. Sie hatte helle Haut und Sommersprossen im Gesicht. Ihre Haare könnten blond gewesen sein. Die Bildunterschrift lautete »Heuernte Aareggerhof– 1.August 1940«. Das Gesicht zog Becky in seinen Bann. Der Fotograf hatte die Frau in dem Moment festgehalten, als sie mit einer Hand eine Haarlocke zurück unter das Kopftuch schob. War sie blond? Das Foto war zu vergilbt, um es eindeutig zu bestimmen. Aber das Gesicht. Becky kannte es aus ihren Träumen.
EMMAAUGUST 1940
3
Über den Rand ihrer Zeitung hinweg beobachtete Emma die Maus. Sie huschte in erratischem Zickzackkurs zwischen den Stoppeln des abgeernteten Feldes hindurch. Die Menschen, die im Schatten des Heuwagens im Gras lagen, beeindruckten sie dabei wenig. Unvermittelt blieb sie stehen. Sie richtete sich auf und sah zu Emma herüber. Diese ließ die Zeitung sinken. Der außenpolitische Teil mit den Kriegsberichterstattungen konnte warten. Sie drückte ihre aufgerauchte Zigarette auf der trockenen Erde aus. Emma und die Maus saßen sich Auge in Auge gegenüber. Emma brach einen Brocken aus dem Stück Emmentaler Käse, das sie sich für das »Zvieri« aufgespart hatte. Bei dem Arbeitstempo, zu dem sie der Meisterknecht des Aareggerhofes antrieb, würde sie bis dahin wieder einen Mordshunger verspüren. Emma hielt der Maus das Käsestück hin. Das Tierchen war sich offensichtlich der Kostbarkeit bewusst, die ihm angeboten wurde.
»Na komm, hol es dir«, murmelte Emma und machte dabei mit spitzen Lippen schnalzende Lockgeräusche. Immer wieder schnuppernd innehaltend, trippelte die Maus heran.
»Hm, was sagst du?« Rosmarie, die neben Emma im Gras lag, streckte sich.
»Beweg dich nicht, du verscheuchst sie sonst.«
»Wen verscheuche ich?« Rosmarie richtete sich auf und sah die Maus. Diese blieb abrupt stehen. Sie hob die Schnauze und beäugte die beiden Frauen mit ihren Knopfaugen. »Halt still, Rosi, sie soll sich den Käse holen.«