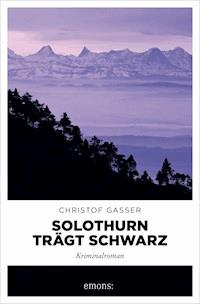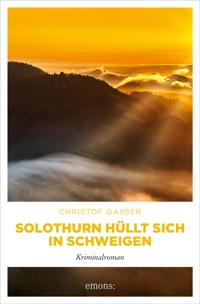Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cora Johannis
- Sprache: Deutsch
Düstere Schluchten, windige Höhen und tödliche Geheimnisse. Während eines schweizerisch-französischen Festakts in Solothurn wird Journalistin Cora Johannis Zeugin, wie die ehemalige Botschafterin Frankreichs von einem Mann angegriffen wird. Wenig später erleidet die Diplomatin bei einem Unfall schwere Verletzungen. Bevor sie das Bewusstsein verliert, nennt sie Cora den Namen des Täters und bittet sie, »Camille zu schützen«. Die Suche nach der ihr unbekannten Frau führt Cora in die Freiberge. Doch statt auf Camille stößt sie dort auf menschliche Abgründe und eine düstere Intrige, die weit in die Vergangenheit reicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Prisma/Weber Raphael
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-210-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Im Gedenken anHejo Emons
Wer Neugeburt will, muss zum Sterben bereit sein.
Hermann Hesse (1877–1962)
Nicht ein Atom des Körpers wird vergehenund nicht ein Hauch von Seele.Sobald der Nordwind den Saum des Geistes zusammenrafft, wird sich der Ostwind erheben und ihn entfalten.
Khalil Gibran (1883–1931)
Wo das Recht nicht in der Lage ist, für Gerechtigkeit zu sorgen, sucht sich die Gerechtigkeit eigene Wegeund schafft neues Unrecht.
Cora Amalia Johannis
Wo das Recht nicht in der Lage ist, für Gerechtigkeit zu sorgen …
Die Sonnenstrahlen kitzelten ihre Nase. Sie kniff ihre Augen zusammen. Ein stiller Protest gegen den erwachenden Tag, der die Geborgenheit der Nacht verdrängte. Die Dämmerung brachte eine Brise, die sie frösteln ließ. Nur die dünne Decke bewahrte ihre Haut vor dem Kontakt mit dem kühlen Lufthauch. Ihre Finger ertasteten den leeren Platz auf der Matte neben ihr, wo sie die Nacht unter freiem Himmel mit ihm verbracht hatte.
Der Gedanke an seinen Geruch, die raue Weichheit seiner Haut und die Härte seiner Muskeln erregte sie erneut. Ihre Hände glitten unter die Decke und über ihren Unterbauch. Es war, als spürte sie ihn noch in ihr. Sie waren erst weit nach Mitternacht eingeschlafen, über ihnen nichts als das Firmament über der Bucht von Quiberon.
Mit einem Seufzer wickelte sie sich in die Decke und schloss die Augen, bis sie durch die geschlossenen Lider einen Schatten wahrnahm.
Er stand direkt über ihr. Die Konturen seines nackten Körpers zeichneten sich dunkel gegen den Halo des Sonnenlichts am azurnen Himmel ab. »Komm her.« Sie streckte die Hand nach ihm aus. Ein Blick auf seine Körpermitte zeigte ihr, dass er verstand, was sie wollte.
Er beugte sich über sie und berührte ihre Brüste. »Frierst du?«
»Ein wenig.«
»Man spürt’s.«
»Was …? Idiot.« Sie umfasste seinen Nacken und zog ihn zu sich herunter. Mit geschlossenen Augen gab sie sich der Symphonie der Sinne hin, die ihre beiden Körper wie ein warmer Dunst einhüllte.
Das Paradies. So musste es sich anfühlen.
Mit dem Unterschied, dass es dort bestimmt keine Motorgeräusche gibt, die sich rasch näherten.
Sie löste sich aus seiner Umarmung und setzte sich auf.
»Idiot!« Diesmal meinte sie den Fahrer des Schnellbootes, das auf sie zusteuerte. Wer konnte das sein, um diese Zeit?
»Das ist Renaud mit den Croissants zum Frühstück«, meinte er.
»Jetzt schon?« Dem würde sie was husten. »Wollte er nicht später kommen? Und seit wann hat er so ein Boot?«
»Gehört wohl seinem Alten.« Renaud arbeitete im Bootsverleih seines Vaters in Kermorvan. Nebst anderem machte er Rundfahrten und Anglertouren mit Touristen. Er hatte ihnen die Yacht zu einem Freundschaftspreis überlassen.
Sie stand auf und wickelte die Decke um ihre Hüften.
»Was machst du?«, fragte er. »Wir können nachher –«
Sie fuhr gespielt lasziv mit beiden Händen über ihre Hüften. »Das hier darf nur einer sehen.« Sie küsste ihn auf den Mund und ging unter Deck. Auf dem Tisch der Kombüse lag das Notebook, an dem sie am Vorabend gearbeitet hatte. Sie klappte es zu und setzte die Kaffeemaschine in Gang. Dann suchte sie ihren Bikini. Das Oberteil lag auf der Bank in der Kajüte, das Höschen fand sie auf dem Bett. Sie nahm den Grapefruitsaft aus dem Kühlschrank, am Vortag frisch gepresst im Bioladen von Quiberon gekauft. Zum Preis dieser einen Flasche hätte sie im Supermarkt zehn Tüten kaufen können. Sie wollte sich etwas Besonderes gönnen, dazu gehörte frisch gepresster Grapefruitsaft und der Champagner, der neben der Saftflasche im Kühlschrank lag. Sie konnten es sich leisten. Auf der Sitzbank lag die Tasche mit dem Geld, zweihunderttausend Euro. Besser, Renaud bekam das nicht zu Gesicht. Sie verstaute die Tasche in einem Schrank in der Kajüte.
Durch die Bordwand hörte sie das Schleifen des Motorbootes gegen die Fender ihres Seglers. Der Motorenlärm brach ab. Jemand rief etwas. Daraufhin hörte sie den dumpfen Schlag eines Körpers, der hart auf den Planken aufschlug, und dann zweimal ein trockenes Ploppen.
Sie ging zurück in die Kombüse und stieg auf die erste Stufe der Treppe an Deck. Vor sich sah sie die Waden zweier Beine in schwarzen Hosen und Sneakers. Dahinter sah sie einen reglosen Körper an der Reling, nackt. Sie biss sich in die Faust, um nicht laut zu schreien, und zog sich in die Kajüte zurück. Die Pistole lag auf der Ablage neben der Kaffeemaschine. Sie nahm die Waffe an sich. Weiter vorne, am Bug, war eine Nische mit einer kleinen Koje, die sie als Abstellraum nutzten. Von dort führte eine Luke ans Oberdeck. Sie öffnete sie und zwängte sich hindurch.
Sie hatte nur Sekunden.
»Fallen lassen!«
Die Stimme hatte die endgültige Schärfe eines Fallbeiles. Es war vorbei. Sie legte die Pistole auf den Boden.
»Umdrehen.«
Sie wandte sich um und erstarrte.
»Du?«
»Ja, ich. Überrascht?«
»Warte, du musst mich nicht –«
»Doch, ich muss.« Die Mündung der Pistole blitzte einmal. Der Einschlag traf sie wie eine Faust aus Stahl in die Magengrube und schleuderte sie über Bord. Das endlose Blau des Himmels war das Letzte, was sie sah, bevor der Atlantik sie verschlang.
1
Je mehr ich versuche, zu vergessen, desto eher holt mich die Erinnerung ein.
Ich habe aufgehört zu rennen. Ich will mich ihr stellen. Welche Alternativen bleiben mir? Der Sprung in den Abgrund? Dafür stehe ich hier am richtigen Ort, am äußersten Ende der Aussichtsplattform des Felsengrates Arête des Sommêtres, rund zweihundert Meter lang und nur eine Handvoll solcher breit. Hinter mir liegt die Hochebene der Freiberge, vor mir, rund fünfhundert Höhenmeter tiefer, die bewaldete Schlucht des Doubs, die über Kaskaden, Windungen und durch Stauwehre fließende Trennlinie zwischen dem Schweizer und dem französischen Jura. Ganz so tief würde ich nicht fallen, wenn ich springen wollte. Aber es wäre ein schöner Tod, an diesem Ort, mit der Weite des Landes vor Augen.
Ich verscheuche den Schwarm dunkler Gedanken. Stattdessen lasse ich meinen Blick über die weißen Felsen schweifen, in der Hoffnung, die Überreste der Burg zu entdecken, die im Mittelalter hier gestanden hatte.
Ruine Spiegelberg.
In einer Gegend, die Wert auf ihre frankofone Identität legt, muten deutschsprachige Ortsbezeichnungen merkwürdig an.
Spiegelberg. Für mich ist es mehr als nur ein Ort. Er steht für eine Erinnerung, die mich zwingt zu vergessen und mir gleichzeitig verunmöglicht, genau das zu tun. Ein Name, der Gespenster erlebten Schreckens auferstehen lässt, die ich hoffte, aus meiner Erinnerung verbannt zu haben.
Hier hatte die Burg gestanden, die heute als »La Ruine de Spiegelberg« bekannt ist. Das Blut der letzten Nachfahren der Dynastie, die es erbaute, klebt an meinen Händen seit den Tagen an jenem verwünschten Ort im Berner Oberland vor zwei Jahren: Blutlauenen.
Charlène, die schwatzhafte Serviererin im Restaurant der Klinik, die einen Steinwurf von hier entfernt liegt, hat mir die Geschichte erzählt. Die im 13. Jahrhundert errichtete Festung war der Sitz der Familie Mireval gewesen. Sie hatte die Grafschaft Muriaux, Spiegelberg zu Deutsch, vom Bischof von Basel als Lehen erhalten. Später verlegten sie ihr Domizil in die Herrschaft Kriegstetten im Solothurner Wasseramt. Dort vermählte sich ein Mireval mit der Adligen Anna von Halten. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stellten zwei Generationen der Mireval oder Spiegelberg, wie sie sich fortan nannten, die Schultheißen der freien Reichsstadt Solothurn. Ludivine, der letzte Spross des Geschlechts, war eine meiner besten Jugendfreundinnen gewesen.
Wenn ich die Augen schließe, werden die Bilder von ihr lebendig. Ich sehe sie vor mir. Der Fels unter meinen Füßen löst sich auf. Unter mir ist die Leere des Abgrunds. Nur etwas hindert mich zu fallen.
Die Schlinge.
Sie schnürt mir die Kehle zu. Ich ringe nach Luft, versuche Halt zu finden, den Druck von mir zu nehmen. Mein Blickfeld verengt sich wie das Licht am Ende eines Tunnels, in dem ich rückwärtsfahre.
»Halten Sie sich fest.« Eine Frauenstimme. Sie spricht französisch mit mir.
Ich mache die Augen auf.
»Vorsicht.« Sie packt mich am Arm. »Für einen Moment dachte ich, Sie fallen mir über das Geländer.«
Ihr Alter ist schwer zu bestimmen, älter als ich auf jeden Fall, zehn Jahre, zwanzig? Sie strahlt Klarheit aus, ohne arrogant zu wirken. So blau ihre Augen sind, ist ihr Haar blond, oder war es mal. Sie scheint nicht eitel genug zu sein, um graue Strähnen nicht zuzulassen.
»Geht es Ihnen besser?«
Ich starre sie an. Sie wiederholt die Frage auf Deutsch, wahrscheinlich aus Gewohnheit. Die meisten Touristen in den Freibergen sind Deutschschweizer.
»Danke, ja. Ich muss mich setzen.«
Die Frau deutet hinüber zum Wald, wo der Felsenpfad seinen Anfang nimmt. »Können Sie gehen?«
Ich nicke.
»Was war mit Ihnen? Es sah aus wie eine Panikattacke.« Es klingt weder neugierig noch übertrieben besorgt, nur mitfühlend.
»Ich hätte es nicht tun sollen.«
»Was?«
Ich winke ab. Der Arzt in der Klinik hat mich ermahnt, es langsam anzugehen. Was heißt langsam? Seit zwei Jahren bewege ich mich im Kriechmodus.
Meine »Retterin« besteht nicht auf eine Antwort. Stattdessen reicht sie mir eine Wasserflasche. »Sie müssen trinken.« Erst will ich ablehnen, ein Pandemiereflex. Monate bevor das Virus zum Thema wurde, befand ich mich in meinem persönlichen Lockdown. Zuerst die Wochen im Spital, die Rückkehr in die eigenen vier Wände, die immer wieder gleichen Alpträume.
Bis der Zusammenbruch kam.
Mit der linken Hand verdecke ich das baumwollene rosa Stoffband mit dem Smiley, das die Narbe an meinem rechten Handgelenk verbirgt. Mila hat es mir geschenkt.
»Sie können ruhig trinken«, sagt die Frau. »Die Flasche ist noch versiegelt.«
»Was?« Ich merke, dass ich die Flasche die ganze Zeit nur versonnen in den Händen drehe. »Danke.« Ich trinke das Halblitergefäß fast leer. Mit jedem Schluck merke ich, wie durstig ich bin. Zwei Kaffee beim Frühstück sind eindeutig zu wenig.
»Besser?«
»Besser.« Ich versuche aufzustehen und setze mich gleich wieder hin.
»Warten Sie, bis sich Ihr Kreislauf normalisiert hat.«
Um nicht reden zu müssen, nehme ich mir Zeit, die Flasche zu leeren. Die Frau hat etwas Irritierendes. Ich glaube, sie von irgendwoher zu kennen, und komme nicht drauf.
»Sie sind Patientin in der Klinik Le Noirmont.« Sie zeigt auf das Patientenband an meinem linken Handgelenk.
»Ich war zur Kur, heute ist mein letzter Tag. Und Sie?«
»Kurzurlaub bei einer befreundeten Familie im Dorf. Morgen geht’s zurück nach Paris. Die Arbeit ruft.«
»Sie sind Französin?«
»Merkt man mir das an?«
Ich nicke, trotz meiner durchschnittlichen Kenntnisse unserer zweiten Landessprache höre ich die geschliffene Aussprache der Pariserin heraus.
»Sie kommen aus der Deutschschweiz, nicht wahr?«
»Dürfte schwer zu überhören sein.« Ich strecke die Hand aus. »Cora Johannis.«
Ein breites Lächeln erhellt ihr Gesicht. »Wusste ich es doch, deine schwarzen Haare, die weiße Strähne über der Stirn, die Bernsteinaugen. Wir kennen uns.« Sie greift nach meiner Hand und schüttelt sie.
»Sie kommen mir auch bekannt vor, aber –«
»Marokko, Anfang der Neunziger, erinnerst du dich nicht mehr an mich? Françoise, Françoise Gravier.«
Die Neunziger? Das war vor Äonen. Trotzdem dämmert es mir langsam. Ich recherchierte für eine Reportage über Flüchtlingsströme nach Europa. Die zu Spanien gehörende Landspitze von Ceuta an der marokkanischen Küste und das weiter östlich gelegene Melilla bilden die einzige EU-Landgrenze zu Afrika. Dort wird mit allem gehandelt, was Geld bringt, erst recht, wenn es auf illegale Weise verschoben werden kann, Alkohol, Drogen und Menschen. Die Arbeit ist mir weniger in Erinnerung geblieben als das lebendige Souvenir, das ich von dort nach Hause gebracht habe.
Inzwischen ist Julian fünfundzwanzig und lebt seit über einem Jahr mit seiner Freundin zusammen. Je älter er wird, desto ähnlicher sieht er Marzuk, dem marokkanischen Assistenten, den mir Françoise Gravier, damals mein Kontakt in der französischen Botschaft, vermittelt hatte. Mit einer Sonderbewilligung bewegte Marzuk sich frei mit mir zwischen Marokko und den spanischen Exklaven. Mich zu schwängern war nicht Bestandteil seines Jobprofils gewesen, geschah aber im gegenseitigen Einvernehmen, was den Akt betrifft, nicht dessen Resultat.
»Wie lange bist du danach in Marokko geblieben?«, will ich wissen, nachdem wir uns umarmt haben.
»Bis Ende 2001. Dann kam die erste Ernennung zur Botschafterin und Vietnam für drei Jahre, darauf folgten zwei weitere in Athen. Dann noch mal Marokko, bevor es zurück nach Europa ging, erst Bern, dann Brüssel.«
»Du warst Botschafterin in der Schweiz? Davon habe ich nichts mitbekommen. Warum hast du dich nie gemeldet?«
»Du warst ständig unterwegs. Ich war oft in Paris und dann …« Gravier senkt den Kopf. »Es ist viel passiert seit Marokko.«
Stimmt. Kaum hatte ich Julian abgestillt, überließ ich ihn der Obhut meines damaligen Partners Matthias. Ein Fehler, wie ich später bemerkte. Seine Assistentin Grazyna unterstützte ihn dabei mehr, als mir lieb sein konnte. Wie man sich bettet … »Bist du noch im diplomatischen Dienst?«
»Im Ruhestand, offiziell.«
»Und inoffiziell?«
»Gibt es so was nicht. Ich arbeite im Stab des Präsidenten.«
»Und mit Präsident meinst du …«
»Genau den, ich bin seine Sonderberaterin für Sicherheit in auswärtigen Angelegenheiten.«
»Diplomaten in Frankreich werden nie pensioniert, oder wie?«
»Nicht, wenn der Präsident sie um sich haben möchte. Nächstes Jahr werde ich siebzig. Dann ist Schluss.«
Dass Alter nur eine Zahl ist, unterstreicht ihr Äußeres. Bis auf die Falten um Mund und Augen wirkt sie wesentlich jünger. Sollte sie dereinst die Diplomatie satthaben, könnte sie eine zweite Karriere als Senior Model oder Best Ager ins Auge fassen.
Die Journalistin in mir stellt sich die Frage, ob Gravier sich nicht nur privat, sondern auch dienstlich in der Gegend aufhalten könnte. Was an den Freibergen könnte für den Hausherrn im Élysée-Palast von Interesse sein? »Vor Jahren kursierte ein Gerücht, der Kanton Jura wolle sich von der Schweiz abspalten und zu Frankreich wechseln«, sage ich augenzwinkernd. »Ist es etwa so weit? Geheime Sondierungsgespräche?«
Gravier lacht. »Mittlerweile dürfte den maßgeblichen Leuten in Delémont aufgegangen sein, dass sie einen schlechten Tausch machen würden. Doch genug von mir. Was ist mit dir, Cora? Weshalb bist du in der Klinik? Sag nicht, du hast Herzprobleme.«
Das wäre die simple Antwort gewesen. Die Klinik Le Noirmont ist bekannt für ihre Rehabilitationsprogramme für Herzpatienten. Zudem bietet sie Therapien in der Psychosomatik an. Nur weil ich vor über einem Vierteljahrhundert mit ihr durch den Souk von Marrakesch gezogen bin, habe ich noch lange keine Lust, mich ihr zu offenbaren. Daniel vom Staal verschaffte mir den Kurplatz in der notorisch voll belegten Klinik. Er und meine Kinder sind die Einzigen, welche die düsterste Ecke meiner Seele kennen. »Lange Geschichte, mit der ich dich nicht langweilen will, es sei denn, du hast stundenlang Zeit.«
Gravier sieht auf ihre Uhr. »Du hast recht, ich muss mich auf den Weg machen. Morgen früh steht ein Treffen in Genf an. Am Nachmittag fliege ich zurück nach Paris.«
Wir stehen gleichzeitig auf. Erleichtert stelle ich fest, dass meine Füße mich wieder tragen.
»Lebst du immer noch in Solothurn?«
»Das weißt du noch?«
»Du bist keine, die man einfach vergisst, Cora.«
»Ich wohne in Nennigkofen, das ist ein Dorf ganz in der Nähe der Stadt. Willst du mich mal besuchen?«
»Bist du übernächste Woche zu Hause?«
»Denke schon.«
»Lass dich überraschen. Du hörst von mir.«
2
Françoise hat Wort gehalten. Vor zwei Tagen zog ich den Brief aus dem Kasten. Einer offiziellen Einladungskarte der französischen Botschaft lag ein handschriftlicher Brief bei. Françoise freue sich, mich am Festakt am Donnerstag in Solothurn zu sehen, hat sie geschrieben. Sie würde einen Tag vorher eintreffen. Das ist heute.
Ich lese zum x-ten Mal die Einladungskarte und den Brief, den ich zusammen mit anderer diverser Korrespondenz in einem Holzkistchen auf der Kommode vor dem Garderobenspiegel aufbewahre, welches früher mal Matthias’ kubanische Zigarren enthalten hatte. Ein Poltern von oben reißt mich aus den Gedanken. Mila kommt mit Rucksack am Rücken und Kater Van Helsing im Schlepptau die Treppe herunter. Van Helsing wartet auf der letzten Stufe, bis sie den Rucksack abgestellt hat. Dann streicht er ihr so lange um die Beine, bis sie ihn aufhebt und in die Arme nimmt.
Seit bald zwei Wochen absolviert sie ein Praktikum auf einem Reiterhof in Muriaux, einer Nachbargemeinde von Le Noirmont. Gestern ist sie für einen Tag zurückgekommen, um etwas für die Schule zu erledigen. Seither ist Van Helsing nicht von ihrer Seite gewichen.
»Kümmerst du dich um ihn, wenn ich weg bin?«
Als würde ich das sonst nicht tun. »Die Frage ist eher, ob es Durchlaucht genehm ist, seine Mahlzeiten von mir kredenzt zu bekommen.«
Als würde er mich verstehen, hebt Van Helsing den Kopf, den er in Milas Armbeuge versenkt hatte. Unsere Blicke verhaken sich ineinander. Ich stelle mir vor, wie er mir am liebsten einen Keil in mein Herz treiben möchte, wenn es in seiner Macht stünde. Mila hatte ihn vor vier Jahren angeschleppt, nachdem er sie von der Bushaltestelle im Dorf bis nach Hause verfolgt hatte. Der europäische Kurzhaartigerkater und ich begegnen uns mit Distanz. Mila meint, es liege an meinen Wurzeln, die in den rumänischen Karpaten liegen. Wegen meiner bernsteingelben Augenfarbe halte er mich für einen Vampir. Sie gab dem Kater den Namen Van Helsing nach dem berühmten Vampirjäger aus Bram Stokers Roman, natürlich um mich zu ärgern. Van Helsing ist geblieben. Ich habe ihr verziehen.
Mila zuckt mit den Achseln. »Keine Sorge, Katzen sind Pragmatiker. Solange du ihm zu fressen gibst, hast du nichts zu befürchten. Er wird dich lieben.«
Letzteres wage ich nach wie vor zu bezweifeln. Trotzdem halte ich Van Helsing zugute, dass er bisher noch nicht versuchte, mich zu zerfleischen.
»Was ist das?« Mila nimmt die Karte aus dem Kistchen. »Der französische Botschafter lädt dich zu einem Empfang ein? Nice. Warum?«
»Die Einladung kommt nicht vom Botschafter selbst, sondern von einer alten Freundin, Françoise Gravier. Sie war mal Botschafterin in Bern, als du klein warst. Sie lädt mich zu einem Empfang morgen in Solothurn ein. Ich habe dir von ihr erzählt.«
»Ist das die, die dem französischen Präsi ins Ohr flüstert?« Normalerweise ist das etwas, das Mila nicht heftig zu beeindrucken vermag. »Gehst du hin?«
»Der Anlass dreht sich um einen historischen Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich aus der Zeit vor der Revolution. Wenn du bis morgen bleibst, kannst du mitkommen. Ich darf eine Begleitperson mitnehmen.«
»Danke, aber nein danke. Deine Françoise würde ich zwar schon mal gern kennenlernen. Voll abgefahren das Ganze. Sie schnippt mit dem Finger, und der Mächtige macht Männchen. Das nenne ich echte Girl Power.«
»Wenn du es sagst. Hast du alles eingepackt, die Schulsachen, die du mitnehmen willst? Was genau eigentlich?«
»Nichts Besonderes, ’n paar Sachen zum Lernen und so, falls ich mal Zeit habe.« Sie wechselt das Thema, indem sie meine Hände nimmt und mir in die Augen sieht. »Ich verlasse mich drauf, dass du klarkommst, Mum.«
Seit ihrem letzten Wachstumsschub überragt sie mich um einen halben Kopf. Ihre Augen sind grün, nicht bernsteinfarben wie meine, ihre Haare heller, fast dunkelblond. Meine weiße Locke habe ich ihr nicht vererbt. Dafür zieht sich eine weiße Strieme von ihrer Schläfe bis über das linke Ohr, die sie neuerdings mit einem Undercut hervorhebt. Vor vier Jahren hatte die Kugel eines Schwerverbrechers ihren Kopf an dieser Stelle gestreift und die Pigmentierung beschädigt. Ich musste es mit ansehen. Wenn man will, kann man dem abgewinnen, dass die gemeinsam ausgestandene Todesangst im Schwarzbubenland uns beide zusammengeschweißt hat. Regelmäßige Zwiste sind nach wie vor ein Bestandteil unserer Mutter-Tochter-Beziehung. Im Vergleich zu früher sind sie weniger aggressiv, eher versöhnlich, in der Regel. Ich lerne immer noch, meiner Tochter zu vertrauen. Mila ist siebzehn, wobei sie bei jeder Gelegenheit betont, fast achtzehn zu sein. Wie Julian werde ich sie bald vollends loslassen müssen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, den Moment des Auszugs aus dem mütterlichen Nest so lange wie möglich hinauszögern zu können.
Keine Ahnung, wie ich ohne Mila zurück ins Leben gefunden hätte. Als meine Seele sich in die dunkelste Ecke meines Wesens verkrochen hatte, rettete sie mir im wahrsten Sinn des Wortes das Leben.
An jenem Abend vor knapp anderthalb Jahren hatten sich alle meine Dämonen gegen mich verschworen. Weder eine ganze Flasche Gin noch die gleichzeitig eingeworfenen Tabletten hatten sie zu vertreiben vermocht. Auf einmal hatte ich die Packung Einwegrasierklingen Marke »Solingen« in der Hand, ein Überbleibsel von Matthias, die ich zuhinterst im Badezimmerschrank gefunden hatte. Der Schmerz des Schnittes, das Blut, welches das Wasser in der Wanne rot färbte, linderten Angst und die Abscheu vor mir selbst.
Das Virus hatte zu jenem Zeitpunkt die Welt und Milas Volleyballtraining kurzfristig lahmgelegt. Ich hatte nicht mitbekommen, dass sie früher heimgekommen war und mich ausblutend in der vollen Wanne fand. Nach dem ersten Schnitt an meinem rechten Handgelenk war ich weggetreten, ein weiterer glücklicher Umstand. Hätte ich es geschafft, beide Arme aufzuschlitzen, wäre es um mich geschehen gewesen. Daniel vom Staal, den Mila zusammen mit den Rettungssanitätern alarmiert hatte, erzählte mir später, dass sie vierundzwanzig Stunden lang nicht von meinem Spitalbett gewichen war. Julian hatte mit seiner Freundin Lara auf einem Flughafen eines warmen Landes, ich weiß nicht mehr, welches, festgesessen und auf einen verfügbaren Rückflug gewartet.
Die neuen Wunden ließen alte vernarben. Mila konnte mir verzeihen, ihrem heiß geliebten Vater den Laufpass gegeben zu haben. Ich habe mich endlich damit abgefunden, dass Matthias schon dreimal länger mit Grazyna zusammen ist als mit mir.
»Mum? Bist du in Ordnung? Kann ich dich allein lassen?«
»Sicher kannst du das.«
»Du rufst mich an oder Patty oder Dani, wenn was ist, versprochen?« Mila hat Daniel vom Staal von Anfang an ins Herz geschlossen. Wie ihre Patentante und meine beste Freundin Patrizia Egger macht sie keinen Hehl daraus, dass sie in ihm gern meinen neuen Lebenspartner sehen würde. Nachdem ihr großer Bruder ausgezogen und Matthias mit Grazyna nach Südamerika ausgewandert ist, vermisst meine Papitochter die männliche Bezugsperson.
»Ich verspreche dir, dass ich dich bald auf dem Pferdehof besuche. Mittlerweile weiß ich auch, wo Muriaux liegt.«
Das Centre Équestre »Equus« ist für seine »Freiberger« bekannt, die einzige heute noch gezüchtete Schweizer Pferderasse. Mila hat sich in den Kopf gesetzt, nach der Matur Veterinärmedizin zu studieren. Dank Daniels großzügiger Honorierung meiner Nachforschungen zum Verschwinden seiner Frau im Schwarzbubenland konnte ich ihren Unterricht an einer Solothurner Reitschule finanzieren, wo sie sich als Naturtalent im Umgang mit Pferden erwies. Da es zeitlich nicht anders einzurichten war, ermöglichten ihre ausgezeichneten Schulnoten eine Unterrichtsdispens vor den Herbstferien mit der Auflage, den verpassten Stoff in der Freizeit nachzubüffeln. Ihr Schulfranzösisch hatte sie sogar freiwillig aufpoliert.
»Hast du alles?«
Sie zeigt auf ihre Reisetasche. »Heb sie mal hoch, du wirst schon sehen.« Sie hält mir die Einladung unter die Nase. »Frag Dani, ob er dich begleitet. Der freut sich bestimmt.«
Ich schnappe ihr die Karte weg. »Schauen wir mal. Wir sollten fahren, wenn du den Zug nicht verpassen willst.« Außerdem will ich Françoise am Bahnhof Solothurn nicht auf mich warten lassen.
Ich lege den Umschlag zur Seite. Daniel bitten, mich zu begleiten? Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt hingehe.
3
Jean Gravier, Marquis de Vergennes, der 1777 als Gesandter König Ludwigs XVI. in Solothurn residierte, ist ein Urahne von Françoise Gravier. Das erfuhr ich von ihr, nachdem ich sie am Vorabend am Bahnhof Solothurn in Empfang genommen hatte. Dem für sie reservierten Gästezimmer in der Residenz des französischen Botschafters in Bern zog sie die Formlosigkeit meiner Gastfreundschaft vor. Es half mir, die Leere von Milas Abwesenheit zu überbrücken.
Bei einem Glas Wein hatte mir Françoise erzählt, wie der Marquis am 28. Mai 1777 in Solothurn den Freundschaftsvertrag zwischen dem Königreich Frankreich und der Eidgenossenschaft erneuerte. Ursprünglich diente der erstmals 1521 geschlossene Pakt dazu, den Einfluss der Habsburger auf die Eidgenossen zu vermindern und sie nach und nach vom Deutschen Reich abzunabeln. Dass eine Nachfahrin des Marquis im Namen des Präsidenten der Republik eine Gedenktafel im Ambassadorenhof einweiht, soll als Geste der Verbundenheit der beiden Länder gelten und helfen, über jüngste bilaterale Differenzen in Bezug auf Kampfjetbeschaffung und Steuerprozesse gegen Großbanken hinwegzusehen. Françoise hat mir am Vorabend geschildert, wie sie dem Präsidenten bei einem gemeinsamen Mittagessen dazu geraten hat. Es könne nicht im Interesse Frankreichs liegen, seinen viertgrößten Investor und größten Schaffer französischer Arbeitsplätze im Produktionssektor vor den Kopf zu stoßen. Gut, dass hinter den Boss-Männern Frauen stehen, die ihnen die Prioritäten erklären.
Ich hätte es wissen müssen. Der ehemalige Regierungsrat Daniel vom Staal fehlt an keinem hochkarätigen Anlass, wenn die Politik involviert ist.
Die Einweihungszeremonie fand im Ambassadorenhof statt, der ehemaligen Residenz der Gesandten der Bourbonenkönige in der Eidgenossenschaft. Heute ist er Domizil des kantonalen Departementes des Innern. Mit halbem Ohr höre ich einem Redaktor des »Solothurner Tagblattes« zu, der mir seine Urlaubsabenteuer auf einem Vulkan auf Gran Canaria erzählt. Dabei positioniere ich mich so, dass Daniel mich möglichst nicht im Blickfeld hat. Eigentlich verhalte ich mich ihm gegenüber nicht so. Françoise hat mich gestern gefragt, ob ich ein »plus one« mitbringe, worauf ich vage mit den Schultern gezuckt habe. Daniel habe ich nicht gefragt, er mich auch nicht. Das ist aber nicht die Ursache des unbehaglichen Gefühls, das mich bei seinem Anblick beschleicht. Es ist seine Begleitung, die mir einen feinen, aber spürbaren Stich versetzt: hübsch, blond, sichtlich jünger als er – und ich. Warum ich mich gerade verhalte wie ein eifersüchtiger Teenager, kann ich mir selbst nicht erklären. Daniel ist gradlinig und großzügig. Mit ihm könnte ich mir eine Beziehung vorstellen. Möglicherweise hätte es zwischen uns gefunkt, wenn Blutlauenen nicht gewesen wäre und was danach passiert ist. Warum kann ich nicht dort anknüpfen, wo wir davor gewesen waren? Daniel hat mich am tiefsten Punkt in meiner persönlichen Hölle erlebt, in der ich nichts anderes mehr verkörpern konnte als Wut und Angst. Dafür schäme mich heute noch vor ihm … und vor mir selbst. Ich liebe diesen Mann. Doch selbst wenn er in Mila die bestmögliche Fürsprecherin hat, wird es eine Weile dauern, bis ich mich ihm gegenüber wieder öffnen kann.
Das hindert mich keineswegs daran, eifersüchtig zu sein.
Der Ambassadorenhof liegt auf der obersten Stelle einer Anhöhe, auf deren zur Aare abfallenden Südflanke sich die Altstadt ausbreitet. In Tat und Wahrheit residierten die Abgesandten der französischen Könige über den Solothurner Regenten im Rathaus gegenüber. Eine aufschlussreiche Tatsache, was die damaligen Machtverhältnisse betrifft. Ein Gedanke, den ich besser für mich behalte. Meine Eltern flüchteten in den Sechzigern vor dem Diktator Ceausescu in die Schweiz. Zu der Zeit war Moskau de facto die Hauptstadt Rumäniens gewesen. Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert war es Paris oder besser Versailles für die Solothurner und ihre Miteidgenossen.
Schönes Wetter und milde Temperaturen erlauben ein Buffet unter freiem Himmel im grünen Geviert des Innenhofes. Die reichhaltige Auswahl der Speisen und der Weine, darunter ein edler Champagner, lässt den Schluss zu, dass die Rechnung vom französischen Staat übernommen wird und nicht vom in dieser Beziehung stets klammen Kanton Solothurn.
Alle und jeder, denen man jeweils an solchen Anlässen über den Weg läuft, sind auch hier zu finden. Zwei Stehtische von mir entfernt unterhält sich Françoise mit der Regierungspräsidentin des Kantons Solothurn, die sie korrekt mit Frau Landammann anredet. Daneben steht der französische Botschafter im Gespräch mit dem Staatssekretär des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten und einem Solothurner Ständerat. Für die Sicherheit sorgen an den Zugängen platzierte Uniformierte der Kantonspolizei. In der Nähe der VIPs stehen zwei Männer und eine Frau in Zivil mit Knopf im Ohr. Ich tippe auf den für die Sicherheit ausländischer Würdenträger zuständigen Bundessicherheitsdienst.
Ich wage einen Blick in die entgegengesetzte Richtung, wo sich Daniel und seine Begleiterin angeregt mit Vertreterinnen des Kantonsparlamentes unterhalten, bis mich eine Berührung am Oberarm zusammenzucken lässt.
»Na, na.« Patrizia Egger gibt mir einen Kuss auf die Wange. »Erwische ich dich gerade bei etwas Verruchtem? Unkeusche Gedanken beim Anblick meines Chefs?«
Ich umarme sie. »Hab dich vermisst, Patty. Seit wann bist du zurück?«
»Gestern Abend, direkt von London. Grenzüberschreitende Sorgerechtsverhandlungen sind immer so eine Sache.«
»Konntet ihr euch einigen?«
»Sieht so aus. Für einen Monat betreut sie die beiden Katzen, während er sich um den Hund kümmert. Dann wird geswitcht.«
»Was? Es ging um Tiere?«
»Emotionale Bindungen bauen sich auch zu Lebewesen mit mehr als zwei oder keinen Beinen auf. Stell dir vor, Matthias erhebt Anspruch auf Van Helsing.«
»Den würde ich ihm noch so gern überlassen«, entgegne ich achselzuckend. »Überhaupt müsste er sich darüber mit Mila streiten. Van Helsing gehört ihr. Für das Viech bin ich nur Personal, zuständig für die Fütterung sowie die Entsorgung toter Mäuse und Vögel, die er ständig anschleppt. Ich würde nicht in Matthias’ Haut stecken wollen, wenn es ihm in den Sinn käme, Mila den Kater wegzunehmen.«
Wir lassen uns die Gläser von einer vorbeikommenden Kellnerin mit Champagner auffüllen. Patty schlürft genießerisch den ersten Schluck, nachdem sie sich die Etikette hat zeigen lassen. »Pommery, aber hallo, der Herr Botschafter lässt sich nicht lumpen. Nichts gegen die Weine von der Domaine de Soleure, aber das ist schon was anderes.«
»Was ist mir dir los? Hast du in London nur Tee getrunken? Hat Daniel das Spesenbudget zusammengestrichen?«
»Daniel doch nicht. Wenn, dann höchstens die Neue.« Patty wirft einen abschätzigen Blick auf die Frau, die sich bei vom Staal untergehakt hat.
»Wer ist das überhaupt? Etwa seine neue …«
»Seine neue Flamme?« Patty lacht. »Inzwischen solltest du Daniel besser kennen. Bestünde die Möglichkeit, dass er sich auf jemanden aus der Kanzlei einlässt, hätte ich ihn mir schon lange gekrallt, und wir beide wären keine Freundinnen mehr.« Sie stupst mich mit dem Ellbogen an.
»Keine Ahnung, was du meinst.«
»Natürlich nicht.« Patty seufzt. »Du und Daniel, zusammen seid ihr das, was man einen hoffnungslosen Fall nennt.«
»Du hast mir immer noch nicht gesagt, wer sie ist.«
»Jeannette Courvoisier, Compliance Spezialistin. Daniel hat es geschafft, sie bei KPMG auszuspannen, frag mich nicht, wie. Wenn alles gut geht, wird sie in sechs Monaten zur Partnerin.« Patty schnaubt spöttisch. »Wenn ich denke, wie lange ich dafür pickeln musste. Im Moment führt sie ein hausinternes Audit über unsere Kosten durch.«
»Wieso? Müsst ihr sparen?«
»Wer muss das nicht? Das ist nicht der Punkt. Die gute Jeannette hat Daniel klargemacht, wenn wir unseren Klienten Compliance verkaufen wollen, sollten wir erst mal unser Haus in Ordnung bringen.«
»Deshalb der Tee in London?«
Patty sieht mich verständnislos an. »Was laberst du die ganze Zeit von Tee? Die Hotelbar war gut bestückt, der Barkeeper übrigens auch, auf dem Zimmer konnte ich mich persönlich davon überzeugen. Willst du Einzelheiten?«
»Danke, dafür reicht meine Phantasie gerade noch aus.«
Patty ist eine eingefleischte Junggesellin, weit davon entfernt, in der Liebe sesshaft zu werden. Ich schätze an ihr, wie sie die Dinge ins rechte Licht rückt. Für sie und meine Tochter bin ich ein offenes Buch, was mein Liebesleben betrifft. Außerdem kann Patty Gedanken lesen. »Wenn ich du wäre, würde ich trotzdem nicht zu lange warten, den Sack mit Daniel zuzumachen.«
Mein Blick fällt auf Françoise. Sie hat sich von der Gesellschaft abgesetzt und unterhält sich eingehend mit einem Mann. Er muss erst vor Kurzem dazugestoßen sein. In seinem Aufzug wäre er mir sonst unweigerlich ins Auge gestochen. Ungeachtet der Witterung trägt er einen schwarzen, an den Aufschlägen zerschlissenen Ledermantel, hohe Schuhe und abgetragene Jeans, die bestimmt seit geraumer Zeit keine Waschmaschine von innen gesehen haben. Eine hagere Erscheinung, das Haar ungepflegt, und die letzte Rasur scheint mehr als nur ein paar Tage her zu sein. Françoises zugeteilte Sicherheitsbeamtin beobachtet jede seiner Bewegungen. Françoise muss ihn vorgelassen haben. Obwohl Welten ihr Äußeres trennen, ist die Vertrautheit zwischen ihnen deutlich.
Ich will mich schon wieder Patty zuwenden, als der Mann Françoise unvermittelt am Oberarm packt und sie an sich zieht. Gleichzeitig redet er heftig auf sie ein. Françoise versucht, ihn zu beruhigen, bis er sie von sich stößt. Sie stolpert und fällt hin. Die Sicherheitsbeamtin greift ein, befördert den Mann mit einem Polizeigriff zu Boden und legt ihm Handschellen an. Patty und ich eilen zu Françoise, die sich mit Hilfe des Botschafters aufrappelt. Derweil richtet die Sicherheitsbeamtin gemeinsam mit einem Kollegen den Angreifer auf und will ihn wegbringen.
»Laissez-le!«, ruft Françoise. Sie winkt die Beamtin zu sich und redet gestenreich auf sie ein. Ich stehe nah genug, um die Worte »Missverständnis« und »Versehen« mitzubekommen. Françoise zeigt auf die gefesselten Hände, bis die Beamtin nickt und ihrem Kollegen bedeutet, dem Mann die Handschellen abzunehmen. Der danebenstehende Botschafter scheint nicht einverstanden zu sein, wagt es aber offensichtlich nicht, die Autorität der Präsidentenberaterin in Frage zu stellen. Auf deren Geheiß lassen die Polizisten den Mann unbehelligt gehen. Er dreht sich nach Françoise um und hebt grüßend die Hand. Sie erwidert es mit einem knappen Nicken.
»Grüß dich, Cora.«
Ich bin dermaßen auf Françoise fokussiert, dass ich vom Staal nicht bemerkt habe. Jeannette Courvoisier steht ein paar Meter weiter mit dem Rücken zu uns und unterhält sich mit Patty. Diese zwinkert mir zu. Sie hat es im Griff.
»Ich will dich schon lange mit meiner neuen Mitarbeiterin bekannt machen«, sagt Daniel. »Doch wie es scheint, wollen sich unsere Wege heute nicht kreuzen.«
»Patty hat sie mir schon vorgestellt. Aus der Ferne.«
»Gut. Es wäre schade, wenn es ein Missverständnis gäbe.«
»Was für ein Missverständnis sollte das sein? Du musst dich mir gegenüber nicht rechtfertigen. Patty hat mir gesagt, was Frau Courvoisier bei euch in der Kanzlei macht.«
»Dann ist es gut. Ich hatte das Gefühl, du gehst mir ihretwegen aus dem Weg.«
Ich ringe mir ein Lächeln ab und klopfe ihm auf die Schulter.
»Woher kennst du Frau Gravier?«, fragt er.
»Von der Arbeit.« Ich erzähle ihm von Nordafrika. »Und du?«
»Aus meiner Regierungsratszeit. Frau Gravier liebt Solothurn. Sie ist einige Male hier gewesen. Sie war es, die ihrem Präsidenten nahelegte, die Gedenktafel einzuweihen, eine Geste des Goodwills.«
»Ich weiß. Kennst du den Mann, mit dem sie sich so intensiv unterhalten hat?«
Vom Staal macht ein nachdenkliches Gesicht. »Er kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern. Frag sie doch selbst.« Er deutet mit dem Kopf auf Françoise, die auf uns zukommt.
Sie legt die Handflächen wie zur Abbitte zusammen. »Entschuldigt, dass ihr das mitbekommen musstet.«
»Was war?«, frage ich. »Für einen Moment sah es so aus, als wollte er auf dich losgehen.«
»Keine Sorge, es sah wirklich nur so aus. Gérard Murival ist ein guter Kerl, der viel durchmachen musste. Zwischendurch geht sein impulsives Temperament mit ihm durch.«
Vielleicht ist das gerade der Grund für sein Pech im Leben. »Was war so wichtig, dass er diese Party crashte?«
»Nicht der Rede wert.« Françoise bemüht sich, die Stimmung zu normalisieren. Sie nickt vom Staal zu. »Ich wusste nicht, dass ihr beide euch kennt. Solothurn ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Dorf. Aber da ich euch gerade beisammenhabe: Ich organisiere anschließend ein Abendessen im kleinen Kreis und hätte euch beide gern dabei. Seid ihr abkömmlich?«
Daniel deutet eine Verbeugung an. »Ich komme sehr gern, Françoise. Vielen Dank.«
Beide sehen mich erwartungsvoll an.
»Tut mir leid, ich bin verhindert. Julian ist in den Staaten. Heute Abend habe ich mit ihm ein Videogespräch vereinbart. Das will ich nicht verschieben. Wer weiß, wann sich die nächste Gelegenheit dazu ergibt.«
Françoise lässt es gelten. »Dann sehen wir uns, wenn ich nach Hause komme.« Sie verabschiedet sich mit einem Kopfnicken und geht weiter zur nächsten Gruppe.
Daniel sieht mich verdutzt an. »Wohnt sie bei dir? Normalerweise übernachtet sie auf der Botschaft in Bern oder im ›La Couronne‹, wenn sie in Solothurn ist.«
»Sie scheint keine Lust auf die Gesellschaft des Botschafters zu haben.« Ich zeige auf Patty und Jeannette Courvoisier, die erwartungsvoll zu uns herübersehen, und hake mich bei Daniel ein. »Jetzt darfst du mich deiner neuen Mitarbeiterin persönlich vorstellen.«
Die Buchstaben rollen sich zusammen, verhaken sich und driften wieder auseinander. Die Worte ziehen Fäden wie schwarze Melasse, bevor sie wie der Balg einer Ziehharmonika wieder zusammengepresst werden. Nach einem weiteren vergeblichen Anlauf, aus dem Ganzen Sinn zu machen, gebe ich den Versuch auf, den Textentwurf für den Artikel eines Kollegen im Magazin »Wirtschaft, Politik & Gesellschaft« fertig gegenzulesen. Es ist kurz vor Mitternacht. Ich habe gehofft, ein Glas Wein mit Françoise trinken zu können, sobald sie zurückkehrt. Wie es aussieht, haben ihre Gäste sie nicht gehen lassen. Verständlich, wenn sich die Gelegenheit bietet, mit einer Persönlichkeit Geschäfte aufzugleisen oder andere wichtige Themen anzusprechen, die Zugang zum höchsten Ohr der zweitgrößten Marktwirtschaft der EU hat.
Meine Gedanken driften ab zum Videochat mit Julian. Wir sprachen fast eine Stunde miteinander, so lange wie seit Jahren nicht mehr am Stück. Seit ich seine mir entgegengebrachte Zuneigung größtenteils an seine Partnerin Lara abtreten musste, vermisse ich seine Nähe, aus der inzwischen eine gefühlt endlose Distanz geworden ist. Dafür ist er glücklich, dass es mit seinem Austauschjahr an der Universität von Colorado in Boulder geklappt hat. Also bin ich es auch. Eine Fügung des Schicksals wollte es, dass Lara für eine Gastdozentur an derselben Fakultät selektiert wurde. Ich mag Lara oder besser ich habe mich dazu gebracht, sie zu mögen, obschon der Altersunterschied zwischen den beiden mir etwas zu schaffen macht. Lara ist über zehn Jahre älter als er. Erst hatte ich ihre Beziehung für mich als Laune abgetan, eine Liebelei – die seit vier Jahren andauert. Als sich die beiden ineinander verliebten, war Lara Julians Dozentin an der Uni Neuchâtel. Dann passierten die typischen Gedankenspiele einer Mutter, die vielleicht mal ein Enkelkind in den Armen halten möchte. Doch wer bin ich, von meinem Sohn Konformität zu erwarten, wenn ich mir in seinem Alter Kapriolen leistete, von denen mich heute die wenigsten mit Stolz erfüllen? Jegliche Einmischung meiner Eltern stieß damals auf massive Gegenwehr meinerseits.
Als es mir nicht gut ging, dachte Julian laut darüber nach, auf Amerika zu verzichten und sich stattdessen um mich zu kümmern. Lara wäre nichts anderes übrig geblieben, als allein nach Colorado zu reisen. Die Versuchung war groß, darauf einzugehen. Schließlich habe ich ihn gedrängt, mit Lara zu gehen. Ich will meine Kinder glücklich sehen. Und überhaupt, es existiert kein Menschenrecht auf erfüllten Enkelwunsch.
Ich klappe das Notebook zu und stelle das leere Rotweinglas in die Spüle. Beim Verkorken der angebrochenen Flasche Merlot klingelt mein Handy. Ohne die anrufende Nummer auf dem Display zu beachten, drücke ich auf den Antwortknopf. »Wo steckst du?«
»Cora?«
»Wer spricht?«
»Karin Jäggi.«
»Karin?« Ich nehme den Hörer vom Ohr und sehe mir die Nummer auf dem Display an. Es ist Karins Diensthandy, dessen Nummer ich seit einem gemeinsamen Fall gespeichert habe. »Entschuldige, ich habe deine Stimme nicht gleich erkannt. Eigentlich erwarte ich einen anderen Anruf. Ist etwas passiert?« Mila geht mir durch den Kopf. Ich rede mir ein, dass nicht Karin mich anrufen würde, wenn meiner Tochter etwas zustieße.
»Sorry, dass ich dich so spät störe. Kennst du eine Françoise Gravier? Sie hat dich als Notfallkontakt angegeben.«
»Ja, warum?«
»Kannst du ins Bürgerspital kommen? Wir treffen uns dort.«
Bevor ich nachfragen kann, hat Karin aufgelegt.
Karin erwartet mich am Eingang zur Notaufnahme. Der Ort weckt ungute Erinnerungen. Hier wachte ich auf, nachdem Mila und Daniel mich bewusstlos, blutend und nackt in der Badewanne gefunden hatten.
»Salut, Cora, du siehst besser aus als beim letzten Mal.« Ich habe die junge Ermittlerin der Solothurner Kantonspolizei im Schwarzbubenland kennengelernt. Spätestens seit den furchtbaren Tagen in Blutlauenen sind wir befreundet. Sie zeigt der Frau am Empfang ihren Dienstausweis und steuert die Tür zu den Behandlungszimmern an. »Wir können direkt durch.«
»Sagst du mir, was mit Françoise passiert ist?«
»Wie es aussieht, hatte sie einen Unfall.«
»Wie es aussieht?«
»Die Katzentreppe ist dir ein Begriff?«
»Du vergisst, dass ich in Solothurn aufgewachsen bin. Klar kenne ich die.« Sechsundzwanzig Stufen aus weißem Kalkstein verbinden die Ostseite der Plattform der Kathedrale und den Pisoniplatz mit der darunterliegenden Seilergasse und dem römisch-katholischen Pfarramt zu St. Ursen. Wie die Treppe zu diesem Namen kam, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie gerade und steil ist.
»Kurz vor elf Uhr wurde Frau Gravier bewusstlos am Fuß der Treppe gefunden. Wir gehen davon aus, dass sie die Stufen hinuntergestürzt ist. Darauf lassen die Prellungen und eine Kopfverletzung schließen.«
»Wie geht es ihr?«
»Sie wird gerade untersucht, ist aber bei Bewusstsein. Sie hat nach dir verlangt.«
»Kann ich sie sprechen?«
»Deshalb habe ich dich angerufen.«
Vor einem der Behandlungszimmer haben sich eine uniformierte Polizistin der Kantonspolizei und die zivile Bundespolizistin postiert, die beim Empfang dabei war.
Karin hält mich zurück, bevor ich das Zimmer betrete. »Der Fall ist heikel, Cora. Du weißt, dass Frau Gravier eine hochgestellte Person in der französischen Regierung ist?«
Ich nicke.
»Es ist unklar, was vorgefallen ist. Bis jetzt gibt es keine Zeugen. Eine Passantin hat uns alarmiert, nachdem sie Frau Gravier ohne Bewusstsein gefunden hat. Sie gibt an, den Vorfall selbst nicht gesehen zu haben. Frau Graviers Schilderung ist nicht schlüssig.«
»Was heißt ›nicht schlüssig‹?«
»Sie kann nicht genau schildern, was passiert ist. Angeblich war sie allein unterwegs, ohne Personenschutz. Sollte sie ausgerechnet hier in Solothurn angegriffen worden sein, haben wir ein Problem.«
»Ich soll für euch herausfinden, was passiert ist, oder wie?«
»Sie will mit dir reden, das ist schon mal gut. Vielleicht sind wir nachher schlauer.« Karin klopft zweimal an die Tür des Behandlungszimmers und öffnet sie, ohne eine Antwort abzuwarten. Eine Pflegerin misst der mürrisch dreinblickenden Françoise den Blutdruck, während eine Ärztin danebensteht.
»Fünf Minuten, nicht länger«, lässt diese uns wissen. »Sie hat eine starke Gehirnerschütterung und darf sich nicht aufregen. Wir möchten sie diese Nacht hierbehalten. Ein Privatzimmer wird in diesem Moment für sie vorbereitet. Morgen sehen wir weiter.« Dann verlässt sie mit der Pflegerin den Raum.
Françoise ist wach und scheint erleichtert, mich zu sehen. »Cora, endlich!« Sie bemerkt Karin. »Wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Karin Jäggi, Kantonspolizei.« Sie zeigt ihren Dienstausweis. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten.«
»Später, zuerst muss ich mit Frau Johannis allein sprechen, bitte.«
Nach einem kurzen Blickwechsel mit mir verlässt Karin das Zimmer. Ich setze mich auf einen Stuhl neben dem Bett.
Françoise schenkt mir ein gezwungenes Lächeln. »Tut mir leid, dass ich dir Umstände bereite, das war nicht geplant.«
»Das hoffe ich schwer. Hast du Schmerzen?«
»Ich fühle mich ein wenig groggy, sind wohl die Schmerzmittel. Die Kopfschmerzen haben mich fast umgebracht.« Ihre Stimme klingt müde. »Die meinen, ich hätte eine schwere Gehirnerschütterung.«
Ich verzichte darauf, sie zu fragen, was sie bei der Katzentreppe wollte, anstatt mit ihren Gästen im Hotel La Couronne zu dinieren. Danach hätte sie eine Limousine nach Nennigkofen bringen sollen. Um diese Nachtzeit nimmt die Fahrt maximal zehn Minuten in Anspruch.
»Was ist geschehen, bist du gestolpert?«
»Ich … ich … keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass ich auf die Treppe zugegangen bin, dann wurde es schwarz um mich, dann bin ich in diesem Bett erwacht.«
»Warst du allein, hast du jemanden gesehen?« Ich muss an ihre Auseinandersetzung beim Empfang denken. »Oder wurdest du gestoßen?«
Françoise errät, was ich denke. »Ich … tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, da war was, aber …« Ihre Stimme driftet weg.
»Was wolltest du dort, hinter der Kathedrale?«
»Ich wollte sie mir wieder mal ansehen, wenigstens von außen. Ich brauchte eh frische Luft. Seit ich diese Stadt zum ersten Mal besucht habe, liebe ich diesen Bau. Als mein Vorfahre 1777 in den Ambassadorenhof einzog, war sie quasi brandneu.«
»Warst du allein, bist du jemandem begegnet?«
Françoise legt die Hand über die Stirn. »Ich bin mir nicht sicher. Mein Gehirn ist vollkommen vernebelt. Ich glaube, ich habe Gérard gesehen.«
»Gérard Murival, mit dem du den Streit beim Empfang hattest?«
»Ja, ich glaube … möglich, dass … Aber das kann nicht sein. Er wollte …« Françoise macht eine Grimasse.
»Hast du Schmerzen? Soll ich die Ärztin rufen?«
Sie bewegt den Kopf hin und her. »Geht schon. Cora, du musst etwas für mich tun. Es ist wichtig.« Ihre Stimme wird leiser. Die Worte kommen gequält über ihre Lippen.
»Du musst dich ausruhen, Françoise. Wir sprechen morgen.«
»Nein, hör mir zu. Wenn mir etwas passiert, dann musst du … du musst …« Ihre Stimme stockt. Sie bewegt den Mund, als müsste sie die Worte aus sich herauspressen. »Du musst Camille finden … schützen, bitte, Cora. Es ist wichtig … Gefahr.«
»Wer ist Camille?«
»Ja, Camille, bitte, Cora … finde … du musst … ist …«
Ihre Pupillen drehen sich nach innen. Ich sehe nur noch das Weiße. Sie beginnt am ganzen Körper zu zittern, immer stärker, bis es in Konvulsionen übergeht. Ich drücke hastig den Rufknopf. Dann renne ich zur Tür und reiße sie auf. »Hilfe! Jemand, bitte!«
Karin und die Bundespolizistin stürmen mit zwei Pflegerinnen herein.
Ich schmeiße die Autoschlüssel in die schilfgrüne, muschelförmige Keramikschale auf der Garderobenkommode. Sie dient als Gefäß für allerlei Kleinkram, der sich im Lauf eines Tages in Hosentaschen ansammelt, Münzen, Büroklammern, Bonbons und, zu meinem Ärger, zerknüllte Kassenzettel. Mila hat das Teil bei einem Strandurlaub in Italien – oder war es Südfrankreich? – mit ihrem Taschengeld erstanden. Obwohl ich nie verstehen werde, wie man für so was Geld ausgeben kann, anerkenne ich seine Nützlichkeit.
Weshalb ich ausgerechnet jetzt über diese lächerliche Schale nachdenke, ist mir ein Rätsel. Es ließe sich vermutlich mit Verdrängung, Kompartimentierung oder was immer erklären. Ich fühle mich erschlagen und weiß nicht mal mehr recht, wie ich nach Hause gekommen bin. Macht der Gewohnheit, die Strecke zwischen Solothurn und Nennigkofen könnte ich im Schlaf fahren. Jeder Nerv und Muskel in mir schreien nach dem Bett, wo ich garantiert kein Auge zubringen könnte. Zu sehr haben sich die Bilder der letzten Stunde in meine Hirnrinde gebrannt. Françoises Spasmen, die fassungslosen Gesichter von Karin und der Bundespolizistin, das entschlossene und routinierte Handeln der Ärztin und der Pflegepersonen.
Die Notoperation ist seit knapp einer halben Stunde im Gang. Was die Ärztin befürchtete, ist eingetroffen. Françoise erlitt eine Hirnblutung. Karin ist im Spital geblieben und wartet, bis sie den Ausgang der Operation kennt.
Ich ignoriere das Verlangen, die Flasche Wein wieder zu entkorken. Stattdessen fülle ich in der Küche ein Glas mit Leitungswasser.
Wer um alles in der Welt ist Camille?
Ich kenne weder ihren oder seinen Nachnamen, noch habe ich eine Ahnung, ob es sich bei dieser Person um einen Er oder eine Sie handelt. Wie die Dinge liegen, wird mir Françoise in absehbarer Zeit keine große Hilfe sein.
Ich klappe das Notebook auf und tippe »Camille« in das Eingabefeld der Suchmaschine. Fast zweihundert Millionen Einträge. Bei »Camille Gravier« erhalte ich fast siebenhunderttausend Hits. Hingegen kennt das digitale Universum keine Camille Murival. Wie ein Wikipedia-Eintrag erläutert, war der Vorname im französischen Sprachraum zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowohl bei Männern als auch Frauen beliebt. Seine Popularität bei den Frauen begann Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre zu schwinden. Bei den Männern ging er ab 1950 auf Sinkflug. Neue Beliebtheit gewann er in den Siebzigern vorzugsweise bei Mädchen. Wenn ich annehme, dass unser oder unsere Camille plus/minus in meinem Alter ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Frau suche. Das beantwortet nicht die Frage, was sie für Françoise ist, eine Verwandte, Bekannte oder deren Kind? Wenn ich die Nachforschungen falsch anpacke, ist die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen im Vergleich dazu ein Kinderspiel.
Ich entsinne mich nicht, dass Françoise den Namen mir gegenüber zuvor jemals erwähnt hat. War sie überhaupt bei klarem Verstand, als sie ihn mir nannte?
Ich nehme ein Paar Latexhandschuhe aus dem Putzschrank und streife sie über. Françoise ist in Julians Zimmer im oberen Stockwerk einquartiert. Im Gegensatz zu seiner Schwester hat er es vor seiner Abreise peinlichst aufgeräumt und sauber gemacht. Den Ordnungsfimmel hat er nicht von mir. Ich würde mich nicht als Chaotin bezeichnen, aber putzen und aufräumen gehören einfach nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten.
Françoises Koffer steht verschlossen neben dem Kleiderschrank. Ich lege ihn aufs Bett. Das Kombinationsschloss lässt sich ohne Weiteres öffnen. Françoise hat es nicht verstellt. Sie hat nur ihre Kleider ausgepackt und in den Schrank geräumt. Im Koffer liegen Accessoires, Unterlagen und ein Notebook. Ich nehme das Notebook heraus und verdränge mein schlechtes Gewissen. Soll ich Camille finden, muss ich die Informationen dort suchen, wo ich am ehesten eine Chance habe, welche zu finden. Ich klappe das Notebook auf und schaue das Eingabefeld an, als könnte das Passwort dank meiner mentalen Kraft von allein aufpoppen. Der Erfolg ist überschaubar. Das Notebook einer Diplomatin mit Zugang zum Élysée-Palast ist bestimmt mehrfach gesichert, und ich kenne nicht mal ihren Geburtstag. Ihr Pass und der Personalausweis liegen bei ihren Sachen im Spital.
Was soll’s. Achselzuckend gebe ich Françoises Vor- und Nachnamen als Benutzer und darunter »123456« ein.
»Falsches Passwort«, war ja klar, darunter der freundliche Hinweis, dass ich zwei weitere Versuche habe, bevor die Maschine für dreißig Minuten die Schotten dicht macht. Ich fahre das Notebook herunter, widme mich dem restlichen Inhalt des Koffers und hoffe, dabei auf einen Hinweis, ein Notizbuch oder einen herumliegenden Zettel zu stoßen. Und warum nicht eine versteckte Botschaft im Hohlraum des Lippenstiftes? Wenn ich anfange, in James-Bond-Klischees zu denken, wird es vielleicht doch langsam Zeit, ins Bett zu gehen.
Einige Schnellhefter mit verschiedenen Unterlagen klappe ich schnell wieder zu, weil sie mich nichts angehen. Bis auf einen. Er enthält nur eine Zeigetasche mit einem Briefumschlag, handschriftlich an Françoise Gravier an der Rue de Lafayette in Versailles adressiert, vermutlich ihre Privatadresse. Das Schriftbild ist rund und geschwungen, es könnte von einem Mädchen oder einer jungen Frau stammen. Die Handschrift erinnert mich an diejenige von Mila. Auf dem Umschlag ist kein Absender vermerkt, die Briefmarke ist ausgeschnitten. Er sieht aus, als wäre er schon oft in Händen gehalten worden. Ich spreize die Öffnung mit zwei Fingern auseinander und sehe hinein. Er enthält einen schmalen Stapel Fotos zweier junger Frauen, aufgenommen in unterschiedlichen Posen an verschiedenen Orten in der freien Natur, an einem See oder in einem Wald. Einige der Bilder zeigen die beiden auf einem Felsenkamm. Ich kenne ihn, weil ich vor wenigen Wochen dort war: die Arête des Sommêtres. Auf vereinzelten Bildern ist nur eine der Frauen zu sehen. Eine hübsche Erscheinung, sportliche Figur mit hellen, fast weißblonden Haaren, grünen Augen und einem breiten, ansteckenden Lachen. Das Haar ihrer Freundin ist ein paar Töne dunkler und das Gesicht ein wenig schmaler. Ich drehe die Fotos. Mit einer Ausnahme ist auf keinem ein Name oder ein Datum vermerkt. Auf dem Bild mit den beiden auf den Sommêtres hat jemand mit Kugelschreiber »juin 1999« hingeschrieben. Die Handschrift ähnelt derjenigen auf dem Umschlag.
Welche der beiden könnte Camille sein?
Als ich die Bilder zurück in den Umschlag stecken will, merke ich, dass er noch etwas enthält, einen schmalen, harten Gegenstand. Ich greife hinein und halte einen USB-Datenstick in der Hand.
4
Camille beneidete Léonie für ihre Leichtfüßigkeit. Wieder einmal hatte ihre Freundin sie weit hinter sich gelassen. Dabei konnte sich Camilles Kondition sehen lassen. Im Schulsport war sie stets unter den Klassenbesten gewesen. Dennoch musste es in der Ahnenlinie der Familie Ory Gämsen gegeben haben. Anders war die Behändigkeit nicht zu erklären, mit der Léonie über die Felsen kletterte.
Sie blickte von ihrem steinernen Hochsitz auf Camille herab. Ihre Füße baumelten über dem Abgrund. »Mach schon, ich habe nicht ewig Zeit. Wenn ich das Abendessen verpasse, muss ich mir von der Direktorin wieder was anhören. Darauf habe ich keine Lust.«
Camille fühlte sich heute nicht so in Form wie sonst. Ihr Bauch schmerzte. Sie biss die Zähne zusammen und erklomm die letzten Meter, so rasch sie konnte.
»Endlich.« Léonie griff in ihre Bluse und zog ein Päckchen Gauloises hervor. Es war ein alter Trick von ihr. Deshalb trug sie ihre BHs eine Nummer größer. »Ich dachte schon, ich muss allein rauchen.«
»Woher hast du die schon wieder?«
»Aus Claudes Spind, wie immer.«
»Irgendwann wird er merken, dass du seine Zigaretten stibitzt.«
»Der doch nicht. Solange ich ihm nicht eine ganze Stange klaue. Er kauft immer mehrere auf einmal. Wenn ich ihn um den Finger wickle, merkt der nicht mal, wenn ihm ein Päckchen fehlt.«
Claude war der Gärtner des Instituts, in dem sie arbeitete. Léonie wusste sich seine Schwäche für sie zu Nutzen zu machen. Sie riss das Siegel auf und klopfte zwei Glimmstängel heraus.
»Danke, heute nicht.« Camille zeigte auf ihren Nabel.
»Rote Flagge?«
»Seit heute Morgen. Was glaubst du? Sonst hätte ich dich vorhin mit Leichtigkeit überholt.«
»Träum weiter.« Léonie gab sich Feuer und blies spielerisch den Rauch in Camilles Gesicht.
Diese musste husten. »Was ist das? Getrockneter Kuhmist?«
»Gauloises Bleues, die Richtigen, ohne Filter. Sie sind stärker als die Blondes, die Claude sonst raucht.« Léonie blies ihr erneut ins Gesicht.
»Putain, wenn du nicht aufhörst, kotze ich dich voll.«
»Entschuldige, ich wusste nicht, dass du neuerdings empfindlich bist.«
»Wenn ich die Periode habe, schon.«
»Wenigstens hast du sie.«
Camille sah Léonie fragend an.
»Meine ist überfällig, seit einer Woche.«
»Bist du etwa …«
»Keine Ahnung, ich hab’s immer nur mit Gummi gemacht. Kann sein, dass der Idiot vom letzten Mal zu blöd war, sich das Ding korrekt überzuziehen. Es ist geplatzt. Gut möglich, dass was von seiner Sauce bei mir reingelaufen ist.«
»Und?«
»Und was?«
»Was machst du, wenn du schwanger bist?«
»So schnell geht’s auch wieder nicht. Ist nicht das erste Mal, dass meine Tage ausfallen oder sich verzögern. Deswegen mache ich nicht gleich auf Panik.«
»Wenn du es doch bist? Weißt du wenigstens, von wem du es hast?«
Grinsend zog Léonie ein Büchlein aus ihrer Jackentasche. »Darin habe ich die Namen aller Typen aufgeschrieben, die bei mir durch sind, mit Adresse und Telefonnummer.«
Camille machte große Augen. »Woher hast du die? Doch sicher nicht von denen selbst.«
»Ist heutzutage ein Kinderspiel.«
»Und was willst du tun? Bei dem Kerl auftauchen und ihm sagen, er soll zahlen? Der schickt dich zum Teufel.«
»Glaub mir, der wird zahlen, bevor er einen öffentlichen Skandal riskiert. Außerdem ist seine Frau diejenige, die das ganze Geld hat. Was glaubst du, was los ist, wenn ich ihr stecke, wofür ihr Herr Gemahl es ausgibt?«
»Und das Kind? Was hast du vor, wenn es mal da ist?«
»Ich gebe es zur Adoption frei.« Mit der brennenden Zigarette im Mundwinkel blätterte Léonie im Büchlein. »Hier.« Sie zeigte Camille die aufgeschlagene Seite und legte den Zeigefinger tippend auf einen Namen. »Das ist er.«
Camille schluckte leer. »Der? Mit dem habe ich auch …«
»Weiß ich. Er hat’s mir gesagt. Jetzt will er, dass wir was zu dritt machen.«
»Wie? Du und ich, mit dem?«
»Klar.«
»Nie im Leben!«
»Warum nicht. Er bezahlt gut. Je schneller wir die Kohle zusammenhaben, desto eher kommen wir weg von hier. Und überhaupt …« Léonie rutschte näher zu Camille. »Mit dir würde es mir wenigstens Spaß machen.«
Camille lehnte sich an ihre Freundin. »Ich weiß nicht. Ich bin mit dir zusammen, weil ich Lust dazu habe, und nicht, um diese schmierigen Säcke aufzugeilen.«
»Das hat nichts damit zu tun. Wir machen ein bisschen rum, tun so als ob und stöhnen uns gegenseitig an, etwa so.« Léonie rieb ihren Oberkörper an Camilles und gab gekünstelt lustvolle Laute von sich.
»T’es conne.« Camille schob sie kichernd von sich. »Lass den Mist, bevor ich runterfalle.«
Léonie setzte sich richtig hin. »Im Ernst, wir brauchen nicht viel zu machen. Aber es wird ihn dermaßen aufgeilen, dass er garantiert nicht merkt, dass wir ihm was vorspielen. Wenn wir Glück haben, geht ihm allein davon schon einer ab. Leicht verdiente Kohle, glaub’s mir.«
»Ich weiß nicht.«
»Komm schon. Du ahnst nicht, wie ich das Leben hier satthabe. Die ganze Zeit um bigotte Nonnen und geile alte Geldsäcke herum.«
Camilles Blick glitt über den tiefen Einschnitt, den sich der Doubs in das weiche Kalkgestein gegraben hatte, und über die sich jenseits davon erstreckenden Höhen und Wälder des französischen Juras. Sie wollte auch weg, irgendwann mal. So eilig wie Léonie hatte sie es nicht. Ihrer Heimat den Rücken zu kehren bedeutete, Lila zurückzulassen, die Freiberger Stute, die ihr Mathilde geschenkt hatte. Die Natur würde sie ebenso vermissen, die Höhen, die Schlucht, den Doubs und mit Mathilde durch die Wälder zu streifen. Doch was sollte sie hier ohne Léonie? Sie gab Camilles Leben richtig Sinn. »Wie viel zahlt der Typ für einen Dreier?«
»So viel, wie wir dafür verlangen. Selbst nachdem wir Marko seinen Teil abgegeben haben, wird genug für uns übrig bleiben.« Léonie nahm Camilles Hand. »Stell dir das mal vor: Vielleicht ist es das letzte Mal. Dann haben wir genug beisammen, um uns abzusetzen. Wir können dorthin, wo es uns passt, nach Spanien oder sogar weiter. Das Leben in der Karibik ist einiges billiger als hier. Dort haben wir mehr Möglichkeiten. Auf einer Insel mit vielen Touristen machen wir eine Bar am Strand auf. Genug Alkohol, guter Sound und ein wenig mit dem Hintern wackeln. Das wird eine Goldgrube.«
»Man wird uns suchen. Mathilde hat Verbindungen. Sie wird alle Hebel in Bewegung setzen, um uns aufzuspüren. Und was ist mit Marko? Er wird uns nicht einfach so ziehen lassen.«
Léonie verschränkte beide Hände in Camilles Nacken und drückte deren Stirn gegen ihre. »Merk dir eins, chérie. Wir sind nicht wie die anderen Mädchen, die er laufen hat. Marko hat genug mit uns verdient, er wird andere finden, die uns ersetzen. Wir besorgen uns falsche Papiere. Ich weiß jemanden in Deutschland. Der macht uns das für je einen Tausender. Damit werden uns weder deine Großmutter noch Marko finden.« Léonie sah auf ihre Uhr. »Ich muss.« Sie stand auf. »Vergiss nicht, heute Abend pünktlich zu sein. Du kennst den Treffpunkt?«
»Wie immer, denke ich.«
»Wenn der Van wegen dir warten muss, zieht Marko uns das vom ›Trinkgeld‹ ab. Überleg’s dir wegen dem Dreier. Wenn nicht heute, dann halt eben bei der nächsten Party.« Léonie schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Merde