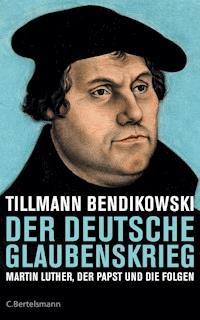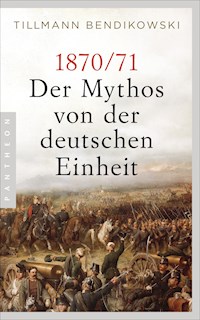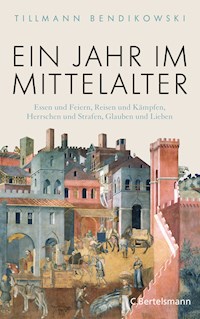15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der renommierte deutsche Historiker über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs
Allgemeine Kriegsbegeisterung in Deutschland 1914 – das war lange die vorherrschende Einschätzung. Doch haben die Menschen den Krieg wirklich freudig begrüßt? Tillmann Bendikowski schildert den Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus der vielschichtigen Perspektive derjenigen, die diese Zeit unmittelbar erlebten. Er begleitet fünf Deutsche – den Kaiser, einen Historiker, einen jungen Journalisten, eine Lehrerin und einen Lyriker – durch die Sommermonate des Jahres 1914: eine Zeit, in der sich das Leben in Europa grundlegend veränderte. Und er zeigt: Die Deutschen wussten früh, welche Schrecken ihnen bevorstanden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Ähnliche
Tillmann Bendikowski
Sommer 1914
Zwischen Begeisterung und Angst –wie Deutsche den Kriegsbeginn erlebten
C. Bertelsmann
Inhalt
Vorwort – Ein Blick zurück nach vorn
Juni 1914 – Ein Thronfolger wird erschossen
Kaiser Wilhelm II. Ein Monarch feiert sich als »Friedenskaiser«
Alexander Cartellieri. Ein Historiker in seiner Welt
Wilhelm Eildermann. Ein junger Kämpfer der Arbeiterklasse
Gertrud Schädla. Eine Volksschullehrerin in der Provinz
Ernst Stadler. Ein Literat auf dem Weg nach Kanada
Juli 1914 – Fast alle sind im Urlaub
Kaiser Wilhelm II.: »Man drückt uns das Schwert in die Hand«
Alexander Cartellieri sieht seine Studenten in der vaterländischen Pflicht
Wilhelm Eildermann lauscht flammenden Reden gegen den Krieg
Gertrud Schädla wird »die Sache schon etwas brenzlig«
Ernst Stadler macht mobil und kauft sich einen Revolver
August 1914 – Der Krieg beginnt
Kaiser Wilhelm II. trägt Feldgrau und bekommt es mit den Nerven
Alexander Cartellieri spricht von einem »Verstandeskrieg«
Wilhelm Eildermann: »Alle haben das Gefühl, es geht direkt zur Schlachtbank«
Gertrud Schädla ergibt sich in »Gottes unerforschlichen Ratschluß«
Ernst Stadler: »Ich grüße dich, süße Erde von Frankreich«
September 1914 – Die Zweifel wachsen
Kaiser Wilhelm II. Mitten drin und außen vor
Alexander Cartellieri rühmt sich seines Glaubens an die gute Sache
Wilhelm Eildermann. Was ist ein guter Sozialdemokrat?
Gertrud Schädla: »Unser einziger Gedanke ist Krieg«
Ernst Stadler. Hexensabbat
Oktober 1914 – Immer mehr Tote müssen betrauert werden
Kaiser Wilhelm II.: »Wir müssen mit Anstand untergehen«
Alexander Cartellieri bleibt auf Kriegskurs
Wilhelm Eildermann hofft auf die Niederlage
Gertrud Schädla: »Und wie sehnen sich alle, alle nach Frieden«
Ernst Stadler. Im Westen nichts Neues
Nachtrag
Ein Blick zurück – Was möglich ist im Sommer 1914
Literatur
Personenregister
Orts- und Sachregister
Bildnachweis
BILDTEIL
Vorwort – Ein Blick zurück nach vorn
»Wenn unsere Kinder und Enkel dermaleinst auf die jetzige gewaltige Zeit von 1914 zurückblicken, werden sie als Wissende mehr als wir selbst, die wir jetzt vor der geschlossenen Pforte der Zukunft stehen, die ungeheure Größe dieser Zeitwende voll begreifen.«
(Schöneberger Tageblatt vom 7. August 1914)1
Hinterher ist man bekanntlich immer klüger. Was einst geschah, scheint immer plausibler zu werden, je weiter wir uns von einem historischen Ereignis entfernen. So macht die Zeit aus uns Nachgeborenen zwangsläufig retrospektive Besserwisser – wir haben den Menschen von damals schließlich voraus, dass wir wissen, wo alles geendet hat und was aus ihren Zukunftserwartungen tatsächlich wurde. Für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gilt dies in besonderem Maße. Wir wissen heute, wie sehr er das Gesicht der Welt verändern sollte, welcher Schrecken und wie viel Leid während seiner vierjährigen Dauer angerichtet wurden – und welche neuen Katastrophen ihm wohl auch deshalb folgten, weil er diesen mit seinen Gewalterfahrungen und seinen direkten und indirekten Auswirkungen den Weg ebnete. Aber bedeutete das zugleich, dass die Menschen hierzulande es im Jahr 1914 auch schon wussten? Sicher nicht. Sie hatten ihre eigenen Erwartungen an die Zukunft, die sich mit unseren heutigen Erfahrungen allerdings nicht immer decken.
Diese Erwartungen sollen im Folgenden näher betrachtet werden – das Buch ist der Versuch zu verstehen, was im Sommer 1914 geschah und wie die Menschen diese Zeit erlebten. Denn ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten, ihre Erwartungen gegenüber dem Kommenden führen uns zu einem historischen Thema, das die Deutschen seit Jahrzehnten bewegt. Traditionell herrscht in unseren Geschichtsbüchern und großen historischen Darstellungen die Vorstellung vor, es habe so etwas wie eine allumfassende Kriegsbegeisterung im Deutschen Reich gegeben. Die Deutschen seien demnach im August 1914 in übergroßer Mehrheit begeistert in den Krieg gezogen, viele von ihnen hätten ihn gewollt. Der Krieg, der Kampf, die Gefahren – all das sei regelrecht herbeigesehnt worden.
Mit guten Gründen haben Historiker in den vergangenen Jahren immer stärker moniert, dass diese Vorstellung im Laufe der Zeit zu einem Klischee, ja zu einem Mythos erstarrt ist; längst schon hat die historische Forschung die vermeintliche Kriegsbegeisterung infrage gestellt. So zeigt sich inzwischen, dass es das alle Bevölkerungsschichten umfassende sogenannte »August-Erlebnis« tatsächlich so nicht gegeben hat – in der historischen Wirklichkeit waren die Reaktionen auf die Kriegsgefahr und den Beginn des Krieges sehr viel komplexer und widersprüchlicher.2 Sicher, eine allgemeine emotionale Erregung trieb große Teile der städtischen Bevölkerung im Deutschen Reich im August 1914 auf die Straße, aber die Gefühlslage dieser Menschen war vielfältig: Nicht nur Begeisterung oder Ausgelassenheit ist im Nachhinein zu erkennen, sondern auch Neugier oder zuweilen sogar Angst. Zu patriotischen Aufmärschen kam es ebenso wie zu stillen Versammlungen an öffentlichen Plätzen oder eben auch zu Protestmärschen.3
Um diesen vielfältigen Reaktionen im Sommer 1914 auf die Spur zu kommen, wollen wir unseren Blick zurückwenden, zurück auf die Menschen, die in jenen Monaten zunächst eine Krise und dann den Ausbruch eines Krieges erlebten. In diesem Buch werden deshalb fünf ausgewählte Personen vorgestellt und zu Wort kommen.4 Wir wollen mit ihrer Hilfe verstehen, wie sie – und mit ihnen andere – den Sommer 1914 wahrnahmen. Diese fünf Menschen sind bis zu einem gewissen Grad stellvertretend für die unterschiedlichen Gruppen der deutschen Bevölkerung, für die Land- ebenso wie für die Stadtbevölkerung, für die Intellektuellen ebenso wie für die Arbeiter, für Frauen wie für Männer, für Zivilisten wie für Soldaten. Auf sie fällt unser Blick zurück, mit dem wir zugleich unser Interesse an ihrem Blick nach vorn bekunden: Was erwarteten sie in diesen Wochen und Monaten, wie blickten sie in die Zukunft? Wie nahmen sie die zunehmenden internationalen Spannungen wahr? Fühlten sie sich bedroht? Hatten sie Angst vor einem Krieg, oder sehnten sie ihn herbei? Und dann, als Millionen Männer zu den Waffen greifen mussten – wie schnell verflog der vorhandene Optimismus? Wann und wie setzte die Trauer um Angehörige und Freunde, die Wut über einen verlorenen Frieden ein? Wenn wir ihre Perspektive auf das Geschehen besser verstehen, dann wird unsere Retrospektive ein adäquates Verständnis ihrer Geschichte hervorbringen.5
Die Auswahl der fünf Protagonisten geschah in gewisser Hinsicht zufällig. Schließlich sollten sie die deutsche Bevölkerung möglichst breit vertreten, ohne dass zugleich ein Anspruch auf repräsentative Aussagen im Sinn empirischer Forschung erhoben werden muss. Diese Biografien stellen vielmehr fünf Möglichkeiten dar, wie die Menschen einst reagierten. Es gab sicherlich auch andere Möglichkeiten, aber wir wollen uns im Wesentlichen auf diese fünf beschränken und sie näher betrachten. Wir begleiten unsere Protagonisten durch den Sommer 1914 – wenngleich nicht kalendarisch ganz streng –, durch die Monate Juni, Juli, August, September und Oktober. In dieser Zeit verwandelte sich das Leben in Europa: Einem nicht ganz gewöhnlichen Juni, in dem der Mord am österreichischen Thronfolger in Sarajevo den Kontinent zu erschüttern scheint, folgten im Juli erst die Krisen, dann im August der Krieg. Und schon im Oktober 1914 fürchteten die meisten Deutschen, dass dieser Krieg wohl entgegen ihrer ursprünglichen Hoffnungen lang und verlustreich sein wird.
Anhand dieser fünf Biografien soll erzählt werden, was in diesen dramatischen Monaten passierte. Die Protagonisten sind:
Wilhelm II., geboren 1859. Er ist seit 1888 deutscher Kaiser und König von Preußen. Nicht zuletzt aufgrund seiner langen Regentschaft verleiht er den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende ihren Namen »Wilhelminische Epoche«. In dieser Zeit versucht Kaiser Wilhelm Deutschland zu einer gleichberechtigten Größe unter den Weltmächten zu machen; wirtschaftlich wie militärisch strebt das Deutsche Reich nach dem sprichwörtlichen »Platz an der Sonne«. Wilhelms Vorliebe fürs Militärische ist bekannt, für die Marine schwärmt er geradezu. Andererseits erfüllt es den Kaiser mit einem gewissen Stolz, dass das Reich unter ihm schon ein Vierteljahrhundert Frieden erlebt hat. Am 27. Januar 1914 feiert Wilhelm seinen 55. Geburtstag.
Alexander Cartellieri, geboren 1867. Er ist Professor an der Universität in Jena und als Historiker einer der zu diesem Zeitpunkt wenigen, aber ausgewiesenen Kenner der französischen Geschichte. Unter Fachkollegen wird Cartellieri bis heute eher nicht beachtet und zählt deshalb auch nicht zu den herausragenden Figuren des deutschen Kultur- und Gelehrtenlebens dieser Epoche. Gleichwohl legt er ein durchaus beachtliches Werk vor: Neben der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen widmet er sich unter anderem der westeuropäischen Geschichte des Mittelalters und schreibt schließlich sogar eine fünfbändige Weltgeschichte. Alexander Cartellieri wird am 19. Juni 1914 47 Jahre alt, ist also nur wenige Jahre jünger als der Kaiser.6
Wilhelm Eildermann, geboren 1897, ist der jüngste im Kreis unserer Protagonisten: Er feiert am 24. Juli 1914 seinen 17. Geburtstag. Eildermann ist Volontär bei der Bremer Bürger-Zeitung, die als Parteiblatt der SPD den linken Flügel der deutschen Sozialdemokratie vertritt. Eildermann stammt aus einem Bremer Arbeiterhaushalt mit traditioneller Hinwendung zur Sozialdemokratie – sein älterer Bruder Heinrich hat sich dort schon lange engagiert. Zwei seiner Brüder werden im August 1914 in den Krieg ziehen, Wilhelm jedoch bleibt daheim in Bremen und erlebt intensiv mit, wie die deutsche Sozialdemokratie sich um die »richtige« Haltung zum Krieg bemüht.
Gertrud Schädla, geboren 1887. Sie ist Lehrerin an der Nicolai-Schule in Verden an der Aller, nicht weit entfernt von Bremen.7 Schädla ist ledig und lebt bei ihrer Mutter, einer verwitweten Pfarrersfrau. In ihrer Freizeit nutzt die junge Lehrerin die kulturellen Angebote der Stadt und der Region, besucht das Theater und beschäftigt sich mit zeitgenössischer Literatur. Als fromme Protestantin besucht sie regelmäßig den Gottesdienst und religiöse Vorträge. Gertrud Schädla feiert am 25. Januar 1914 ihren 27. Geburtstag.
Ernst Stadler, geboren 1883. Er arbeitet als Dozent für Philologie an der Universität in Brüssel – aber eigentlich ist er Lyriker. Stadler stammt aus dem Elsass, hat in Straßburg studiert und sich zunächst als Herausgeber von Literaturzeitschriften einen Namen gemacht. 1914 legt er einen durchaus beachteten Gedichtband mit dem Titel Der Aufbruch vor, der ihn – so urteilt später die Nachwelt – zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des deutschen Expressionismus macht. Ernst Stadler wird am 31. Juli 1914 als Reserveoffizier eingezogen. Er ist 30 Jahre alt.
Diese fünf Menschen stehen – um das Eingangszitat aus dem Schöneberger Tageblatt aufzugreifen – im Juni 1914 »vor der noch verschlossenen Pforte der Zukunft«. Wir wollen uns zu ihnen gesellen und sie durch den Sommer 1914 begleiten.
1Zit. n. Berliner Geschichtswerkstatt, August 1914, S. 7.
2Ullrich, Kriegsbegeisterung, S. 630.
3Zur Widerlegung einer allgemeinen Kriegsbegeisterung vgl. allen voran Verhey, Geist von 1914.
4Damit unterscheidet sich dieses Buch von dem Vorhaben Peter Englunds, der unlängst die Geschichte des Ersten Weltkriegs in 19 Einzelschicksalen über den gesamten Zeitraum des Krieges erzählte, um das »Wie« dieses Krieges zu dokumentieren (Englund, Schönheit und Schrecken, S. 7).
5Diese Überlegungen basieren auf den geschichtstheoretischen Arbeiten von Lucian Hölscher, der sie vor einigen Jahren unter dem Begriff der »Neuen Annalistik« zusammenfassend vorgestellt hat (Hölscher, Neue Annalistik).
6Der Jenaer Historiker Matthias Steinbach hat diesen Gelehrten »wiederentdeckt«: Erst mit seiner Biografie aus dem Jahr 2001 (Steinbach, Biograph) wurde Cartellieris Leben einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Auf dieses Werk stützt sich auch die Darstellung Cartellieris in diesem Buch maßgeblich; überdies konnte der Autor auf die überaus freundliche Unterstützung Steinbachs und seiner Mitarbeiter zurückgreifen.
7Es ist das Verdienst des Verdener Stadtarchivars Björn Emigholz, der Person Gertrud Schädla Konturen verliehen zu haben: 1998 erhielt er aus einer Testamentsvollstreckung die Tagebücher der Lehrerin, die zwischen 1913 und Ende 1918 geführt wurden, und legte sie nach mühevoller Transkription der Öffentlichkeit vor. Das Ergebnis – eine ebenso beeindruckende wie seltene Dokumentation ländlicher Kriegserfahrungen – ist ein Beispiel dafür, wie sehr Geschichtsforschung und -schreibung von solchen Archivprojekten immer wieder profitieren können.
Juni 1914 – Ein Thronfolger wird erschossen
Kaiser Wilhelm II. Ein Monarch feiert sich als »Friedenskaiser«
Dieser Mann hat mehr als einen Titel. Da sind zunächst einmal die offiziellen, denen zufolge Wilhelm II. deutscher Kaiser und König von Preußen ist. Seit 1888 hat der nun 55-Jährige beide Regentschaften inne. In seinem Land (Preußen) wie in seinem Reich (in dem man sich erst allmählich an die preußische Führung gewöhnt hat) wird er allerdings mit durchaus gemischten Gefühlen betrachtet. Es gibt viele Menschen, die sich in dieser wilhelminischen Gesellschaft wohlfühlen, weil sie beispielsweise als Mitglieder des Bürgertums bevorzugt Anteil an Bildung und Einkommen haben oder persönlich von den wirtschaftlichen Erfolgen des Landes profitieren. Andere hingegen beäugen den Kaiser skeptisch – etwa viele Katholiken und vor allem die Anhänger der Sozialdemokratie: Beide hat das offizielle Preußen zu lange als angebliche »Reichsfeinde« denunziert, die innenpolitischen Wunden aus der Zeit des Kulturkampfs und der Sozialistengesetze sind noch nicht verheilt. Und so gibt es gerade bei Katholiken und Sozialdemokraten – aber nicht nur dort – immer auch Kritik an der Person des Kaisers. Sein öffentliches Auftreten, oft genug von markigen Worten und donnernden Reden begleitet, sorgt immer wieder für Ablehnung und Kritik, zuweilen sogar für Spott, der auch vor der körperlichen Beeinträchtigung des Monarchen aufgrund seines verkürzten Arms nicht haltmacht.8
Nein, dieser Kaiser ist nicht unumstritten. Vor diesem Hintergrund ist es deshalb für Wilhelm II. durchaus ein Erfolg, dass das Deutsche Reich Bestand hat. Denn das Reich und sein Kaiser haben bis dato gemeinsam so manche innen- und außenpolitische Krise überstanden. Schon nach der Thronbesteigung als junger Regent im Jahr 1888 hatte Wilhelm seinerzeit den Machtkampf gegen den damals als so übermächtig erscheinenden, aber in die Jahre gekommenen Reichskanzler Otto von Bismarck gewonnen. Bei seinem Amtsantritt, so ist es einmal treffend beschrieben worden, glich das noch vergleichsweise neue Amt des Kaisers einem Haus, in dem die meisten Zimmer noch nie bewohnt waren.9 Wilhelm II. hat sich darangemacht, diese Zimmer zu beziehen, und mit ihm zieht – noch anders als bei seinem Großvater und Reichsgründer Wilhelm I. – so etwas wie politischer Gestaltungswille ein. Wilhelm II. will nicht nur repräsentieren, er will auch regieren. Bereits während der zwei gemeinsamen Jahre mit Otto von Bismarck ist dies deutlich geworden, und im Lauf der folgenden Jahrzehnte versucht der Kaiser, in diesem Sinne zu einer eigenständigen politischen Macht aufzusteigen.
Innen- wie außenpolitisch agiert der Kaiser allerdings bislang nicht immer so, dass man ihn unbedingt als geschickten, vielleicht diplomatischen oder gar weitblickenden Monarchen bezeichnen würde. Im Nachhinein hat man vielmehr oft genug den Eindruck, dass seine persönlichen politischen Impulse für die Reichsleitung im Grunde wenig hilfreich gewesen sind. Seine Abneigung – vielleicht auch Unfähigkeit –, sich über die Entwicklung der Politik erst zu informieren, bevor man sich zu Wort meldet, führt zu bisweilen bizarren und unberechenbaren Interventionen, die so manchen Minister und Reichskanzler nervös aufschrecken lassen. Von den »Launen« des Monarchen ist zuweilen die Rede, wenn er in Sachen »Regierungsverantwortung« wieder einmal vorprescht.10
Doch bei aller Kritik an seinem »Regierungsstil« – eines kann sich Wilhelm nach über einem Vierteljahrhundert Regentschaft zugute halten: Er hat sein Land nie in einen Krieg geführt. Das gefällt ihm – und selbstverständlich auch vielen Menschen im Land. Und so trägt Wilhelm II. einen inoffiziellen Titel, auf den er sichtlich stolz ist, und mit ihm die öffentliche Meinung: »Friedenskaiser«. Tatsächlich erleben die Preußen und Deutschen in dieser Zeit eine ungewohnt lange Phase der Abwesenheit von Krieg. Der Waffengang von 1870/71 liegt über 40 Jahre zurück, und trotz der ungemein starken Präsenz der Armee sowie der demonstrativ zur Schau gestellten Vorliebe des Kaisers für alles Militärische ist das Land schon lange von Kriegen verschont geblieben. Im Jahr 1912 hat ein Nachfahre des berühmten Alfred Nobel sogar vorgeschlagen, den deutschen Kaiser für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen – also ausgerechnet jenen Monarchen, der nicht zuletzt mit seiner bewusst provozierenden Flottenpolitik den offenen Konflikt mit Großbritannien verursacht hat und immer wieder einmal auch über einen »nächsten Krieg« nachdenkt. Der Vorschlag aus Schweden verhallt denn auch ungehört; er hätte übrigens, wie es einmal treffend beschrieben wurde, vermutlich eher »ein schallendes Hohngelächter in aller Welt und zumal bei den Sozialdemokraten im eigenen Land ausgelöst«.11
Aber nicht nur bei den Sozialdemokraten, die Wilhelm ebenso offen verachten wie er sie, erntet der Kaiser Kritik. Tatsächlich hat man sich weder über Wilhelm I. noch über Bismarck so respektlos lustig gemacht wie über Wilhelm II.12 Majestätsbeleidigungen sind bald fast gängige Vorkommnisse, und einige Fälle unbotmäßiger Äußerungen landen vor Gericht, was wiederum günstige Gelegenheiten sind, den Monarchen in der Berichterstattung erneut mit Hohn und Spott zu bedenken. Zu den weniger ehrverletzenden, aber immer spöttisch gemeinten Bezeichnungen gehört die Titulierung Wilhelms als »Reisekaiser«. Dieser Spotttitel hat einen wahren Kern: Der Kaiser ist halt gern und viel unterwegs. Statt »Heil Dir im Siegerkranz« singt man hinter vorgehaltener Hand gerne auch einmal »Heil Dir im Sonderzug« – und eine Berliner Tageszeitung errechnet für 1893, dass der Kaiser allein in diesem Jahr mehr als 200 Tage auf Reisen war. Tatsächlich kommt Wilhelm im In- und Ausland gleichermaßen herum. Regelmäßig ist er zwischen Wilhelmshaven und Schlesien, zwischen der Mark Brandenburg und Elsass-Lothringen, zwischen den Wiesbadener Maifestspielen und der Kieler Woche unterwegs – das kaiserliche Reisekarussell dreht sich unaufhaltsam und für Hof und Öffentlichkeit weitgehend erwartbar. Hinzu kommen die Fernreisen, die Wilhelm unter anderem nach Palästina, nach Italien und immer wieder nach Korfu führen, wo er 1907 übrigens auch das Schloss Achilleion erwarb, das sich die neun Jahre zuvor gestorbene österreichische Kaiserin Elisabeth (»Sissi«) dort hatte erbauen lassen.13
»An Kaisers Geburtstag mußten achtjährige Abc-Schützen in einer Standesschule Sachsens auf Geheiß der Lehrerin folgenden Satz auf die Tafel niederschreiben: ›Der Deutsche Kaiser heißt Wilhelm und wohnt in Berlin.‹ Zu Hause sollten die Kleinen selbst einen Satz dazuschreiben, der quasi die Fortsetzung des ersten Satzes bildete. Ein Abc-Schütze, der nicht weiß, was er schreiben soll, wendet sich an seinen Vater um Rat und Auskunft. Dieser diktiert ihm folgenden Satz als Fortsetzung in den Griffel: ›An seiner Türe hängt ein Briefkasten mit der Inschrift: Verreist! Nicht zu Hause!‹«
(Simplicissimus, 1911, Heft 47)14
Einen besonderen Platz in Wilhelms Reisekalender nehmen die sogenannten Reisen nach »Nordland« ein. Unter dieser Bezeichnung versteht der Kaiser in einem engeren Sinne Norwegen. Insgesamt 26-mal sticht Wilhelm in See – anfangs noch mit dem veralteten, räumlich ziemlich beengten Raddampfer »Hohenzollern (I)«, dann mit der neuen »Hohenzollern (II)«, einer in jeder Hinsicht zeitgemäßen Dampfjacht, die sich im Mobilisierungsfall übrigens rasch umrüsten und militärisch nutzen lässt.15 Auf seiner Jacht fühlt sich der Regent sicher und frei. Er bestimmt, wer ihn auf diesen Fahrten begleiten darf, hier kann er sich ohne Rücksicht auf die in dieser Hinsicht ebenfalls herzhaft spottende Öffentlichkeit seiner Vorliebe für Uniformen hingeben und mehrmals am Tag neue Garderobe anlegen. Sicherlich tritt man Wilhelm nicht zu nahe, wenn man ihn auch als »Verkleidungskünstler von Gnaden« betitelt16: Leidenschaftlich gern wechselt er die Uniformen. Als ginge es um einen »martialischen Karneval«, tritt er mal in preußischen Regimentsuniformen auf, mal in ausländischen Uniformen (schließlich bekleidet er bei österreichischen, russischen oder englischen Regimentern offiziell die Stellung eines Ehrenkommandeurs), mal auch in historischen Kostümen, wobei er hier besonders jene aus friderizianischer Zeit bevorzugt: Schließlich ist Friedrich der Große eines der großen Idole des Kaisers.17
Sowohl Wilhelms Leidenschaft für die Seefahrt als auch seine regelmäßigen Jachttouren sind immer ein öffentliches Thema, denn aus der privaten Vorliebe ist längst eine politische Passion geworden. Der Flottengedanke hat derart von Wilhelm Besitz ergriffen, dass er zu einer Frage von Krieg und Frieden geworden ist. Seit seiner Thronbesteigung hat der Kaiser keinen Hehl aus seiner Vorliebe für die Marine gemacht, oft genug gibt er fortan Anlass zur Vermutung, er würde bei öffentlichen Anlässen hohen Marineoffizieren den Vorzug vor den Generälen des Heeres gewähren. Seit Mitte der 1890er-Jahre ist der Bau von Schiffen ein zentraler Bestandteil der sicherheits- und außenpolitischen Überlegungen Wilhelms, und auch in der Öffentlichkeit wird dieser Kurs von einer immer weiter um sich greifenden Zustimmung für den Flottenbau eskortiert. So lässt sich das Deutsche Reich wissentlich und – betrachtet man die enorme Propaganda für diesen politischen Kurs – geradezu mit Pauken und Trompeten auf ein maritimes Wettrüsten mit der traditionellen Seemacht Großbritannien ein. Wilhelm, direkter Oberbefehlshaber der Marine, ist bald vom Bedarf an Schiffen derart überzeugt, dass er schließlich in fast jeder internationalen Krise – und von diesen gibt es zu dieser Zeit einige – eine Lektion für den Vorrang der Seemacht auszumachen glaubt.18 Man werde England notfalls »totrüsten«, heißt es manchmal. Der Aufbau der deutschen Flotte ist zum schier überragenden Symbol deutscher Großmachtpolitik geworden19 – und Wilhelm gibt diesem Symbol ein Gesicht.
»Man muß in die Zukunft blicken und danach trachten, sein Land kräftig und wehrhaft zu machen, um auf alle Fälle gerüstet zu sein, falls man selbst dereinst vom Herrn zum Rüstzeug ausgewählt werden könnte!? Darum ist es im Interesse des Weltfriedens sowohl als auch der niederländisch-friesischen Rasse auf dem Kontinent, daß eine mächtige Flotte auf dem Meere sei! Schwimmt sie erst, dann wird, wie in alter Zeit, Oraniens und Brandenburgs Banner auf allen Wassern nebeneinander wehen.«
(Wilhelm II. im Jahr 1900)20
In seiner Vorliebe für die Flotte vermischen sich viele Vorstellungen Wilhelms: seine fraglos immer wieder aufkommenden Weltmachtfantasien, seine Begeisterung für Erhalt und Ausweitung des Kolonialbesitzes sowie schließlich seine kruden Rassengedanken – immer wieder spricht er etwa vom »Kampf zwischen Germanen und Slawen«. Die Umgestaltung der Weltkarte – wie es zu dieser Zeit immer wieder heißt – ist gleichermaßen Hoffnung wie Bedrohung für ein Land wie das Deutsche Reich. Es geht um Weltgeltung (und dies nicht nur bei Wilhelm II. – hier weiß er das stolze Bürgertum und selbstverständlich die Militärs hinter sich) und um den angemessenen Platz der Deutschen in einer Welt, die in den Jahrzehnten zuvor zunächst territorial neu aufgeteilt wurde und in der nun die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen geltend gemacht werden. Ein möglicher Krieg hat in diesen Vorstellungen durchaus seinen Platz. Mehr als einmal hat der Kaiser in seiner Regentschaft bereits vor der Frage gestanden, ob nicht ein Waffengang der angemessene Schritt sei. Doch immer wieder schreckt Wilhelm davor zurück, worüber sich die militärische Führung verärgert zeigt.
Im Nachhinein könnte man spöttisch behaupten, dass die Zurückhaltung hinsichtlich eines Krieges mit dem großen Jubiläum zu begründen sei, das Wilhelm im Jahr 1913 feiert: sein 25-jähriges Thronjubiläum. Das will er gern friedlich begehen, denn schon 1911 erlässt er erste Anweisungen, wie und wo er das große Ereignis zu feiern gedenke. Es findet schließlich im Juni 1913 in Berlin statt – mit großen Umzügen und Versammlungen. Es gibt dabei ebenso eine Parade der Schornsteinfeger wie ein demonstratives Treffen aller Universitätsrektoren, ein großes Galadiner und eine – für die kleinen Gauner im Lande nicht ganz unwichtige – kaiserliche Amnestie, nach der den Internierten in allen Bundesstaaten Haftstrafen von unter drei Monaten erlassen werden.21 Für Wilhelm ist es wichtig, dass bei diesem Jubiläum wiederholt jenes Bild von ihm gezeichnet wird, das ihm fraglos besonders gut gefällt und das jetzt und in den kommenden Monaten immer wieder (auch von ihm selbst) besonders bemüht wird: das des »Friedenskaisers«. »Er, der das mächtigste Kriegsinstrument in seiner Hand hält«, so heißt es in einer Laudatio im Juni 1913, »hat es benutzt, nicht um kriegerische Lorbeeren zu pflücken, sondern um uns und der Welt den Frieden zu bewahren.«22 Genau das ist es, was der Kaiser hören will.
Nun ist das mit dem Bewahren des Friedens im Sommer 1914, ein Jahr nach diesem friedlichen Jubiläum, allerdings eine besondere Herausforderung. Von anderen internationalen Krisen einmal abgesehen, bereitet Politik und Öffentlichkeit vor allem die Lage auf dem Balkan Sorgen, wo sich die Spannungen in der konfliktreichen Beziehung zwischen Österreich-Ungarn und Serbien zuspitzen. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern hat sich seit einigen Jahren drastisch verschlechtert, da sich die serbische Außenpolitik vom Habsburgerreich abgewendet und entschieden an die Seite Russlands gestellt hat. Belgrads Verhältnis zu Wien hat sich permanent verschlechtert – anfangs scheiterte ein eigentlich vereinbartes Waffengeschäft, dann brach 1906 ein regelrechter Zollkrieg aus. Beide Länder belegten die Waren des jeweils anderen mit hohen Zöllen, sodass sie kaum noch ökonomisch sinnvoll eingeführt werden konnten. Das betraf auf serbischer Seite vor allem den wichtigsten Exportartikel Belgrads: Schweine – weshalb der Konflikt auch die Bezeichnung »Schweinekrieg« erhielt. Dieser vergiftete das Verhältnis zwischen Belgrad und Wien nachhaltig, und durch die Annexion Bosnien-Herzegowinas durch Österreich wurde es 1908 noch zusätzlich gestört (die Gründung der berüchtigten serbischen Geheimgesellschaft »Schwarze Hand« fiel in diese Zeit und ist nur vor dem Hintergrund dieser Spannungen verständlich). Auch als der »Schweinekrieg« 1911 schließlich beendet war, kehrte keine Normalität ein – es blieb ein Misstrauen zurück, das zutreffend als »serbische Todfeindschaft gegenüber der Habsburgermonarchie« bezeichnet wurde.23 Da sich das Deutsche Reich in diesen Jahren – demonstrativ und zum Missfallen der Großmächte Russland und Großbritannien – auf die Seite Österreich-Ungarns gestellt hat, sind Deutschland und sein Kaiser indirekt schon lange von diesen Konflikten berührt. Die vielzitierte »Nibelungentreue« Berlins zu Wiens ist längst offenkundig.
Die Spannungen auf dem Balkan eskalieren im sogenannten Ersten Balkankrieg von 1912, in dem Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland dem Osmanischen Reich den Krieg erklären. Dem Friedensschluss von London 1913 folgt allerdings bald darauf der Zweite Balkankrieg, in dem bulgarische Truppen die griechische und die serbische Armee angreifen. Diese Kriege haben nicht nur zwischenzeitliche Grenzveränderungen und Gebietsabtretungen zur Folge, sondern sind begleitet von ethnischen Verschiebungen und mörderischer Gewalt gegen Zivilisten. Die Spannungen zwischen den Ländern und Volksgruppen auf dem Balkan bleiben bestehen, das Bild vom »Pulverfass« ist nicht falsch – jederzeit können auf dem Balkan neue Konflikte aufflammen und eskalieren.
Noch sind die Großmächte indes nicht unmittelbar in das Kriegsgeschehen involviert. Auch Deutschland nicht. Doch wenn man so will, lässt sich sagen, dass ein großer Krieg längst mental vorbereitet wird: Es scheint, als warteten die Menschen im Deutschen Reich auf einen Krieg, als sähen sie ihn kommen, ohne ihn wirklich noch verhindern zu können. Dabei ist nicht nur von Bedeutung, dass die Krieger-, Wehr- und Flottenvereine im Lande längst der Regierung das Heft des Handelns aus der Hand genommen zu haben scheinen. Die Militarisierung der wilhelminischen Gesellschaft kann als prägendes Moment gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Es herrscht seit Langem schon ein Gesinnungsmilitarismus, der nicht mehr künstlich beschworen werden muss, weil er schon längst ein allgemein akzeptierter Bestandteil des Alltagslebens geworden ist und alle Poren der Gesellschaft durchdrungen hat.24 Musste allein das nicht irgendwann zu einem Krieg führen? In diesem Sinne notiert der angesehene Anglist Levin Ludwig Schücking in einem privaten Brief im Juni 1913: Der Militarismus werde letztlich eine »Riesen-Kriegs-Orgie« feiern. »Praktisch muß jedes Kind erkennen: Es kann nichts anderes dabei herauskommen.«25
Kann es wirklich nicht anders kommen? Für den Juni 1914 lässt sich beobachten, wie sehr in der deutschen Öffentlichkeit die Meinung an Boden gewonnen hat, dass früher oder später mit einem großen europäischen Krieg gerechnet werden müsse, ob man wolle oder nicht.26 Längst hat sich die Vorstellung durchgesetzt, der gordische Knoten einer deutschen »Weltpolitik« könne nur in einem europäischen Krieg durchschlagen werden – wodurch sich zugleich nicht nur in der deutschen Politik, sondern auch in der deutschen Bevölkerung eine eigentümlich fatalistische Stimmung der Kriegserwartung herausgebildet hat.27
Die deutschen Militärs glauben sich für einen solchen Fall gut vorbereitet. Sie wünschen sich schon lange einen Präventivkrieg, der seit Jahren zu einer festen Denkfigur der deutschen Generalität geworden ist. Für sie steht nicht infrage, ob es zu einem großen Krieg kommen werde, sondern nur noch, wann man sich zu diesem entschließen müsse, um ihn auch erfolgreich bestehen zu können. In diesem Juni 1914 empfiehlt Helmuth von Moltke – als Chef des Großen Generalstabs zugleich der oberste Heerführer im Land – erneut einen solchen Präventivkrieg. »Wir sind bereit«, erklärt er am 1. Juni, »und je eher, desto besser für uns.«28 Vor allem Russland gilt als aktuelle, aber zu bewältigende Bedrohung. Moltke hat im Februar 1914 eindringlich vor der »Kriegsbereitschaft Rußlands« gewarnt; und als diese Einschätzung in die Öffentlichkeit gelangt, entspinnt sich eine Pressefehde, an der sich sogar der russische Kriegsminister Suchomlinow beteiligt. Und der Kaiser? Der tut selbst das Seine dazu, den Eindruck von der russischen Strategie eines gewollten Waffenganges zu verfestigen, um Deutschland als potenziell gefährdet dastehen zu lassen: Es drohe ein Krieg, und einen solchen würden er und sein Land fraglos auch führen.
»Ich als Militair hege nach allen Meinen Nachrichten nicht den allergeringsten Zweifel, daß Russland den Krieg systematisch gegen uns vorbereitet; und danach führe ich meine Politik.«
(Wilhelm II. im März 1914)29
Doch trotz starker Worte schreckt Wilhelm II. vor einem tatsächlichen Waffengang noch zurück. Sicher: Angesichts der großspurigen, aggressiven und sorglosen Wortwahl bei seinen ohnehin oft unbedachten Äußerungen und Reaktionen fällt es nicht schwer, ihn als »eingefleischten Kriegshetzer« zu bezeichnen.30 Doch tatsächlich zögert er, wenn es um einen Präventivkrieg geht. Damit gerät er in Gegensatz zu seinen Militärs, vor allem Generalstabschef Moltke. Wilhelm II. sieht sich an diesem Punkt fraglos unter Druck gesetzt, und dies nicht nur, weil es um Krieg und Frieden geht. Zunächst geht es einmal um seine eigene Position. Er weiß leider selbst allzu gut, dass er keineswegs der starke Mann der deutschen Politik ist, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Vielmehr ist sein tatsächlicher Einfluss auf die aktuellen Entscheidungsprozesse in den zurückliegenden Jahren immer geringer geworden. Es existiert eine vom Kaiser selbst so genannte »nichtparlamentarische« Beamtenregierung, die zwar peinlich genau darauf achtet, in der Öffentlichkeit nicht in einen Gegensatz zum Kaiser zu geraten. Doch aus der Tagespolitik wird Wilhelm II. inzwischen weitgehend herausgehalten oder entsprechend gelenkt.31 Die Reichsleitung hat ihn schrittweise in den Hintergrund gedrängt, sodass die öffentlichen Äußerungen des Kaisers vielfach gesteuert oder sogar nachträglich zensiert werden.32 Aber unabhängig von der Frage, wie stark Wilhelms Position innerhalb des Machtgefüges nun wirklich ist – ohne ihn geht zumindest hinsichtlich eines Krieges nichts. Er ist schließlich der Kaiser. Ohne ihn kann das Land nicht in den Krieg ziehen, gegen seinen Willen erst recht nicht. Der Kaiser muss vorangehen, ohne ihn ist schließlich formal keine Mobilisierung der deutschen Truppen und keine Kriegserklärung möglich.
Dieser Schritt rückt im Juni 1914 möglicherweise näher, weil es auf dem Balkan erneut zu diplomatischen Verwicklungen kommt. Zwischen Griechenland und der Türkei gibt es Streit wegen der Zugehörigkeit einiger Inseln. Wilhelm hat jetzt große Sorge, dass das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn im Kriegsfall einer Übermacht von Feinden gegenüberstehen könnten – nicht nur Russland und Frankreich, sondern möglicherweise auch noch Großbritannien. Gegen eine solche Koalition will der Kaiser keinen Krieg führen, und so baut er im Juni 1914 fest darauf, dass Großbritannien in einem europäischen Konflikt neutral bleiben würde. Das ist allerdings ziemlich naiv. Doch der Vorwurf der Naivität richtet sich nicht nur gegen den Kaiser, sondern auch gegen die politische Führung: Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hat ebenso wie Gottlieb von Jagow, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, immer versichert, Großbritannien werde einen europäischen Konflikt verhindern.Als Berlin hingegen durch einen Agenten von den britisch-russischen Flottenverhandlungen erfährt, die Großbritannien sehr wohl als potenzielle Partei in einem Krieg erscheinen lassen, ist diese Annahme nunmehr unrealistisch. Der Kaiser jedenfalls reagiert geradezu hysterisch, weil er jetzt tatsächlich den großen Krieg nahen sieht, von dem immer die Rede war: Es komme bald »das III. Kapitel des Balkankriegs«, erklärt er, »an dem wir alle betheiligt sein werden«33.
In dieser politisch brisanten Situation des Juni 1914, in der Wilhelm immer noch eine Politik der Friedenswahrung vorzieht, bricht er zu einem Freundschaftsbesuch auf: Er trifft sich mit dem österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Zwischen den beiden besteht eine demonstrative Freundschaft, die auch diplomatische Beachtung findet. Seinen österreichischen Freunden hatte Wilhelm schon vor Jahren erklärt: »Ich halte zu Euch durch dick und dünn« – und als er sich 1908 mit dem Thronfolger zu einem gemeinsamen Jagdausflug getroffen hatte, hatte dies angesichts der schwelenden Balkankrise und der erwähnten Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich-Ungarn international für große Beunruhigung gesorgt.34 Jetzt, im Juni 1914, nimmt Wilhelm also wieder eine Einladung des österreichischen Thronfolgers an; vom 12. bis 13. Juni ist er zu Gast bei Franz Ferdinand auf dessen südlich von Prag gelegenem Jagdschloss Konopischt. Offiziell lässt man verlauten, Wilhelm sei gekommen, um eine Jagdeinladung des Erzherzogs anzunehmen – der deutsche Kaiser ist bekanntermaßen ein begeisterter Jäger, was diese Einladung zumindest offiziell nachvollziehbar macht. Aber jeder Beobachter weiß, dass ein solches Treffen immer auch eine willkommene Gelegenheit bietet, die aktuelle politische Lage zu besprechen – in diesem Fall die Lage auf dem Balkan.
In der deutschen Öffentlichkeit wird das Bekanntwerden dieser Zusammenkunft deshalb aufmerksam verfolgt, weil der Kaiser auf seinen Wunsch unter anderem von Alfred von Tirpitz, dem Chef des Reichsmarineamtes, begleitet wird. »An unterrichteten Stellen wird mit Entschiedenheit erklärt, daß jeder politische oder marinepolitische Zweck beim Jagdbesuch des Großadmirals ausgeschlossen ist«, heißt es schon Tage zuvor beschwichtigend in den Zeitungen.35 Das Treffen wird also fraglos als politische Zusammenkunft wahrgenommen und interpretiert: »Daß der Zar genau in diesen gleichen Tagen seinen Besuch des rumänischen Bodens veranstaltet, erscheint förmlich wie eine Gegenkundgebung gegen die Konopischte Begegnung.«36 Russland reagiert also empfindlich auf die »private« Jagdeinladung und stärkt einem potenziellen Gegner Österreichs – und entsprechend der Logik einer »Nibelungentreue« auch Deutschlands – den Rücken.
Wenn anschließend erklärt wird, dass an diesen beiden Tagen im Jagdschloss von Konopischt kein Kriegsrat gehalten worden ist, darf man aber wohl davon ausgehen, dass das Treffen der Versicherung gegenseitiger Positionen gedient hat. Franz Ferdinand zeigt sich überzeugt, dass ein Krieg Österreich-Ungarns auf dem Balkan notwendigerweise den Kriegseintritt Russlands provozieren werde. Aber Kaiser Wilhelm will sich trotz des Drängens des Erzherzogs »noch« nicht auf eine bedingungslose Unterstützung Österreichs einlassen.37 Angeblich hat sich der greise Kaiser Franz Joseph I. in Wien eine solche Zusicherung gewünscht, doch einer anschließend kolportierten Äußerung des Erzherzogs zufolge sei Wilhelm »der Frage ausgewichen und die Antwort schuldig geblieben«38. Wieder einmal, so kann man es deuten, schreckt der deutsche Regent vor dem entscheidenden Schritt in Richtung Krieg zurück.
Nach seinem Jagdausflug ins böhmische Konopischt warten in diesem Juni daheim indes erst einmal zahlreiche repräsentative Pflichten auf den deutschen Kaiser. Dazu zählt in den folgenden Tagen ein Treffen mit Vertretern der katholischen Kirche, aber auch die Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Großherzog in Neustrelitz oder die offizielle Eröffnung des »Hohenzollernkanals«, des nun fertiggestellten Großschifffahrtswegs von Berlin nach Stettin.39 Dieser Termin ist fraglos auch nach dem persönlichen Geschmack des Kaisers, schließlich geht es dabei um Schiffe und Schifffahrt.
Ohnehin freut sich Wilhelm sicherlich bereits auf das maritime Großereignis des Jahres, die Kieler Woche. Wie jedes Jahr wird er als Initiator dieses Festes selbstverständlich persönlich daran teilnehmen. Seine Jacht ist bereits präpariert und nimmt zunächst ohne ihn Kurs Richtung Kieler Förde. Der Kaiser selbst erledigt auf dem Weg dorthin noch die ein oder andere Aufgabe eines Staatsoberhaupts: Über Hannover – wo er eine Landwirtschaftsausstellung besucht40 – führt ihn die Reise gen Norden, zunächst nach Hamburg. Dort erwartet ihn noch eine besondere Freude. Der dritte für die Schifffahrtslinie Hapag gebaute Schrauben-Schnelldampfer soll bei dieser Gelegenheit seinen offiziellen Namen erhalten: Nach der »Imperator« und der »Vaterland« wird dieser Gigant nun auf den Namen »Bismarck« getauft (ausgerechnet Bismarck, mag man mit Blick auf die Beziehung zwischen dem alten Reichskanzler und dem damals jungen Kaiser denken). Diese riesigen Schiffe – die damals größten der Welt – sind genau nach dem Geschmack Wilhelms, denn sie sind – und da weiß er die öffentliche Meinung in Deutschland hinter sich – bestens dazu geeignet, das »Ansehen des deutschen Namens in alle Welt« zu tragen.41
»Am Sonnabend fand auf der Werft von Blohm & Voß in Gegenwart des Kaisers der Stapellauf des neuen, 291 Meter langen Hapag-Dampfers statt. Das gewaltigste Schiff, das jemals von dieser Erde zum Meere ging, trägt den Namen des gewaltigsten Deutschen: ›Bismarck‹. […] Gräfin Hannah Bismarck, des Fürsten Herbert älteste Tochter, vollzog den Taufakt. […] Aber die Flasche Schaumwein hatte ein zähes Leben und wollte sich nicht von zarter Frauenhand so leicht den Garaus machen lassen. Da nahm sie kurz entschlossen der Kaiser selbst beim Wickel, schleuderte sie mit scharfem Wurf gegen den Schiffsleib, daß sie in Scherben klirrte und sprudelnd ihr schäumendes Naß über den Bug goß.«42
Schon in Hamburg residiert der Monarch auf der mittlerweile eingetroffenen »Hohenzollern«, sodass er – wie bei solchen Reisen üblich – den sonntäglichen Gottesdienst an Bord feiern kann. Seine Repräsentationspflichten führen ihn zunächst noch nach Altona (die zu diesem Zeitpunkt noch eigenständige Stadt feiert ihr 250-jähriges Jubiläum), in den Hagenbeck’schen Tierpark (eine bereits reichsweit bekannte Attraktion) sowie zu einem Treffen mit Albert Ballin, dem bekannten Reeder und Generaldirektor der Hapag, mit dem der Kaiser regelmäßigen, auch privaten Kontakt pflegt.43 Das jetzige Treffen hat allerdings auch Bedeutung für die Frage von Krieg und Frieden: Ballin ist von der Reichsleitung zu Sondierungsgesprächen nach London geschickt worden, um zu erfahren, wie es tatsächlich um britisch-russische Flottenverhandlungen steht. Jetzt will der Kaiser von ihm wissen, ob es auch angesichts der vermeintlichen russischen Kriegsvorbereitungen »nicht besser wäre loszuschlagen, anstatt zu warten«. Allerdings hat der Reeder selbst den Eindruck, dass Wilhelm, ungeachtet des Ernstes der Lage, noch immer den Frieden bewahren will.44
Anschließend verlässt Wilhelm II. Hamburg an Bord seiner Jacht elbabwärts Richtung Brunsbüttel. Dort trifft er am 23. Juni ein und besichtigt aus gegebenem Anlass auch die Kanal- und Hafenanlagen45 – schließlich ist in diesem Jahr die Vertiefung und Erweiterung des Kaiser-Wilhelm-Kanals (heutiger Name: Nord-Ostsee-Kanal) zwischen Nord- und Ostsee erfolgreich abgeschlossen worden. Die kaiserliche Jacht durchquert demonstrativ den Kanal und erreicht auf diesem Weg Kiel. Auch hier nimmt Wilhelm an den Einweihungsfeierlichkeiten der neuen Schleusen teil46, ehe er endlich in das große Spektakel der Kieler Woche eintaucht. Der Kaiser selbst hat dieses politisch-gesellschaftliche Großereignis ins Leben gerufen, um öffentlichkeitswirksam – und für die übrigen Nationen erkennbar – für seine Lieblingsidee von Deutschlands Zukunft auf dem Wasser zu werben. Wilhelm II. hält hier Hof im Kreise der Mächtigen und Reichen: Europäische Fürsten und amerikanische Millionäre, rheinische Großindustrielle und hanseatische Patrizier kommen nach Kiel und nehmen mit ihren schicken Segeljachten auch an der kaiserlichen Regatta teil.
Manchem in der kaiserlichen Umgebung mag das nicht gefallen, weil das Treiben auf den Schiffen und das Auftreten des Monarchen in dieser Umgebung nicht höfisch genug anmutet. Für standesbewusste Adlige ist allein schon die Zusammensetzung der Gäste auf der kaiserlichen Jacht schwer zu ertragen – sie sehen einen »von Hofadligen, Professoren und angeblich sogar von jüdischen Finanzmagnaten umringten König, der seine altadligen Generale an Deck zu unwürdigen Leibesübungen zwang«, und dies noch an Bord eines modernen Stahlschiffs wie der »Hohenzollern«.47 Das ist nicht mehr die alte Welt des traditionsbewussten Adels. Doch Wilhelm genießt diese Tage und ihr ganz eigenes Flair: Es geht elegant zu, sportlich und modern – und fast ist alles so schick wie bei den britischen Segeltagen in Cowes, die Wilhelm als Kronprinzen einst imponiert hatten.48 Der Kaiser hat sich bis zu einem gewissen Grad am englischen Vorbild orientiert, und an den geselligen Runden des Kaisers nehmen jetzt oft auch Offiziere der britischen Royal Navy teil.49
Die Kieler Woche des Jahres 1914 ist geprägt von einer beachtlichen Ansammlung imposanter Schiffe sowie von hohem Besuch aus dem Ausland. Zugleich findet wieder einmal ein »heimlicher Stärkevergleich« zwischen britischer und deutscher Marine statt. Diesmal (und das empfindet Wilhelm II. fraglos als Ehre) besteht das britische Geschwader aus vier Schlachtschiffen und drei Kreuzern, die an der Förde gemeinsam mit den modernsten deutschen Schlachtschiffen im Wasser liegen. Nur eine Einladung des britischen Marineministers Winston Churchill, wie dies Wilhelms Vertrauter Albert Ballin angeregt hat, ist nicht zustande gekommen.50 Aber auch so sind die deutsch-britischen Begegnungen standesgemäß: Zunächst nimmt Wilhelm am 24. Juni auf seiner Jacht die Meldungen der englischen Schiffskommandanten entgegen, am 25. Juni besucht er selbst das englische Flaggschiff »King George V.«, abends sind dann die britischen Gäste erneut auf der »Hohenzollern«.51
Die Tage verlaufen ganz im Sinne des Kaisers. So kann er am Freitag, dem 26. Juni, bei herrlichem Wetter an Bord seiner eigenen Segeljacht »Meteor« am Wettsegeln teilnehmen. Am Abend ist er wieder umworbener Gastgeber auf seiner »Hohenzollern«, wobei unter anderem der US-amerikanische Botschafter zu Gast ist.52 Zuvor allerdings nimmt der Kaiser beim Verlassen des kaiserlichen Jachtklubs noch eine ganz besondere Parade ab: Am Strandweg haben rund 1000 Veteranen Aufstellung genommen, die 50 Jahre zuvor im Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 am inzwischen mythisch verklärten Sturm auf die Düppeler Schanzen teilgenommen haben. Wilhelm II. nimmt sich die Zeit, das – wegen des hohen Alters der Veteranen langsam vonstatten gehende – Defilee grüßend anzuschauen und anschließend sogar noch mit einigen ehemaligen Soldaten und Generälen persönlich zu sprechen.
»Der Kaiser schritt die Fronten ab, indem er von Gruppe zu Gruppe einen ›Guten Abend, Veteranen!‹ entbot, welches kräftig erwidert wurde, und zeichnete viele der alten Leute durch freundliche Ansprachen aus, besonders solche, welche das Eiserne Kreuz trugen. Dann wurde zum Parademarsch angetreten. Die Kapelle des Seebataillons setzte mit dem Düppelmarsch ein, in einem nicht allzu schnellen Tempo, und nun zogen die alten Düppelstürmer vorüber, keiner unter 70 Jahren, entblößten Hauptes, voran die Generäle und Exzellenzen, dann die Oesterreicher. Der Kaiser grüßte andauernd.«53
Es liegt nicht nur an dieser Mischung an politischen Begegnungen, gesellschaftlichem Vergnügen und sportlichem Treiben, dass späteren Betrachtern die Kieler Woche von 1914 »als die letzte große Friedensveranstaltung« gilt.54 Tatsächlich erlebt das Fest am Sonntag, dem 28. Juni, eine dramatische Wende. Wilhelm II. hat diesen Tag mit dem obligatorischen sonntäglichen Gottesdienst an Bord seiner »Hohenzollern« begonnen, ehe er um zehn Uhr zur »Meteor« übersetzt, mit der er an der angesetzten prestigeträchtigen Regatta teilnehmen will. Die Botschaft, die die Welt verändern sollte, trifft gegen 16 Uhr am Nachmittag ein: Ein kleines motorgetriebenes Hafenschiff hält auf die kaiserliche Segeljacht zu, darf aber (so viel Fairplay muss sein) entsprechend den strengen Regeln des Segelsports nicht an der »Meteor« anlegen. Doch augenscheinlich bringt das kleine Schiff wichtige Nachrichten, denn an Deck steht aufgeregt winkend Admiral Georg von Müller höchstselbst, immerhin Chef des Marinekabinetts. Offensichtlich hält er ein Telegramm in den Händen, das er seinem obersten Befehlshaber überreichen will. Da er nicht anlegen darf, zückt er kurzerhand sein Zigarettenetui, steckt das Telegramm hinein und wirft alles zusammen in hohem Bogen an Bord der kaiserlichen Segeljacht. Ein Matrose hebt das Etui auf und bringt die offensichtlich so wichtige Nachricht direkt zum Kaiser, der das Telegramm sofort liest:55
»Sarajewo, den 28. Juni, um 12 Uhr.Seiner Majestät, Kiel.Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit Erzherzog Thronfolger und Höchstdessen Gemahlin sind soeben Opfer eines Revolverattentats geworden.
Generalkonsul Eiswaldt«56
Der Kaiser bricht die Regatta sofort ab und kehrt zur »Hohenzollern« zurück; die Kieler Woche wird angesichts der dramatischen Ereignisse vorzeitig beendet. Wilhelm ist bestürzt und empört über das Geschehen in Sarajevo. Erst zwei Wochen zuvor hat er noch in Konopischt den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Gemahlin Sophie getroffen. Ihr Verhältnis war gut, der deutsche Kaiser fühlte sich dort wohl, weil er bei dem Paar stets ein gern gesehener Gast war. Und das aus gutem Grund: Wilhelm behandelte Sophie mit einer Herzlichkeit, die sich vom ansonsten gepflegten Ton am österreichischen Hofe deutlich abhob. Denn in Wien wurde Sophie wegen ihrer Herkunft aus einem verarmten tschechischen Adelsgeschlecht schlecht behandelt – als Franz Ferdinand sie heiratete, hatte man ihn deshalb sogar gezwungen, für sie und ihre Kinder auf das Recht der Thronfolge zu verzichten.57
Ausgerechnet der als launisch geltende deutsche Kaiser hat durch sein freundliches Auftreten gegenüber der Gemahlin eine besondere Beziehung zum Paar – und ist über dessen Ermordung auch persönlich betroffen. Einerseits sicherlich deshalb, weil mit dem Tod Franz Ferdinands auch Wilhelms stabiles Verhältnis zum Zukunftsträger des wichtigsten deutschen Bündnispartners Österreich-Ungarn zerstört ist, andererseits aber auch wegen der Todesumstände selbst. Es liegt schließlich erst gut zehn Jahre zurück, dass geradezu eine Welle von Attentaten auf gekrönte Häupter durch Europa ging: 1898 war die österreichische Kaiserin Elisabeth erstochen worden, 1900 hatte es einen Mordanschlag auf den Prinzen von Wales gegeben, im selben Jahr fiel König Umberto von Italien einem Attentat zum Opfer. Auch Wilhelm II. war ins Visier geraten: 1900 schleuderte bei einem Besuch in Breslau eine angeblich geistesgestörte Frau ein Beil in den Wagen des Kaisers, ohne dass jemand verletzt wurde, 1901 warf in Bremen ein junger Arbeiter eine Eisenschnalle nach Wilhelm II., die ihm knapp unterhalb des rechten Auges eine vier Zentimeter lange Wunde zufügte. Diese Attacken hatten Auswirkungen auf die nervliche Verfassung des Monarchen – aus den Attacken schloss er deprimiert, dass monarchische Gesinnung und Achtung vor der Autorität auf dem Rückzug seien.58
Im Juni 1914 hatte eine weitere Meldung die Öffentlichkeit aufgeschreckt: Angeblich war versucht worden, das russische Zarenpaar mit einer Bombe zu töten – es blieb indes unverletzt.59 Dass also im Juli 1914 ein Thronfolger ermordet wird, ist somit in gewisser Hinsicht ein schreckliches Ereignis in einer Kette von vielen anderen Attentaten. Aber diesmal – und das ließ Europa fraglos aufhorchen – geschieht es zu einer politisch brisanten Zeit und an einem symbolträchtigen Ort mitten in einem höchst unruhigen Land. Auch der Tag des Attentats ist ein besonderer: Nicht nur, weil das österreichische Thronfolgerpaar dem Anschlag ausgerechnet an seinem Hochzeitstag zum Opfer fällt60 – zugleich ist dieser 28. Juni auch der Jahrestag der sogenannten Schlacht auf dem Amselfeld, bei der die Serben im Jahr 1389 eine furchtbare Niederlage gegen die Türken erlitten hatten. Grund genug für den serbischen Geheimbund »Vereinigung oder Tod« – besser bekannt als »Schwarze Hand« –, gerade diesen Tag für ein politisches Fanal zu nutzen. Fast wäre der Anschlag übrigens gescheitert: Dem Bombenattentat auf ihren Wagen entgehen Franz Ferdinand und Sophie noch, erst als sie kurze Zeit später die dabei Verletzten besuchen wollen, nutzt einer der noch unentdeckten Verschwörer, Gavrilo Princip, die unerwartete zweite Chance und feuert mit einem Revolver auf sie.
»Das schreckliche Ereignis hat alle Herzen im Innersten aufgewühlt. […] Tief gebeugt, ins Innerste getroffen, empfangen die Völker der Monarchie diese grausame Fügung. Ihren Schmerz teilt die ganze gesittete Welt, die einig ist in dem Abscheu vor dem unmenschlichen Verbrechen, und schon heute liegen unzählige Kundgebungen trauervoller Teilnahme vor, welche die hohe Verehrung bezeugen, die dem verewigten Prinzen und seiner Gemahlin dargebracht wurde.«61
In den europäischen Hauptstädten löst die Nachricht vom Mord in Sarajevo tatsächlich einen Schock aus, aber deshalb denkt in diesem Moment – jedenfalls außerhalb von Österreich – kaum jemand ernsthaft an einen Krieg.62 Später wird man urteilen, dass die Ereignisse rund um dieses Attentat eigentlich einen zweitrangigen Konflikt darstellen, der allerdings angesichts der angespannten internationalen Lage den seit Jahren angehäuften Zündstoff zur explosiven Entladung bringt. Tatsächlich sind die führenden Kreise Österreich-Ungarns bereits jetzt entschlossen, diesen Zwischenfall als Anlass für eine militärische Aktion gegen Serbien zu nehmen, um das Ansehen der alten Donaumonarchie als Großmacht wiederherzustellen und allen großserbischen Vorstellungen ein für alle Mal Einhalt zu gebieten.63
Der tote Franz Ferdinand als Mittel zum Zweck? Bei aller öffentlich gezeigten Trauer bleibt festzuhalten, dass der österreichische Thronfolger ja nicht überall ungeteilte Sympathie genoss. Der Ermordete war keineswegs besonders beliebt gewesen. So notiert rückblickend der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig: »[…] es gab viele an diesem Tag in Österreich, die im stillen heimlich aufatmeten, daß dieser Erbe des alten Kaisers zugunsten des ungleich beliebteren jungen Erzherzogs Karl erledigt war.«64 In führenden Kreisen der Doppelmonarchie ist sogar unverhohlene Erleichterung zu erkennen65, selbst Kaiser Franz Joseph, der Franz Ferdinand nie als Thronfolger gewünscht hatte, soll über das Ereignis zwar bestürzt, in seiner Konsequenz nicht aber unglücklich gewesen sein. Jedenfalls nimmt jetzt der 26-jährige Karl in Wien die Rolle des Thronfolgers ein.
Der deutsche Kaiser Wilhelm II. ist zu diesem Zeitpunkt hingegen noch immer tief bestürzt von dem Geschehen und teilt Kaiser Franz Joseph am 28. Juni 1914 umgehend mit, dass er selbstverständlich zur Beisetzung des Thronfolgers anreisen werde. Das hält der Monarch für angemessen und unterbreitet dieses Angebot fraglos mit bester Absicht. Denn dass er diese Reise tatsächlich nie antreten wird, weiß Wilhelm II. zu diesem Zeitpunkt noch nicht …
Alexander Cartellieri. Ein Historiker in seiner Welt
Es gibt ein Foto, das Alexander Cartellieri im Frühjahr 1914 zeigt. Er steht auf der heimischen Veranda und trägt stolz die offiziellen Insignien seines neuen Amtes: Talar, Kette und Hut. Schließlich ist der Historiker soeben Prorektor der thüringischen Landesuniversität in Jena geworden. Damit steht er dieser Hochschule vor, denn lediglich nominell fungiert zu diesem Zeitpunkt der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach als Rektor. Das neue Amt scheint Cartellieri Freude zu bereiten, denn er ist erkennbar vergnügt; fröhlich, vielleicht auch ein wenig spöttisch, blickt er durch seine runden Brillengläser auf den Betrachter. Schaut man das Bild lange genug an, mag der Herr Professor mit seinem schmalen Gesicht und seinem fröhlichen Wesen fast wie ein Schelm wirken.66 Und doch: Albernheit können wir ihm nun wahrlich nicht unterstellen, schließlich übernimmt Cartellieri gerade die Führung seiner Universität. Erst wenige Tage zuvor hat er erfahren, dass die Wahl auf ihn gefallen ist. Die Entscheidung ist für den 46-jährigen Historiker fraglos eine Ehre: Er gilt als anerkannter Vertreter seines Fachs – und die neue Verantwortung passt durchaus zur bisherigen Karriere dieses Mannes.
Wenn man so will, ist Alexander Cartellieri ein Mann von Welt: Geboren wird er weit weg von Jena – am 19. Juni 1867 in Odessa. Fünf Jahre nach der Geburt zieht der kleine Alexander mit seiner Familie nach Paris, wo der Vater als Kaufmann eine neue Stelle antritt. Dieser Schritt prägt die bürgerliche Jugend des Jungen. 1872 ist die Niederlage gegen Deutschland in Paris noch in frischer Erinnerung, und so verkehrt die Familie Cartellieri in dieser politisch angespannten Situation tendenziell zunächst eher mit den wenigen deutschen Familien in der Stadt, als dass sich entspannte Kontakte zu Franzosen ergeben hätten. Doch die Umgebung prägt: Alexander lernt früh Französisch, das ihm zur zweiten Muttersprache wird. Bald greift der Junge auch schon mal zu Rousseaus Confessions, die im väterlichen Bücherregal stehen. In der Schulzeit lernt Alexander die alten Sprachen sowie Englisch und erwirbt früh wichtige philologische Grundlagen; zudem liest er Homer und übersetzt Tacitus und Schiller ins Französische.67
Es muss für den Jungen nahezu ein Kulturschock sein, als seine Eltern entscheiden, ihn 1883 nach Deutschland zu schicken, wo er ein deutsches Gymnasium besuchen soll. Damit wollen sie ihm zunächst ein Studium an einer deutschen Universität und anschließend den Eintritt in den Staatsdienst ermöglichen. Der noch 15-Jährige verlässt also die Millionenstadt Paris und landet ausgerechnet im provinziellen Gütersloh, das zu diesem Zeitpunkt gerade einmal rund 10000 Einwohner zählt. Der schmächtige, kurzsichtige Bursche aus der Fremde – denn das war Paris damals für den durchschnittlichen Ostwestfalen – integriert sich erfolgreich durch Leistung: Er steigt zum jahrgangsbesten Schüler auf und besteht 1887 das Examen ebenfalls als Bester. Nicht zuletzt angeregt durch die Lektüre der Weltgeschichte von Leopold von Ranke, hegt Cartellieri schon als Schüler den Wunsch, selbst Historiker und Professor zu werden (wenngleich er bescheiden davon ausgeht, zunächst wohl nicht Rankes Ruhm erlangen zu können). Dass er im Jahr seines Schulabschlusses aufgrund seiner Kurzsichtigkeit vom üblichen einjährigen freiwilligen Militärdienst ausgemustert wird, dürfte er deshalb nicht als persönlichen Rückschlag empfunden haben – Alexander Cartellieri will schließlich seine so gewonnene Zeit nutzen, um rasch Gelehrter zu werden.68
»Mein Ziel ist, ein christlicher Gelehrter zu werden und von Ferne Ranke zu folgen, der einer der wenigen Historiker gewesen zu sein scheint, die positiv an Gott glauben. Es wird besonders notwendig sein, […] dass ich mehr Zeit auf das Studium als auf das Bier verwende und dass ich weniger eine Säule der Kaffeehäuser und der Brauereien als der Bibliotheken sei.«
(Tagebucheintrag des 19-jährigen Cartellieri)69
Zunächst studiert Cartellieri in Tübingen, dann zieht es ihn nach Berlin, wo er sein Studium mit der Dissertation abschließt und das Staatsexamen für höhere Schulen ablegt. Er heiratet mit Margarete Ornhold eine Anwaltstochter aus guten Berliner Verhältnissen (und erfährt deshalb übrigens von seinem Schwiegervater fortan immer wieder materielle Unterstützung). Nach einer beruflichen Zwischenstation in Karlsruhe, wo er im Archiv arbeitet, gelingt es ihm schließlich endgültig, die akademische Laufbahn einzuschlagen (was zu dieser Zeit immer auch eine finanzielle Anstrengung bedeutet). Nach Habilitation und einer Zwischenstation in Heidelberg gelangt er 1902 als 35-Jähriger nach Jena – zunächst als Extraordinarius (damit zählt er zu den rechtlich wie finanziell schlechter gestellten Hochschullehrern), dann als ordentlicher Professor.
»Er gilt allgemein als sehr tüchtig und als einer der besten jüngeren Vertreter des Mittelalters. […] Seine Vorlesungen werden gern gehört, und auch persönlich nimmt er sich seiner Schüler innerhalb und ausserhalb der Übungen lebhaft an. Guter Vortrag und allgemeines Nachdenken über Fragen der Historiographie werden ihm nachgerühmt. Auch persönlich macht er einen angenehmen Eindruck und ist sehr beliebt.«
(die philosophische Fakultät der Jenaer Universität zur Berufung Cartellieris 1902)70
Alexander Cartellieri steigt damit in einen erlesenen Kreis auf: Bis zum Ersten Weltkrieg gibt es im Deutschen Reich nur rund 1300 ordentliche Professoren.71 Doch finanziell ist der Ruf nach Jena nicht gerade das große Los: Die dortige Universität gilt am Ende des 19. Jahrhunderts als diejenige, die ihre Professoren besonders schlecht bezahlt. 1881 hatte sie den Landesherrn sogar bitten müssen, wenigstens Mindestgehälter und Alterszulagen für die Hochschullehrer zu bezahlen. Abhilfe schafft zunächst eine Besoldungsreform im Jahr 1902 (als Cartellieri an die Hochschule kam) sowie schließlich eine generelle Gehaltserhöhung im Jahr 1911.72
Wenn auch Cartellieri in Jena bei Weitem nicht das Leben seines frühen Vorbilds Leopold von Ranke erwartet, so kann er doch ein standesgemäßes Haus für sich und seine vielköpfige Familie beziehen (aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor). Doch zunächst muss sich der junge Gelehrte auch privat in einer eher ungewohnten Umgebung zurechtfinden: Zum Haus führt ein steiler Weg, auf dem ein Gespann mit acht Pferden mühsam den Hausrat der Familie hinaufziehen muss. Im Regen und vor allem bei Schneefall verwandelt sich der Weg, der nur notdürftig mit Kies befestigt ist, regelmäßig in eine gefährliche Rutschbahn – es gibt Berichte, wonach sich hier verschiedene Professoren auf dem Weg in die Stadt dann und wann auf dem Hosenboden wiederfanden.73
Mit seiner Frau Margarete teilt und pflegt Cartellieri die Vorliebe für Bücher; eine Fotografie aus den Jenaer Anfangsjahren zeigt beide an einem Tisch im Garten – in Lektüre vertieft. Im Hause Cartellieri wird ein bildungsbürgerliches Leseideal gelebt, die Jenaer Villa bietet ausreichend Platz für die private Bibliothek. Auf seine Bücher ist der Professor fraglos besonders stolz. Sie finden zunächst im Bibliotheks- und Arbeitszimmer, später im Herrenzimmer, auf dem Boden und schließlich in der Garage Platz. Zur häuslichen Routine gehört übrigens auch, dass der Historiker sich den Sonntag grundsätzlich von beruflichen Verpflichtungen frei hält: Jegliche Forschungstätigkeiten und Lehrvorbereitungen sind tabu, der Tag bleibt dem Schöngeistigen vorbehalten, der Literatur, der Sprache, der Kunst. Der Sonntag ist, soweit möglich, auch der Tag, an dem Cartellieri sich zurückzieht, um sein Tagebuch zu führen. Schon als Elfjähriger hat er damit begonnen, und für seine späteren Biografen werden diese Aufzeichnungen zur wichtigsten Quelle ihrer Arbeiten werden.74
Die Welt seiner Bücher ist ihm wichtig, die öffentliche Debatte schon weniger: Er gehört in publizistisch-politischer Hinsicht zur weitgehend schweigenden Mehrheit der deutschen Professoren, im bestehenden politischen System des Kaiserreichs sieht er – trotz möglicher Kritik an Einzelerscheinungen – den besten Sachwalter von nationalen und sozialen Interessen. Die Monarchie, ihre Bürokratie und ihr Militär sind für den Professor feste Säulen eines sicheren Lebens.75 Alexander Cartellieri ist im Sommer 1914 somit in der Tat das, was man einen gestandenen – und wohl auch zufriedenen – Gelehrten nennen könnte.
Und doch ist etwas Besonderes an diesem Historiker: Er ist nämlich einer der wenigen deutschen Vertreter seiner Zunft, dessen Hauptforschungsgegenstand die Geschichte Frankreichs ist.76 1899 erschien der erste Band seiner schließlich vierbändigen Darstellung Philipp II. August König von Frankreich« (1165–1223), die ihn als quellenkundigen Mediävisten ausweist. Zugleich – und dies sollte sein ganzes Gelehrtenleben prägen – richtet der Kenner des Mittelalters seinen Blick immer auch über diese Epoche hinaus. 1913 tritt er erstmals mit Betrachtungen zu einem Thema der Neuzeit an die Öffentlichkeit, einige Jahre später macht er sich Gedanken über Grundzüge einer Weltgeschichte, schließlich sollten vier Bände über Weltgeschichte als Machtgeschichte folgen.77
Aber mehr als die große Bandbreite seines wissenschaftlichen Interesses macht seine inhaltliche wie persönliche Beziehung zu Frankreich und Belgien Cartellieri zu einer besonderen Figur unter den deutschen Historikern: Er gilt aufgrund seiner Beschäftigung sozusagen als der »Franzose« unter den Historikern des späten Kaiserreichs. Er ist schließlich in Paris aufgewachsen und steht seit Langem in engem Austausch mit französischen, belgischen und britischen Historikern. Cartellieri unterscheidet sich schon durch seinen Werdegang von anderen professoralen Zeitgenossen; aufgrund seiner Herkunft und seiner (frühen) Vielsprachigkeit ist ihm später sogar eine »faktische und geistige Heimatlosigkeit« bescheinigt worden. Das kann man auch als intellektuellen Vorteil verstehen, denn dadurch ist der Weltbürger Cartellieri davor gefeit, in die Provinzialität thüringischer oder auch nur deutscher Geschichte abzustürzen.78 Cartellieris Welt ist eben größer als Thüringen und Sachsen – gerade seine Kontakte ins Ausland kennzeichnen seine Arbeit als Wissenschaftler: 1913 ist er einer der Redner auf dem Londoner Historikerkongress und gehört ursprünglich zum Mitarbeiterkreis der (dann nach dem Krieg und ohne deutsche Beteiligung vorgelegten) Cambridge Medieval History, einer wegweisenden und renommierten Weltgeschichte des Mittelalters.79
Alexander Cartellieri ist noch vergleichsweise jung, als er an die Saale zieht, aber fraglos bereits ein international renommierter Gelehrter. Sein Werdegang und seine Herkunft – eben nicht aus der Enge eines protestantischen Pfarr- oder preußischen Beamtenhauses – machen ihn übrigens nicht nur finanziell schon früher unabhängig als seine Kommilitonen oder Professorenkollegen. Auch in politischer Hinsicht dürfte ihm eine gewisse Weite der Perspektive eher zu eigen gewesen sein – »nationalistische Wadenbeißer und fanatische Herolde von Rasse, Blut und Boden«, so urteilte ein Beobachter rückblickend, »stammen in der Regel aus anderen Milieus«. Cartellieri lässt sich zwar mit Fug und Recht als national und konservativ bezeichnen, doch fühlt er sich aus Überzeugung der internationalen Gelehrtengemeinschaft zugehörig.80
Die Universität Jena genießt bei der Berufung Cartellieris in dieser Zeit überregional Anerkennung. Das liegt einerseits an ihrer Geschichte, schließlich haben hier einst Geistesgrößen wie Schiller, Fichte und Hegel gewirkt. Andererseits stellt die Hochschule auch jetzt noch immer »eine wissenschaftliche Adresse erster Güte mit großer internationaler Ausstrahlung« dar.81 Zwar liegt die »Salana« hinter den großen Universitäten des Landes zurück, rund 2000 Studenten und Studentinnen (erst später als an anderen Orten werden hier im Jahr 1907 Frauen zum Studium zugelassen) sind 1914 hier eingeschrieben.82 Damit hat auch diese Hochschule ihren Anteil an der regelrechten Bildungsexplosion an den Universitäten im Deutschen Reich: Zwischen 1871 und 1914 steigt die Zahl der Studierenden von rund 13000 auf über 60000 an. Besonderen Anteil an dieser Entwicklung haben die philosophischen Fakultäten, jenes große Sammelbecken aller Geistes- und Naturwissenschaften, dem zu Beginn des Ersten Weltkrieges etwa die Hälfte der Studentenschaft zugerechnet wird.83 Sie und ihre Professoren sind stolz auf den Ruf der deutschen Universitäten. Nicht zuletzt sind es eben die Hochschulen, deretwegen das kaiserliche Deutschland höchste Geltung in der Welt genießt.84
Die deutschen Professoren stellen im Kaiserreich etwas Besonderes dar: Sie genießen hohes Sozialprestige in der Bevölkerung und zugleich das Vertrauen des Obrigkeitsstaates. Sie sind – nicht zuletzt über Titel und Ehren – feste Bestandteile des monarchisch-bürgerlichen Establishments, genießen aber zugleich große wissenschaftliche und organisatorische Freiheiten. Unterschiede gibt es bei ihren Einkommen. Nicht nur – wie bereits im Falle Cartellieri und Jena gezeigt –, weil die jeweiligen Länder ihre Ordinarien unterschiedlich besolden. Der Verdienst ist auch von den Fächern abhängig. Professoren in Massenfächern profitieren – über das sogenannte Kolleggeld, das jeder Student pro unterrichtete Stunde zu zahlen hat – von steigenden Studentenzahlen, während vor allem die Juristen und Mediziner traditionell über zum Teil erhebliche Nebeneinnahmen verfügen.85
Es gibt unter den deutschen Professoren wahre Berühmtheiten. Und für eine Universität – gerade wenn es nicht die alles beherrschende Berliner Universität oder die großen Hochschulen in München, Leipzig oder auch Bonn sind – stellen Ordinarien von Rang und Namen ein wichtiges Kapital dar. Auch die vergleichsweise kleine Universität in Jena hat ihre prominenten Professoren, denen sie ihren guten Ruf verdankt: allen voran der Philosoph Rudolf Eucken, Nobelpreisträger für Literatur von 1908, Ernst Haeckel, der bekannte naturwissenschaftliche Materialist und Monist (der allerdings 1909 seine Lehrtätigkeit aufgegeben hat), der Sprachwissenschaftler Berthold Delbrück86 sowie Gottlob Frege, der als Begründer der modernen mathematischen Logik auch im Ausland wahrgenommen wird.87 Doch das Historische Seminar, das Cartellieri beim Antritt seiner Professur in Jena antrifft, ist nicht nur für seine Ansprüche von recht provinziellem Zuschnitt:
»Gearbeitet wurde dort nicht, auch nicht Seminar gehalten, sondern der Senior verlieh zweimal in der Woche Bücher. Man kann sich denken, wie dieser äusserst bescheidene Betrieb auf mich wirkte, der ich in Leipzig und Berlin Seminarmitglied gewesen war.«88