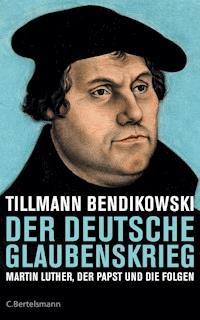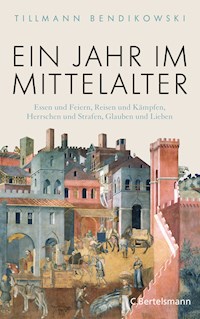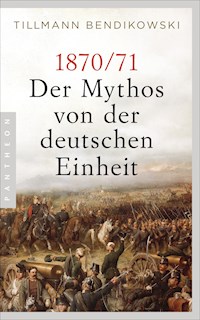
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Einheit – nur ein Mythos?
Zentrales Gründungsdatum des immer noch wirkmächtigen Mythos von der deutschen Einheit ist der Krieg gegen Frankreich und die anschließende Reichsgründung im Jahr 1870/71. Anhand der eingehenden Schilderung von neun symbolträchtigen Tagen vergegenwärtigt Tillmann Bendikowski entscheidende Wegmarken zur deutschen Einigung unter Preußens Führung: von der Flucht des Welfenkönigs aus Hannover ins österreichische Exil im Juni 1866 bis – nach der Proklamation des deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles – zur Siegesparade fünf Jahre später.
Das Buch erhält einen 16-seitigen Farbbildteil, der die für die Thesen des Buches wesentlichen Ereignisse der Zeit illustriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Der Mythos von der deutschen Einheit, so Tillmann Bendikowski, prägt bis heute die Sicht der Deutschen auf sich selbst und ihre Geschichte. Zentrales Gründungsdatum dieses Mythos ist der Krieg gegen Frankreich und die anschließende Reichsgründung im Jahr 1870/71. Anhand der eingehenden Schilderung von neun symbolträchtigen Tagen werden entscheidende Abschnitte auf dem Weg zur deutschen Einigung unter Preußens Führung vergegenwärtigt: von der Flucht des Welfenkönigs aus Hannover ins österreichische Exil im Juni 1866 bis – nach der Proklamation des Deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles – zur Siegesparade fünf Jahre später.
Autor
Dr. Tillmann Bendikowski, geb. 1965, Journalist und Historiker, leitet die Medienagentur Geschichte in Hamburg. Der leidenschaftliche Geschichtserzähler schreibt Beiträge für Printmedien und Hörfunk, betreut wissenschaftliche Forschungsprojekte und kuratiert historische Ausstellungen. Als Autor verfasste er u.a. »Der Tag, an dem Deutschland entstand. Geschichte der Varusschlacht« (2008), »Friedrich der Große« (2011), »Sommer 1914« (2014), »Der deutsche Glaubenskrieg – Martin Luther, der Papst und die Folgen« und »Helfen. Warum wir für andere da sind« (beide 2016) sowie »Ein Jahr im Mittelalter: Essen und Feiern, Reisen und Kämpfen, Herrschen und Strafen, Glauben und Lieben« (2019).
TILLMANN BENDIKOWSKI
1870/71
Der Mythos
von der
deutschen
Einheit
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung,
insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2020 C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Christian Sell, Beginn der Verfolgung bei Königgrätz, 1872, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin © bpk / Nationalgalerie, SMB / Jochen Remmer
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-25709-5V002
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Vorwort: Das Echo der Reichsgründung
1 30. Juni 1866 Ein deutscher König auf der Flucht
2 18. Mai 1868 Ein Parlament für Deutschland?
3 13. Juli 1870 Telegramm für Herrn Bismarck!
4 2. September 1870 Gotteskrieger und der Glaube an die Unbesiegbarkeit
5 30. November 1870 Bayern macht einen Preußen zum deutschen Kaiser
6 Weihnachten 1870 Was die Zukunft bringt
7 18. Januar 1871 Fremder Herrscher im Spiegelsaal
8 21. März 1871 Die Reichsfeinde nehmen Platz
9 16. Juni 1871 Sieg, Frieden und wieder Krieg?
10 In der Vitrine der Erinnerung
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweis
Bildteil
»Das Land, in dem unsere Geschichte anhob, sich entfaltete und zu Ende ging, ist, muß man wohl sagen, verschwunden. Denn zu jener guten Zeit war es noch ein schönes, freies und blühendes kleines Fürstentum im alten Deutschland, und sein Souverän war niemandem verantwortlich als Gott, dem Herrn. Später jedoch, als Zeiten und Menschen sich verhärteten, wurde es still-traurig vom großen neuen deutschen Reich verschluckt.«
Tania Blixen in ihrer Erzählung Ehrengard (1963)1
Vorwort: Das Echo der Reichsgründung
Die Geschichte, die die Deutschen bis heute über sich selbst und ihr Land erzählen, geht ungefähr so: Lange hatten sie es nicht leicht mit ihrer Nation, denn anders als die meisten ihrer Nachbarn hatten sie keinen Nationalstaat vorzuweisen, kein einiges Reich mit einem mächtigen König an der Spitze, kein geschlossenes Territorium mit einer überall in gleichem Maße funktionierenden Herrschaft. Ihr Deutschland hatte zwar von vielen anderen Errungenschaften mehr als genug, allen voran ein reiches kulturelles Leben mit angesehenen Dichtern, Denkern und Künstlern, einen Wissenschaftsbetrieb samt weltweit geschätzten Forschern und Gelehrten sowie eine Volkswirtschaft, die vom florierenden Handel mit der Welt profitierte und zudem mit zahlreichen technischen Innovationen kluger Tüftler reich gesegnet war. Aber das reichte nicht, um die Menschen glücklich zu machen. Denn ein Land, ein Deutschland gab es eben lange nicht, sondern stattdessen eine Vielzahl großer, mittlerer und noch viel mehr kleinerer Länder, die nicht oder nur lose miteinander verbunden waren. Kein einiges Deutschland? Das bedauerten viele Deutsche und empfanden es zugleich als ungerecht, oft sahen sie die Schuld bei den anderen Ländern, von denen sie sich schlecht behandelt, sogar regelrecht gedemütigt fühlten. Zudem ärgerten sie sich immer auch über sich selbst, weil sie es augenscheinlich partout nicht schafften, ein einiges Vaterland aufzubauen.
Und was man schmerzlich entbehren muss, steigt bekanntermaßen umso stärker im Wert, je länger das Warten dauert. So war es auch in der Beziehung der Deutschen zu ihrer nationalen Einheit. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Ruf nach einer geeinten deutschen Nation immer lauter – doch weiterhin gab es keine praktischen Fortschritte in dieser Richtung. Viele Versuche scheiterten, besonders spektakulär in der Revolution von 1848/49, als das Verlangen nach einem einigen Deutschland mit ersten mutigen parlamentarisch-demokratischen Ansätzen verknüpft wurde. Das Ergebnis war ernüchternd: Die alten Herrschaftsstrukturen blieben weitgehend intakt, und auch die zahlreichen großen, mittleren und kleinen Staaten im Land bestanden fort – der berühmte »Flickenteppich«. Erst 1871, so jedenfalls das vorherrschende Verständnis in der kollektiven Erinnerung, gelang dann unter lautem Jubel der Deutschen die Gründung des Deutschen Reiches mit Kaiser Wilhelm I. an der Spitze. In die Geschichtsbücher ging diese Reichsgründung folglich als die Krönung aller deutschen Einheitsbestrebungen ein. Endlich, so die bis heute gängige Vorstellung, sei Wirklichkeit geworden, wovon Generationen von Deutschen so sehnlich geträumt hatten. So weit also diese Geschichte.
Aber stimmt sie eigentlich? Oder trügt unsere kollektive Erinnerung, wenn es um die »deutsche Einheit« geht? Bis heute ist sie ein politischer Koloss, ein Schwergewicht unter den politischen Argumenten, wenn es um das Wohl und Wehe der Nation geht. Ohne Einheit und Einigkeit scheint es nicht zu gehen, sie gelten als »des Glückes Unterpfand« – auch deshalb wird die Einigkeit in unserer Nationalhymne stets vor dem Recht und der Freiheit besungen (wenn denn noch gesungen wird). Haben sich unsere Ahnen bei der Reichsgründung 1871 die Einheit wirklich so gewünscht, wie sie schließlich kam? Haben sie sie überhaupt gewünscht? Und wie hoch war eigentlich der Preis, den sie dafür zu zahlen bereit waren – und jener, den sie schließlich dafür zahlen mussten? Wie konnte es geschehen, dass der Mythos von der deutschen Einheit politisch so wirkungsmächtig wurde, dass er in unserer Erinnerung nahezu uneingeschränkt positiv erscheint?
Im Rückblick drängt sich die Vermutung auf, dass die Einheitsidee den Deutschen zuweilen die Gedanken vernebelt hat. Geradezu rauschhaft verfielen sie bereits im 19. Jahrhundert der Vorstellung, wonach sie allen politischen Stürmen trotzen könnten, wenn sie nur fest – eben vereint – zusammenstehen. Die politische Quittung dafür erhielten sie im 20. Jahrhundert, spektakulär zunächst einmal nach 1914, als das Deutsche Reich und sein Kaiser glaubten, vereint gegen »eine ganze Welt von Feinden« antreten zu müssen. Im Zweiten Weltkrieg wiederholte sich die Hybris dann noch auf sehr viel dramatischerem Niveau, ehe die anschließende deutsche Teilung der Einheitsfrage eine neue, tragische Dimension verlieh und dann nach 1990 eine regelrechte Sentimentalisierung der Einheit einsetzte: Der Zustand der »inneren Einheit« scheint heute das Maß der Zufriedenheit der Deutschen mit ihrer Welt schlechthin zu sein. Das mag übertrieben klingen, aber es zeigt zugleich, dass die Wucht, die der Glaube an die Kraft einer vereinten Nation so lange freigesetzt hat, kaum überschätzt werden kann. Diese Geschichte wirkt nach, und ihren zentralen Ausgangspunkt hat sie in den Ereignissen der Jahre 1870 und 1871, in denen in einem spektakulären Krieg zunächst das benachbarte Frankreich niedergeworfen und anschließend das Deutsche Reich gegründet wurde.
Doch so zentral »1870/71« für die deutsche Nationalgeschichte ist, so wenig sind die tatsächlichen Ereignisse dieser beiden Jahre in der deutschen Erinnerung präsent. Der Krieg selbst scheint weitgehend vergessen zu sein, jedenfalls hierzulande. Die Annexion Elsass-Lothringens ist womöglich noch bekannt, aber kaum hingegen die wochenlange Beschießung der eingekesselten Stadt Paris. Zwar gibt es in unseren Städten und Dörfern noch immer Denkmäler und Straßennamen, mit denen an die gefallenen Soldaten der Schlachten bei Spichern oder Mars-la-Tour erinnert wird. Aber wer weiß denn noch, wo diese Orte liegen und welche Schlachten dort wirklich geschlagen wurden? Und wie ist eigentlich die folgende Reichsgründung in der deutschen Erinnerung verankert? Das bekannte Gemälde des Malers Anton von Werner von der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles ziert so ziemlich jedes Geschichtsbuch, es zeigt die bunte Pracht der Fahnenträger und Militärs sowie den stolzen Kaiser Wilhelm. Doch wird durch dieses farbenprächtige Stück wilhelminischer Geschichtspropaganda nicht das spektakuläre Ringen innerhalb Deutschlands verdrängt – die Angst vieler kleiner Staaten vor dem angeblich kriegslüsternen Preußen, die Ohnmacht selbst großer Königreiche wie Bayern oder Württemberg? Auch die nicht erst im Rückblick geradezu skandalöse Auslöschung des Königreichs Hannover im Jahr 1866, die ebenfalls der Reichsgründung vorausging, wird kaum noch als die politische Erschütterung wahrgenommen, die sie damals fraglos war.
Hinter »1870/71« verbergen sich zahlreiche unterschiedliche und zuweilen widersprüchliche Geschichten, die in ihrer Gesamtschau nicht nur einen anderen Blick auf das Geschehen der Reichsgründung ermöglichen, sondern im Detail auch den Aufstieg und die politische Instrumentalisierung des Mythos von der deutschen Einheit aufzeigen. Es gab schon damals Gegner eines preußisch dominierten Einheitsstaates, es gab Nachfragen und Alternativen. Zugleich existierten aber auch große Hoffnungen und es machte sich eine entfesselte Begeisterung über die Weichenstellungen für eine Zukunft breit, von der sich auch die Mehrheit der Menschen, und keineswegs nur die politischen oder militärischen Eliten, eine bessere Zeit erhofften. Dass das Reich und die Einheit 1871 so gekommen sind, war nicht von vornherein klar, und es war auch keineswegs selbstverständlich. Zuweilen, und dies nicht nur im Ausland, hatte man sogar regelrecht Angst vor diesem neuen Gebilde – und die »deutsche Einheit« erschien eher als ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung.
Dieses Buch geht zurück zu den Ereignissen. Es lenkt den Blick auf die Zeit des Geschehens selbst, es stellt sich an die Seite der Handelnden und erzählt »1870/71« nicht von seinem Ende her, sondern in seinem Verlauf. Und es beherzigt die Einsicht, dass die Reichsgründung mehr beinhaltete als »Bismarck«: Der preußische Ministerpräsident und spätere erste Kanzler des Deutschen Reiches spielte zwar fraglos eine gewichtige Rolle, aber er war beileibe nicht der einzige Akteur – auch wenn sich dieser Eindruck aufgrund der späteren Geschichtsschreibung heute zuweilen einstellt. Deshalb kommen im Folgenden Minister und Könige ebenso zu Wort wie Landtagsabgeordnete aus Württemberg, Bayern oder Preußen, einfache Soldaten, die in diesem Krieg ihr Leben riskierten, oder Journalisten, die tagesaktuell über die Ereignisse berichteten. Welches Bild machten sie sich von der deutschen Vergangenheit, und mit welchen Hoffnungen und Erwartungen schauten sie in die Zukunft?
Das Thema »deutsche Einheit« ist aber keineswegs nur ein historisches. Wenn sich Deutschland regelmäßig an den Mauerfall von 1989 und die Vereinigung ein Jahr später erinnert und wenn im Sinne eines innenpolitisch befriedeten Landes das Gelingen einer »inneren Einheit« beschworen wird, so knüpft dies an den historischen Mythos an. Und heute wie damals ist die Kehrseite des Einheitsappells offensichtlich: Wie stark war und ist die Abneigung gegen abweichende Standpunkte, gegen Kritiker und Einheits-»Feinde«? Müssen sie mit ihrer Ablehnung einer bestimmten Einheitsidee zwangsläufig als »Vaterlandsverräter«, zumindest als patriotisch unzuverlässige Zeitgenossen abgewertet werden? War und ist die »Einheit« als Denkfigur wirklich das geeignete politische Mittel, eine Pluralität zu einem großen Ganzen zusammenzuführen – oder dient sie vielmehr als aggressives innenpolitisches Mittel dem Zweck, diese Pluralität zu beseitigen, so wie sie womöglich außenpolitisch auch als Drohung gegenüber den Nachbarn verstanden werden könnte?
Wie schwer es angesichts der deutschen Nationalgeschichte weiterhin ist, auch einzelne Länderinteressen und regionale Bedürfnisse bundesweit zu akzeptieren, zeigt der Umstand, dass »Partikularismus« hierzulande zuweilen immer noch als politisches Schimpfwort verwendet wird – und auch der »Föderalismus« kommt oft nicht viel besser weg. Wie ist es heute um unsere Fähigkeit bestellt, eine Einheit im Blick zu haben, die Einzelinteressen nicht als einheitsgefährdend oder egoistisch denunziert? Solche Überlegungen sind in unserer Gegenwart über nationale Belange hinaus von Bedeutung, denn auch das anstehende große Friedenswerk der europäischen Einigung ist darauf angewiesen, dass die beteiligten Völker und ihre Staats- und Regierungschefs dieses Zusammenwachsen in Respekt vor der Vielfalt und der Mehrdeutigkeit des europäischen Lebens und seiner Traditionen vorantreiben. Für dieses Vorhaben lässt sich mit Blick auf die deutsche Geschichte tatsächlich einmal etwas aus der Vergangenheit lernen, und dies vor allem in einer Zeit, in der auch in Deutschland politische Gruppierungen sich als EU-Feinde positionieren, die den demokratischen Ideen und Werten der Europäischen Union feindlich gegenüberstehen und die ganz offen das Ende einiger ihrer Institutionen fordern.
Dieses Buch greift zur Beschreibung der Reichsgründung auf neun ausgewählte Tage zwischen den Jahren 1866 und 1871 zurück, an denen wegweisende Entscheidungen gefällt wurden oder wichtige Ereignisse stattfanden. Dabei geht es beispielsweise um den Anlass für einen Krieg, um den eine geschickte Legende gestrickt wurde, oder um eine höchst eigentümliche Kaiserkrönung in einem beschlagnahmten Palast eines fremden Königs, bei der übrigens der eingeschnappte Monarch kein Wort mit seinem Reichskanzler sprach. Auch wird verschiedenen Parlamenten ein Besuch abgestattet, in denen sich die anwesenden Männer eine politisch wie emotional denkbar intensive Debatte um ihre Heimat, ihren König und Deutschlands Zukunft lieferten. Den Anfang macht allerdings ein Tag im Jahr 1866, an dem sich ein König aus Deutschland vor seinen Feinden in ein kleines Jagdschloss seines Schwiegervaters flüchten musste. Zusammengenommen sollen die Beschreibungen dieser neun Tage ein Gesamtbild des Einigungsprozesses ergeben und zugleich deutlich machen, dass das »Echo« von 1870/71 im Grunde immer noch nachklingt – ob wir wollen oder nicht. Es ist also angebracht, genauer hinzuhören.
»So ist nun das Schlimmste geschehen! Unser schönes, theures Land, es ist uns geraubt! All die treuen lieben Menschen, die so rührend die schweren Schicksalsschläge der 3 letzten Monate mit uns getragen, wir sollen sie vielleicht auf immer verlassen! Ich kann es noch nicht glauben!«
Königin Marie von Hannover in einem Brief an ihren Mann im August 18662
1
30. Juni 1866
Ein deutscher König auf der Flucht
Endlich kommt König Georg V. von Hannover dazu, es sich auf dem Bett bequem zu machen und für seine Frau einige Zeilen zu diktieren, um sie über sein Schicksal zu unterrichten. Dass er unverletzt geblieben und nicht in Gefangenschaft geraten ist und dass er hier in diesem »wundervollen Jagdschloss« in Sicherheit ist. Es liegt auf einer Insel mitten in einem kleinen See nahe des kleinen thüringischen Stadtroda, weit genug entfernt von all dem Unglück der zurückliegenden Tage. Als der König den Brief diktiert, ist es Sonntagabend, doch schon am Tag zuvor, am 30. Juni 1866, hat er mit seinen Begleitern diesen Ort erreicht. Das kleine, aber feine Schloss gehört seinem Schwiegervater, dem ehemaligen Herzog von Sachsen-Altenburg, und trägt seit Jahrhunderten einen Namen, der gerade jetzt für den König vielversprechender denn je klingt: »Schloss Fröhliche Wiederkunft«. Das muss doch ein gutes Omen sein, oder? Der königliche Brief endet jedenfalls genau mit dieser Hoffnung:3
»Gott gebe, daß es eine frohe Vorbedeutung für uns ist, daß ich nach allen wichtigen Ereignissen, die ich seit vierzehn Tagen erlebt, zuerst meine Füße in Fröhlich Wiederkunft setze, dieses geschichtlich interessante Schloß, dessen Name auch für uns jetzt so bezeichnend ist.«
Glaubt Georg V. tatsächlich, dass es für ihn einst eine »fröhliche Wiederkunft« geben kann? Das ist in diesem Moment nur eine bloße Hoffnung, denn er befindet sich jetzt auf der Flucht, im Ausland, er kann nicht mehr nach Hause. Der Monarch hat alles gewagt, und er hat alles verloren. Er ist jetzt ein König ohne Land, womöglich nicht einmal mehr ein König …
Nur auf den ersten Blick ist dieser Mann ein König in den besten Jahren: Erst vor einem Monat hat er seinen 47. Geburtstag begangen, und im November steht eigentlich sein 15. Thronjubiläum an. Aber dass es in ein paar Monaten in seinem Königreich noch etwas zu feiern gibt, glaubt in seinem Umfeld längst niemand mehr. Schon das ganze Jahr hindurch haben sich in politischer Hinsicht dunkle Wolken über seinem Königreich Hannover zusammengezogen. Und jetzt, nach dem großen »Gewitter«, scheint dieser König als der große Verlierer dazustehen. Ist das seine Schuld? Fraglos hat Georg V. in den zurückliegenden Wochen oft genug die politische Lage falsch eingeschätzt, er hat gravierende Fehler gemacht im diplomatischen und militärischen Spiel der deutschen Dynastien und Staaten. Jetzt steht sein Königreich Hannover ebenso vor dem Aus wie er selbst: Er hat einen Krieg gegen das mächtige Preußen verloren, und dies obendrein ziemlich schmählich nach nur wenigen Tagen Kampf. Er selbst, der sich stets als stolzer und standesbewusster Regent gegeben hat, wird wohl auf die Gnade des Siegers angewiesen sein. Der ist wenigstens so nett, ihm freien Abzug zuzusichern. Immerhin.
Georg V. hat es nie leicht gehabt, auch weil er seit seiner Kindheit erblindet ist. Einige Zeit war sogar darüber gestritten worden, ob er damit überhaupt König werden konnte, bis sein Vater diese Diskussion beendete und an ihm als Thronfolger festhielt. Es ist eine traditionsbewusste Familie, in die der Junge am 27. Mai 1819 hineingeboren wird: Die Welfen gelten als ein stolzes Adelsgeschlecht, das seit dem frühen Mittelalter das Geschehen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation mitbestimmt hat, das mächtige Herrscher wie im 12. Jahrhundert Heinrich den Löwen hervorgebracht hat und das damals zum Konkurrenten der Staufer um die Kaiserkrone wurde. Der norddeutschen Linie gelang im Jahr 1692 der Aufstieg zum Kurfürstentum, damit zählte die Familie fortan zum erlauchten Kreis der deutschen Königswähler. Europäische Bedeutung erlangten die Welfen nach 1714, als das Haus Hannover für 123 Jahre in Personalunion zugleich den König von Großbritannien stellte. Erst der Vater des blinden Georg V. war dann »nur« noch König von Hannover, während über Großbritannien fortan Königin Victoria herrschte, eine Cousine von Georg. Auch wenn die frühere britische Herrschaft vergangen ist: Die guten Verbindungen der Hannoveraner in den europäischen Hochadel und vor allem nach London sind intakt. Der König von Hannover ist in dynastischer Hinsicht nicht irgendwer.
Freundlich formuliert ist Georg V. ein Mann von Grundsätzen und Tradition. Das kann zuweilen seine Vorteile haben, für seine Untertanen heißt das im konkreten Fall aber auch, dass er sich den politischen Entwicklungen der Zeit samt ihren Forderungen nach Reformen und Neuerungen jeglicher Art geradezu halsstarrig widersetzt. Der Monarch tut fast so, als habe es den politischen Aufbruch im Vormärz und während der Revolution von 1848/49 gar nicht gegeben. Stattdessen träumt Georg V. unverdrossen weiter von einem absolutistischen Königtum. Innenpolitische Zugeständnisse seines Vaters lässt er nach seiner Thronbesteigung sogar wieder kassieren, und er umgibt sich lieber mit traditionsbewussten adeligen Beratern als mit klugen, »modernen« Reformern, die es auch in seinem Königreich gibt. Darüber hinaus vertraut der Regent in seiner tiefen protestantischen Frömmigkeit stets auf den lieben Gott und seine lutherische Landeskirche, als deren oberster Bischof er als König zugleich fungiert. So findet der König noch wenige Monate vorher eigentlich alles gut bestellt in seinem Leben, aber eben nur bis zu diesem Sommer 1866. In diesem kann ihm auch sein Gott nicht mehr helfen, erst recht keine Soldaten und Verbündeten, und nicht einmal seine mächtige Cousine Victoria auf dem britischen Thron. Wie konnte das geschehen?
Es ist Preußen, das Hannover in den Abgrund treibt. Der Nachbar, der im Osten und im Süden an das Königreich grenzt, ist auf Expansionskurs. Wieder einmal, sagen die Kritiker Preußens. Tatsächlich lässt sich behaupten, dass die Hohenzollern-Dynastie seit den Tagen Friedrichs des Großen versucht, durch Eroberungen permanent und rücksichtslos die eigene Macht zu erweitern. Was mehr als 100 Jahre zuvor im Ersten Schlesischen Krieg (1740–1742) mit der Einverleibung der österreichischen Provinz Schlesien begann, scheint sich bis jetzt fortzusetzen. Die Gefahr durch den immer mächtiger werdenden preußischen Nachbarn wurde auch im Königreich Hannover schon im 17. und 18. Jahrhundert gesehen: 1850 prophezeite ein führender Minister geradezu resigniert, eines Tages »werden wir preußisch werden«. Und 14 Jahre später, 1864, hat Preußen an der Seite Österreichs die seit Langem schwelende Krise um die Herzogtümer Schleswig und Holstein geschickt für einen Krieg gegen Dänemark und eine weitere Eroberung genutzt: Schleswig wird preußisches Hoheitsgebiet, während Österreich zunächst Holstein verwaltet. Doch bald kommt es zwischen den eben noch Verbündeten zum erbitterten Streit, und in ganz Deutschland fürchten die Menschen, dass dieser in einen Krieg münden könnte. Es ist der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck, der geschickt die alten liberalen Träume von einem deutschen Nationalstaat bedient: Er schwenkt die politische Fahne der Einheit und erntet dafür reichlich Zuspruch sogar über die Grenzen Preußens hinaus, obwohl er tatsächlich nur das Ziel preußischer Vorherrschaft verfolgt.
Was sich zwei Jahre zuvor im Krieg gegen Dänemark gezeigt hat, scheint sich 1866 gegen andere Staaten zu wiederholen: Preußen schreckt erkennbar vor einem Krieg nicht zurück, wenn es um die Erweiterung der eigenen Macht geht. In Hannover nimmt auch Georg V. die zunehmende Bedrohung wahr, denkt aber nicht daran, dem preußischen Streben nach deutschlandweiter Vorherrschaft nachzugeben. Beharrlich setzt er auf die Sicherung des Status quo in Form des Deutschen Bundes, der nach dem Wiener Kongress 1815 gegründet worden war und dem die deutschen Einzelstaaten angehören. Der Zusammenschluss befriedigt zwar weder den liberalen Wunsch nach einer deutschen Einheit noch die Etablierung demokratischer Strukturen, denn die an diesem Bund beteiligten Staaten können Teile ihrer Souveränität abgeben, bleiben jedoch in erster Linie autonome Staaten. Aber immerhin soll der Deutsche Bund die innere und äußere Sicherheit seiner Mitglieder garantieren, und das ist nach den Erfahrungen der Kriege gegen Napoleon zu Beginn des Jahrhunderts auch weiterhin ein wichtiges gemeinsames Anliegen. Als zentrales Gremium dieses Staatenbundes fungiert die Bundesversammlung mit Sitz in Frankfurt am Main. Hier laufen bis zu diesem Zeitpunkt alle wichtigen Fäden einer deutschen Einheit zusammen. Wenn diese konkreter ausgestaltet werden soll, muss das auch hier entschieden werden.
Doch Preußen unter Führung von Otto von Bismarck ist dieser Bund ein Hindernis. Eine preußische Vorherrschaft in einem deutschen Reich wird so nicht gelingen, weiß der machtbewusste und diplomatisch überdurchschnittlich versierte Ministerpräsident. Er fordert wiederholt Reformen an dem Zusammenschluss, aber die anderen Staaten fürchten, dass mit Veränderungen am Bund der zunehmende Verlust eigener Souveränität im Zuge preußischen Machtgewinns drohe.4 Auch Hannovers König Georg V. wittert die Absicht, die deutschen Mittel- und Kleinstaaten zu schwächen. Er schätzt weiterhin den Deutschen Bund als das einzig legitime und brauchbare Mittel einer deutschen »Einheit«, wie er 1861 in einer Notiz festhalten lässt:5
»Die Bundesverfassung und der Bundestag sind meiner innigen Überzeugung nach die einzig wünschenswerten und einzig möglichen Bindemittel und das einzig wünschenswerte und einzig mögliche Centralorgan für Deutschland.«
Das ist weit mehr als eine strategische Äußerung: Georg V. kann der Einheitspropaganda dieser Zeit tatsächlich auch inhaltlich nichts abgewinnen. Er und seine Untertanen haben doch das Königreich Hannover und die Herrschaft seiner Familie, etwas anderes erscheint dem Monarchen weder wünschenswert noch denkbar. In diesem Sinne versucht er dem Herzog von Sachsen-Coburg bei anderer Gelegenheit einmal grundsätzlich klarzumachen, dass es eine einheitliche deutsche Nation doch im Grunde gar nicht gebe: In Wirklichkeit setze diese sich doch aus verschiedenen Stämmen mit jeweils besonderen Eigentümlichkeiten und Gesetzen zusammen, die schon seit 1000 Jahren nur in lockerer Form miteinander verbunden gewesen seien. So etwas könne man doch jetzt nicht einfach aneinanderketten.6 Keine Frage: Der König von Hannover sieht keinerlei Bedarf für einen weiteren Ausbau einer wie auch immer gearteten »deutschen Einheit«.
Aber Preußen, allen voran der Ministerpräsident Otto von Bismarck, setzt sich zunehmend an die Spitze jener bunt gemischten Gruppe von Einheitsfreunden, die es nicht nur in seinem Land gibt. Aber Georg V. lässt sich damit nicht als Partner gewinnen. Er ist zwar nahe mit der Hohenzollern-Familie verwandt, aber seine persönlichen Sympathien gelten den österreichischen Habsburgern. Als Regent, dessen Reich zwischen zwei rivalisierenden Großmächten eingeklemmt ist, zielt er allerdings politisch auf ein Gleichgewicht zwischen Berlin und Wien. Das ist alles andere als einfach, vor allem, da sich im Jahr 1866 tatsächlich ein Krieg zwischen Preußen und Österreich anbahnt. Otto von Bismarck hat aus dem Krieg gegen Dänemark gelernt, dass die Großmächte Russland, Großbritannien und Frankreich sich in einen Konflikt nicht einschalten, solange dieser nur außenpolitisch und propagandistisch geschickt vorbereitet ist. Für den klugen Strategen ist das kein Problem, und so erhöht er nach und nach den Druck auf Österreich, endlich den Konditionen für ein preußisches Holstein zuzustimmen und damit diesen Teil der Kriegsbeute endgültig Berlin zu überlassen. Schließlich verlangt er von Österreich dermaßen vehement, sich endlich den preußischen Forderungen zu beugen, dass das Nachbarland nicht mehr ohne Gesichtsverlust nachgeben kann. Großdeutsch-antipreußische Stimmen werden in Österreich laut, und Bismarck stellt Wien vor die Wahl, »entweder aufrichtige Allianz oder Krieg, bis aufs Messer«.7
Ein solcher Krieg ist fraglos ein Wagnis. Einen Kampf Deutscher gegen Deutsche will selbst in Preußen im Grunde kaum jemand. König Wilhelm und sein Ministerpräsident werden mit Bittschriften überhäuft, in denen die Verfasser dafür plädieren, doch unbedingt den Frieden zu wahren. Otto von Bismarck bekommt wegen seiner aggressiven Politik zunehmend ein Imageproblem. Allzu offensichtlich erscheint seine Absicht, einen Krieg gegen Österreich um die Vorherrschaft über Deutschland bewusst herbeiführen zu wollen. Der Gießener Professor Rudolf von Ihering empört sich am 1. Mai 1866 in einem Schreiben an einen österreichischen Kollegen und Freund, dass er »meinem Gefühl über die öffentlichen Dinge Luft machen« muss:8
»Es ist das Gefühl der tiefsten Entrüstung, dem ich Worte leihen muß! Mit einer solchen Schamlosigkeit, einer solchen grauenhaften Frivolität ist vielleicht nie ein Krieg angezettelt wie der, den Bismarck gegenwärtig gegen Österreich zu erheben sucht. Das innerste Gefühl empört sich über einen solchen Frevel an allen Grundsätzen des Rechts und der Moral.«
Der Rechtswissenschaftler, der im Großherzogtum Hessen-Darmstadt seiner Professur nachgeht, kann für das gegenwärtige preußische System keine Sympathien entwickeln, aber er will auch keine österreichische Herrschaft über Deutschland. So wünscht er sich für den nahenden »Bürgerkrieg« von Deutschen gegen Deutsche notgedrungen einen preußischen Sieg. Für den Rechtsgelehrten bedeutet diese Situation eine moralische wie intellektuelle Zwickmühle: Österreich ist im Recht, aber aus nationalen Erwägungen müsse man Preußen den Erfolg wünschen, denn »ein Sieg Bismarcks ist trotz Junkertum und Absolutismus ein gewaltiger Schritt vorwärts auf der Bahn der deutschen Entwicklung«.9 Der Krieg wird kommen, und er wird viel Leid bringen, ist sich der Professor sicher, und er beklagt jetzt schon die verwundeten Soldaten, denn die »wird es durch ganz Deutschland geben wie noch nie«.10 Die meisten Menschen rechnen für diesen Fall mit einem sehr langen Krieg, womöglich mit einem neuen Siebenjährigen Krieg.
Otto von Bismarck bekommt schließlich seinen Krieg, indem er sich geschickt außenpolitisch die Neutralität Frankreichs sichert und zugleich Italien für den Krieg gegen Österreich als Verbündeten gewinnt. Innenpolitisch eskaliert der Streit zwischen Berlin und Wien im Deutschen Bund, als Österreich die strittige Stellung der Herzogtümer Schleswig und Holstein dem Bundestag zur Entscheidung anträgt. Preußen reagiert am 9. Juni 1866 mit dem bundeswidrigen Einmarsch seiner Truppen in Holstein, woraufhin Österreich im Bund erfolgreich die Mobilisierung der nicht-preußischen Teile des Bundesheeres gegen den Aggressor beantragt. Am 14. Juni 1866 stimmen Bayern, Württemberg, Kurhessen und das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, Sachsen, Hannover und einige kleinere Staaten in der Bundesversammlung für den österreichischen Antrag (Baden enthält sich), die Mehrheit der nord- und mitteldeutschen Staaten schlägt sich auf die preußische Seite. Berlin erklärt angesichts seiner Abstimmungsniederlage den Deutschen Bund kurzerhand für erloschen und sieht sich endgültig an bisherige Vereinbarungen nicht mehr gebunden. Die preußische Armee beginnt am 15. Juni 1866 mit dem Marsch auf Sachsen, Hannover und Kurhessen, am 16. Juni beschließt der Bundestag – nun auch mit Unterstützung Badens – die sogenannte Bundesexekution gegen Preußen.11 Der Krieg, der von so vielen seit Wochen erwartet wurde, ist im Juni 1866 Wirklichkeit.
Allerdings scheint ein preußischer Sieg nicht notwendigerweise ausgemacht, denn das militärische Kräfteverhältnis ist keineswegs eindeutig. In Berlin spekuliert die Börse sogar auf einen Erfolg Wiens und löst damit in Preußen eine wirtschaftliche Flaute aus. Keine Frage: Otto von Bismarck geht in diesen Tagen ein unkalkulierbares Risiko ein.12 Außerdem hat Berlin ein Problem mit der öffentlichen Meinung: Eine Kriegsbegeisterung gibt es im Land nicht, stattdessen Volksversammlungen und Proklamationen gegen einen Waffengang. Auch die Konservativen sind zurückhaltend, weil sie auch für die österreichische Seite Verständnis haben. Viele Liberale misstrauen dem König und viel mehr noch Bismarck, weil beide bisher alle liberalen Hoffnung enttäuscht haben – aber ausgerechnet der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von Ferdinand Lassalle, ansonsten ein verlässlicher Gegner der preußischen Politik, unterstützt den Krieg Bismarcks, weil dieser sich doch zugleich für das allgemeine Wahlrecht eingesetzt hat.13 Als ob das schon einen Bruderkrieg rechtfertigen würde …
Andere Zeitgenossen wie der erwähnte Gießener Rechtsgelehrte Rudolf von Ihering sind trotz aller Bedenken gegen einen Krieg aber letztlich froh, dass es endlich losgeht. Den Kriegsbeginn empfindet Ihering als ein Gewitter, das sich nach unerträglicher Schwüle und Ungewissheit endlich entlädt und nach Wochen der Anspannung die willkommene Erleichterung bringt.14 Wie viele andere erlebt der Gelehrte diese Wochen als »zusammengedrängt«, als eine Zeit, in der so vieles in so kurzer Zeit geschehen ist, was die Zeitgenossen zuvor noch kaum für möglich gehalten haben.
Preußen geht offiziell mit dem Anspruch in diesen Krieg, Sachwalter der deutschen Sache zu sein und mit einem Waffengang doch nur dem Wunsch nach einer deutschen Einheit zu entsprechen.15 So heißt es in einer offiziellen telegrafischen Depesche, die in zahlreichen Tageszeitungen abgedruckt wird:16
»Verleiht Gott den Sieg, so werden wir stark genug sein, das lose Band zwischen den deutschen Landen fester und heilvoller zu erneuern.«
In diesem Sinne soll nach preußischer Lesart auch das Ende des Deutschen Bundes verstanden werden. Der nun beginnende Krieg sei schlicht nötig für die Sache der nationalen Einheit, denn »Feinde oder zweifelhafte Freunde« könne Preußen an seinen Grenzen nicht brauchen, lässt die preußische Regierung verlauten. Die Menschen in Deutschland bräuchten keine Angst zu haben, denn was jetzt geschehe, sei nur zu ihrem Besten. Sie mögen Preußen nur vertrauen, heißt es:17
»Indem die preußischen Truppen die Grenze überschreiten, kommen sie nicht als Feinde der Bevölkerung, deren Unabhängigkeit Preußen achtet, und mit deren Vertretern es in der deutschen National-Versammlung gemeinsam die künftigen Geschicke des deutschen Vaterlandes zu berathen hofft. Möge das deutsche Volk, im Hinblick auf dieses hohe Ziel, Preußen mit Vertrauen entgegenkommen und die friedliche Entwicklung des gemeinsamen Vaterlandes fördern und sichern helfen!«
Das ist im besten Falle gut gelogen: Preußen wird die Unabhängigkeit der Länder, deren Grenzen seine Soldaten jetzt übertreten, keineswegs achten. Das haben die preußische Führung und vor allem Otto von Bismarck überhaupt nicht vor. Und auch »Vertrauen« seitens des deutschen Volkes kann Preußen nicht erwarten. Stattdessen regen sich vor allem bei süddeutschen Liberalen massive Vorbehalte gegen Preußen. Sie durchschauen Bismarcks Einheitsrhetorik und sehen die bisherigen friedlichen Bemühungen um eine deutsche Einheit am Ende. In der Heidelberger Zeitung heißt es Anfang Juli des Jahres 1866:18
»Annexion bis zur Mainlinie oder Anschluß der norddeutschen Staaten an Preußen in einer Form, die von der Annexion politisch wenig verschieden ist, das heißt die definitive Theilung Deutschlands. Deutlicher als jemals betonen die Organe des Hrn. v. Bismarck die Schaffung eines preußischen Großstaates als das Kampfziel.«
Für die Gegner Preußens ist es offensichtlich, dass es den Angreifern nicht um die Einheit geht, sondern im Grunde um die Teilung Deutschlands, um das Ende der bisherigen deutschen Zusammenarbeit. Zugleich nehmen auch die militärischen Gegner Preußens für sich in Anspruch, das Vaterland aller Deutschen zu verteidigen, indem sie es vor der Raublust der Hohenzollern in Schutz nehmen. So heißt es in einer Proklamation des bayerischen Königs Ludwigs II.:19
»Unser Ziel, es ist der höchsten Opfer werth – die Erhaltung Gesammtdeutschlands als eines freien und mächtigen Ganzen, gekräftigt durch den Bund seiner Fürsten und die nationale Vertretung seiner Stämme, die Erhaltung Bayerns als eines selbständigen würdigen Gliedes des großen deutschen Vaterlandes.«
Was nun der »höchsten Opfer« in diesem Krieg wirklich wert ist, darüber gehen außerhalb Preußens die Meinungen dann aber doch deutlich auseinander. Im Königreich Hannover jedenfalls ist die Angst vor der militärischen Übermacht Preußens so groß, dass liberale Politiker das Abstimmungsverhalten ihres Königsreichs in der Bundesversammlung heftig kritisieren, denn das habe für Hannover »eine unabsehbare Last und die Gefährdung der Unabhängigkeit des Landes« mit sich gebracht. Deshalb fordern sie von ihrem König die Nichtausführung des Beschlusses einer Bundesexekution gegen Preußen.20
Doch Georg V. bleibt bei seiner Position: Sein Hannover will nicht mit Preußen paktieren, sondern das Recht auf eine eigenständige Rolle behalten, sowohl in politischer als auch in militärischer Hinsicht. Seine Anordnung, bereits im Mai 1866 die hannoverschen Reservisten zu Wehrübungen einzuberufen, dürfen die Preußen getrost als gegen sie gerichtete Maßnahme verstehen, auch wenn es sich keineswegs um eine Mobilmachung handelt. Anschließend stellt Bismarck den Welfenkönig vor die Alternative, sich förmlich zu einer unbewaffneten Neutralität zu verpflichten oder aber in Kauf zu nehmen, dass Preußen seine Pläne sonst eben mit Gewalt und ohne Rücksicht auf Hannover und seinen König durchsetzen werde. Georg V. pocht als souveräner Herrscher auf seine Militärhoheit. Er lässt sich von Preußen nicht sagen, was er zu tun hat. Er wolle lieber »mit Ehren untergehen«, erklärt er, als sein weiteres Schicksal von der Gnade Preußens abhängig zu machen.21
Preußen erfüllt dem blinden Monarchen diesen Wunsch umgehend: Er geht mit seinem Reich unter, weil er dem preußischen Kurs und den militärischen Notwendigkeiten eines Kriegs gegen Österreich schlicht im Weg ist. Hannover lehnt die von Preußen verlangte unbewaffnete Neutralität ab und unterstützt den österreichischen Antrag auf Mobilisierung der Bundesarmee gegen Preußen. Eine letzte ultimative Forderung, doch noch ein Bündnis mit Preußen zu schließen, weist Georg V. am 15. Juni 1866 zurück. Dann geht es militärisch sehr schnell: Noch am selben Tag überschreiten preußische Truppen die Elbe, andere preußische Einheiten dringen von der Garnison Minden aus in hannoversche Gebiete vor, und schon am 17. Juni ist die Residenzstadt Hannover besetzt.22 Die Empörung über das preußische Vorgehen ist groß, die Wortwahl unmissverständlich. Dafür steht eine Proklamation des hannoverschen Generals von Arnschildt Ende des Monats:23
»Ein trauriger Act verwerflicher brudermörderischer Politik hat Preußen zum Feinde Hannovers gemacht, Länder, die das innigste Band verknüpften, die seit Jahrhunderten nur gewußt haben, daß ihre Krieger Schulter an Schulter dem Feinde entgegenzutreten berufen seien. Fluch treffe die Urheber dieses Bruderkrieges, den wir verabscheuen.«
Das sind starke Worte, aber sie helfen nicht: Die hannoversche Armee ist für einen Krieg, erst recht für einen längeren Krieg, nicht ausreichend gerüstet. Der König zieht mit seiner Armee in den Süden des Landes, um noch eine Vereinigung mit den verbündeten österreichischen oder bayerischen Truppen zu versuchen. Doch das gelingt nicht. Und nur ein Etappensieg ist die Schlacht bei Langensalza, bei der die hannoversche Armee am 27. Juni 1866 mit über 20 000 Soldaten über rund 8400 Preußen siegt. Doch schon am nächsten Tag wird deutlich, dass die nachrückende preußische Verstärkung jede weitere Kampfhandlung aussichtslos macht. Am 29. Juni kapitulieren die Welfen; der preußisch-hannoversche Krieg hat gerade einmal zwei Wochen gedauert. Die Soldaten werden aus dem Dienst entlassen, ihrem Feldherrn und König wird mit seinem engsten Gefolge freier Abzug gewährt, das Land Hannover der preußischen Militäradministration unterstellt.24 König Georg V. scheint erkennbar Schwierigkeiten damit zu haben, die Realität dieser Niederlage und ihre Bedeutung zu erfassen. In einem Brief an seine Frau gibt er nur wenige Tage später einen Wortwechsel zwischen ihm und seinem kommandierenden General wieder, der ihn nach der Schlacht von Langensalza mit dieser Botschaft konfrontiert:25
»›Ich darf Ew. Majestät zu diesem glänzenden Sieg Glück wünschen; es ist indeß der Todestag unserer Armee.‹ Ich antwortete ihm: ›Gott sey ewig gepriesen, daß dieser Sieg unser ist. Wie Sie aber behaupten können, daß dieser Tag zugleich der Todestag meiner Armee seyn soll, verstehe ich nicht. Ich betrachte ihn wie unsern Auferstehungstag.‹«
Am 30. Juni 1866, als sich längst herausgestellt hat, dass die Schlacht von Langensalza nicht die Wende gebracht hat, Hannover bereits kapituliert hat und Georg V. im Jagdschloss »Fröhliche Wiederkunft« Zuflucht findet, wartet man im restlichen Deutschland noch auf verlässliche Informationen über die Vorgänge. »Über das Schicksal der Hannoveraner«, so heißt es etwa in der Heidelberger Zeitung, »ist man leider noch immer nicht im Klaren.«26 Dabei ist die Kapitulation bereits unterzeichnet, und die Niederlage ist für Hannover umfassend, dokumentiert in den Bedingungen der Sieger:27
»Der König, der Kronprinz und ihr Gefolge dürfen beliebigen Aufenthalt außerhalb Hannovers nehmen. Des Königs Privatvermögen bleibt zu seiner Verfügung. Die Officiere und Beamten versprechen auf Ehrenwort, gegen Preußen nicht zu dienen, behalten Waffen, Pferde und Gepäck, sowie ihr Gehalt und ihre Competenzen. Die Unterofficiere und Gemeinen liefern Waffen, Pferde und Munition ab, begeben sich in … ihre Heimath unter dem Versprechen, gegen Preußen nicht zu dienen.«
Auch wenn König Georg V. sich dafür nun politisch nichts mehr kaufen kann, so erntet er doch zuweilen eine gewisse Anerkennung für seine Haltung: Das Organ der Arbeiterbildungsvereine, die Allgemeine deutsche Arbeiter-Zeitung, attestiert ihm, dass er mit dem Zug seiner Armee »wenigstens durch Muth und Festigkeit zum erstenmal in seinem Leben sich einige Sympathie erwirbt«.28 Viele Hannoveraner verübeln Georg V. zwar weiterhin seine Regentschaft, manche denken wie der liberale Politiker Rudolf von Bennigsen erst recht im Moment der Niederlage, dass dieser König »besser nie zur Regierung gekommen wäre«, weil er mit seiner »an Wahnsinn grenzenden Verstocktheit« so großes Unglück über das Land gebracht habe. Auch in der Bevölkerung ist die Meinung verbreitet, dass der König ihr Land durch seinen persönlichen Eigensinn erst in diesen Krieg geführt habe.29 Doch die überwiegende Mehrheit der Menschen lehnt die Annexion durch Preußen ab, auch wenn sie deshalb keineswegs der Meinung ist, dass Georg V. unbedingt auf den Thron zurückkehren müsse. Und doch verändert sich mit der Niederlage das Bild von diesem König: Seine Starrheit wird von einigen jetzt als Prinzipientreue gewürdigt, sein unverkennbarer monarchischer Dünkel als echter königlicher Stolz gewertet.
Doch Georg V. hat in dem thüringischen Jagdschlösschen jetzt andere Sorgen, als sich über sein öffentliches Image Gedanken zu machen. Langsam wird er gewahr, dass »die Schufte von Preußen« nicht nur sein Land vollständig besetzt halten, sondern dass er es nicht mehr wiederbekommen könnte. Derweil ziehen die preußischen Armeen weiter – und sie siegen weiter. Kampflos waren sie in das Königsreich Sachsen eingezogen, sie greifen Länder wie das Kurfürstentum Hessen-Kassel und die Stadt Frankfurt am Main an, weitere Truppen ziehen nach Böhmen, wo sie auf österreichische Einheiten treffen. Dass württembergische Truppen zu Beginn des Krieges in die hohenzollernschen Lande einmarschiert sind, das alte Stammgebiet der preußischen Herrscherdynastie, und bayerische Soldaten den Kreis Schleusingen sowie Bundestruppen unter Prinz Alexander von Hessen Wetzlar besetzt haben,30 kann Preußen bei seinem militärischen Siegeszug nicht aufhalten.
Aber gerade die ersten Erfolge lassen vor allem im deutschen Süden die Frage nach den tatsächlichen Kriegszielen und den politischen Zukunftsvorstellungen vor allem der Preußen immer brennender erscheinen. Wenn diesen der Ausschluss Österreichs aus einem deutschen Staatengebilde gelinge, und das scheine ja das wichtigste Motiv für den Krieg zu sein, »fängt die eigentliche Aufgabe mit ihren Schwierigkeiten erst an«, kommentiert beispielsweise die Freiburger Zeitung im Juli 1866. Gerade nach den ersten erfolgreichen Schlachten müsse den Preußen doch gerade jetzt die Grenzen ihres Machtstrebens aufgezeigt werden:31
»Deutschland ist kein herrenloses Gut, über das der glückliche Sieger ohne Weiteres verfügt … Preußen muß gezwungen werden, sich wieder als ein Glied des Ganzen anzuerkennen, und muß ausreichende Sicherheit geben, daß es nicht noch einmal den Versuch machen kann, Deutschland zu trennen, um es zu beherrschen. Das ist das eigentliche Ziel des Krieges.«
Doch solche Aufrufe kommen im Prinzip schon zu spät. Niemand scheint in der Lage zu sein, den preußischen Sieg noch zu verhindern. Am 3. Juli 1866 treffen im Nordosten Böhmens rund 200 000 preußische Soldaten auf ebenso viele österreichische und sächsische Soldaten. Bei dieser Schlacht von Königgrätz siegen die Preußen, die daraufhin weiter auf österreichisches Gebiet vorstoßen. Diese Schlacht ist die letzte große Kampfhandlung des preußisch-österreichischen Kriegs, gut drei Wochen später werden ein Waffenstillstand und ein Vorfrieden geschlossen, ehe am 23. August in Prag ein Friedensvertrag unterzeichnet wird. Der Krieg endet mit einer Niederlage Österreichs, allerdings resultiert dieses Ende keineswegs nur aus der militärischen Lage, sondern ist auch das Ergebnis einer politischen Entscheidung Wiens: Die Fortsetzung des Kampfes gegen Preußen birgt offensichtlich das Risiko, dass die Monarchie eine weitere Niederlage erleiden und diese wohl nicht verkraften würde. Auch wenn es die Militärs später immer wieder behaupten sollten, so war die Schlacht von Königgrätz doch keine Entscheidungsschlacht in einem militärischen Sinn; das Ereignis selbst hat den Krieg lediglich beendet, aber nicht entschieden. Doch die österreichische Seite wird die preußische Leistung bei diesem Aufeinandertreffen bewusst überhöhen, um die eigenen politischen und militärischen Fehler kleinerzureden. Und die preußischen Chronisten nehmen das Angebot gern an: Sie arbeiten eifrig am Mythos Königgrätz, von der Überlegenheit des modernen Preußens und seiner Waffen.32
Aber noch herrscht Krieg – mit all seinen Facetten. Leidtragende sind die Soldaten. Eines von vielen Schicksalen, der Tod des preußischen Majors Cäsar Rüstow, wird am 22. September 1866 in der Allgemeinen Militär-Zeitung beschrieben. Der 40-Jährige kämpft nach der Okkupation Hannovers mit seinem Bataillon gegen die Bayern. Am 4. Juli 1866 kommt es bei Dermbach zum Gefecht.33
»Da traf ihn ein bayerisches Musketen-Geschoß in den Unterleib, und er sank vom Pferde. Die Wunde war wohl, wie die meisten Unterleibswunden, tödtlich, doch hätte er noch Tage lang in Leiden fortleben können. Dieß sollte ihm erspart werden. Auf dem Verbandsplatze, wohin ihn einige seiner Leute trugen, und während er verbunden ward, traf ihn ein zweites Geschoß in den Hinterkopf und machte seinem Leben augenblicklich ein Ende.«
Nach dem Gefecht bei Kissingen am 10. Juli 1866 sind die ohnehin erst in Ansätzen vorhandenen Sanitätsdienste der Armeen mit der Versorgung der vielen Verwundeten rasch überfordert. Rund 700 preußische und 570 bayerische Soldaten müssen anschließend betreut werden. Da in den wenigen Lazaretten nicht genug Platz vorhanden ist, werden die Verwundeten unter anderem im Kurgarten von Kissingen notdürftig versorgt.34 Abseits der Städte ist die Versorgung noch dürftiger: Aus Böhmen berichtet ein Sanitäter, dass die Verwundeten zunächst auf den Schlachtfeldern geborgen, dann auf einfache Bauernwagen geladen und in Lazarette gebracht werden, die behelfsmäßig in Kirchen, Gasthäusern oder Bürgerhäusern eingerichtet worden sind. Diese sind indes zuweilen überfüllt, weshalb auch Scheunen und Ställe als Unterbringung genutzt werden. Oft fehlt es nicht nur an medizinischer Versorgung, selbst Trinkwasser ist für die verletzten Soldaten nur schwer zu beschaffen. »Das Schreien der Verwundeten nach Wasser«, so berichtet ein Krankenpfleger, sei für ihn nur schwer zu ertragen, weil er keine schnelle Abhilfe schaffen könne.35
Der Transport der Verwundeten geschieht mit denkbar einfachsten Mitteln: Ein Teilnehmer des Krieges berichtet aus dem niederschlesischen Löbau, »wo ein sehr grosser Zug mit lauter Verwundeten ankam, ein jämmerlicher Anblick, die armen Menschen liegen in den Wagons auf Stroh, wie das Schlachtvieh«.36 Zudem bricht im preußischen Heer die Cholera aus; im Juli 1866 berichtet ein freiwilliger Krankenpfleger aus der niederösterreichischen Ortschaft Poisdorf von der Lage der Erkrankten. Bis zu 300 Soldaten seien betroffen, aber an eine geregelte Versorgung sei nicht zu denken: »nur ein Arzt, kein Gehülfe, kein Wärter, kein Essen, keine Betten, keine Medizin, gar nichts mehr in der Apotheke«.37 Auch die Schändung toter Soldaten durch andere Deutsche gehört zu den Realitäten dieser Wochen. Die Heidelberger Zeitung berichtet im August 1866 aus Frankfurt am Main:38
»Der gestern Morgen um 9 Uhr 15 Min. anlangende Zug der Hanauer Bahn brachte außer einer Anzahl Kriegsgefangener auch zwei verhaftete Civilisten mit. Dieselben haben auf dem Schlachtfelde bei Tauberbischofsheim Todte und Verwundete ausgeplündert und sich dabei die gräßlichsten Verstümmelungen erlaubt, indem sie Finger und Ohren nebst der Beute abschnitten.«
Wie in jedem Krieg lastet die Versorgung der Soldaten schwer auf der Zivilbevölkerung. Ein Beispiel dafür liefert ein Zeitungsbericht, dem zufolge die kleinen sächsischen Amtsbezirke Ostritz, Reichenau und Herrnhut alle drei Tage folgende Kriegskontributionen an die Preußen zahlen müssen:39
»15 000 Pfund Brod, 16 875 Pfund Fleisch, 11 250 Pfund Bohnen, ebensoviel Erbsen, 5625 Pfund Graupen, 1500 Pfund Reis, 67 000 Pfund Kartoffeln, 33 750 Pfund Salz, 7070 Pfund Kaffee, 22 500 Kannen (à 2 Seidel) Bier, 225 000 Cigarren, 33 500 Rationen Hafer, 8000 Rationen Heu, 9750 Pfund Stroh.«
Für die Menschen in Berlin ist dieser Krieg hingegen zunächst einmal weit weg; sie lesen in den Zeitungen von den Geschehnissen, erfahren auf Straßen und Plätzen von den Ereignissen. Erzählt wird viel, doch was ist wahr, was nur ein Gerücht? Der Schriftsteller und Maler Ludwig Pietsch notiert Ende Juni 1866, wie abends in einigen Straßen der Innenstadt Menschenmassen zusammenfanden, denn »Gerüchte der abenteuerlichsten Art von ungeheuren Verlusten, von unverantwortlichen Versäumnissen, durch welche das Unheil verschuldet sei, schwirrten von Gruppe zu Gruppe«. Als am 29. Juni 1866 Meldungen über die preußischen Siege bei Nachrod und Münchengrätz aus Böhmen eintreffen, ziehen nach seiner Beobachtung »dichte Scharen enthusiastisch aufgeregter Menschen« über die Friedrichstraße und schließlich in die Wilhelmstraße zu Bismarcks Quartier. Sie lassen den preußischen Ministerpräsidenten hochleben, und der anhaltende Jubel bringt diesen tatsächlich dazu, ein Fenster zu öffnen und zu der Menge zu sprechen – allerdings gehen seine Worte im Lärm nahezu vollständig unter. Der »Bestgehaßte«, so notiert Ludwig Pietsch, ist »mit einem Schlage der am glühendsten Verehrte und Bewunderte geworden«.40
Ein besonderes Schauspiel für einige Menschen der preußischen Hauptstadt ist das Eintreffen von Kriegsgefangenen, ihr Anblick macht das Kriegsgeschehen auf spektakuläre Weise greifbar. Auch Ludwig Pietsch macht sich neugierig auf den Weg zu den Bahnhöfen, wenn wieder einmal tagsüber oder auch abends die fremden Soldaten zu sehen sind, die mit Eisenbahnzügen ankommen und anschließend weitertransportiert werden. Es sind gleichermaßen sächsische wie österreichische Gefangene:41
»Unter den letzteren zumal eine überreiche Fülle prachtvoller, höchst malerischer Charakterfiguren, Italiener, Kroaten, Ungarn in ihren, alle Spuren des Krieges, der Märsche, der Biwaks der Schlachten tragenden, verstaubten, zerfetzten, blutbesudelten, vielfarbigen Uniformen.«
Solche Momente sind ein regelrechtes Spektakel für die Berliner: Hier an den Bahnhöfen können sie die Siege ihrer preußischen Soldaten sozusagen mit eigenen Augen bestaunen. Dabei kann es allerdings ungewollt auch geschehen, dass die Kehrseite des Krieges erkennbar wird. Denn zugleich treffen auch andere Züge in der Hauptstadt ein, die »eine für uns desto traurigere Last« befördern, so Ludwig Pietsch, nämlich »die Verwundeten, die mit ihrem Blut diese Siege erkauft hatten und von den Schlachtfeldern zu den Berliner Lazaretten transportiert wurden«.42
Doch Ende Juli 1866 ist das Kämpfen beendet; am 26. Juli sowie am 28. Juli willigen zunächst Österreich und dann Bayern in einen Waffenstillstand ein. Wenige Tage später tun dies auch das Königreich Württemberg, das Großherzogtum Hessen-Darmstadt sowie das Großherzogtum Baden. Jetzt schlägt die Stunde des Siegers, und in den folgenden Friedensverträgen werden die fälligen Kriegsentschädigungen sowie mögliche Gebietsabtretungen festgelegt. Wer nicht an der Seite Preußens gekämpft hat, wird zur Rechenschaft gezogen. Einige scheinen vergleichsweise glimpflich davonzukommen, indem sie eine Strafzahlung leisten müssen, anderen droht ganz offensichtlich der Verlust ihrer Souveränität. Württemberg beispielsweise hat durchaus Glück im Unglück; aus der Sicht der württembergischen Politik notiert die Frau des späteren württembergischen Gesandten in Preußen, welche Erfahrungen die Delegierten aus Stuttgart in Berlin machen:43
»Sie sind von Bismarck sehr gut empfangen worden und waren gleich im reinen; Württemberg zahlt 8 Millionen Gulden Kriegssteuer und bleibt im übrigen ganz unbeschränkt und unangetastet. Von einem Eintritt in den Norddeutschen Bund konnte jetzt Frankreichs wegen noch nicht die Rede sein. Nach geschehenem Friedensschluß empfing der König unsere Herren und hielt eine lange, sehr dumme Anrede an sie, d.h. schalt sie tüchtig aus, daß sie mit Österreich es gehalten haben.«
Diese »sehr dumme« Rede des preußischen Königs können die Herren Diplomaten mehr oder weniger entspannt über sich ergehen lassen. Denn auf diese Weise erntet Württemberg zwar königlich-preußischen Tadel, aber kommt damit deutlich besser weg als andere Staaten.44 Vor allem in Bayern ist man besorgt, was die Forderungen des siegreichen Preußens angeht. König Ludwig II. erklärt anfangs gegenüber dem französischen Gesandten noch: »Herr von Bismarck will aus meinem Königreich eine preußische Provinz machen.« Doch Mitte August kann er schon seiner Mutter erleichtert schreiben, dass die Friedensbedingungen glücklicherweise besser sind, »als zu erwarten stand«. Zwar muss das Königreich eine Kriegsentschädigung von 30 Millionen Gulden zahlen, doch bis auf drei sehr kleine Gebiete, die es an Preußen abtreten muss, bleibt Bayern territorial nahezu vollständig unangetastet.45 Das ist im Sommer 1866 für einen deutschen Regenten schon ein Grund zur Freude.
Ludwig II. darf also sein Reich behalten. Anders als etwa Friedrich Wilhelm I., der Kurfürst von Hessen-Kassel, der zunächst in Kassel festgehalten und dann als Gefangener ins preußische Stettin gebracht wird. Der stolze Fürst ist selbstredend erbost über die in seinen Augen entwürdigende Behandlung. In den Zeitungen finden sich Auszüge aus angeblich geführten Gesprächen des abgesetzten Kurfürsten mit dem preußischen Gesandten General Heinrich von Roeder, mit dem er in Streit darüber gerät, inwieweit Preußen auch die Herrschaft seines »Bruders« zerschlagen wolle, des Großherzogs von Hessen-Darmstadt. Der Kurfürst wird folgendermaßen zitiert:46
»Mein Bruder in Darmstadt ist ebenso gut ein legitimer deutscher Fürst als Ihr König von Preußen, ja er ist noch zehnmal legitimer, denn als die deutsche Geschichte schon von hessischen Fürsten erzählte, da kannte man nur Brandenburg und keinen König von Preußen.«
Das klingt wie dynastische Überheblichkeit eines kleinen Fürsten, verweist aber doch auf den Stolz jener deutschen Fürsten, die fraglos nicht über die Macht und den Einfluss von Preußen, Österreich oder Bayern verfügen, die aber doch aufgrund ihrer Geschichte und ihrer traditionellen Souveränität über ihre Herrschaftsgebiete als Regenten respektiert werden wollen. Doch auf solche Empfindsamkeiten wird in diesem Sommer 1866 noch weniger Rücksicht genommen als zuvor. Wer nicht für Preußen war, muss nun schlicht die Konsequenzen tragen. Am 16. August 1866 zeichnet der preußische König den entsprechenden Text, in dem die wichtigsten Annexionen verkündet werden:47
»Nicht in dem Verlangen nach Ländererwerb, sondern in der Pflicht, Unsere ererbten Staaten vor wiederkehrender Gefahr zu schützen, der nationalen Neugestaltung Deutschlands eine breitere und festere Grundlage zu geben, liegt für Uns die Nöthigung, das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen, das Herzogthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt auf immer mit Unserer Monarchie zu vereinigen.«
Das ist majestätisch formuliert, doch die Grobheit des Vorgehens kann damit auch nicht überdeckt werden. Die genannten Gebiete hatten ja durchaus eine eigenständige Idee von einer deutschen Einheit, sie war aber nicht identisch mit der Vorstellung, die man sich in Berlin davon macht, nämlich ein geeintes Reich unter Ausschluss Österreichs und mit dem Königreich Preußen als mächtigem Mittelpunkt. Der Umgang mit den betroffenen deutschen Ländern, deren Regenten anderer Meinung sind, ist ein atemberaubender diplomatischer Vorgang, und Otto von Bismarck stößt mit diesen Annexionen beim preußischen König Wilhelm zunächst auf Unbehagen. Nun gut, Preußens Herrscher waren seit den Tagen Friedrichs des Großen nie zimperlich mit ihren Gegnern umgegangen, da will sich auch Wilhelm nicht unnötig sensibel zeigen. Aber eine andere deutsche Dynastie einfach entthronen? Dazu noch eine solch traditionsreiche Herrscherfamilie wie die der Welfen? Das widerspricht seinem Rechtsempfinden und seinem Gefühl von einem nach Möglichkeit zu bewahrenden Respekt vor anderen Monarchien. Wenn man sie in einem Krieg besiegt, dann ist es für Wilhelm legitim, nach einen solchen Sieg Gebietsabtretungen zu verlangen. So will er es jetzt auch von Österreich – auch hier ist die Erinnerung an Friedrich den Großen eine Bestärkung, schließlich eroberte er einst die wertvolle Provinz Schlesien in seinem ersten von später drei Schlesischen Kriegen und nach seinem Sieg über Wien. Aber sich ganze Länder einfach einverleiben? Das geht nur mit dem Argument, dass man dies nicht für sich selbst, sondern für die deutsche »Einheit« mache. Sie wird damit zur politischen Ausrede für die preußische Expansion.
Das wird auch deutlich an dem spektakulären Raub der Stadt Frankfurt am Main. Als sei dieser legitim und zudem politisch alternativlos, lässt der preußische König Wilhelm am 3. Oktober 1866 verkünden:48
»Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, thun gegen Jedermann hiermit kund: Nachdem in Folge eines von Oesterreich und seinen Bundesgenossen begonnenen, von Uns in gerechter Abwehr siegreich geführten Krieges die freie Stadt Frankfurt a. M. von Uns besetzt worden ist, so haben Wir beschlossen, dieselbe mit Unserer Monarchie zu vereinigen … Wir werden Unserem Königlichen Titel den entsprechenden Titel hinzufügen.«
Das dreiste Vorgehen wird in feierliche Worte gekleidet, und die alte Reichsstadt ist nun eine »fette Beute« für Preußen. 30 Millionen Gulden verlangt der Sieger von Frankfurt, wo noch vor wenigen Wochen die Bundesversammlung des Deutschen Bundes tagte, welche die Bundesexekution gegen Preußen verhängte. So gesehen ist die Annexion der Stadt auch ein großer symbolischer Sieg Preußens über das »alte« Deutschland. Frankfurt verliert seine Unabhängigkeit und wird in die preußische Provinz Hessen-Nassau eingegliedert. Die Zahlung der Kriegskontribution ist für die Stadt leistbar, und bald fließen erste Gelder. Doch als die Forderung nach möglichen Ratenzahlungen aus der Bürgerschaft laut wird, gerät der Bürgermeister Karl Fellner in einen unauflösbaren Konflikt mit den Preußen, die keinerlei Diskussionen um Erleichterungen akzeptieren. Die preußische Stadtkommandantur ordnet schließlich die Auflösung von Senat, Bürgerrepräsentation und der gesetzgebenden Versammlung an.49 Zudem werden zahlreiche Zwangsmaßnahmen angedroht für den Fall, dass es bei den Zahlungen zu Verzögerungen kommen sollte. In dieser Lage begeht Bürgermeister Fellner am Morgen seines 59. Geburtstages, dem 24. Juli 1866, in seinem Wohnhaus Selbstmord. Das Entsetzen in der Stadt ist verständlicherweise groß, und umgehend wird Fellner zum Märtyrer gegen die preußische Fremdherrschaft stilisiert. Im folgenden Jahr erscheint aus der Feder eines anonymen Autors sogar ein Drama mit dem Titel »Der letzte Bürgermeister der freien Stadt Frankfurt a.M.«. Darin wird die vermeintliche Auflehnung Fellners mit den Worten zitiert: »Eh’ zieh’ ich’s vor, als freier Mann zu sterben, als um die Gunst der Tyrannei zu werben.«50
Die Nachricht vom Freitod des Bürgermeisters dringt kaum aus Frankfurt heraus, denn zu den ersten Opfern des Krieges gehört auch jetzt die freie Meinungsäußerung: Der Druck von freien Zeitungen wird in den preußisch besetzten Ländern umgehend verboten. Gerüchte ersetzen jetzt häufig verlässliche Nachrichten, ganz gleich, ob es um die große Politik oder um lokale Vorgänge geht. Die Situation ist unübersichtlich. So wird der Gelehrte von Ihering als gebürtiger Preuße mit anderen Professoren an der im Großherzogtum Hessen-Darmstadt liegenden Universität Gießen in diesem Sommer irrtümlich für einen preußischen Spion gehalten, wie er einem Freund schreibt, »doch sind wider Erwarten unsere Fenster noch verschont geblieben«.51 Überhaupt habe ihm »in der bewegten Zeit niemand etwas zuleide getan«, schreibt der »Hauptpreußenfreund« durchaus anerkennend über die gesellschaftliche Achtung, die er augenscheinlich an der Universität und in der Stadt Gießen genießt.52
Die Schlachten des Krieges sind also geschlagen, und zumindest aus preußischer Sicht hat die deutsche Einheit einen Sieg errungen. Dies bedeutet auch den offiziellen Verzicht des Kaisers von Österreich, sich weiterhin als Teil eines deutschen Reiches zu verstehen. Wien muss schon am 26. Juli im Vorfrieden von Nikolsburg nicht nur seine Niederlage eingestehen, sondern auch von einer Zukunft in einem deutschen Staatsgebilde Abstand nehmen:53
»Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich erkennt die Auflösung des bisherigen Deutschen Bundes an und gibt seine Zustimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Betheiligung des Oesterreichischen Kaiserstaates.«
Der Deutsche Bund, der mit seinen Beschlüssen Otto von Bismarck den willkommenen Grund für diesen Krieg geliefert hatte, ist endgültig am Ende. Vor den vorrückenden preußischen Truppen musste die Bundesversammlung mit einem Sonderzug in das vorerst sichere bayerische Augsburg flüchten, wo ein Großteil der Delegierten im Hotel »Zu den drei Mohren« Quartier bezieht. Doch die Versammlung ist ohnehin nur noch ein Torso; Preußen ist früh aus dem Bund ausgetreten, andere Länder sind dem Beispiel gefolgt. So verwaltet die Bundesversammlung in Augsburg nur noch das eigene Ende und beschließt am 24. August 1866, »ihre Thätigkeit mit der heutigen Sitzung zu beendigen«, weil infolge »der Kriegsereignisse und der Friedensverhandlungen der Deutsche Bund als aufgelöst betrachtet werden« müsse.54 Anwesend sind in diesem Moment neben den Vertretern Österreichs nur noch die Delegierten von Bayern, Württemberg, des Großherzogtums Hessen-Darmstadt und Kurhessens.55 Viele Verdienste des Deutschen Bundes werden schon sehr bald – vor allem von den folgenden Generationen und der Geschichtsschreibung – schlicht vergessen. Dabei profitiert das schließlich 1871 gegründete Deutsche Reich in vielerlei Hinsicht von diesem Bund: Von ihm wurden unter anderem das einheitliche Patentrecht, das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch, die Auswanderergesetzgebung oder die Vereinheitlichung von Münzen, Maßen und Gewichten entscheidend vorbereitet.56 Die preußische Behauptung, dieser Deutsche Bund sei generell ein Hemmschuh für die Entwicklung einer deutschen Einheit gewesen, wird auch durch permanente Wiederholung nicht zutreffender.
Während die süddeutschen Länder in Augsburg die Organisationsplattform des alten Deutschlands auflösen, sehen sie sich zugleich gezwungen, sich den militärischen Bedingungen des neuen Deutschlands zu beugen: Bayern, Württemberg und Baden schließen mit Preußen weitgehend identische Schutz- und Trutzbündnisse ab, die einen unkündbaren »ewigen Militärbund« im Falle eines casus foederis begründen, worunter allerdings auch ein präventiver Verteidigungskrieg fallen könnte. Im Kriegsfall soll fortan der Oberbefehl der Truppen automatisch auf den preußischen König übergehen. Für Preußen bedeutet der Abschluss dieser Verträge nicht weniger als eine kleindeutsche, »militärische Reichsgründung«. Im August 1866 wird der Norddeutsche Bund gegründet, dem neben Preußen zunächst 17 norddeutsche Kleinstaaten angehören; später treten weitere Staaten wie etwa das Königreich Sachsen bei. Da der preußische König innerhalb dieses Bundes die Funktion des obersten Feldherrn einnimmt, ist mit den zu den Bündnisverträgen gezwungenen Kriegsverlierern Süddeutschlands im Kriegsfall die militärische Einheit des gesamten Deutschlands unter Ausschluss Österreichs vollzogen.57 Was da an die Stelle des Deutschen Bundes tritt, ist für Preußen nach dem militärischen Erfolg der zweite, vielleicht der noch größere Sieg in Deutschland. Das wissen auch die süddeutschen Vertragspartner, weshalb in den Dokumenten zunächst strikte Geheimhaltung vereinbart wird. Damit wollen die neuen Partner nicht nur den Unmut Frankreichs vermeiden, das sich von dem neuen Bündnis bedroht fühlen könnte, sondern auch den heimischen Kritikern nicht zusätzlichen Anlass zu der Befürchtung liefern, hier werde die Eigenstaatlichkeit allzu leichtfertig für immer aus der Hand gegeben.
Doch auch wenn die Verträge noch nicht öffentlich werden, die Kritik an dem preußischen Modell der Einheit besteht fort. Die demokratischen Kräfte sehen mit dem preußischen Sieg ihre Idee der Freiheit durch die machtpolitische Instrumentalisierung der Einheit bedroht. Freiheit und Einheit wird es unter preußischer Vorherrschaft nicht geben, heißt es beispielsweise in der Allgemeinen deutschen Arbeiter-Zeitung, die sich auf die Schriften des Journalisten und Schriftstellers Ludwig Pfau bezieht, der ein scharfer Kritiker der Bismarck’schen Politik ist. König Wilhelm inszeniere sich gern als »Mehrer der Reiches«, so heißt es in dem Artikel, er sei jedoch vor allem »allzeit Verringerer der Freiheit«. Denn es sei ein Irrglaube, dass sich ein freies Deutschland unter einem preußischen, unfreien Regime entwickeln könne:58
»Wie soll ein Königthum, das eben erst die gesamte Nation niedergeworfen hat, das unter dem Geklirr seiner Waffen eben erst sich eine ›conservative‹ Majorität zusammenmanövriert hat, so einfältig sein, sich selbst beschränken zu wollen, während es diese Beschränkung von sich wies, als es noch schwächer war?«
Preußen gewährte vor diesem Krieg keine politischen Freiheiten, so lautet die weitverbreitete Warnung, und es werde nach seinem Sieg über das übrige Deutschland diese den Bürgern erst recht nicht zugestehen. Schlimmer noch: Deutschland drohe in seiner Entwicklung um Hunderte von Jahren zurückgeworfen zu werden, heißt es in dem Zeitungsartikel weiter:59
»Wenn heute die deutschen Staaten unter preußischer oder österreichischer Herrschaft wieder vereinigt würden, so wäre die politische Entwicklung Deutschlands bis zur Reformationszeit zurückgeschraubt. Unsere Staatenbildung, die nach vielhundertjährigen Kämpfen endlich aus der Phase der Gewalt in die der Gerechtigkeit zu treten strebt, wäre mit der Herrschaft großmächtlichen Säbelregiments auf den Boden des Faustrechts zurückgeworfen. Wir hätten wieder ein heiliges römisches Reich, d.h. Junkerthum, Pfaffenherrschaft, Volksbedrückung, überhaupt Ausbeutung der Masse durch eine bevorrechtete Minderheit, und damit einen neuen dreißigjährigen Bürgerkrieg in Aussicht.«
Während die einen noch ihre Befürchtungen äußern, gehen die Sieger schon einmal zum Feiern über. Preußen hat einen Krieg gewonnen, und allen voran Berlin stürzt sich in den Jubel: Die Stadt wirft sich in ihr Festkleid, das Kriegsglück scheint viele Menschen in eine enthusiastische Stimmung versetzt zu haben, die zwischen Überschwang und Größenwahn oszilliert: Was Preußen sich vornimmt, das gelingt ihm auch! Und so beeindruckend die Siege der Armee waren, so rauschend soll auch dieses zweitägige Fest am 20. und 21. September 1866 werden. Pompös sind die Straßen für die große Parade geschmückt, allen voran das Brandenburger Tor, nach den Worten von Ludwig Pietsch eine »zu Triumphzügen« wie keine andere geschaffene »Eingangspforte«.60 Entlang der Prachtstraße bis hin zum Schloss der Hohenzollern sind rund 300 feindliche Geschütze aufgereiht, präsentiert von jenen Einheiten, die sie erbeutet haben. Allenthalben wehen Fahnen, bunte Wimpel und Girlanden, und auch der Schriftzug mit den Worten, die der preußische König am 18. Juni bei Ausbruch des Krieges hatte proklamieren lassen, findet sich auf einer großen Tafel wieder: »An mein Volk: Das Vaterland ist in Gefahr! Gott mit uns!«
Zwischen diesem königlichen Aufruf und der Siegesfeier sind gerade einmal drei Monate vergangen, Preußen hat einen kurzen und siegreichen Krieg geführt, die führenden Männer werden als Helden umjubelt: Der Monarch, seine Generäle und die Soldaten ziehen unter dem Jubel der Schaulustigen, darunter eine ganz in Weiß gekleidete Gruppe von »Ehrenjungfrauen« der Stadt Berlin, bis zum Schloss. Otto von Bismarck ist leider wieder einmal erkrankt und kann nur mit Mühe an dem Spektakel teilnehmen. Aber der umjubelte Held der Feiern ist neben dem Ministerpräsidenten ohnehin der 69-jährige König, der, zumindest in der Wahrnehmung von Ludwig Pietsch, wie ein jugendlicher Held auf seinem Ross die Truppen anführt. Aktuelles Geschehen und patriotischer Mythos fließen in dieser Art von Berichterstattung willig ineinander:61