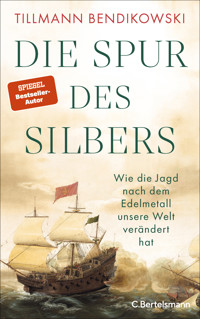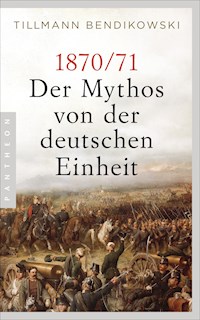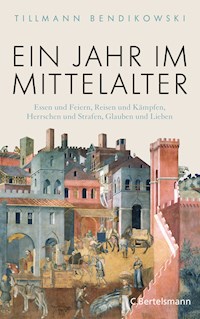12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Norden gibt es viel zu entdecken! Vierzehn verblüffende Geschichten: von der mecklenburgischen Blumenkönigin bis zu den Untoten im Kloster Harsefeld
Was hat die vielleicht schönste Blume der Welt mit einer Prinzessin aus Mecklenburg zu tun? Woran scheiterten die römischen Soldaten vor 2000 Jahren gegen die Germanen? Und wie kam es eigentlich, dass so manches Schloss in Norddeutschland mit Gewinnen aus dem Sklavenhandel finanziert wurde? Solchen und vielen anderen Fragen gehen Sabine Knor und Tillmann Bendikowski in ihren NORDGeschichten nach - überraschend und spannend erzählt. Sie nehmen die Leserinnen und Leser mit auf eine historische Entdeckungsreise durch den Norden zwischen Elbe und Harz. Nordsee und Ostsee. Ein Muss für alle Norddeutschland-Fans und solche, die es noch werden wollen.
Reich illustriert mit Abbildungen und Karten samt praktischer Hinweise für Ausflüge.
Mit spannenden Geschichten aus Ahrensburg, Ahrenshoop, Binz, Bremerhaven, Bückeburg, Emden, Hamburg, Harsefeld, Kalkriese, Lübeck, Mirow, Osterode, Neustrelitz, Stade, Steinhude, Tannenhausen, Wienhausen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DR. TILLMANNBENDIKOWSKI, geb. 1965, ist Journalist und promovierter Historiker. Als Gründer und Leiter der Medienagentur Geschichte in Hamburg schreibt er Beiträge für Printmedien und Hörfunk und betreut die wissenschaftliche Realisierung von Forschungsprojekten und historischen Ausstellungen. Seit März 2020 ist er als Kommentator im NDR Fernsehen zu sehen, wo er in der Reihe »DAS! historisch« Geschichte zum Sprechen bringt. Bei C. Bertelsmann erschienen zuletzt Ein Jahr im Mittelalter (2019), 1870/71: Der Mythos von der deutschen Einheit (2020) und Hitlerwetter. Das ganz normale Leben in der Diktatur: Die Deutschen und das Dritte Reich 1938/39 (2022).
SABINEKNOR, Politikwissenschaftlerin und Journalistin, studierte in Kiel, Hamburg und Rom. Seit 1999 ist sie als NDR-Fernsehredakteurin vor allem in Talk- und journalistischen Formaten tätig. Ihre Schwerpunkte sind gesellschaftspolitische, insbesondere frauenpolitische und historische Themen, die sie regelmäßig in Sendungen umsetzt. Ihr Anliegen: Menschen mit ihrer Geschichte zu Wort kommen zu lassen.
Tillmann Bendikowski / Sabine Knor
SAGENHAFTE ––––NORD ––––GESCHICHTEN
Ein Reiseführer in die geheimnisvolle Vergangenheit Norddeutschlands
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Eckard Schuster, München
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Shutterstock/©Thorsten Schier/©Alvov/©RT Images/©Daniel Eskridge/©tinkivinki/©Anastasia Lembrik; Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, Gemälde nach Johann Georg Ziesenis d. J.; Stephan Gatzen/BILD
Karte: Peter Palm, Berlin
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Reprografie: Lorenz+Zeller GmbH, Inning a. Ammersee
ISBN 978-3-641-28804-4V001
www.penguin-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Von Römern und Mönchen, von Sklaven und Prinzessinnen
TILLMANNBENDIKOWSKIFrauen mit Durchblick
Die ältesten Brillen der Welt im Kloster Wienhausen
SABINEKNORMit einem Kajak in die Freiheit
Peter Faust flieht 1988 über die Ostsee aus der DDR
TILLMANNBENDIKOWSKIDer gut gekleidete Mann im Moor
1907 wird die berühmteste Leiche Ostfrieslands gefunden
SABINEKNORNachts auf St. Pauli für Frauenrechte
Lida Gustava Heymann gründet 1897 in Hamburg Deutschlands erstes Frauenzentrum
TILLMANNBENDIKOWSKIDie Katastrophe von Binz
16 Menschen sterben 1912 beim Einsturz der Seebrücke
SABINEKNORWie die Strelitzie zu ihrem Namen kam
Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz: britische Königin und »Queen of Botany«
TILLMANNBENDIKOWSKIGefesselte Füße, Steine über dem Kopf
Die Untoten im mittelalterlichen Kloster Harsefeld
SABINEKNOREin weißes Schloss und seine wechselhafte Geschichte
Heinrich Carl von Schimmelmann: Unternehmer, Politiker – und Sklavenhändler
TILLMANNBENDIKOWSKIDie Schlacht im Wiehengebirge
In Kalkriese schlugen die »Germanen« vor 2000 Jahren die Römer
SABINEKNOR»Good-bye Deutschland« 1929
Else Arnecke wandert aus: Mit 17 von Bremerhaven nach Amerika
TILLMANNBENDIKOWSKIDer Mord an den vier Priestern
1943 werden Geistliche aus Lübeck hingerichtet
TILLMANNBENDIKOWSKIWer sah das erste deutsche U-Boot?
1762 wird der Plan für den »Steinhuder Hecht« vorgelegt
SABINEKNORDas Geheimnis der Lichtensteinhöhle im Harz
3000 Jahre alte Spuren eines Familienclans aus der Bronzezeit
TILLMANNBENDIKOWSKIDie Welt als Karte
In Stade konzipiert Carl Diercke seinen berühmten Schulatlas
Anmerkungen
Einleitung
Von Römern und Mönchen, von Sklaven und Prinzessinnen
Was hat eine der schönsten Blumen der Welt mit einer Prinzessin des 18. Jahrhunderts aus Mecklenburg zu tun? Und weshalb spielten die Sandalen der römischen Soldaten eine so große Rolle bei ihrem Siegeszug, als sie vor 2000 Jahren gegen die Germanen kämpften? Und wer weiß eigentlich, dass so manches Schloss in Norddeutschland die herrschaftliche Residenz eines Sklavenhändlers war? Solchen und anderen großen und kleinen Geschichten spüren Tillmann Bendikowski und Sabine Knor nach. Gemeinsam gehen sie auf historische Spurensuche – und lüften Geheimnisse im Norden zum Mitfiebern und Mitentdecken.
Ihre Recherchen führen sie durch die Antike und das Mittelalter bis in die Gegenwart. Was sie herausfinden und erzählen, ist immer überraschend und unterhaltsam, sensibilisiert und regt zum Nachdenken an. So steht etwa die Hinrichtung von vier mutigen Geistlichen aus Lübeck im Jahr 1943 bis heute für einen verzweifelten Versuch, der Nazi-Barbarei die Stirn zu bieten – für viele sind sie bis heute Vorbilder für Zivilcourage und Gottvertrauen. Und der Zusammenbruch der Seebrücke von Binz im Jahr 1912 forderte zwar viele Menschenleben – doch die Erfahrung mit dieser Katastrophe hilft bis heute, weitere Unglücksfälle zu verhindern, denn sie gab den Impuls zur Gründung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Geschichte einer dramatischen Flucht aus der DDR lenkt hingegen den Blick auf das Schicksal jener Deutschen, die auf der Ostsee einst ihr Leben riskiert haben, um in die Freiheit zu gelangen.
Sabine Knor und Tillmann Bendikowski ermöglichen mit ihrem Blick auf die Geschichte eine Wiederentdeckung von historischen Ereignissen und persönlichen Schicksalen und liefern dabei vorzügliche historische Unterhaltung. Und am Ende eines jeden Kapitels geben sie den Leserinnen und Lesern Tipps für eigene Entdeckungstouren an den historischen Orten. Was ist dort heute noch vom früheren Geschehen zu erkennen? Welches Museum und welche Attraktion lohnen unbedingt einen Besuch? Auch das verrät dieses Buch – und wird damit zu einem historischen Reisebegleiter für die ganze Familie!
TILLMANN BENDIKOWSKIFrauen mit Durchblick
Die ältesten Brillen der Welt im Kloster Wienhausen
Es war einmal eine Nonne, die lebte im 14. Jahrhundert im Zisterzienserinnenkloster Wienhausen nahe dem Städtchen Celle. Sie war wie die anderen Frauen im Konvent wohl sehr fleißig und fromm, und sie verbrachte sicher auch viele Stunden auf den Sitzen des Nonnenchors, eines für festliche Anlässe abgegrenzten Bereichs der Klosterkirche eines Frauenkonvents. Eines Tages – womöglich war sie besonders tief ins Gebet versunken oder in diesem Moment schlicht etwas unaufmerksam – entglitt ihr an diesem Ort ein für ihren Alltag geradezu unverzichtbarer Gegenstand. Er fiel zu Boden und verschwand in einer der Spalten zwischen den schweren Eichenbohlen des Fußbodens. Wann genau ihr dieses Missgeschick geschah, wissen wir heute nicht mehr, und auch den Namen der Nonne kennen wir nicht. Aber eines ist sicher: Die Dame konnte ziemlich schlecht sehen. Denn sie war im Besitz einer damals kostbaren Brille, die sie nun just an diesem Tag verlor. Und als diese nach gut sechs Jahrhunderten endlich wiedergefunden wurde, sorgte sie zusammen mit anderen Gegenständen für allergrößte Aufregung …
Es war das Jahr 1953, als die verlorene Brille unversehens ins Blickfeld der Wissenschaft geriet. Zu diesem Zeitpunkt war die Ära der Zisterzienserinnen in Wienhausen allerdings längst vergangen: Die Reformation hatte in Norddeutschland in den meisten Regionen den christlichen Glauben erneuert, und dort, wo sich der neue protestantische Glaubensritus durchgesetzt hatte, wurden nach und nach viele Klöster aufgelöst. Zuweilen wurden der Besitz und die Gebäude nun für weltliche Zwecke genutzt, in anderen Fällen indes ging das christliche Leben an diesen Orten unter anderen konfessionellen Vorzeichen weiter. Das gilt auch für das Kloster Wienhausen, das ebenso wie die Anlagen von Ebstorf, Isenhagen, Lüne, Medingen und Walsrode wegen seiner Lage im ehemaligen Fürstentum Lüneburg bis heute zu den sogenannten Lüneburger Frauenklöstern zählt. In Wienhausen wurde der Konvent in ein evangelisches Damenstift umgewandelt, in eine religiöse Lebensgemeinschaft, in der bei allen Neuerungen die Traditionen des Klosters bewahrt werden und christliches Leben weitergeführt wird. Und so leben heute dort sogenannte Konventualinnen und eine Äbtissin, die das Kloster nach außen vertritt.
Das im 13. Jahrhundert gegründete Kloster Wienhausen verfügt heute nicht mehr über die beachtlichen wirtschaftlichen Einkünfte des einstigen mittelalterlichen Zisterzienserinnenklosters, aber es ist in seinem Fortbestand gesichert, weil es wie andere Klöster in Niedersachsen von der Klosterkammer Hannover unterstützt wird. Wienhausen selbst ist heute ein kunsthistorischer Schatz, ein kultureller Ort von immer noch beeindruckender Pracht. Allein die Malereien im gotischen Nonnenchor haben das Kloster berühmt gemacht, Wände und Decken sind mit biblischen Szenen ausgemalt. Über Jahrhunderte hinweg versetzte die Pracht dieses religiösen Raumes die Betrachter in Staunen. Wer heute diese Gemälde betrachtet, sollte zugleich daran denken, dass diese Arbeiten ebenso wie weite Teile der herrschaftlichen Klostergebäude eben auch auf die solide Finanzkraft des Klosters Wienhausen im Mittelalter verweisen – die Zisterzienserinnen an diesem Ort hatten schlicht das Geld dazu.
Der Innenraum des prachtvollen Nonnenchores mit Blick auf den Flügelaltar im Kloster Wienhausen.
© Kloster Wienhausen/Lüneburger Klosterarchiv
Nach Jahrhunderten der frommen Nutzung weckte der Nonnenchor allerdings in den 1950er-Jahren die Neugierde historischer Fachleute. In einem benachbarten Kloster waren sie auf Reste eines kleinen jahrhundertealten Hausaltars gestoßen – ließe sich Ähnliches womöglich auch in Wienhausen entdecken? Der Konvent konnte überzeugt werden, zunächst vorsichtig nur die mittleren Fußbodenbohlen zwischen dem zweireihigen Gestühl aufzunehmen. Die historischen Sitze wie die Bodenbretter selbst, das konnten die Forscher zusichern, würden dadurch keinen Schaden erleiden. Am 22. September 1953 war es dann so weit, die zuständige Restauratorin erinnerte sich später an diesen Moment:1
»Die breiten Eichenbohlen wurden von Zimmerleuten gelöst und die schweren Bretter zur Seite gekippt. Staunend standen wir vor der langen offenen Strecke, die bis oben mit grauem Staub angefüllt war. Ein gefalteter Pergament-Bogen lugte aus dem Staub hervor. Aufgeschlagen lag ein Bild in schönsten Farben mit glänzender Vergoldung vor uns, Christus, wie er aus dem Grabe steigt.«
Aus dem grauen Staub der Jahrhunderte wurden die verschiedensten Dinge ans Tageslicht gezogen – all das, was den Nonnen und Konventualinnen über die Jahrhunderte so aus der Hand oder aus der Tasche gerutscht war. Oder – die Frage stellte sich rasch – hatten die Frauen die bekannten Hohlräume im Chorgestühl zuweilen sogar extra dafür genutzt, wertvolle oder gefährdete Dinge hier zu verstecken? Jetzt wurde auch an anderen Stellen im Nonnenchor unter den Bodenbrettern nachgeschaut, und die Restauratorin kam schließlich aus dem Staunen nicht mehr heraus:2
»Was dann noch nach und nach hervorkam, ist kaum zu beschreiben […]: Holzschnitte, mehr oder weniger zerknüllt, kleine Figuren, Holzlöffel, Holzschalen, Teile von Rosenkränzen und eine Spanschachtel; weiter Knochen, Eberzähne, sogar ganze Skelette von Mäusen und Fledermäusen in Mengen, schließlich ein in Leinen genähtes Bündel, in Form und Größe einer verpackten Ente ähnelnd. Die Nähte wurden schnell getrennt; hervor quollen Knochen, Stoffreste, Beutelchen, Briefchen und beschriftete Pergamentstreifen. Wir hatten Reliquien vor uns. Ein schwarz verbrannter Knochen, an einem Ende in Silber gefasst, und eine Schädeldecke mit kreisrundem Loch darin zeugen von dem grausamen Ende der Märtyrer.«
Diese Nietbrille aus dem 14. Jahrhundert diente einst einer Nonne in Wienhausen als unverzichtbare Lesehilfe – bis diese sie offensichtlich verlor ...
© Kloster Wienhausen/Lüneburger Klosterarchiv
Die Bandbreite der Funde ist groß – und unter den nicht in erster Linie religiös genutzten Stücken zählten vor allem die aus dem Staub gezogenen Brillen und Brillenteile als eine archäologische Sensation. Dies gilt vor allem für die heute im Klostermuseum ausgestellten so bezeichneten »Nietbrillen« aus dem 14. Jahrhundert, die wegen der fehlenden Bügel eher an Zwicker erinnern. Ein solches Modell besteht aus zwei baugleichen Hälften, die mit einem Niet zusammengehalten und so auf der Nase festgeklemmt werden konnten. Für die Herstellung der Brille, die im Nonnenchor von Wienhausen verloren gegangen war, wurde das besonders harte Buchsbaumholz verwendet. Aus nur zwei Millimeter dicken Brettchen wurden die Rahmen für die Gläser herausgeschnitten und mit einer Nut für die Linsen versehen. Diese Fassung wurde anschließend aufgeschlitzt, um die Linsen einzusetzen, und dann wieder mit einem Faden verschlossen. Die fertige Brille bekam anschließend sogar noch etwas modischen Schick: Auf dem Stiel ist in diesem Fall ein kleines Kleeblatt eingeritzt.3 Mochten die Brillen für die Trägerin also hilfreich und sogar etwas hübsch gewesen sein, so ganz angenehm waren sie nicht zu tragen: Die Nietbrille – die ja über keine Bügel verfügte – musste vergleichsweise fest auf die Nase geklemmt werden, außerdem sollte beim Tragen tunlichst der Kopf etwas in den Nacken gekippt werden, damit sie nicht herunterfiel.
Dass es schon im Mittelalter Brillen gab, war zwar bei der Entdeckung von Wienhausen 1953 bekannt, doch bis zu diesem Zeitpunkt ging die Wissenschaft davon aus, dass von den mittelalterlichen Lesehilfen kein Exemplar erhalten geblieben war. Wie diese einst ausgesehen haben, war hingegen klar: Brillen ließen sich schließlich auf zahlreichen Gemälden gut erkennen, etwa auf einer Darstellung des italienischen Malers Tommaso da Modena, der um das Jahr 1352 in einem Dominikanerkloster in Treviso nördlich von Venedig zahlreiche Mönche malte. Unter ihnen ist einer, der an einem Pult stehend einen Text schreibt – und deutlich erkennbar eine Nietbrille auf der Nase hat.
Lesen und Schreiben dank einer Brille: Dieses Gemälde von Tommaso da Modena aus dem Jahr 1352 ist eine der ältesten Abbildungen, die den Gebrauch einer Brille zeigt.
© Akg Images: Science Photo Library
Dass die Augen im Laufe des Lebens schwächer werden, ist keine Erkenntnis unserer Gegenwart, sondern war auch im Mittelalter schon ein Problem. Aber vor der Erfindung der Brille gab es kaum Chancen, der Verschlechterung der Sehkraft wirkungsvoll zu begegnen. In der Antike griffen reiche Männer mit schlechter werdenden Augen auf schriftkundige Sklaven zurück, die ihnen dann vorlesen mussten; eigene Texte wurden damals ohnehin lieber diktiert als selbst geschrieben. Wer als Weitsichtiger aber nicht mit Reichtum gesegnet war und sich keinen Vorleser leisten konnte, musste zwangsläufig auf die Freude am Text verzichten. Eine wichtige Hilfe boten da die ersten Vergrößerungsgläser, mit denen selbst kleine Buchstaben wieder lesbar wurden. Der englische Theologe und Naturphilosoph Roger Bacon (ca. 1214–1292) schwärmte:4
»Wenn man Buchstaben oder kleine Gegenstände durch ein Kristall oder Glas betrachtet, das geformt ist wie das kleinere Segment einer Kugel, und dabei die gewölbte Seite vor das Auge hält, dann sieht man die Buchstaben weit besser und größer. Ein solches Instrument ist nützlich für jedermann.«
Nützlich waren diese Hilfsmittel vor allem in den Skriptorien der Klöster, in denen im Mittelalter geschrieben und gelesen wurde. Dort entstanden religiöse Texte, aber auch Verträge; zudem wurden antike Schriften studiert und gegebenenfalls kopiert. Andere, vermeintlich »gefährliche« alte Schriften wurden allerdings bei der Gelegenheit gern auch vernichtet, indem die alte Schrift abgeschabt und das Pergament neu beschrieben wurde. Das alles war in der Praxis eine gelehrte, aber fraglos auch körperlich anstrengende Tätigkeit. Vor allem die Augen hatten Schwerstarbeit zu verrichten, weil es weithin an künstlichem Licht fehlte. Kerzen aus Bienenwachs waren lange sündhaft teuer, nur wenige Privatleute sowie Kirchen und Klöster konnten sich diesen Luxus der Beleuchtung sparen. Somit war schummriges Licht auch in den Schreibstuben mittelalterlicher Klöster vorherrschend.
So mancher Mönch litt still unter seinem Dienst im Skriptorium, oft in gekrümmter Haltung und bei niedrigen Temperaturen. Im Winter waren die in der Regel kleinen Fensteröffnungen außerdem verhängt, damit die Kälte und der Wind draußen blieben – aber so kam eben auch das Tageslicht kaum herein. Kein Wunder also, dass einer dieser Schreiber der Nachwelt die folgende Klage über seine Arbeitsbedingungen hinterließ – und zwar passenderweise am Rand eines Buches:5 »Es ist eine Quälerei. Es raubt mir das Augenlicht, es krümmt mir den Rücken, es quetscht mir die Eingeweide und die Rippen, es bringt den Nieren Schmerzen und dem ganzen Körper Müdigkeit.«
Zumindest für die Sache mit dem Augenlicht konnte schließlich Abhilfe geschaffen werden, und die Erfindung der Brille Ende des 13. Jahrhunderts muss für die Betroffenen eine wahre Erlösung gewesen sein. Sie lässt sich nachvollziehen in einer Predigt aus dem Jahr 1305, in der ein Dominikaner in Florenz regelrecht ins Schwärmen geriet:6
»Es ist noch keine zwanzig Jahre her, dass man sich darauf versteht, Brillen zu fertigen, die die Sehkraft verbessern, das ist eine der besten und notwendigsten Künste, über die die Welt verfügt, und es ist noch gar nicht lange her, dass man sich darauf versteht: eine neue Kunst, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat.«
Die mittelalterlichen Nietbrillen verbreiteten sich rasch, auch wenn manchen Zeitgenossen die technischen Neuentwicklungen anfangs noch fremd, zuweilen regelrecht unheimlich waren. Kann es nicht sein, so der in Süditalien lange verbreitete Aberglauben, dass gerade diejenigen Menschen Brillen tragen, die über den gefürchteten »bösen Blick« verfügen? Wenn sie es gut mit den Mitmenschen meinten, dann setzten sie eine Brille auf, »damit die Vorübergehenden nicht von den Ausflüssen seines giftigen Blicks berührt werden«.7
Aber solche finsteren Vorstellungen konnten den Erfolg dieser technischen Neuerung nicht gefährden, denn ganz offensichtlich gab es – obwohl ja nur ein kleiner Teil der Menschen damals des Schreibens und Lesens kundig war – eine enorme Nachfrage. Auch wenn die Lesehilfen zunächst ein Luxusgegenstand blieben, so wurden sie in dem Maße selbstverständlicher und erschwinglicher, als auch Bücher mit der Erfindung der Druckerpresse als neues Medium seit dem 15. Jahrhundert immer gebräuchlicher wurden. Beide Erfindungen bedingten sich sozusagen gegenseitig: Es wurden immer mehr Bücher verkauft, auch weil mehr Brillen zur Verfügung standen, um diese Bücher zu lesen. Und es wurden mehr Brillen produziert, um das neue Medium auch konsumieren zu können. In der Praxis befanden sich die Fehlsichtigen oft auf einer schier unaufhörlichen Suche nach der richtigen Sehhilfe. Von einem englischen Lord wird noch im 17. Jahrhundert berichtet, dass er im Laufe von 13 Jahren insgesamt 27 Brillen kaufte, weil er einfach nicht die richtige fand.8
Für ein Leben im Kloster waren gesunde Augen und eine gute Sehfähigkeit zwar keine unverzichtbare Voraussetzung, aber durchaus eine Erleichterung, wenn es um die Teilhabe am Alltag dieser Gemeinschaft ging. Wenn wir heute die mittelalterlichen Klöster nicht nur als theologische Orte, sondern auch als Zentren der damaligen Kulturarbeit im weitesten Sinne verstehen, wird allerdings auch deutlich, dass dabei das Augenmerk der Geschichtserzählung viel zu lang überwiegend auf die Männer gelenkt wurde. Die Mönche als Träger der mittelalterlichen Kultur wurden stets herausgehoben – die Nonnen hingegen immer ein wenig vergessen. Dabei waren auch die Frauenklöster über Jahrhunderte hinweg für die jeweilige Region gleichermaßen spirituelle wie kulturelle Zentren, deren Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Fromme, gebildete und letztlich auch selbstbewusste Frauen lebten und arbeiteten dort. Aber weil die Kirche damals weitgehend eine Männerkirche war, blieben die Frauen in zentraler theologischer Hinsicht stets von den Klerikern abhängig, wenn es um den Zugang zu den Sakramenten ging: Mochte eine Äbtissin auch noch so gescheit und politisch weitsichtig sein, und war eine Nonne auch noch so belesen und gut organisiert – für die Beichte oder für das Abendmahl war immer ein Priester vonnöten.
Nichtsdestotrotz wurden auch damals schon theologisch und wissenschaftlich versierte Frauen den Männern der Kirche zuweilen unheimlich. Bereits im Mittelalter war bekannt, zu was vor allem die Frauen in den Klöstern fähig waren: Sie leisteten ihren Beitrag zum theologischen Denken ihrer Zeit, sie konnten lesen und schreiben oder verfügten über außergewöhnliche Kenntnisse in der Heilkunde. Auch dafür steht das Kloster der Zisterzienserinnen in Wienhausen: Dort besaßen die Nonnen Kenntnisse sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin. Das hatte für Wienhausen durchaus praktischen Nutzen, schließlich verfügte das Kloster nicht nur über Grundbesitz, sondern besaß auch zahlreiche Nutztiere, die eben gesund bleiben oder von Krankheiten geheilt werden sollten. In den überlieferten Rezepten für die Behandlung bei Erkrankungen und Unfällen von Menschen finden sich beispielsweise zahlreiche medizinische Ratschläge für die täglichen wie außergewöhnlichen Notlagen:9
»Item wenn jemand an Kopfschmerzen erkrankt ist, dann soll man für diesen zunächst Wacholderbeeren und Hanf zerstoßen und danach Eiweiß von zwei Eier hinzugeben. Dieses Gemisch zusammen mit Wein aufkochen und danach dem Erkrankten auf den Kopf und die Stirn binden.«
Auch bei Magenschmerzen wussten die Nonnen Rat, ebenso bei Schwindsucht (Tuberkulose) oder bei schlechter werdendem Gedächtnis (»zu klein gestoßener Petersilie Wein angießen« und dieses Gemisch anschließend trinken). Ihr Wissen versetzte die Zisterzienserinnen im Kloster Wienhausen in die Lage, ein funktionierendes und medizinisch wohl effektives System der Krankenversorgung aufzubauen. Schon im 14. Jahrhundert war das Amt der sogenannten Klosterinfirmarin besetzt, die die Versorgung der Mitschwestern überwachte. Vermutlich wurde diese Aufgabe gerade den ältesten Nonnen des Konvents übertragen, weil ihnen das größte Erfahrungswissen über die Behandlung von Kranken zugeschrieben wurde.10
Fraglos von praktischem Nutzen für das Leben im Kloster dürften auch die zahlreichen Rezepte für die Herstellung von Heilmitteln gegen ganz unterschiedliche Erkrankungen der Augen gewesen sein: bei Juckreiz (wenn es »iucket vor der oghen«), bei Trocken- und Hitzegefühl (bei »groote hitte der ogen«) oder bei häufigem Tränenfluss (»weme de oghen vaken tranet«).11 Diese und ähnliche Augenleiden dürften sehr häufig auch mit der Anstrengung beziehungsweise Überanstrengung der Augen zu tun gehabt haben. Das galt nicht nur für die Nonnen, die schreiben konnten – egal, ob sie medizinische Rezepte oder liturgische Texte verfassten –, sondern auch für jene, die sich im Kloster Wienhausen an der Herstellung eines ganz besonderen Kulturschatzes beteiligten: der großformatigen Wandteppiche. Noch heute gibt es eine imposante Sammlung dieser Werke aus dem 14. und 15. Jahrhundert, für die Wienhausen berühmt ist. In mühevoller Kleinarbeit von den Nonnen hergestellt, zeigen sie verschiedene christliche Motive, etwa die Geschichte des heiligen Thomas oder der heiligen Elisabeth von Thüringen, die im Spätmittelalter zu einer der populärsten Heiligenfiguren wurde und gerade für die christlichen Frauen ein Vorbild für Barmherzigkeit und tätige Nächstenliebe war.
Solche Teppiche waren ein regelrechtes Bildmedium dieser Zeit, und die kostbaren Stücke wurden selbstverständlich weder als Bodenbelag noch als Sitzauflage genutzt. Sie dienten in den allermeisten Fällen auch nicht als Einnahmequellen für das Kloster, sondern dem religiösen Leben im Kloster selbst. Ein Teppich mit einem bestimmten Motiv konnte etwa im Nonnenchor aufgehängt werden und dort auch die malerische Ausstattung der Räume ergänzen. Aber zugleich ist die oft über viele Monate sich erstreckende Stickerei selbst schon ein religiöses Erlebnis: Während ihrer Arbeit beschäftigten sich die Nonnen ja sozusagen hautnah mit den heiligen Figuren und ihren Erlebnissen, die dargestellten Glaubensinhalte wurden damit bereits während der Arbeit an einem Teppich eingeübt. Zugleich leisteten die frommen Frauen so den Dienst der memoria, des Gedenkens an die Heilstaten Gottes und des Erinnerns an die dargestellten Personen.12
Allerdings legten einige Nonnen die religiöse Bedeutung dieser Handarbeiten wohl ein wenig großzügig aus. Zu den 1953 im Nonnenchor gefundenen Gegenständen zählen nämlich auch Dinge, die bei Gebet und Gesang eigentlich nicht zwingend vonnöten sind: Spindeln und Messer, Brettchen zur Bandweberei, Schriftmuster und Ornamentschablonen. Allen Verboten zum Trotz, so legen es die Funde nahe, gingen einige der frommen Damen während der kanonischen Stunden mehr oder weniger heimlich ihrer Handarbeit nach.13 Vielleicht rutschte dabei in einem unbedachten Moment eben auch einmal eine der unbequemen Nietbrillen von der Nase …
Es ist naheliegend, dass die Nonnen vor allem an den wertvollen Stücken wie den großformatigen Teppichen nur so lange arbeiteten, wie sie ausreichend sehen konnten. Manch eine könnte womöglich dank einer mittelalterlichen Nietbrille ihre Arbeit im fortgeschrittenen Alter fortgesetzt haben – sie war in dieser Hinsicht Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Teil der Gemeinschaftsarbeit. Dies gilt auch für die Musik im Kloster: Sie hatte als Mittel zur geistlichen Übung große Bedeutung für das Leben in Wienhausen. Die Nonnen waren zunächst einmal in ganz anschaulicher Hinsicht von Musik umgeben. Noch heute sind die zahlreichen Darstellungen von mittelalterlichen Musikinstrumenten dafür ein eindrucksvoller Beleg. Nicht nur auf den Teppichen und zahlreichen Stickarbeiten finden sich musizierende Figuren, auch auf den atemberaubenden Malereien im Nonnenchor sind sie bis heute zu erkennen: Engel, die zum Lobe des Herrn zu Blasinstrumenten, zur Harfe oder zur mittelalterlichen Fidel greifen, aber auch musizierende Frauengestalten. Solche Darstellungen verwundern nicht, denn die Nonnen in Wienhausen waren selbst musikalisch – und sie hinterließen auch in dieser Hinsicht der Nachwelt einen kulturellen Schatz: das Wienhäuser Liederbuch aus dem späten 15. Jahrhundert, in dem zahlreiche geistliche Lieder sowohl in Latein als auch in Niederdeutsch gesammelt sind.
In unserer Gegenwart, in der vergleichsweise wenig selbst gesungen wird, darf nicht übersehen werden, welch enorme Bedeutung das gemeinschaftliche Singen auch in diesem Frauenkloster für die Bildung und den Zusammenhalt des Konvents hatte. Es ist sicher nicht übertrieben, vom »Gesang als Lebenselixier« zu sprechen. Die bis heute ein wenig verborgene Musikkultur in den Frauenklöstern ist nicht zu unterschätzen: Alle Novizinnen wurden ausgiebig in die Kenntnisse von Liturgie und Gesang eingeführt, und im Alltag hatte eine Cantrix, eine Sangmeisterin, die Verantwortung für den Gesang in den Gottesdiensten. Es ist naheliegend, dass damit die Klöster immer auch ein Freiraum für musikbegeisterte Frauen war.14
Und die Frauen ließen sich dann und wann eben das Singen nicht verbieten. So legten die Nonnen in Wienhausen, als ihnen im Zuge der Reformation bei Abhaltung ihrer Stundengebete in der Klosterkirche der Gesang untersagt wurde, eine resolute Dickköpfigkeit an den Tag: Sie beschlossen, dann eben auf den Nonnenchor zu verzichten und sich stattdessen zumindest für diese Anlässe im Arbeits- und Speiseraum zu treffen und dort ungestraft ihre Lieder anzustimmen – wo »sie sich lustig hören ließen«, wie es in der Chronik des Klosters heißt.15 Noch heute klingt aus diesen Worten irgendwie ein wenig diebische Freude heraus, der Reformation zumindest in gesanglicher Hinsicht ein kleines Schnippchen geschlagen zu haben.
Nun ließ sich der neue Glaube mit solchen gesanglichen Mitteln letztlich nicht aufhalten. Das erfuhren auch die Nonnen im Kloster Wienhausen. Erst im Jahr 1622, fast ein Jahrhundert nachdem die Reformation Lüneburg erreicht hatte, legten sie den Habit der Zisterzienserinnen ab. Sie taten es nach fast vier Jahrhunderten Klostertradition allerdings nicht freiwillig, sondern auf Anordnung des Herzogs von Celle. Doch die Tradition dieses Ortes ging nicht verloren, sondern wurde mit der Umwandlung zu einer evangelisch-klösterlichen Gemeinschaft bewahrt. Dabei hielten sich allerdings augenscheinlich noch lange vorreformatorische, katholische Elemente des Glaubens. Dass noch im Jahr 1722 der hannoversche Kurfürst forderte, künftig jedwede »papistische Riten« im Kloster zu unterlassen, zeugt nur zu gut davon, dass damals in Wienhausen, wie auch in den Jahrhunderten zuvor und den Jahrhunderten danach, eben ausgesprochen selbstbewusste Damen lebten.16
So lebt der christliche Gedanke im Kloster Wienhausen bis in unsere Zeit weiter, und auch die Malereien im historischen Nonnenchor beeindrucken heute die Besuchergruppen ebenso wie vor Hunderten von Jahren die hier betenden und singenden Frauen. Die – und auch das brachten die archäologischen Funde von 1953 ans Licht – vertrauten allerdings augenscheinlich nicht immer nur ihrem Gott, sondern hingen auch in der einen oder anderen Weise dem an, was heute als »Aberglauben« bezeichnet wird. Denn unter den Bodenbrettern wurden nicht nur gezielt Reliquien und andere religiös wertvolle Gegenstände versteckt, sondern wohl auch das eine oder andere Objekt der Magie. Dazu zählt eine Spanschachtel, in der die Archäologen ein sorgsam in seidene Tüchlein eingehülltes Wurzelmännchen fanden – fraglos eine sogenannte Alraune, die im Volksaberglauben seit dem 15. Jahrhundert von besonderer Bedeutung war. Sie verhieß ihrer Besitzerin angeblich Glück und Reichtum. Freilich musste sie dafür um ihr Seelenheil fürchten, wenn sie sich nicht rechtzeitig vor ihrem Tod wieder von der Alraune trennte.17 Wurde sie deshalb eines Tages im Nonnenchor versteckt?
Die alten Eichenbohlen, unter denen vor vielen Jahrhunderten diese und andere Dinge verschwanden, liegen übrigens längst wieder im Nonnenchor und dienen hier den heute Lebenden wie den kommenden Generationen als stabiler Boden. Und wer weiß – vielleicht rutscht auch in Zukunft jemandem wieder einmal etwas unbemerkt aus der Tasche, findet seinen Weg durch eine Spalte der Eichenbohlen und landet womöglich für Jahrhunderte in einer dicken Staubschicht …
Zum Weiterlesen
Die kleine Broschüre Der Fund vom Nonnenchor, die direkt beim Kloster Wienhausen zu beziehen ist, gibt einen gut lesbaren und reich bebilderten Einblick in die archäologischen Funde der 1950er-Jahre.
Für einen Besuch
Eine Führung durch das Kloster Wienhausen ist nach Anmeldung möglich, wobei der Besuch im Nonnenchor ein unvergessliches kulturhistorisches Erlebnis ist. Im Klostermuseum wird zudem anhand zahlreicher Exponate – so auch der 1953 entdeckten Brillen – die Geschichte des Klosters bis in die Gegenwart des evangelischen Frauenklosters erzählt. Auch die historischen Bildteppiche sind hier ausgestellt.
SABINE KNORMit einem Kajak in die Freiheit
Peter Faust flieht 1988 über die Ostsee aus der DDR
Bis zur Erfolgsgeschichte der deutschen Einheit haben Menschen fast 30 Jahre ihr Leben riskiert, um aus der sozialistischen Diktatur der DDR in den Westen zu fliehen. Viele haben es nicht geschafft. Hinter Mauertoten, Inhaftierten und Geflüchteten stehen Schicksale und Tragödien – und bei jedem Fluchtversuch die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben.
Auch die Ostsee war ein solcher Fluchtort und wurde in einem kaum beachteten Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte für Frauen, Männer und Kinder zur Todesfalle. Vom Mauerbau bis zum Mauerfall war das Meer für DDR-Bürgerinnen und -Bürger vor allem ein Symbol für Freiheit – und wurde als Fluchtroute dramatisch verharmlost und unterschätzt. Man geht heute davon aus, dass mehr als 5600 DDR-Bürgerinnen und -Bürger von der knapp 600 Kilometer langen Ostseeküste aus versucht haben, mit Booten aller Art, auf Surfbrettern oder schwimmend über die »maritime Mauer« aus der DDR zu fliehen, um nach Schleswig-Holstein, Dänemark oder Schweden zu gelangen.1
Doch nur jeder sechste Flüchtling erreichte überhaupt die Ostseeküste der DDR.2 Die meisten, etwa 80 Prozent, wurden schon im Vorfeld von der 6. Grenzbrigade Küste, der Volkspolizei oder der Transportpolizei aufgegriffen und zu langen Gefängnisstrafen verurteilt.3 Beim Versuch, über das Meer in den Westen zu fliehen (Stand September 20224), starben mindestens 133 Erwachsene und Kinder, manche Quellen sprechen sogar von über 180 Toten.5 Das wären etwa so viele wie an der Berliner Mauer, wo man von mindestens 140 Todesopfern ausgeht.6 Eine erschütternde und dramatische Bilanz!
Ob mit dem Schlauchboot, der Luftmatratze oder dem Surfbrett – bei den mehr als 5600 Fluchtversuchen gelang nur 913 Menschen, etwa 16 Prozent, die Flucht über die »Staatsgrenze Nord«, wie sie offiziell hieß. Viele Geflüchtete gelten noch immer als vermisst und sind wahrscheinlich ertrunken. Bis heute sind viele dieser Fluchtschicksale ungelöst. Aber ein Forschungsprojekt der Universität Greifswald hat es sich seit ein paar Jahren zur Aufgabe gemacht, genau diesen Schicksalen nachzugehen: Menschen, die in Fischernetzen gefunden, angespült oder im Meer hinuntergezogen wurden und nie mehr aufgetaucht sind. Sogenannte »Vermisstenvorgänge«, bei denen nur vermutet werden kann, dass es sich um einen Fluchtversuch gehandelt haben könnte, ohne dass je Leichen gefunden wurden. Merete Peetz vom Forschungsprojekt »Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee« an der Universität Greifswald sagt hierzu:7
»Insgesamt 660 Todes- und Verdachtsfälle konnten bis April 2022 recherchiert und erfasst werden. Bei einem Großteil der Verdachtsfälle war anfangs nicht klar, ob es sich um einen Todesfall mit Fluchthintergrund oder ein anderes tragisches Schicksal wie Unfall oder Suizid handelte. Die Einzelfallprüfung ist noch nicht abgeschlossen, es kann jedoch folgendes vorläufiges Ergebnis (Stand September 2022) aufgezeigt werden: Nachweislich sind derzeit mindestens 133 Personen bei ihrem Versuch, über die Ostsee aus der DDR zu fliehen, umgekommen; zu 31 von ihnen konnte bis heute allerdings kein Leichnam identifiziert werden. In 101 Verdachtsfällen muss aufgrund der ermittelten Indizien angenommen werden, dass es sich auch bei diesen um Todesfälle mit Fluchthintergrund handelt, aber es fehlt noch der letzte stichhaltige Nachweis. […]
Bei den tödlich verunglückten Flüchtlingen handelt es sich hauptsächlich um junge männliche Erwachsene. Lediglich 15 Todesopfer (12 Prozent) sind weiblich. 96 Prozent aller Fluchtopfer waren im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, als sie verstarben.«
Sogenannte »Fluchtbewegungen über die Ostsee«, vor allem aus der Sowjetischen Besatzungszone, begannen nicht erst mit dem Mauerbau 1961, sondern bereits unmittelbar nach Kriegsende.8 Sie führten im benachbarten Skandinavien sogar zu innenpolitischen Debatten – denn aus dem Nachkriegsdeutschland flohen auch ehemalige Nazis. Deshalb mussten sich Geflüchtete in Aufnahmelagern aufwendigen Kontrollen unterziehen. Und erst nach intensiver Prüfung durften sie bleiben – oder wurden zurückgeschickt. In den ersten Tagen nach dem Mauerbau am 13. August 1961 konnten Ostdeutsche noch einfach von einem Touristenschiff mit täglicher Ankunft in Dänemarks südlichster Stadt Gedser von Bord springen – entweder auf den Kai oder in das Hafenbecken von Gedser. Diese Lücke wurde aber schnell geschlossen und die Touristenstrecke eingestellt.
Bald überwachte und kontrollierte die DDR-Staatsführung alle Wasserwege. Das betraf auch den westlichsten Abschnitt der DDR-Ostseeküste vom Dorf Brook bis zur Halbinsel Priwall bei Travemünde. Von dort aus riegelte dann eine 13 Kilometer lange Mauer entlang der Pötenitzer Wiek und des Dassower Sees – das Wasser war Westdeutschland, das östliche Ufer DDR – das DDR-Staatsgebiet gegen den Westen ab. Der größere Teil der Außenküste zwischen Lübecker Bucht im Westen und Pommerscher Bucht im Osten blieb hingegen »offen« und sollte Freiheit suggerieren.9 Die Grenzsicherung zu Wasser und Kontrollen an Land stellten eine besondere Herausforderung dar. Denn jedes Jahr kamen im Sommer über 250 000 Ostseeurlauber an die Küste. Die Volkspolizei und sogenannte »freiwillige Grenzhelfer« sollten deshalb »Augen und Ohren offen halten« – und mögliche »Republikflüchtlinge« melden. »Und wurde ein Fluchtwilliger gefasst, gab es für den Verräter einen Präsentkorb oder eine Prämie.«10
An Land bewachten rund 1000 Mann in Uniform, davon die Hälfte bewaffnet, die Küste. Am Tag wurden die Strände samt Umgebung von 38 Beobachtungstürmen aus – »von West nach Ost: bei Pötenitz, Boltenhagen, auf der Insel Poel, bei Kühlungsborn, in Warnemünde, auf dem Fischland, auf Darßer Ort, in Barhöft, auf dem Dornbusch (Insel Hiddensee), auf Kap Arkona (Insel Rügen), auf den Kreidefelsen der Stubbenkammer (Rügen), in Sellin (Rügen), auf der Insel Ruden und der Insel Oie vor dem Greifswalder Bodden«11 – observiert. In der Nacht patrouillierten zusätzlich Posten am Strand. Und Suchscheinwerfer mit großer Lichtkegelreichweite sowie spezielle Radargeräte sorgten für eine möglichst lückenlose Erfassung.
Weil die Fluchtversuche in der DDR in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre zunahmen, verschärften sich auch die Bedingungen für die Urlauber an der Ostseeküste. Sie mussten die Dauer ihres Aufenthaltes anmelden und ihre Freizeitaktivitäten stark einschränken.12 Es war untersagt, zu weit hinauszuschwimmen, Segeln auf der Ostsee war nahezu ausgeschlossen und Surfen nur in den Boddengewässern möglich. Schon bei der Anreise wurden Touristen mit »verdächtigem Gepäck«, wie zum Beispiel Faltbooten, von der Transportpolizei überwacht und gemeldet.
Zu Wasser sollte die Grenzbrigade Küste abschrecken.13 Sie bestand aus 2500 Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehrpflichtigen und wurde von der Marine der DDR mit Schnellbooten und Hubschraubern unterstützt. Zu den Wasserfahrzeugen gehörten insgesamt 34 Schiffe (davon 18 Hochseeminensuch- und -räumschiffe mit je 24 Mann Besatzung, zehn gut 20 Meter lange Grenzboote und sechs Kutter, mit Stab und Besatzung waren das 800 Personen). Die »Sicherung der Seegrenze« wurde zur Chefsache – alle wichtigen Maßnahmen mussten nicht nur mit der Volksmarine, sondern auch mit dem Ministerium für Nationale Verteidigung abgestimmt werden.
Besondere Aufmerksamkeit wurde Orten mit häufigen Fluchtversuchen zuteil: Wer war auf einem Campingplatz aufgefallen? Wer blies ein Schlauchboot auf? Waren Fluchtabsichten und Vorbereitungen bereits in den Heimatorten zu erkennen? Viele wurden auf diese Weise schon im Vorfeld als »Grenzverletzer« festgenommen. Und in der »5-Kilometer-Grenzzone an der Ostseeküste« halfen der Volkspolizei gerade in den Sommermonaten sogenannte »Grenzaufklärer« beziehungsweise »Grenzhelfer«, IM (Inoffizielle Mitarbeiter) und FHG (Freiwillige Helfer der Grenztruppen):14
»Bei der Gewinnung weiterer IM wollte man sich Anfang der 1970er Jahre (und auch später!) an diese Personenkreise wenden: Rentner, Fischer, Strandläufer, Dünenmeister, Rettungsschwimmer, die als Besatzungen auf den Seenot-Rettungstürmen zum Einsatz kommen, Zeltplatzpersonal, Personal der Strandkorbvermietung und des Zeltverleihs, Postboten, Mitarbeiter der Wasserwirtschaft und Forstbetriebe, Personal in den Erholungs- und Ferienheimen entlang der Küste.«
Durch die hochgerüstete Abschreckung und immer noch mehr Kontrolle wurden insbesondere in den 1980er-Jahren »Ostseeflüchtlinge der DDR immer weiter nach Osten abgedrängt, wo die Fluchtwege länger und gefährlicher waren«.15 Doch alle Abschreckung konnte über 5600 Menschen nicht davon abhalten, die meist lebensgefährliche Flucht aus der DDR über die Ostsee zu versuchen. Das Ministerium für Staatssicherheit setzte übrigens alles daran, Fluchtversuche vor der Öffentlichkeit zu verbergen, um Nachahmer zu verhindern. Stattdessen wurden sogenannte »Legenden« verfasst, bei denen der Tod eines Geflüchteten als Unfall dargestellt werden sollte.16 Und einmal mehr zeigte sich die Grausamkeit des DDR-Regimes: Die Angehörigen durften sich häufig noch nicht einmal von den Opfern verabschieden.17
Die schmalste Stelle der Ostsee zwischen der DDR