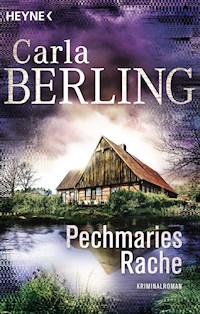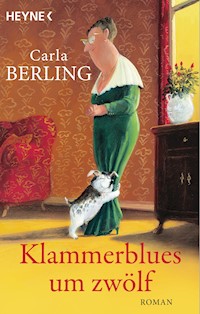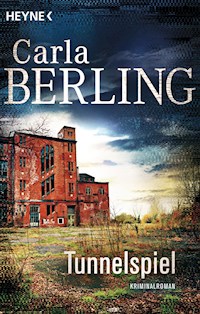3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Wittekind-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Lokalreporterin Ira Wittekind ist gerade erst in ihre westfälische Heimat zurückgekehrt, als eine schreckliche Nachricht sie erreicht: Ihre Schulfreundin Verena ist tot, ermordet von ihrem Mann Richard. Direkt nach dem Mord hat der angesehene Hotelier sich selbst das Leben genommen. Kurz darauf ist Ira Zeugin, als ein Toter in einer verwahrlosten Wohnung gefunden wird. Durch ein kleines Detail wird sie auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Todesfällen aufmerksam. Und ihr wird klar, dass hinter der idyllischen Fassade der Provinz ungeahnte Abgründe lauern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
Carla Berling
Sonntags Tod
Kriminalroman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Charly.
Und für Hans, Gerd, Sylwester und Achim.
Prolog
Ich bin schon oft gestorben, aber heute wird es das letzte Mal sein. Es gibt diesen Ort, an dem auch der Schmerz stirbt, wenn alle Last abfällt und die Masken sich auflösen. Solche Qual, so viele Enttäuschungen, so viele Tränen.
Du hast genug gelitten. Dich zurückzulassen wäre ein schlimmeres Verbrechen, als dich mitzunehmen.
Du würdest das Leben nicht überleben, nicht ohne mich, du würdest dich endgültig verlieren in deinen zerstörenden Fluchten, darin ertrinken, alle mitreißen, und nicht mal an deinem Hass könntest du dich noch festhalten, wenn ich nicht mehr da bin. Er ist alles, was dir geblieben ist.
Nein, ich kann dich damit nicht zurücklassen.
Früher war deine Liebe mein Geländer, an das ich mich klammern konnte in schwarzen Zeiten. Weißt du noch?
Wie schön du warst.
Wie abstoßend du sein kannst.
Ich habe dieses hässliche Tier in dir geweckt, ich war es, ich habe dich erstickt, wieder und wieder, gefesselt, fester und fester. Nicht nur dich habe ich enttäuscht, alle habe ich enttäuscht, aber jetzt bekommt das Wort seinen Sinn, verstehst du? Wenn die Täuschung zu Ende ist, folgt die Enttäuschung.
Und was bliebe mir, wenn ich jetzt doch noch zurückschreckte?
Hoffnung? Dass jemand, der mir den Boden unter den Füßen wegreißen will, doch noch innehalten wird?
So viele Fehler habe ich gemacht, mich hilflos verlaufen, wo ich nur hätte geradeaus gehen müssen. Alles holt mich ein, jetzt gibt es keinen Weg mehr, nur diesen einen Ausweg, den letzten.
Unsere Familien und alle, die wir lieben, werden glücklicher sein ohne uns. Auch du wirst überall glücklicher sein als hier, ich weiß es.
Vielleicht wird man mich noch mehr hassen, mich einen Feigling nennen, aber es ist mir egal. Endlich ist es mir egal.
Vielleicht habe ich nie gelernt, den geraden Weg zu gehen, vielleicht liegt die Wurzel meines Leids in dieser schrecklichen Kindheit, in der mich jeder lehrte, bei Gefahr zu fliehen.
Ich sehne mich nach dem Tod.
Warum hat nie jemand bemerkt, dass ich nicht in der Lage bin, etwas zu Ende zu bringen? Dass jede Herausforderung in einer Flucht endete und jeder Tag in einer Lüge?
Ich habe immer gelogen, und ich bin in den Jahren sehr überzeugend geworden. Mein Lügenballon droht zu platzen. Das ertrage ich nicht.
Diesen Schritt werde ich schaffen.
Es gibt kein Zurück mehr, du bist schon dort.
Ich folge dir.
Gleich.
1
Die kalte Januarluft wehte Ira ins Gesicht. Sie wickelte sich in ihren roten Schal und reihte sich in die Trauergemeinde ein. Mehr als hundert Menschen waren zur Beerdigung gekommen.
Warum gab es auf diesem Friedhof keine asphaltierten Wege? Sie würde sich mit dem Kies die Absätze ruinieren. Langsam bewegte sich der Trauerzug, die knirschenden Schritte übertönten sogar das Rauschen des Verkehrs auf der nahen Autobahn. Ira hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da sein würden. Es waren sicher mehr Neugierige als Trauernde. Sie ging fast am Ende der Menschenschlange, die Särge konnte sie nicht sehen.
Unglaublich, dass an einem solchen Tag die Sonne schien. Doch es war eine kalte Wintersonne.
Die Prozession schritt langsam voran. Es war weit bis zur Grabstelle, sie mussten das ganze Gelände überqueren, und der Friedhof war in den letzten Jahren größer geworden.
Ob jemand von der Polizei hier war? Nein, die Sachlage war eindeutig gewesen. Mord mit anschließender Selbsttötung, also ein »erweiterter Suizid«. O Mann, sie konnte offensichtlich selbst jetzt nicht aufhören, in ihrem Journalistenjargon zu denken. Aber sie war nicht als Reporterin hier. Und die Menschen, die da zu Grabe getragen wurden, waren keine Fremden.
So viele Jahre war sie schon nicht mehr in dieser Gegend gewesen, und wer weiß, ob sie überhaupt jemals wieder nach Rehme gekommen wäre, wenn diese schreckliche Geschichte sie nicht dazu gezwungen hätte.
Verena war tot. Und Richard.
Ihre Gedanken wanderten zu Patrick, der seine Eltern verloren hatte. Für ihn war es sicher am schlimmsten.
In diesem Moment war Ira froh, kein Kind zu haben. Natürlich war die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, sehr viel höher, als auf solche Weise ums Leben zu kommen und einen jungen Menschen allein zurückzulassen. Aber die Särge da vorne bewiesen, dass es Tragödien gab, die niemand vorhersehen konnte. Sie hatte Verena in den letzten Jahren kaum noch gesehen. Und obwohl sie selbst nach der Trennung von Alex vor einem guten halben Jahr von Köln nach Bielefeld gezogen war, hatte sie es nicht geschafft, ihrer alten Freundin in dem nur knapp vierzig Kilometer entfernten Bad Oeynhausen einen Besuch abzustatten. Mit fast fünfzig lösen sich die letzten alten Freundschaften allmählich auf.
Sie kamen an Karmanns Gruft vorbei, und Ira wurde von Erinnerungen überflutet. Als Kinder hatten Verena und sie hier gespielt. Es war eine Mutprobe gewesen, das schmiedeeiserne Türchen mit den stilisierten Pfeilspitzen zu öffnen und die Stufen hinunterzugehen. Zu wissen, dass dicht unter den blanken Marmorplatten echte Leichen lagen, war viel unheimlicher gewesen als der Gedanke an die Skelette draußen in den Gräbern. Ira hatte zuerst geglaubt, dass die Toten sie beobachten könnten, irgendwie, von irgendwoher. Aber als sie den Blumenstrauß mitnahm, der von den Angehörigen in die steinerne Vase gestellt worden war, und trotzdem nicht auf der Stelle tot umfiel, erkannte sie, dass die Toten nicht wirklich gefährlich waren. Es gab keinerlei Konsequenzen, als sie ihrer Mutter die geklauten Grabblumen zum Geburtstag überreicht hatte.
Aus einem Seitenweg kamen schwarz gekleidete Leute auf sie zu und reihten sich in die Prozession ein. Ira erkannte Elsa Weyer. Die Bäuerin hatte ihre zierliche Statur im Alter bewahrt, sie trug das Haar immer noch raspelkurz geschnitten, und das schmale Gesicht wirkte trotz der Falten jung. Kaum zu glauben, dass eine zarte Person wie sie vier Söhne großgezogen und jahrzehntelang all die schwere Arbeit auf Hof Eskendor verrichtet hatte. Der korpulente Riese mit der Halbglatze musste Thomas sein, der zweitjüngste der Brüder. Seine Mutter reichte ihm nur bis zur Schulter, und er schien mehr als doppelt so breit zu sein wie sie. Ira vermutete, dass die unscheinbare Frau im Patchworkmantel neben ihm seine Frau Gundis war. Hinter ihnen schlurften die beiden alten Schwestern Friedchen und Sophie, die auf Hof Eskendor lebten, seit Ira denken konnte. Sie waren ihr schon immer alt vorgekommen, mussten jetzt über achtzig sein, schienen sich aber erstaunlicherweise in all den Jahren gar nicht allzu sehr verändert zu haben. Mit ihren riesigen Brillen und den in altmodischen Dutts zusammengefassten weißen Haaren hätten sie glatt als Zwillinge durchgehen können. Als Kind hatte sie sich oft darüber lustig gemacht, wenn die beiden Schwägerinnen von Elsa Weyer abends vor dem Haus saßen, Schnaps tranken und Zigarrenstumpen rauchten.
Ira murmelte einen Gruß, bemerkte das Erkennen in ihren Augen, sah das angedeutete freundliche Lächeln.
Die Trauergäste stellten sich im Halbkreis um die mit Kunstrasen ausgelegte Grube. Langsam setzten die Träger beide Särge ab.
Iras Magen krampfte sich zusammen, als sie sich Verena und Richard im Dunkel der Kisten vorstellte. Gestecke aus gelben Rosen lagen auf den Särgen. Verena hatte schon als kleines Mädchen gelbe Blumen geliebt.
»Sie sind golden, nicht gelb«, hatte sie immer behauptet, wenn sie sich Kränze aus Butterblumen oder Löwenzahn flochten. Und jetzt war sie tot. Mit ihrem Mörder – ja, so musste man ihn doch nennen – würde sie die letzte Ruhestätte hier am Rande des Rehmer Dorffriedhofs teilen und gemeinsam mit ihm im Schatten der riesigen Zeder verfaulen. Ira sah ein Eichhörnchen am rissigen Stamm hinaufhuschen und im Geäst verschwinden.
Offenbar hatte sich der halbe Ort hier versammelt. Der Bad Oeynhausener Stadtteil Rehme hatte knapp achttausend Einwohner, und gerade solche Tragödien sprachen sich natürlich schnell herum. Das war schon früher so gewesen. Durch die dunklen Gläser ihrer Sonnenbrille konnte Ira die Umstehenden unbemerkt beobachten. Sie erkannte Verenas Sohn sofort: Patrick hatte das gleiche blonde Haar wie seine Mutter, blasse Haut und helle Augen, die jetzt gerötet waren. Er war lang und schlaksig und hatte nichts vom mediterran anmutenden Äußeren seines Vaters geerbt. Nun stand er mit gebeugten Schultern und hängendem Kopf neben einem Paar: Amelie und Alois Schäfer, Hotelbesitzer, Richards Eltern. Besser gesagt, Adoptiveltern. Obwohl sie sicher auch schon Ende siebzig war, trug Amelie Pumps mit hohen Absätzen und einen auffälligen, modernen Mantel. Die hennagefärbte Dauerwelle war perfekt gelegt, aber ihr Gesicht war grau und eingefallen, zwischen tiefen Falten wirkte ihre Mimik wie versteinert.
Wer hatte eigentlich entschieden, dass beide gemeinsam in einem Grab bestattet wurden? Weiß der Teufel, ob Verena das wirklich gewollt hätte.
Der Trauerredner ordnete mit fahrigen Bewegungen die Blätter seines Manuskripts. Plötzlich erklangen Saxofontöne, und die Umstehenden blickten wie auf ein Kommando in eine Richtung. Jetzt erst bemerkte Ira die beiden Geiger und den Saxofonisten, die abseits hinter dem Pulk der Trauergäste standen. Sie spielten »Freiheit« von Marius Müller-Westernhagen. Ira seufzte. Das war ihr entschieden zu theatralisch. Wer konnte schon wirklich wissen, ob Verena und Richard jetzt frei waren. Warum hatte Richard das getan? Patrick schluchzte. Amelie Schäfer presste sich ein Taschentuch auf den Mund.
Ein Paar um die fünfzig stand in der ersten Reihe. Die Frau biss sich auf ihre schmale Unterlippe und hatte die Augen zusammengekniffen. War das etwa Linda? Sie war schon als Kind dünn gewesen, aber jetzt sah sie aus wie ein Skelett im schwarzen Kaschmirmantel. Dennoch strahlte sie eine spröde Eleganz aus. Wenn Ira sich richtig erinnerte, hatte Linda Markus Weyer geheiratet, früh ein Kind bekommen und dennoch Karriere gemacht. Der Mann an ihrer Seite war also Markus. Wie seine Frau war auch er elegant gekleidet, das dunkle Haar trug er seitlich gescheitelt und exakt geschnitten. Seine gerade Nase und der sinnlich geschwungene Mund ließen ihn beinahe wie ein Model aussehen.
Die Musiker spielten jetzt »Mackie Messer«. Ira sprach den Text in Gedanken mit: Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht …
Das Lied passt irgendwie immer, dachte sie. Man sieht uns, die im Lichte, und euch in eurer zugenagelten Kiste sieht man nicht. Die Melodie war schön, selbst hier auf dem Rehmer Friedhof. An diesem sonnigen Freitag, dem 9. Januar, hatte das Lied einen Zauber, eine weise Leichtigkeit, ganz anders als im Theater.
Wo war eigentlich Verenas Vater? Günter Friese hatte sie letzte Woche angerufen. Wahrscheinlich hatte Verena ihm irgendwann erzählt, dass Ira wieder bei Tag 7 in Bielefeld arbeitete. Er hatte so verzweifelt geklungen, als er ihr vom Tod der beiden berichtete. Wahrscheinlich wäre sie sonst heute gar nicht hier. Ira sah sich suchend um. So viele graue Dauerwellen und Hüte, so viele schwarze Wollmützen und Filzkappen. Dann entdeckte sie ihn. Verenas Vater stand auf der anderen Seite des Grabes und starrte auf die Särge hinab. Sie hatte sich als Kind vor dem Dorfsheriff, Schutzmann Friese, wie er damals genannt wurde, immer ein wenig gefürchtet. Heute wusste sie nicht mehr, warum eigentlich. Der alte Mann wirkte apathisch, gebrochen, überhaupt nicht beängstigend. Vielleicht lag es auch mit daran, dass seine buschigen Augenbrauen und das dichte Haar inzwischen nicht rabenschwarz, sondern grau waren, und dass seine dunklen Augen glasig und starr wirkten und nicht mehr furchterregend funkelten.
Ein eisiger Wind fuhr Ira in ihre störrischen Locken, und sie zog die Schultern hoch. Sie hatte schon viele Beerdigungen erlebt, und sie hatte schon oft getrauert. Das hier war anders. Es war eher ein Akt des Respekts, der alten Kinderfreundschaft zu Verena geschuldet; dazu kamen ein wenig Sentimentalität und Mitgefühl mit dem alten Friese. Und ja – auch eine gehörige Portion journalistische Neugierde angesichts der ungewöhnlichen Todesumstände. Zu ihrem Leben hatte Verena schon lange nicht mehr gehört.
Die Musiker stellten ihre Instrumente ab. Irgendjemand klatschte spontan. Zweimal. Alle wandten sich in die Richtung des peinlichen Beifalls, schauten böse oder missbilligend. Ira musste grinsen, bemühte sich aber rasch wieder um einen angemesseneren Gesichtsausdruck.
Sie ging nicht ans Grab, wollte keine Erde hineinwerfen. Dieses Geräusch, wenn die Klumpen auf den Sarg fallen, gehörte zu den schlimmsten Geräuschen, die sie kannte. Kein schöner Brauch. Sie glaubte nicht an den ganzen Quatsch von der Wiederauferstehung. Für sie war es, als würde sie dem Toten, der da in seiner Kiste lag, zum Abschied Dreck ins Gesicht werfen. Als die Trauergäste sich anstellten, um dieses Ritual auszuführen, drehte Ira sich um und rempelte dabei jemanden an. »Entschuldigung!«, sagte sie und blickte in sehr blaue Augen. Der Mann starrte sie kurz an. Ira stand wie festgenagelt. Der Typ war groß, breitschultrig, hatte eine hohe Stirn, zerzaustes, schon ein wenig schütteres Haar mit grauen Schläfen. Er trug ein dunkles Flanellhemd unter einer derben Lederjacke.
»Darf ich?«, murmelte er, und Ira trat zur Seite. Sie sah ihm nach. Er ging mit festen Schritten zum Grab, stellte sich in die Reihe derer, die mit der Handvoll Erde Abschied nahmen. »Andy Weyer«, murmelte Ira, »du bist ja ein cooler Typ geworden.«
Der Festsaal des Rehmer Eck konnte mit einer Falttür von der Gaststube abgetrennt werden. Jetzt war die Tür offen, Gastraum und Saal gingen ineinander über. Die Rehmer kannten ihn von Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen und runden Geburtstagen. Hier kochte der Chef selbst, ein Holzbrett mit entsprechender Aufschrift hing über der Küchentür. Heute trafen sich etwa fünfzig Menschen zur Trauerfeier von Verena und Richard Schäfer.
Es war festlich eingedeckt: Tischbänder aus schwarzem Tüll wiesen die Tafel als Trauertisch aus. Die Nelken in den schmalen Messingvasen passten farblich zu den fahlgelben Papierservietten. Auf großen Tellern waren Stücke von Platenkuchen aufgeschichtet, ein Blechkuchen mit Zuckerstreuseln und Butterflocken, im Volksmund auch »Beerdigungskuchen« genannt. Wenn die Schwingtür zur Küche sich öffnete, wehte der Duft von Kaffee, Suppe und Schinkenbroten herein.
Ira hatte nach dem Begräbnis zuerst Tante Erna aus dem Auto geholt und war mit ihr Gassi gegangen. Jetzt lag sie unter dem kleinen Tisch am Fenster des Gasthofs Rehmer Eck und hatte alles im Blick.
Ein kalter Luftzug kündigte an, dass sich die Eingangstür vor dem dicken Filzvorhang geöffnet hatte.
Andy Weyer blieb in der Tür stehen, grüßte mit einem Kopfnicken in die Runde, entdeckte Ira und ging auf sie zu. Er lächelte, hielt ihr die Hand hin und sagte: »Ira Wittekind von gegenüber! Fast hätte ich dich vorhin nicht erkannt. Ist hier noch frei?«
Ira erwiderte sein Lächeln und gab ihm die Hand:
»Hier ist noch frei, wenn dich Tante Erna nicht stört.«
Ira zeigte auf die Hündin. Andy ließ sie an seinem Handrücken schnüffeln und streichelte dann ihr schwarzes Fell. »Komischer Name für eine Promenadenmischung.«
»Keine Mischung!«, protestierte Ira. »Sie ist eine reinrassige Königspudeldame, aber das erkennt man nicht auf den ersten Blick, weil ich sie nicht pudelig trimmen lasse.«
»Na, zum Glück lässt du dich auch nicht trimmen«, sagte Andy grinsend und griff ihr ganz kurz in die schulterlangen aschblonden Locken. »Deine Haare sind noch genauso wild wie früher.«
Ira war ein wenig verlegen und wies mit dem Kopf hinüber zum offenen Saal. »Willst du dich nicht zu deiner Mutter und deinen Brüdern setzen?«
»Später.«
Andy zog seine Lederjacke aus und hängte sie über die Stuhllehne, setzte sich und bestellte Kaffee. Er lehnte sich zurück und sah sie an. »Ich hatte schon fast vergessen, wie hübsch du bist. Immer noch diese blitzenden grünen Augen. Das Alter steht dir wirklich gut.«
»Alter? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Andy Weyer.«
Er grinste. »Wie lange ist es her?«
»Dass wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das war auf der Hochzeit von Verena und Richard, muss so ungefähr zwölf Jahre her sein, aber da haben wir kaum miteinander gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.«
Andy überlegte. »Ja. Wer hätte damals gedacht, dass die beiden einmal so enden würden. Verena und du, ward ihr eigentlich noch befreundet?«
»Wir haben nur noch ab und zu mal telefoniert, mehr nicht. Wir führten so unterschiedliche Leben, da gab es irgendwann nicht mehr viele Gemeinsamkeiten.«
Die Kellnerin verteilte Schnäpse. Ira nahm das beschlagene Glas entgegen, schnupperte an der klaren Flüssigkeit und schüttelte sich. Was für eine Tradition, mit kaltem Wacholder auf die Toten anzustoßen. Jeder Gast hielt nun ein »Pinnchen« in der erhobenen Hand und nickte stumm in die Runde. Auch Ira und Andy prosteten sich zu. »Auf Verena und Richard«, sagte Andy. Alle kippten den Klaren mit einem Schluck hinunter.
»Weißt du eigentlich Näheres?«, fragte Ira. »Verenas Vater hat mich angerufen, war aber natürlich total durch den Wind und hat mir eine ziemlich wilde Geschichte erzählt.«
»Es heißt, Amelie Schäfer sei am Neujahrsmorgen in die Wohnung der beiden gegangen. Sie hatte angerufen, weil es nebenan im Hotel irgendein Problem gab. Und weil niemand ans Telefon ging, ist sie rüber. Tja, und da lagen sie in ihren Betten …«
Als Günter Friese Ira am Telefon mit rauer Stimme erzählt hatte, dass seine Tochter Verena und ihr Mann Richard tot seien, hatte sie nicht nach Details gefragt. Sie ließ ihn einfach reden und konnte nicht glauben, was sie hörte: Richard habe seine Kleine umgebracht, besoffen habe er sie gemacht und ihr Tabletten gegeben, und dann habe er selbst eine Flasche Schnaps ausgetrunken und Tabletten genommen.
Verenas Vater saß jetzt drüben an der Stirnseite der Tafel. Der schwarze Anzug war ihm zu groß, sein dünner Hals ragte aus einem viel zu weiten Hemdkragen. Er starrte ins Leere. Verenas Mutter war gestorben, als sie fünf war. Sie wuchs bei der Großmutter auf, bis ihr Vater einige Jahre später wieder heiratete. Und heute musste der alte Mann sein einziges Kind beerdigen. Das Schicksal hatte es mit Friese nicht gut gemeint.
Ira wandte sich an Andy: »Hat Richard eigentlich keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Selbstmörder erklären ihrer Nachwelt doch meistens, warum sie nicht anders konnten, oder nicht?«
»Ich weiß nur von meiner Mutter, was so im Dorf geredet wird, von einem Abschiedsbrief habe ich nichts gehört.«
Ira schaute wieder hinüber in den Saal. Elsa Weyer saß zwischen ihren Söhnen Markus und Thomas, die Schwiegertöchter widmeten sich dem Platenkuchen. Ira hatte richtig vermutet: Die Frau in dem Patchworkmantel war tatsächlich Gundis gewesen. Mit ihrem langen Zopf und dem offensichtlich selbst gestrickten schwarzen Pullover war sie der unvorteilhafte Gegenentwurf zu ihrer eleganten Schwägerin Linda im dunkelgrauen Kostüm. Irgendwie war Ira plötzlich froh, dass sie am Morgen nach kurzem Zögern auf ihre gewohnte Jeans-Pulli-Kombination verzichtet und stattdessen ein schmales dunkles Wickelkleid gewählt hatte. Natürlich mit einem roten Gürtel. Das musste sein.
Langsam wurden die Gespräche drüben lauter, die Kellnerin hatte die nächste Runde Schnaps verteilt.
»Andy, welcher von denen ist eigentlich Michel?«
Ira hatte fast zwanzig Jahre lang gegenüber gewohnt und kannte die Jungs von Hof Eskendor, seit sie denken konnte: Andy, der Älteste, war nur einige Monate älter als sie. Den ein Jahr jüngeren Markus sah sie in ihrer Erinnerung als freundliches, zurückhaltendes Kind, er war nie so barsch wie viele seiner Altersgenossen. Mit dem riesigen, stämmigen Thomas hatte sie nichts zu tun gehabt. Er war fast noch ein Baby, als sie schon zur Schule ging. Und als Michel geboren wurde, war Ira siebzehn Jahre alt und interessierte sich weiß Gott nicht für Babys aus der Nachbarschaft. Michel musste demnach Anfang dreißig sein, sie hatte ihn unter den Trauergästen nicht ausmachen können.
»Sag bloß, die Sache mit Michel weißt du nicht?«
»Welche Sache?«
Andy runzelte die Stirn: »Aber vom Tod unseres Vaters hast du schon gehört?«
Ja, Ira hatte es in der Zeitung gelesen, über das tragische Unglück war sogar überregional berichtet worden. Der damals achtjährige Julian, Sohn von Markus und Linda Weyer, hatte seinen Großvater versehentlich mit dem Jagdgewehr erschossen. Die ungesicherte Flinte stand auf dem Dachboden der Scheune, der Junge spielte damit, und gerade in dem Moment, als Karl Weyer heraufkam, löste sich irgendwie ein Schuss. An Einzelheiten konnte Ira sich nicht erinnern, nur an das wohlige Entsetzen in der Stimme ihrer Mutter, die wochenlang am Telefon von nichts anderem sprach als vom »schrecklichen Unglück auf Hof Eskendor«.
»Ja, das war eine schlimme Geschichte, tut mir wirklich sehr leid für euch, aber was hat der Tod eures Vaters mit deinem kleinen Bruder zu tun?«
Andy trank einen Schluck Kaffee. Er fuhr sich mit den Fingern durch sein Haar. Ira lächelte. Diese Geste kam ihr bekannt vor. Schon damals, als seine Haare ihm noch dicht und lockig bis über die Schultern fielen, hatte er sie so zurückgestrichen.
»Der Kleine ist mir immer fremd geblieben.« Andy war fast achtzehn, als Michel geboren wurde. Er übernachtete oft im Personalhaus des Hotels Hahnenberg, denn er hatte sich gegen die Arbeit auf dem Bauernhof und für eine Kochlehre im Hotel entschieden. »Zwei Wochen nach dem Drama mit unserem Vater ist Michel verschwunden. Spurlos. Hat einen Koffer mitgenommen und einen Batzen Geld, und wir haben ihn nie wieder gesehen.«
»Verschwunden? Wie kann ein Mensch heutzutage spurlos verschwinden?«
»Na ja, es gab schon eine Spur, meine Mutter glaubte jedenfalls lange, Michel sei mit den Schaustellern abgehauen. Als er seine Sachen gepackt hat, war nämlich gerade Rehmer Markt.«
»Ich verstehe. Kirmes, junger Mann zum Mitreisen gesucht …«, sagte Ira.
Obwohl sie sich so viele Jahre nicht gesehen hatten, war Andy ihr noch immer so vertraut, wie man sich nur sein kann, wenn man Kindheit und Jugend miteinander verbracht hatte. Sie dachte gern daran zurück. Zumindest eine Zeit lang war ihre kleine Welt heil gewesen. Mittagessen pünktlich um eins, freitags Fisch, samstags Suppe, und sonntags gab es Nachtisch. Draußen auf der Straße spielen, bis die Laternen angingen, Gummitwist und Bonanzaräder, zelten an der Weser, heiße Sommer in der Batze, Kirmes und Schützenfest, paffen auf dem Friedhof, rumgammeln auf der Rehmer Insel – und immer war Verena dabei gewesen. Die fröhliche Verena, das Püppchen, die hübsche Blonde mit den großen Augen und den süßen Grübchen, die sich als Jugendliche in jeden Jungen verliebte, den Ira auch nur ansah. Und nun war sie tot.
»Verena und ich haben uns vor ein paar Jahren in Köln getroffen. Sie war ziemlich am Boden, hatte bestimmt dreißig Kilo zugenommen, und sie trank zu viel. Zum Mittagessen Sekt für den Kreislauf, dann Bier gegen den Durst, später Wein für den Genuss und Underberg für den Magen. Meinst du, die Trinkerei und die Eheprobleme haben etwas mit Richards Tat zu tun?«
»Mein Bruder Markus war mit Richard als Kind befreundet. Soviel ich weiß, hatten die beiden aber in den letzten Jahren keinen Kontakt mehr. Er könnte bestimmt trotzdem etwas dazu sagen. Aber Markus spricht nicht. Seit Tagen nicht. Er ist wie versteinert.«
Ira sah zu Markus hinüber. Er spielte mit seinem Kaffeelöffel, starrte auf den Tisch. Sein Gesicht war reglos wie eine Maske.
»Warum sitzt du eigentlich hier alleine und nicht drüben im Saal bei den anderen, du kennst die Leute doch alle?«, fragte Andy.
Ira schüttelte den Kopf: »Ich bin doch viel zu lange weg gewesen, um mich in die Familien an der Trauertafel einzureihen. Richards Eltern kenne ich kaum, aber ich gehe natürlich nachher noch hin und spreche ihnen mein Beileid aus. Deiner Mutter und deinen Brüdern sage ich auch noch Guten Tag. Günter Friese will ich in den nächsten Tagen besuchen, er ist ja jetzt ganz allein. Nur sein Enkel ist noch da, aber ich weiß nicht, ob die sich gut verstehen. Patrick Schäfer wird sicher das Hotel übernehmen.«
Ira war erschöpft. Erst der Schock, dann die Beerdigung und dazu all die Menschen, die sie seit ihrer Geburt kannte und so viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Es war, als wäre sie in die Vergangenheit zurückgekehrt. Aber Verena fehlte. Erstaunt stellte sie fest, dass ihr diese ganze Geschichte doch mehr zu schaffen machte, als sie auf dem Friedhof noch gedacht hatte.
Andy sagte: »Erzähl mir etwas von dir, Ira. Bleibst du länger hier? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Wohnst du noch in Köln?«
Ira schüttelte den Kopf: »Keine Kinder, keine Ehen. Alex, mein letzter Lebensabschnittsgefährte, hat mich letztes Jahr Knall auf Fall verlassen. Klassische Sache, er hatte ’ne Jüngere, und dann hab ich mir einen schwarzen Hund und ein gelbes Auto gekauft und bin nach Bielefeld gezogen. Ich wollte noch mal neu anfangen, bevor ich endgültig zu alt dafür bin. Und nun arbeite ich wieder als Reporterin bei Tag 7 und bin für ganz Ostwestfalen-Lippe zuständig. Back to the roots – quasi. Übernächste Woche fahre ich in Bad Oeynhausen eine Nacht lang mit auf Streife, für eine Polizeireportage.«
»Wolltest du nicht eigentlich Lehrerin werden?«
Ja, Lehrerin für Deutsch und Erdkunde wollte sie werden. Das Studium hatte sie sich durch freie Mitarbeit bei Tag 7 finanziert, und dann war sie dort hängen geblieben. Ira sagte: »Die Entscheidung, bei der Zeitung zu bleiben, habe ich keinen Tag bereut. Ich gehöre zu den altmodischen Leuten, die ihren Beruf lieben. Auch nach so langer Zeit ist noch immer kein Tag wie der andere, und die Geschichte hinter der Schlagzeile interessiert mich nach wie vor mehr als die Schlagzeile an sich. Und du? Was hast du in all den Jahren so getrieben?«
Andy erzählte, dass er nach der Lehre beim Bund war und später wieder ins Hotel Hahnenberg zurückkehrte. »Tja, und dann hab ich Doro kennengelernt. Wir haben geheiratet, unsere Tochter kam zur Welt. Zwei Jahre später hat Doro mich verlassen und ist mit Tessa und ihrem Neuen nach Mallorca gezogen. Und ein bisschen hab ich es so gemacht wie du, als dein Typ dich verlassen hat: Hab die Brocken hingeschmissen und bin abgehauen, hab auf ’nem Kreuzfahrtschiff gekocht. Nur Mittelmeer. War ’ne tolle Zeit.« Immer, wenn das Schiff vor Mallorca ankerte, konnte Andy seine Tochter Tessa sehen. Und dort erreichte ihn im August 1995 auch der Anruf, dass sein Neffe Julian seinen Vater erschossen hatte.
»Ich bin natürlich gleich mit dem nächsten Flieger nach Hause. Bin dann erst mal auf dem Hof geblieben und hab meiner Mutter später beim Umbau geholfen.«
»Ja, ich hörte davon, dass ihr Eskendor umgebaut und eine Kommune gegründet habt, O-Ton meiner Mutter.«
Andy lachte. »Kommune, das ist mal wieder typisch Rehmer Dorftratsch. Wir sind keine Kommune. Wir haben den Hof zur Wohnanlage umgebaut, ein sogenanntes Mehrgenerationen-Projekt. Keiner von uns wollte den Hof traditionell bewirtschaften. Michel war ja abgehauen, Markus ist Prokurist bei Opel Hüttemann, der hat kein Interesse an Landwirtschaft, und ich sowieso nicht. Blieb nur Thomas, und der hat mit seinem Öko-Konzept voll ins Schwarze getroffen.«
Im früheren Schweinestall gab es jetzt einen Hofladen mit eigenen Erzeugnissen, den Thomas und Gundis mit Erfolg betrieben. Auf der Westkoppel gegenüber vom Friedhof standen nun Treibhäuser, in denen er Bio-Gemüse zog. Thomas hatte einen klassischen Bauerngarten mit Blumen und Kräutern angelegt, und auf der Wiese hinter der alten Turnhalle hielt er sechzig frei laufende Hühner.
»Die hab ich gesehen, Tante Erna stand schon sabbernd vor dem Maschendraht«, sagte Ira.
Andy klang begeistert, als er ihr den Hof schilderte: »Meine Mutter bewohnt die untere Etage im großen Haus. Drei Zimmer vermietet sie als Gästezimmer. Oben leben Thomas, Gundis und ihre drei Kinder. Die Dachwohnung haben wir an ein junges Paar vermietet. Markus und Linda wohnen in der früheren Scheune. Ihr Sohn Julian lebt nicht mehr auf dem Hof. Die Remise ist auch vermietet. Für Tante Sophie und Tante Friedchen haben wir die alte Kate renoviert, und auf der Wiese hinter der Mauer an der Eschentorstraße steht ein Einfamilienhaus, auch vermietet.«
»Und wo wohnst du?«
»Erinnerst du dich an die Deele und den Kuhstall? Da wohne ich jetzt, im Kuhstall und in der Deele. Du bist herzlich eingeladen, mit mir vor dem Kamin einen Lambrusco zu trinken!«
Ira verzog das Gesicht. »Lambrusco? Wie früher, auf der Rehmer Insel, aus der Korbflasche?«
Früher. Heute war Verenas Beerdigung. Wie konnte sie nur in Kindheitserinnerungen schwelgen, während drüben die Verwandten um ihre Toten trauerten.
Der Lärmpegel im Saal war merklich gestiegen. Dem Schnaps wurde reichlich zugesprochen, dazu gab es jetzt Schinken- und Schmalzbrote und eingelegte Gurken. Manchmal lachte jemand, dann wieder ertönte ein Schluchzen. Dieses Zusammensitzen, das gemeinsame Trauern, Sicherinnern, Weinen … Ira wusste, wie wichtig das alles war. Sie fing Blicke von Andys Mutter und seinen Brüdern auf, nickte, hob grüßend die Hand, beschloss aber, doch nicht hinüberzugehen, sondern ihre persönlichen Beileidsbekundungen später hinter sich zu bringen. Hier, auf dem Dorf, musste man sich für einen Besuch nicht vorher anmelden, man konnte einfach hingehen.
Ira stand auf, Tante Erna kam sofort unter dem Tisch hervor, setzte sich brav und schaute ihr Frauchen abwartend an.
»Ich muss leider los, hab noch einen Termin in der Redaktion, und man weiß ja nie, wie viel Verkehr unterwegs ist. Und du wirst drüben erwartet.« Sie reichte Andy die Hand. »War schön, dich wiederzusehen, auch wenn ich mir andere Umstände dafür gewünscht hätte.«
Andy brachte sie zur Tür. Als sie sich zum Abschied die Hand gaben, hielt er ihre einen Moment länger als üblich. »Wir sehen uns, Ira.«
2
Es war an einem Samstagabend Ende Januar, als Ira um kurz vor zehn ihren Mini vor der Wache in der Blücherstraße parkte. Schon vor Wochen hatte sie von der zuständigen Kreispolizeibehörde die Genehmigung erhalten, bei dieser Nachtschicht mit auf Streife zu fahren.
Kommissar Carlo Brück begrüßte Ira mit einem Grinsen, das die Furchen in seinem Gesicht noch vertiefte. Er war ein Oeynhausener Urgestein mit Ecken und Kanten. Anfangs hatte Ira sich mit dem muffeligen, wortkargen Hünen etwas schwergetan, aber im Laufe der vielen Jahre, die sie sich jetzt schon kannten, war er ihr mit seinem ostwestfälischen Charme fast ein wenig ans Herz gewachsen. Dass sie sich lange nicht gesehen hatten, als Ira in Köln gearbeitet hatte, hatte ihre gegenseitige Sympathie nicht beeinflusst.
»Moin, Wittekind, wir haben ’ne schöne Leiche, wollen Sie die sehen?«
Ira dachte: Oh nein, aber sie sagte: »Na klar!«
So ist das nun mal: Schlechte Neuigkeiten sind gute Schlagzeilen, eine Leiche würde in jedem Fall Schwung in die geplante Reportage bringen.
Brück fuhr sich durch den Bart, dessen Farbe Ira immer an das Fell eines Yorkshire-Terriers erinnerte. »Na, dann los, die Kollegen von der Spätschicht warten schon vor dem Haus auf uns.«
Auf dem Weg zum Auto stellte der Kommissar Ira seinen Kollegen Rondorf vor. Rasch stiegen die drei in einen der Streifenwagen und fuhren los, Richtung Richterstraße.
»Was ist denn das für ’ne Leiche?«, fragte Ira. Rondorf drehte sich zu ihr um. »Keine Ahnung, die Spätschicht wurde von den Hausbewohnern gerufen, weil es erbärmlich nach Verwesung stinkt. Der oder die muss also schon länger dort liegen.«
Ira bekam weiche Knie. Sie hatte in ihrem Berufsleben schon einige Leichen gesehen: Unfallopfer, Selbstmörder … aber eine solche Leiche war ihr glücklicherweise bisher erspart geblieben … herrje, das brauchte doch kein Mensch. Am liebsten wäre sie jetzt ausgestiegen, aber das kam natürlich überhaupt nicht infrage. Eine Leiche kann man sich als Reporter nicht entgehen lassen, egal, in welchem Zustand sie ist.
Sie nahm ihre Nikon aus der Tasche, wählte das Objektiv, ließ es einrasten, befestigte den Blitz, prüfte die Akkus und hängte sich schließlich die Kamera um den Hals.
Das Polizeiauto der Kollegen aus der Spätschicht stand mitten auf der Straße vor dem Haus Nummer neun. Aus dessen geöffneter Haustür schien helles Treppenhauslicht auf den Waschbetonweg. Ein paar Schaulustige standen auf dem Bürgersteig und gafften. In den benachbarten Häusern starrten Leute aus den Fenstern.
Die Spätschicht übergab den Fall nun offiziell an die Nachtschicht. Brück fasste noch einmal zusammen, was die Kollegen soeben berichtet hatten: Eine Nachbarin hatte auf der Wache angerufen, weil der Briefkasten des Mieters Michael Sonntag total überfüllt war und weil der widerliche Gestank sie beunruhigt hatte.
Die Kollegen von der Spätschicht hatten dann die Wohnungstür in der dritten Etage öffnen lassen. Der Schlüssel steckte von innen, es war nicht abgeschlossen. Sie hatten die Tür einen Spaltbreit geöffnet, sich sofort die Nasen zugehalten, gerufen, aber keine Antwort bekommen. Offenbar befand sich keine lebende Person in der Wohnung. »Aber da oben liegt einer, der muss seit Wochen tot sein, macht euch auf was gefasst«, sagte der Kollege. Nun war die Spätschicht zu Ende, und der Fall musste pünktlich an die Nachtschicht übergeben werden. Typisch Beamte, dachte Ira, sogar jetzt machen die Dienst nach Vorschrift.
»Dann wollen wir mal!«, sagte Brück und ging vor. Das Treppenhaus war pieksauber, die Fußmatten vor den Wohnungstüren lagen akkurat, und die Grünpflanzen auf den Fensterbänken und Treppenabsätzen hatten kein einziges braunes Blatt. Alle Klingelschilder waren sauber und lesbar beschriftet. Ein ordentliches Haus.
Was war hier passiert?
O ja, jetzt bemerkte Ira den Gestank. Süßlich, faul. Mein Gott, bloß nicht mehr durch die Nase atmen. Die linke Wohnungstür in der dritten Etage stand nur einen Spaltbreit offen. Brück drückte mit der flachen Hand und dem Fuß dagegen, sie ließ sich nicht ganz öffnen. Er brauchte Kraft, um sie weiter aufzuschieben. Es war stockfinster in der Wohnung. Brück tastete nach einem Lichtschalter. »War ja klar, kein Strom. Rondorf, gib mir mal die Taschenlampe.«
Er nahm die Stablampe von einem Kollegen entgegen, schaltete sie ein, leuchtete kurz in die Diele, sagte: »Ach du Scheiße!«, und trat einen Schritt zurück. Und dann ging das Licht aus.
»Drecksbatterien!«, fluchte Brück. Die Tür war jetzt weit offen, das Licht aus dem Treppenhaus schien in die Diele. Rondorf warf einen Blick hinein, drehte sich auf dem Absatz um, lehnte sich gegen das Treppengeländer, fasste sich an den Hals und würgte. Er war kalkweiß im Gesicht.
Der Gestank musste bestialisch sein. Ira atmete vorsorglich kurz und flach durch den Mund. Sie glaubte, der Geruch habe sich auf ihre Zunge gelegt und sie könne ihn schmecken. Sie wusste, wenn sie das nur einmal roch, würde sie kotzen müssen.
»Wittekind, kommen Sie mal her, und machen Sie Licht mit Ihrem Blitz!«, sagte Brück. Ira schluckte. Sie trat vor und blickte in einen schmalen Flur, dessen Fußboden mit Plastiktüten, angerosteten Dosen, Kippen und leeren Flaschen fast vollständig bedeckt war. Nur ein schmaler Pfad, wie ein Trampelpfad, war frei. Herrschaftszeiten, was war das? Deswegen war die Tür nicht ganz aufgegangen, Brück hatte erst den Müll beiseiteschieben müssen.
Wie ferngesteuert hob Ira die Nikon vor ihr Gesicht und drückte auf den Auslöser. Sie schaute durch den Sucher, nicht auf das Display, und was sie sah, verschlug ihr den Atem. Brück hielt sie am Ellenbogen fest und half ihr, langsam durch den kniehohen Dreck zu waten.
Blitz. Das Badezimmer. Auf dem schmierigen Fliesenboden Zeitungen, Kippen, Plastiktüten, Undefinierbares. Vorne ein Hocker, darauf zerknülltes Papier und Kartons. Blitz. Auf der Fensterbank einen halben Meter hoch gestapelter Abfall verschiedenster Art. Im Waschbecken leere Flaschen, Ravioli-Büchsen mit verschimmelten Resten. Blitz. Die Kloschüssel bis oben an den Rand verdreckt. Die Klobrille mit Fäkalien beschmiert. Blitz. Die Badewanne zu einem Drittel mit Abfall gefüllt. Iras Puls raste. Ihr wurde schwindelig, sie atmete kurz und hastig durch den Mund. Bloß nicht riechen, bloß nicht riechen.
Stille in der Wohnung, nur das Knirschen des Mülls unter ihren Füßen und ihr heftiges Atmen waren zu hören.
Die Küche. Blitz. Dasselbe Chaos. Verkrustetes. Verfaultes. Verwestes. Stinkendes. Scherben. Kein Zentimeter ohne Unrat, Müll, Kippen.
Der Wohn-Schlaf-Raum. Müll. Blitz. Müll. Blitz. Müll. Blitz.
Ein brauner Totenschädel.
Ira schrie auf, griff nach Brücks Arm, krallte sich fest, ließ dabei die Kamera los, sie baumelte am Gurt um ihren Hals. Stockdunkel. Dennoch sah Ira den halb verwesten Schädel, kaum zu erkennen zwischen all dem Abfall. Eine Leiche, da vorne auf dem Bett, im Dreck, im Müll, zwischen zerlumpten Decken und einem versifften Kissen, keine drei Meter von ihr entfernt. Ein grelles, überbelichtetes Bild manifestierte sich in ihrem Kopf. Tiefe, leere Augenhöhlen.
Brücks Stimme war belegt: »Könnten Sie das wohl noch mal fotografieren, schaffen Sie das?«
Ira nahm die Kamera hoch, und es blitzte, blitzte, blitzte. Sie sah nicht hin, kniff die Augen fest zu. Ihr war schlecht, sie würde gleich umfallen, mitten rein in diese ganze Schweinerei. Nein, bloß nicht fallen, nur raus, schnell raus hier. Sie drehte sich um und stapfte zum Treppenhaus zurück, rannte hinunter, hinaus, vor die Tür, in die Kälte, setzte sich auf die Stufe vor der Haustür und sog gierig die eisige Nachtluft ein.
So etwas hatte sie noch nie gesehen. Wie kann ein Mensch nur so armselig enden? Was war da oben verdammt noch mal passiert? Hatte den einer umgebracht, oder war der am Dreck gestorben?