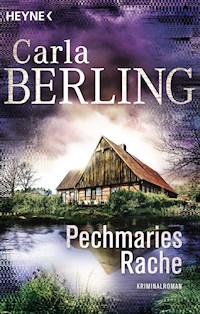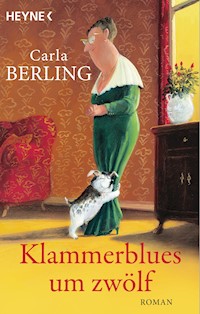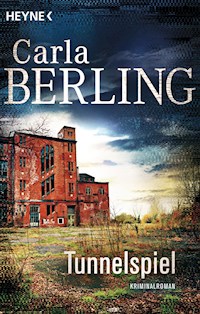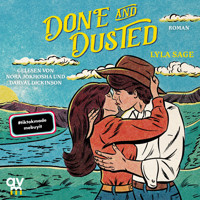9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Steffi, Mitte fünfzig und Reihenhausbewohnerin, ist unzufrieden. Mit ihrem Job. Mit ihrem Aussehen. Mit ihrem Mann Tom und seinem Faible für Kreuzworträtsel. Und mit ihrem Sexualleben. Das Highlight der Woche: Jeden Montag trifft Steffi sich mit ihrer Schwester und ihren Freundinnen im Brauhaus. Außer einer Single-Frau sind alle unglücklich und würden ihre Männer lieber heute als morgen loswerden – Haus, Auto, Sparbuch und Designerküche können aber gerne bleiben! An einem langen Kölsch-Abend entsteht ein perfider Plan, wie eine unauffällige Entledigung der Gatten gelingen könnte. Doch die Umsetzung ist komplizierter als gedacht…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Steffi, Mitte fünfzig und Reihenhausbewohnerin, ist unzufrieden. Mit ihrem Job. Mit ihrem Aussehen. Mit ihrem Mann Tom und seinem Faible für Kreuzworträtsel. Und mit ihrem Sexualleben. Das Highlight der Woche: Jeden Montag trifft Steffi sich mit ihrer Schwester und ihren Freundinnen im Brauhaus. Außer einer Single-Frau sind alle unglücklich und würden ihre Männer lieber heute als morgen loswerden – Haus, Auto, Sparbuch und Designerküche können aber gerne bleiben! An einem langen Kölsch-Abend entsteht ein perfider Plan, wie eine unauffällige Entledigung der Gatten gelingen könnte. Doch die Umsetzung ist komplizierter als gedacht …
Die Autorin
Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimireihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt außerdem regelmäßig mit ihrer Comedyreihe Jesses Maria durch große und kleine Städte.
Lieferbare Titel
Mordkapelle
Sonntags Tod
Königstöchter
Tunnelspiel
Carla
BERLING
Der Alte
muss weg
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 08/2019
Copyright © 2019 by Carla Berling
Copyright © 2019 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda
Umschlagabbildung: © Gerhard Glück
Umschlaggestaltung: © bürosüd
Satz: KompetenzCenter Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-23918-3V001
www.heyne.de
1
»Herr Professor, ich habe hier eine Statistik des Bundeskriminalamtes. Sie besagt, dass in Deutschland mindestens – ich wiederhole: mindestens – jeder zweite Mord unaufgeklärt bleibt. Das ist beängstigend, finden Sie nicht?«, fragte der Moderator.
Sein Gesprächspartner schob die Brille mit dem Mittelfinger hoch, schlug die langen Beine übereinander und lächelte hochnäsig. Er trug einen karierten Pullunder über einem gestreiften Hemd und dazu eine geblümte Fliege. »Nun. Der Terminus Mord ist eine juristische Definition. In unseren Kreisen bezeichnen wir diese Umstände als Tötungsdelikte. Und ich schrieb bereits in meinem neuen Buch, dass nicht nur jedes zweite Tötungsdelikt nicht aufgeklärt wird, sondern …«, er machte eine dramatische Pause und sprach langsam weiter, »sondern, und davon bin ich überzeugt, dass nur jede dritte Tötung überhaupt bemerkt wird!«
»Herr Professor, das würde aber bedeuten, dass jede Menge Mörder unter uns wären!«
Der Satz verfehlte seine Wirkung nicht, die Zuschauer wurden unruhig. Der Moderator stand auf, legte seinen Zettel ab, knöpfte das Sakko zu, verließ die Bühne und ging mit federnden Schritten auf das Publikum zu. »Sie! Sie könnten eine unentdeckte Mörderin sein«, rief er und zeigte auf eine Frau, die erschrocken die Augen aufriss. Dann wies sein ausgestreckter Arm auf eine andere Frau, die drei Plätze weiter rechts saß: »Oder Sie!« Er lief die Treppe hinauf, zeigte nacheinander in rascher Folge auf den, auf die, auf den. Und jedes Mal stach er mit dem Finger in die Luft und rief, jedes Mal lauter werdend: »Und auch Sie könnten ein unentdeckter Mörder sein!«
Jetzt steigerte sich das Gemurmel der Leute zu einem lauten Raunen. Der Moderator blieb auf der Treppe zwischen den Reihen stehen und schaute direkt in die Kamera. »Oder Sie!«, rief er nun und zeigte auf mich.
Ich ließ vor Schreck das Messer sinken und starrte ihm in die Augen. Aber ich schaute nicht weg, o nein, ich hielt seinem Blick stand, umklammerte das scharfe Messer mit meiner rechten Hand, mein Mund war leicht geöffnet, eine Haarsträhne fiel mir über die Augen, ich warf sie mit einem Schwung zurück.
Die Leute auf den Rängen redeten jetzt durcheinander, die Kamera fuhr dicht an sie heran, zeigte Augen in Großaufnahme, Münder mit zitternden Lippen, bebende Nasenflügel, Hände, zu Fäusten geballt, Handflächen, die verstohlen an Hosenbeinen abgewischt wurden.
Der Moderator ging, dem Publikum halb zugewandt und mit beschwichtigenden Gesten, zurück zur Bühne. Er knöpfte das Sakko wieder auf, setzte sich und sagte: »Somit ist es Fakt, Herr Professor, dass es etliche Mörder unter uns gibt, die frei herumlaufen?«
Ich nickte zustimmend, hielt das Messer immer noch fest umklammert.
Der Professor zupfte an seiner Fliege. »Nun ja. So gesehen. Sicher. Aber, und es ist wichtig darauf hinzuweisen, es handelt sich bei diesen unentdeckten Tätern nicht etwa um brutale Serienmörder, sondern in der Regel um sogenannte Einmal-Täter. Damit meine ich jemanden, der im Streit den aggressiven Opa erwürgt oder der zeternden, bettlägerigen Großtante das Kissen aufs Gesicht drückt, der den Kumpel im Suff erschlägt und ihn einfach liegen lässt.«
»Wäre das ein perfekter Mord? Ein Tötungsdelikt, das nicht entdeckt wird? Gibt es den perfekten Mord?«
Ich legte das Messer hin. Meine Kopfhaut begann zu kribbeln, ich spürte das Blut in meinen Adern fließen.
Der Professor machte ein selbstgefälliges Gesicht. »Aber selbstverständlich, ich kenne natürlich eine ganze Reihe, haha, todsichere Mordmethoden, haha.«
Ich bemerkte, dass seine Brillengläser schlierig waren, und an seinem Hals hatte er einen Pickel, direkt neben dem imposanten Adamsapfel über der geblümten Fliege.
»Der perfekte Mord ist doch schon mal, wenn Sie keine Leiche haben, nicht wahr? Wie wollen Sie nachweisen, dass einer überhaupt tot ist, wenn es gar keine Leiche gibt?«
Der Moderator machte sich gerade. »Ja, da haben Sie recht. Gab es in Ihrer Laufbahn denn schon mal einen Mord, der nicht entdeckt wurde?«
Der Professor runzelte ärgerlich die Stirn. »Woher soll ich das wissen, wenn er nicht entdeckt wurde?«
Das Publikum lachte. Der Moderator wurde angesichts seiner dummen Frage verlegen und rutschte auf dem Stuhl hin und her. »Haha, kleiner Scherz meinerseits, aber jetzt mal im Ernst: Können Sie Ihre Theorie näher erläutern?« Er grinste und zwinkerte. »Selbstverständlich dürfen wir hier keine Gebrauchsanweisung für den perfekten Mord geben …«
Die Kamera schwenkte wieder hinüber zum Professor. Der setzte eine wichtige Miene auf. »Nun. Es besteht zum Beispiel die durchaus realistische Möglichkeit, dass der Arzt, der nach dem Eintreten eines Todesfalls die Leichenschau durchführt, getäuscht wird!«
»Einen Arzt täuschen, wie geht denn das?«, fragte der Moderator.
Ich trat einen Schritt nach vorn, um kein einziges Wort zu verpassen.
Der Professor machte eine ausladende Bewegung. Er knetete sein Kinn und sah aus, als müsse er sich die Antwort genau überlegen. »Stellen Sie sich doch mal vor, Ihre Erbtante sei tot, stellen Sie sich vor, jemand habe ihr das Kopfkissen so lange aufs Gesicht gedrückt, bis sie nicht mehr geatmet hat. Stellen Sie sich vor, sie habe sich, alt, krank und geschwächt, nicht mehr wehren können. Stellen Sie sich vor, man habe den Hausarzt angerufen, der sie seit vierzig Jahren behandelt hat, es ist Samstag- oder Sonntagabend, vielleicht ist es schon spät, sagen wir halb zehn, die trauernde Familie sitzt zusammen. Der Hausarzt kennt jeden, der da am Küchentisch sitzt, nimmt den Schnaps an, der ihm angeboten wird, die Flasche steht auf dem Tisch und ist schon halb leer. Ja, glauben Sie denn, dass dieser Arzt noch eine richtige Leichenschau durchführt?«
»Ich habe irgendwo gelesen«, sagte der Moderator, »dass ein Rechtsmediziner gesagt haben soll: Wenn auf jedem Grab, in dem das Opfer eines unentdeckten Mordes liegt, eine Kerze brennen würde, wären Deutschlands Friedhöfe nachts taghell erleuchtet …«
Ich schaltete den kleinen Fernseher aus. Ich, Stefanie Herren, genannt Steffi, 51 Jahre alt, seit November 1986 mit Thomas, genannt Tom, verheiratet. Ich, Steffi, die ich an diesem Sonntag im Juni bis eben in meiner perlweißen Dreißigtausend-Euro-Küche in Köln-Rodenkirchen Kartoffeln geschält und nebenbei ferngesehen hatte, wusste nun endlich, was ich tun konnte, um mein ödes Leben zu ändern.
Ich könnte Tom umbringen. Irgendwie. Irgendwann. Nicht heute. Heute war Sonntag.
Tom lag nebenan im Wohnzimmer auf der Couch vor dem großen TV-Bildschirm und sah sich den »Fernsehgarten« an. Wie jeden Sonntag.
Ich könnte etwas tun, und dann würde sich vielleicht alles ändern. Wenn Tom nicht mehr da wäre, dann … ja, was dann? Würde dann alles besser?
2
Wenn ich etwas wagen könnte, dann …
Wenn ich mir etwas zutrauen würde, dann …
Wenn ich den Mut hätte, etwas zu verändern, dann …
Solche Sätze dachte ich damals jeden Tag. Wie ein Mantra, wie ein Gebet, wie ein Gebet ohne Amen. Wenn. Dann. Ich stellte mir immer wieder vor, meine Komfortzone zu verlassen und einmal, nur ein einziges Mal, ein echtes Risiko einzugehen. Ideen nicht mit »Nein, weil …« oder »Ja, aber …« sofort abzubügeln. Das Wort »immer« aus meinem Wortschatz zu streichen. Das Leben zu spüren. Nicht zu wissen, was kommen würde.
Leider wird mir schon bei dem Gedanken an Veränderungen schlecht.
Und deswegen blieb immer alles wie immer. Von morgens bis abends, von montags bis sonntags, von Januar bis Dezember. Eine zuverlässige Reihenfolge von Abläufen, Ritualen und Pflichten. Eine Käseglocke, unter der ich mich sicher fühlte. Meine Freundinnen bezeichneten mich als »Ritualjunkie«.
Manchmal fragte ich mich, wie die Nachbarn uns beschreiben würden. Man konnte uns wirklich nichts nachsagen, daher hätte das Urteil gut ausfallen müssen.
Wir grüßten freundlich und fast immer zuerst, rollten die Mülltonnen pünktlich an die Straße, bekamen selten Besuch, stellten den Fernseher nicht zu laut und hatten keine Tiere. Wir waren die Traumkunden jedes Immobilienmaklers und die perfekten Nachbarn, ein Ehepaar mittleren Alters, beide berufstätig, saubere Schufa, keine Schulden.
Ich: Personaldisponentin in einer Zeitarbeitsfirma. Tom: seit über dreißig Jahren Industriemeister bei Ford. Wir besaßen ein jüngst abbezahltes Reihenendhaus mit großem Garten in Köln-Rodenkirchen, einen 55-Zoll-Fernseher, zwei weitere, kleinere TV-Geräte, in der Küche und im Schlafzimmer, eine schicke Poggenpohl-Küche mit Miele-Geräten, eine Sofalandschaft von Rolf Benz aus cremefarbenem Leder und einen Ford, natürlich scheckheftgepflegt. Wir machten zweimal im Jahr Urlaub: einen an irgendeinem Strand, einen in irgendeiner Stadt. Zuletzt waren wir in Paris, davor in Rom, Istanbul, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Athen. Die Liste der Metropolen, die wir noch besuchen mussten, war lang: Bis zur Rente sollten alle europäischen Hauptstädte besichtigt sein.
Unser ewig gleicher Tagesablauf: Aufstehen um Viertel nach sechs, arbeiten von acht bis fünf, schlafen von halb elf bis Viertel nach sechs. Am Wochenende verschob sich alles um zwei Stunden nach vorn.
Montags nach der Arbeit ging ich zur Gymnastik. Nach dem Turnen: Treffen im Brauhaus mit meiner Schwester Marion und meinen Freundinnen Elfie, Zita und Babette. Die Treffen waren das einzige Highlight der Woche. Unsinn. Sie waren das einzige Highlight überhaupt.
Tom ging am gleichen Abend in den Kanuverein. Er besaß eine Anstecknadel in Form eines silbernen Paddels, ein Geschenk des Vorstandes für dreißig Jahre Mitgliedschaft.
Jeden Dienstag besuchte ich nach der Arbeit meine Schwiegermutter im Altenheim.
Mittwochabends: einkaufen. Anschließend gab es irgendwo eine Currywurst oder ein Stück Pizza auf die Hand. Bis zur Tagesschau waren wir aber immer wieder zu Hause.
Jeden Donnerstagabend besuchten wir Bastian, unseren Sohn. Er war Filialleiter bei Edeka und hatte immer erst spät Feierabend, deswegen waren diese Besuche meist kurz. Viel zu erzählen hatten wir uns sowieso nicht. Er und seine Freundin Lena redeten nur von ihrem Kinderwunsch, von den Möbeln oder dem Auto, das sie sich anschaffen wollten, wenn das Geld mal reichen würde. Immer hieß es: Wenn – dann.
Das hat er von mir.
Freitags war unser Fernsehabend, aber ohne einen Prosecco, der meinen Kreislauf in Schwung brachte, fiel ich oft schon vor der Talkshow schlafend vom Sofa.
Samstags frühstückten wir ausgiebig mit Kaffee, Brötchen und fünfeinhalb Minuten lang gekochten Eiern, gegen Mittag fuhren wir in die City. Bummeln, shoppen, Kaffee trinken. Abends zum Griechen, Chinesen oder Italiener, immer im Wechsel.
Sonntagvormittag wurde unser Badezimmer zu meinem Wellnesstempel: Maniküre, Pediküre, Rasuren und Peeling, Haarpackung, Kräuterbad, Hyaluronmaske, Augenbrauen und Wimpern färben, Damenbart und Beine epilieren, Bikinizone auf Vordermann bringen. Danach war ich optisch wie neu. Tom guckte solange ZDF-Fernsehgarten. Er stand total auf diese blonde Moderatorin mit dem Obstnamen. Mir war sie zu hektisch, er fand sie »temperamentvoll«. Sagte einer, dem man im Gehen die Hose flicken konnte.
Wenn ich mit meiner Generalüberholung fertig war, sorgte ich für das Mittagessen, anschließend legten wir uns noch mal ein halbes Stündchen hin und hatten Sex. Besser gesagt: Tom hatte Sex. Ich hatte eine Möglichkeit gefunden, meinen E-Book-Reader so zu platzieren, dass ich derweil lesen konnte.
Sonntagnachmittag gingen wir spazieren, danach: Sofa und Fernsehen. Lindenstraße, RTL-Exklusiv, Weltspiegel, Tatort und anschließend den Rest vom Promi-Dinner.
Klingt nach einem ausgefüllten Leben. Unsere Nachbarn hätten sicher gesagt: Steffi und Tom, das sind normale, anständige Leute mit einem normalen, anständigen Leben.
Und das war mein Problem Nummer eins. Mein normales, anständiges Leben, das täglich, wöchentlich und monatlich in denselben Bahnen verlief, war nämlich vor allem eins: zum Kotzen langweilig.
Bis zu diesem Sonntag, der alles veränderte.
Aus der Langeweile resultierte Problem Nummer zwei: Ich musste es ändern, dieses Leben. Und schon kam ich zu Problem Nummer drei: meiner panischen Angst vor Veränderungen.
Neulich hatte ich gelesen: Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst was dafür zu tun, ist, als stünde man am Bahnhof und würde auf ein Schiff warten.
Tom sah mich an wie die Gans, wenn es donnert, als ich diesen Satz aus heiterem Himmel zitierte. Ich hatte mich im Türrahmen postiert und die Hände in die Seiten gestemmt.
»Wie kommst du jetzt auf so was?«
»Das habe ich gelesen«, sagte ich und fügte trotzig hinzu: »Und es ist wahr.«
»Was willst du denn verändern? Wir haben doch vor Kurzem erst die Küche renoviert«, sagte er, ohne den Blick von der Mattscheibe zu nehmen.
»Ich meinte eher uns als die Küche.«
Jetzt schaute er auf, zog die linke Braue hoch, kniff die Augen zusammen, schüttelte verständnislos den Kopf, nahm die Fernbedienung und machte den Ton lauter. Eine Frau mit roten Haaren und langem Schlitz im Kleid begann zu singen und machte dabei theatralische Handbewegungen.
Schnippisch sagte ich: »Oh, ich verstehe, Andrea Berg singt, da darf man nicht stören. Aber bei der hättest du keine Chance, das kannst du mir glauben, die nimmt keinen mit Ohr- und Nasenhaaren, hängendem Hintern und wachsendem Bauch.«
Statt einer Antwort griff er wieder zur Fernbedienung. Typisch Tom. Früher war er auf solche Provokationen schon mal eingestiegen, aber mit dem Alter wurde er immer träger, sturer und wortkarger.
Noch gab ich nicht auf. »Ich meinte, dass wir an uns etwas ändern müssen, an unserem Leben …« Lahm fügte ich hinzu: »… Irgendwie.«
Keine Reaktion.
Ich stapfte an ihm vorbei und stellte mich in angriffslustiger Pose vor den Fernseher.
Jetzt wurde er wütend, ich sah es am Blitzen in seinen Augen. Aber es war eigentlich gar kein Blitz, nicht mal das, nur ein kurzes Aufleuchten.
»Ach, Steffi. Wir sind seit über dreißig Jahren zusammen, was erwartest du denn?« Er schaltete den Fernseher aus, stand auf, dabei knackten seine Knie. Er verließ das Zimmer und ging nach oben. Die Schlafzimmertür fiel ins Schloss, kurz danach hörte ich, dass er dort den Fernseher eingeschaltet hatte, und ich hörte die Moderatorin mit dem Obstnamen das nächste lustige Spiel ansagen.
Der Tag war gelaufen. Ich wusste genau, wie er weitergehen würde. Wenn der Fernsehgarten zu Ende war, würde er sich auf die Terrasse setzen und Kreuzworträtsel lösen. Er hatte sich neulich eine buchdicke Rätselzeitschrift gekauft und kritzelte mit Feuereifer darin herum. Neben sich: sein Laptop mit einer Internetseite, von der er die Lösungen abschrieb.
Wenn Tom rätselte, musste es ganz still sein, weil er sich sonst nicht konzentrieren konnte. Dann tickte nur die Uhr über der Küchentür. Ich sprach im Stillen mit: Ticke-tack. Ticke-tack. Hau-jetzt-ab. Hau-jetzt-ab.
Warum ich nicht einfach ging?
Weil so was nicht einfach geht! Drei Lebensversicherungen wurden in den nächsten Jahren fällig, wir besaßen das Haus samt Inhalt, das Auto und ein Sparbuch mit neunzehntausend Euro. Was das Haus angeht, so hatte Tom es geerbt, im Fall einer Scheidung würde es wohl ihm allein gehören. Warum sollte ich auf vieles verzichten, mich deswegen womöglich vor Gericht mit ihm streiten oder alles verkaufen und den Erlös teilen? Man kriegt doch nie im Leben wieder raus, was man mal investiert hat. Diese ganzen Dinge, die einen Alltag ausmachen, daran hängt man doch! Allein meine Weihnachtsdekoration ist ein Vermögen wert. Sechs Umzugskartons voller Kugeln, Engel, Lichterketten und Kerzenhaltern. Und die Sandsammlung! Seit unserer Hochzeitsreise sammle ich Sand von Stränden dieser Welt. Aber nur von Meeresstränden. See-, Fluss- und Baggerteichstrände interessierten mich nicht. Freunde, Verwandte und Nachbarn bringen mir aus dem Urlaub Meeresstrandsand mit. Ich fülle ihn in Reagenzgläser, die ich mit blauer Tinte beschriftete. Wann, woher, von wem, das steht alles auf den kleinen Klebeetiketten. Ich besitze Sand von über siebenhundert Stränden. Eine wirklich beeindruckende Sammlung. Wo soll die hin? Tom hatte mir zu meinem vierzigsten Geburtstag das kleine Zimmer im Dachgeschoss mit Regalen ausgebaut, damit ich sie unterbringen konnte.
Also: Sollte ich im Fall einer Trennung alles verkaufen, verteilen, verschenken oder verzichten? Damit ich anschließend in einer gemieteten Zweizimmerwohnung mit Ikeamöbeln saß? Nix da.
Auch Problem Nummer vier musste gelöst werden: Mein Job.
Ich hatte eine widerliche Chefin. Heidemarie Bunge. Inkompetent, arrogant und fies. Mobbing vom feinsten, darin war sie richtig gut. Meine Freundin Zita sagt: »Dazu gehören immer zwei: einer, der mobbt, und einer, der sich mobben lässt.« Recht hat sie. Ich dufte mir das nicht länger gefallen lassen. Auch damit musste Schluss sein. Ich wollte mir was Neues suchen – aber mit dem Job ist es wie mit der Ehe: Man kann natürlich nicht kündigen, bevor man sicher was Neues hat. So viele Wünsche und Träume hatte ich. Ich hätte mir gern ein ganz neues Image zugelegt. Kein normales, anständiges Steffi-Herren-Image, sondern einen Knaller. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich gerne rothaarig geworden, hätte schicke Kleider, halterlose Strümpfe und High Heels getragen, mir ein Rosengarten-Tattoo auf den Rücken stechen lassen und unwiderstehlich gewirkt.
Tja. Es gibt doch dieses Sprichwort: Man soll sich Kraft wünschen, um Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann, und man soll sich Mut wünschen, um Dinge zu ändern, die man ändern kann. Und wenn man beides voneinander unterscheiden könne, sei man schon fast weise. Daran, dass ich über fünfzig war, konnte ich nichts ändern. Dass ich in hohen Schuhen nicht laufen konnte, wusste ich auch nicht erst seit gestern. Mein Gang in Pumps ähnelte dem Balanceakt einer Betrunkenen auf einem unsichtbaren Schwebebalken. Also keine High Heels. Das Tattoo – geschenkt. Ich habe solche Angst vor Spritzen, dass ich schon kollabiere, wenn einer nur das Wort »stechen« sagt. Die roten Haare … ich hatte es mal versucht. Quasi am nächsten Tag hatte ich einen grauen Scheitel gehabt, plötzlich schienen meine Haare mit Lichtgeschwindigkeit zu wachsen. Als ich mit der grauen Schneise im Henna wie ein Stinktier aussah, färbte ich den Ansatz nach. Zu Hause. Weil ich es mir wert war. Danach leuchtete in meinem roten Haar ein orangefarbener Ansatz. Nun trug ich wieder den mittelaschblonden Bob mit Seitenscheitel. Wie immer. Keine High Heels, kein Tattoo, keine rote Mähne.
Meine Freundin Zita ist immer elegant, trägt immer schicke Schuhe, immer tolle Klamotten. Ich habe sie noch nie in Jeans gesehen. Wir kennen uns seit der Kindheit – und Zita hat nach meiner Einschätzung alles richtig gemacht. Sie ist Dolmetscherin geworden und spricht acht Sprachen fließend. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch und Schwedisch. Für mich ist sie ein Genie. Nicht nur wegen der Sprachen – sie kann zum Beispiel französische Bücher ins Schwedische übersetzen –, sondern auch weil sie nie geheiratet hat.
Es ist nicht so, dass Zita keine Männer mag, ganz im Gegenteil. Zu unserer Silberhochzeit ist sie mit einem Typen angekommen, der mindestens zwanzig Jahre jünger war als sie. Er war Model, lief für Boss, Armani und solche Firmen. Tom ist fast in Ohnmacht gefallen, als sie mit diesem Adonis auftauchte – just in dem Moment, in dem wir im großen Saal des Bürgerhauses nach meinem Wunschtitel von Stevie Wonder (»I just called to say I love you«) den Ehrentanz aufführten.
Zita nimmt sich jeden Mann, den sie mag, und wenn er ihr auf den Keks geht, schickt sie ihn eben in die Wüste. Basta. Sie ist die einzige Frau, die ich kenne, die ein schwarzes Maserati Cabrio fährt, und zwar ein bezahltes. Manchmal holt sie mich im Sommer damit ab, und wir düsen durch die Gegend, über die Kölner Ringe und an den Cafés der Aachener Straße vorbei, mit wehendem Haar und offenem Verdeck. Dann kann ich mir vorstellen, wofür glatzköpfige Männer über sechzig in roten Hosen und karierten Sakkos solche Schlitten brauchen. Man fühlt sich toll, wenn alle gucken.
Zu meinem Leben gehört auch Elfie. Bis vor Kurzem betrieb sie das Dessous-Geschäft »Elfies Lingerie« in der Schildergasse. Tom nannte es respektlos »Schlüpferladen«. Nachdem der Mietvertrag für den Laden nicht verlängert worden ist, hat Elfie sich ins Privatleben zurückgezogen und kümmert sich hingebungsvoll um ihren Hund Jenny und um ihre Figur.
Wenn ich daran denke, wie wir uns kennengelernt haben …
Meine Schwester Marion hatte Anfang der Achtziger einen Klüngel mit Walter. Besser gesagt, Walter war in Marion verknallt, sie ist ein paarmal mit ihm ausgegangen, aber der Funke sprang bei ihr nicht über. Zuerst fand sie ihn attraktiv, aber als sie erfuhr, dass er zwar ein eigenes Appartement in Nippes besaß, aber eigentlich noch verheiratet war und eine Gattin nebst zwei pubertierenden Kindern und ein Haus in Köln-Marienburg zu versorgen hatte, verlor sie sofort das Interesse.
Eines Abends saßen wir in unserer Stammkneipe: Tom und ich, Marion und Walter. Walter war ziemlich wuschig und grabbelte Marion dauernd an der Wäsche herum, ihr ging das fürchterlich auf die Nerven. Sie raunte mir zu, dass sie jetzt so tun würde, als ginge sie zur Toilette, und bei der Gelegenheit haute sie ab. Heimlich. Walter saß da mit glasigem Blick und dicker Hose und glotzte schmachtend zur Tür.
Tom und ich gaben ihm zwei Bommi-Pflaume aus, die halfen ihm ein bisschen.
Walter hatte irgendwann ordentlich einen im Tee. Zeitgefühl hatte er keins mehr. Marions Minirock hing längst kalt am Bett, als er immer noch auf sie wartete.
Das Lokal hatte eine Schwingtür wie früher im Saloon von Miss Kitty in der Serie »Rauchende Colts«. Plötzlich flog diese Tür auf, und da stand Elfie. Gestrickter Minirock in Grün, Wollstrumpfhosen in Lila, Strickstulpen in Rot, Pulli in Schwarz, ein breites Stirnband in Pink und schwingende Plastikohrringe. Ihre hochmoderne Vokuhila-Frisur war wild zerzaust, ihr Make-up verschmiert, ihr Lächeln schief.
»Die ist ja hackedicht!«, bemerkte Tom.
Elfie hielt sich an den Türflügeln fest und peilte mit wackelndem Haupt die Lage im Lokal. Alle starrten sie an und warteten darauf, dass sie der Länge nach hinschlug, aber sie fing sich und schwankte auf uns zu, grinste Tom an, fiel Walter um den Hals und pflanzte sich grunzend auf seinen Schoß.
Ach, hätte es damals schon Handys mit Kamera gegeben, das Bild hätte ich zu gern festgehalten! Ich sehe es heute noch vor mir: Walter trug wie immer einen Nadelstreifenanzug mit Seidenschlips zur Pilotenbrille und einen schnurgeraden Scheitel. Er schien mit der schrillen Elfie ein bisschen überfordert zu sein, das legte sich aber nach dem ersten Wodka-Feige, den sie für uns bestellte und auf seinen Deckel schreiben ließ.
»Bissuganzeleinehier?«, lallte sie und Walter nickte betrübt. Sie gab ihm ein Küsschen und flüsterte ihm was ins Ohr. Dann legte sie den Kopf weit zurück, starrte ihn mit geschürzten Lippen an und zog die eine Augenbraue hoch.
Walter grinste glückselig.
Da ging noch was, das war klar.
Tom sagte: »Nutzt ja nix, wir müssen mal los.«
Er zahlte, und wir verabschiedeten uns.
Seitdem waren Elfie und Walter ein Paar.
Nun hatte Walter sich zwar in Elfie verliebt, aber er hatte sich offenbar nicht komplett entliebt, was meine Schwester anging.
Seit über dreißig Jahren gab er Elfie das Gefühl, damals die zweite Wahl gewesen zu sein. Was das Ganze pikant machte: Marion und Walter waren Freunde geworden. Sie sah ihn als väterlichen Freund, er sah sie als Verflossene – obwohl sie, das weiß ich ganz genau, niemals Sex miteinander hatten! Und Elfie sah Marion noch immer als Konkurrentin, obwohl die längst zum dritten Mal verheiratet war. Noch …
Marion wollte Walter damals nicht und heute auch nicht. Aber Walter hatte Elfie immer damit provoziert, dass meine Schwester eine attraktive Frau geblieben ist – während Elfie inzwischen Länge mal Breite maß, spätestens um siebzehn Uhr das erste Kölsch trank und vor dem Black-out niemals nach Hause ging.
Wäre Elfie an diesem verhängnisvollen Montag nicht so betrunken gewesen, wäre vieles anders gelaufen.
Vielleicht würden zwei Menschen heute noch leben.
3
Wir trafen uns also jeden Montag im Brauhaus. Diese Treffen waren manchmal lustig, manchmal öde, manchmal endeten sie schon früh, gelegentlich arteten sie in Besäufnisse aus. Sie begannen fast immer gleich, wir trafen sogar meistens in derselben Reihenfolge ein.
An diesem Montag aber veränderte sich alles. Dabei fing der Abend ganz normal an.
Als Marion im Brauhaus ankam, hatte ich schon drei Kölsch-Cola getrunken. Marion sah gut aus, das honigfarbene Haar war frisch gefärbt. Sie trug hautenge Hosen aus Leder und ein lässiges Shirt. Und wie immer knallroten Lippenstift. Alles viel zu rockig für meinen Geschmack, viel zu auffällig, zu jugendlich. Aber, zugegeben, ihre fünfundfünfzig Jahre sah man ihr nicht an. Dagegen wirkte ich in meiner Ton-in-Ton-Kombination wie eine beigefarbene Seniorin. (Marion nannte meinen Lieblingsfarbton leberwurstfarben.) Obwohl ich die Jüngere bin.
Meine Schwester beugte sich zu mir herunter, küsste mich rechts und links neben die Wangen, dabei konnte ich ihr Parfüm riechen, und legte sofort los. »Liebelein, wie isses? Gut siehst du aus! Das war wieder so ein Tag, du kannst dir das nicht vorstellen … also heute kam ein Typ in den Laden, der wollte tatsächlich eine Zweitausend-Tacken-Tasche umtauschen, die er Weihnachten gekauft hat …«
Ich hörte ihr nicht zu. Marion erlebte immer irgendwelche Sachen, von denen sie dachte, ich könne sie mir nicht vorstellen. Sie war Filialleiterin in einem noblen Laden, in dem auch viele Prominente einkauften. Ich kannte die meisten nicht. Für Leute, die zweitausend Euro für eine Handtasche oder tausend für ein Paar Schuhe ausgaben, hatte ich sowieso nichts übrig.
Während sie ihr Kölsch auf ex trank und »Das hab ich jetzt gebraucht!« stöhnte, kam Elfie herein.
Sie warf ihre überdimensionale Leinentasche mit dem Aufdruck »Hunde sind die besseren Menschen« auf die Bank, ließ ihre hundertfünfunddreißig Kilo Lebendgewicht mit einem Ächzen daneben sinken und klopfte zur Begrüßung auf den Tisch. »Allet joot?«, fragte sie in breitem Dialekt und tätschelte dem Köbes, der unaufgefordert mit einem Kölschtablett und vollen Gläsern an den Tisch gekommen war, den Arm. »Mir jibbste mal so nen janz kleinen Jäjermeister mit Jeschmack, isch habbet am Majen.«
Elfie hielt sich an die Grammatikregel »Im Kölschen jibbet kein jeh«, zu Deutsch: »Der Kölner Dialekt kennt kein G.«
Marion verdrehte die Augen und verzog angewidert das Gesicht. »Dass du dir dieses Zeug immer antust.«
Elfies Medizin gegen alles bestand aus Jägermeister und Eierlikör zu gleichen Teilen und wurde mit einem Schuss Cola aufgegossen. Sie reagierte nicht auf Marions Bemerkung, zischte zuerst das Kölsch weg und anschließend das Mixgetränk. Seit sie so zugenommen hatte, trug Elfie keine Kleider mehr, sondern knöchellange Zelte, vorzugsweise in Aubergine- und Fliedertönen. In ihren mittelblonden Haaren prangte eine rotkohlfarbene Strähne.
Die Tür des Brauhauses flog auf, und Babette kam herein. Wie auf Kommando drehten sich alle Gäste zu ihr um, in ihrer rabenschwarzen Lockenmähne steckte eine riesige Sonnenbrille, eine Prada-Tasche schaukelte an ihrem angewinkelten Arm. Babette stöckelte graziös über die Dielen des alten Holzfußbodens, nickte hier und da einem der gaffenden Männer huldvoll zu und begrüßte uns reihum mit großer Geste und lautem Lachen. Hier im Brauhaus hielt sie gewiss jeder für eine Diva vom Film und nicht für die Hausfrau aus der Rodenkirchener Reihenhaussiedlung, die ihren Mann mit spendablen Typen betrog.
»Schöne Schuhe!«, sagte ich mit einem neidischen Blick auf ihre Pumps.
»Du, die waren gar nicht teuer, Escada, habe ich bei eBay ersteigert, nur fünfzig Euro.«
»Mein Mann würde mich in so bunten Schuhen nicht mitnehmen«, sagte ich.
Babette winkelte ein Bein an, musterte den mörderischen Bleistiftabsatz und bemerkte trocken: »Meiner besteht auch drauf, dass ich wenigstens ein Kleid zu meinen Schuhen trage.«
Auf dem Ohr war ich fast taub, zweideutige Bemerkungen rauschten oft unbemerkt an mir vorbei.
»Tom und ich stehen nicht so auf Knallfarben«, sagte ich. Dann stutzte ich einen Moment und sah an mir herab. Woher wusste ich das überhaupt? Hatte Tom je gesagt, dass ich nur Weiß, Beige, Grau und Taupe tragen sollte? Ich konnte mich nicht daran erinnern.
Babette und Ralph waren unsere Nachbarn. Als sie damals einzogen, hat es sich durch unsere Kinder irgendwie ergeben, dass wir uns anfreundeten. Die Kinder waren längst aus dem Haus, aber die Freundschaft ist geblieben. Vielleicht ziehen Gegensätze sich wirklich an. Während ich eher der unauffällige Typ bin, ist an Babette immer alles auf Weibchen programmiert.
An diesem Montag im Brauhaus gab sie sich betont fröhlich, aber ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie etwas überspielte. Sie kaute auf ihrer Zunge herum wie auf Kaugummi. Das tat sie nur, wenn sie extrem nervös war. Während ich darüber nachdachte, ob mal wieder eine von Ralphs Attacken der Auslöser für Babettes Stimmung sein konnte, wandte sie sich an meine Schwester. »Deine Leggings, toll, sind die bei dir aus dem Laden?«
Marion strich mit den Händen über ihre kalbsledernen Hosenbeine und nickte.
»Was kosten die? Kannst du mir eine zum Personalpreis besorgen? In achtunddreißig?«
Elfie rollte mit den Augen und rief: »Achtunddreißig! Ist ja albern! Kindergröße! Schaut mich an: Viele, viele pralle Kilo Weiblichkeit in Größe achtundfünfzig – alles erotische Nutzfläche!« Dabei presste sie ihre imposanten Brüste mit den Oberarmen zusammen, legte ihr Kinn auf den Vorbau und lachte kehlig.
Ich mochte es, wenn Elfie sich selbst auf die Schippe nahm, auch wenn ich wusste, dass sie wegen des Gewichtes kreuzunglücklich war. Damals, in den Achtzigern, als wir sie »die Bunte« nannten, weil sie sich so schrill kleidete, hatte sie eine ganz normale Figur gehabt. Dann hörte sie wegen einer Bronchitis auf zu rauchen und nahm in kürzester Zeit fünfzehn Kilo zu. In den Wechseljahren wurden es noch mal zwanzig Kilo mehr. »Umgerechnet sind das hundertvierzig Pakete Butter!«, hatte sie eines Tages ausgerechnet – und wieder angefangen zu rauchen. Aber sie nahm dadurch kein Gramm ab. Und seit sie Diäten machte, wurde es immer schlimmer.
Ich hatte ihr neulich gesagt, wenn sie auf den täglichen Alkohol verzichten könnte, würden die Kilos vielleicht von allein purzeln, aber davon hatte sie nichts wissen wollen. »Liebelein, wenn ich darauf auch noch verzichte, hab ich jar nix mehr vom Leben. Man jönnt sich doch sonst nix.«
Ich sagte nichts mehr dazu.
Wir klopften auf den Tisch, als Zita endlich ankam. Wie immer verbreitete sie sofort gute Laune. Sie begrüßte jeden mit Wangenküsschen, winkte den Köbes heran, bestellte, ließ die Runde Kölsch auf ihren Deckel schreiben und hob ihr Glas. »Trinkspruch?«, rief sie, und wir antworteten im Chor: »Ob Hans, ob Heinz, ob Dieter – alle lieben Zita!« Wir stießen an und tranken.
Wir quatschten über dies und das. Über Klamotten, Haare und Kleidergrößen, über Kollegen, Kantinenessen und Chefs, über unsere Kinder. Bei letzterem Thema hielt Elfie sich zurück. Sie hatte keine eigenen Kinder, aber sie hatte sich im Laufe der Jahre um Ersatz gekümmert: Sie behandelte Walter – er war zwanzig Jahre älter als sie und inzwischen über siebzig – wie ein Kind. Legte ihm raus, was er anziehen sollte, band ihm die Schuhe zu, zupfte an seinem Gürtel herum, stellte den Kragen seiner Polohemden hoch. Manchmal, wenn ich sie dabei beobachtete, erwartete ich, dass sie einen Finger mit Spucke befeuchtete, um ihm damit das Haar zu glätten.
Die nächste Runde ging auf Elfie. Auch sie hatte ihren eigenen Trinkspruch, selbst gewählt, und wir sangen die abgewandelte Zeile aus einem Lied von den Höhnern: »Schöne Mädchen haben dicke Namen, heißen Rosa, Tosca oder: Elfie!« Wohlsein.
Zita stand auf, um eine zu rauchen, ich spürte in diesem Moment eine Hitzewelle und begleitete sie vor die Tür.
»Wie findest du den?«, sagte sie und hielt mir ihr Handy hin.
Ich sah mir das Foto an. »Johnny Depp? Sieht klasse aus.«
Sie lachte. »Quatsch. Das ist Lars-Robin aus Euskirchen.« Sie hielt das Handy ein Stück weit weg und betrachtete das Bild mit zusammengekniffenen Augen. »Soll ich ihn daten?«
Ich sog scharf die Luft ein. »Der ist doch höchstens vierzig!«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir so einen alten Knacker antun würde? Nein, Lars-Robin ist Ende zwanzig.«
»Boah. Und du würdest dich vor ihm ausziehen?«, fragte ich ungläubig und dachte an meine schlaffen Brüste, meinen von Dehnungsstreifen gemusterten Bauch und die verbeulten Oberschenkel. Nein, mein Körper taugte nur noch für zu Hause, vor einem Fremden würde ich mich bestimmt nicht mehr ausziehen.
Zita lachte wieder und rief: »Natürlich würde ich mich vor ihm ausziehen, oder meinst du, ich will im Schlafanzug vögeln?«
Ich machte mein Pokerface, wie immer, wenn jemand sexuelle Handlungen beim Namen nannte. »Woher kennst du ihn?«, fragte ich, um das Gespräch wieder in seriöses Fahrwasser zu steuern.
»Noch gar nicht, du Dummerchen, er wurde mir als Sex-Kontakt vorgeschlagen.«
Ich schnappte nach Luft. »Von wem?«
Zita tippte etwas auf dem Bildschirm ihres Handys, wartete einen Moment und zeigte es mir. Es war eine Straßenkarte von Köln, auf der etliche rote Herzchen blinkten.
Ich verstand nur Bahnhof.
»Jedes Herz zeigt den Standort eines Kerls, der sich sofort mit mir treffen würde.«
Ich starrte fassungslos auf die kleine Karte. Jetzt entdeckte ich unten rechts eine Anzeige. 48 Singles in deiner Nähe. So viele. Die Zahl sprang auf 55.
Kopfschüttelnd gab ich Zita das Handy zurück. »Das würde ich nie tun! Mit einem wildfremden Typen sofort ins Bett …«
»Na ja, was heißt sofort, du reißt dir ja nicht beim ersten Anblick die Klamotten runter, man geht schon vorher was trinken. Aber es ist doch total praktisch, wenn das ganze unnötige Gesülze vorher entfällt. Jeder weiß, was er will, und gut. Wir sind doch erwachsen, und es geht schließlich immer nur um Sex.«
Ich dachte daran, dass ich seit über dreißig Jahren nur Sex mit Tom hatte und dass mir das ganze Theater seit neunundzwanzig Jahren keinen Spaß mehr machte. Okay, nur mit Tom bis auf eine einzige Ausnahme. Aber die zählte nicht. Weil sie mir auch keinen Spaß gemacht hatte. Ich war einmal fremdgegangen, ganz klassisch, auf einer Fortbildung, nach dem geselligen Beisammensein, abends im Hotel. Ich schüttelte mich beim Gedanken daran.
Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. »Liebelein, ist dir kalt?« Elfie wartete meine Antwort nicht ab und zündete sich eine Zigarette an. »Worüber redet ihr?«
Zita winkte ab. »Worüber wohl, über Männer natürlich.«
»Hör mir bloß auf.« Elfie blies den Rauch in die Luft und starrte ihm hinterher. »»Mein Jötterjatte jeht mir sowatt von aufn Jeist!«
»Ist was passiert?«, fragte ich.
»Nicht mehr als sonst. Walter hat nichts anderes im Kopf als poppen. Je oller, je doller, sag ich nur. Ich hätte nie jedacht, dass der auch mit über siebzig noch so auf’m Kiwief ist. Und er hat kein Verständnis dafür, dass ich in meinem Alter und mit meiner Fijur keine Lust mehr habe, nackend unterm Pelzmantel mit ihm im Cabrio durch die City zu düsen. Ich hab doch weiß Jott andere Sorjen!«
Ich dachte schnell an Katzenbabys, um das Bild der nackten Elfie gar nicht erst vor meinem geistigen Auge aufsteigen zu lassen.
»Ein echter Pelz müsste es nun nicht sein, aber gegen eine Spritztour im Cabrio habe ich nichts …«, sagte Zita.
Elfie prustete los. »Spritztour ist ja niedlich!«
Diesmal verstand auch ich den Witz sofort und stimmte in das Lachen der anderen ein. Damit waren wir schon wieder beim Thema Nummer eins. Das war doch nicht zum Aushalten.
Marion und Babette unterhielten sich, als wir wieder ins Lokal kamen. Babette sagte gerade: »… manchmal könnte ich ihn umbringen!«
»Wen?«, fragte Zita.
»Na, Ralph. Ihr wisst, dass er ein Sadist ist, ein widerliches Ekel.«
»Dann verlass ihn. Niemand zwingt dich, mit einem widerlichen Ekel unter einem Dach zu leben«, sagte Zita.
Babette stützte die Ellenbogen auf den Tisch, faltete die manikürten Hände und legte ihr Kinn darauf. In diesem Moment sah sie so zerbrechlich aus! Ich wusste, was für ein Drecksack ihr Mann war.
Elfie sah Zita spöttisch an. »Du hast gut reden, du hast ja keinen Mann, der dich in allem ausbremst und sich ganz anders entwickelt als du.«
»Richtig«, konterte Zita, »und deswegen bleiben mir auch viele Entwicklungen und Erfahrungen erspart: Rosenkriege, Scheidungen und Unterhaltszahlungen zum Beispiel.«
»Aber eine Ehe ist doch nicht nur negativ, man bekommt auch was zurück«, sagte ich lahm, aber mein Einwand ging im Gespräch der anderen unter.
Ich dachte an Tom und fragte mich, was ich vermissen würde, wenn er weg wäre. Das verwüstete Badezimmer, nachdem er geduscht hatte? Die Bremsspuren im Klosett? Seine Schmutzwäsche, die er neben den Wäschekorb warf statt hinein? Gläser, die er auf die Spülmaschine stellte und nicht gleich einräumte? Schranktüren, die er offen ließ? Sein Schnarchen? Seine Bierfahne? Die Nasenhaare? Mir fiel nichts Positives ein. Lautlos sagte ich zu mir selbst: »Mein Gott, Steffi, worüber denkst du nach? Das sind Bagatellen, unwichtiger Alltagskram, und so was beschäftigt dich? Was ist bloß aus dir geworden?«
Und da war er, der nächste Gedanke, der etwas in meinem Inneren auslöste. Ja, was war aus mir geworden? Eine frustrierte Frau um die fünfzig mit immer weiter abwärts sinkenden Mundwinkeln. War es zu spät, um die Richtung zu ändern? Nicht die der Mundwinkel, sondern die, in der mein Leben verlief, geradeaus, in einer Spur, ohne Kurven und Hügel. Wenn Tom weg wäre, dann …
Die nächste Runde ging auf mich.
»Und nun trinken wir auf Steffi!«, rief Elfie, als die Mädels die Gläser erhoben und mir zuprosteten. »Lobet die Herren!«
Das war mein Trinkspruch. Schlicht und ergreifend. Wie ich.
Auch meine Schwester hatte einen, den wir vor der nächsten Runde deklamierten: »Wir trinken nicht im Stadion, sondern mit der Marion!«
»Man sollte sich auch einen Luc anschaffen«, murmelte Marion mit einem Seitenblick auf Babette.
Die anderen kicherten.
Ich verstand mal wieder nichts. »Einen was?«
»Einen Lover under Cover, L U C – kurz Luc«, erklärte Marion.
»Um Himmels willen, wer will denn so was? Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe!«, entfuhr es mir.
Elfie verstand mich, wir ticken in der Hinsicht total gleich. Sie sagte: »Wisst ihr, was Walter neulich meinte? Er hätte lieber schwul werden sollen. Schwule hätten immer Lust auf Sex, da gäb’s keine Kopfschmerzen, Figurprobleme und andere Ausreden.«
Ich gab ihr recht. War doch klar, Männer eben, die wollen immer. Bei Tom war es insgesamt weniger geworden, aber aufhören würde es wohl nie. Allerdings benutzte ich ihm gegenüber keine Ausreden, ich ließ ihn sonntags machen. Dauerte ja nicht lange.
Wir hatten mal eine ernste Krise, nachdem ich herausgefunden habe, dass er fremdgegangen war. Zehn Jahre ist das jetzt her. Einer seiner Arbeitskollegen hat seinen Junggesellenabschied gefeiert, die Männer sind in der Altstadt um die Häuser gezogen und am Ende im Pascha gelandet. Zuerst habe ich das fremde Parfüm gerochen, als Tom nach Hause gekommen ist, dann habe ich es ihm angesehen. Er hat den Fehltritt sofort gestanden.
Ich war total fertig, konnte fast eine Woche lang kein einziges Wort mit ihm reden. Irgendwann haben wir uns zusammengesetzt, und Tom hat mir alles erklärt. Es wäre doch viel schlimmer gewesen, wenn er eine Affäre oder ein Verhältnis gehabt hätte. Dieser Ausrutscher war nur passiert, weil er es ohne Liebemachen mit mir nicht mehr ausgehalten hat. Und dass es nach einer Kneipentour im Pascha passiert war, war aus seiner Sicht eher ein später Jungenstreich als ein Verrat gewesen. Die Frau habe ihren Job gemacht, sie kannte Tom nicht, würde sich wahrscheinlich nie mehr an ihn erinnern, da waren keine Gefühle im Spiel gewesen.
Darüber habe ich damals lange nachgedacht. Wenn er mit einer Kollegin fremdgegangen wäre oder mit einer Nachbarin, dann wäre es wirklich Verrat gewesen, auch weil diejenige mich wahrscheinlich gekannt hätte. Und ich hätte mir eine Million Fragen gestellt: Wo hat er sie kennengelernt? Wo haben sie es getan? Bei ihr? Im Hotel? Draußen? Im Auto? In unserem Auto? Wer hat die Initiative ergriffen, hat er angefangen oder sie? War er Opfer oder Täter? War sie dicker als ich? Hatte sie weniger Falten? War er in sie verliebt? Aber Gott sei Dank war es »nur« ein Bordellbesuch gewesen. Dass er mit den Kollegen dorthin gegangen sei, habe bestimmt an den Hormonen gelegen, sagte Tom, und als er die ins Feld geführt hatte, begriff ich, was er meinte.
Meine Hormone haben mich mein ganzes Leben lang geärgert: Früher vor, während und nach meiner roten Welle und jetzt, in den Wechseljahren … reden wir nicht drüber. So oft wie in den letzten Jahren hatte ich jedenfalls noch nie meinen Moralischen. Früher war ich nicht so nah am Wasser gebaut, aber ich war schon damals ziemlich launisch. Und unfassbare Putzanfälle hatte ich, einmal im Monat, ganz regelmäßig. Daran waren auch die Hormone schuld. Diese Biester haben eine solche Macht! Bei Tom damals eben auch. Seitdem haben wir uns auf den Sonntag geeinigt, damit es ihm besser geht und so etwas nicht wieder vorkommt.
Ich konzentrierte mich wieder auf unsere Brauhausrunde. Babette gab jetzt einen aus.
»Nette Facette, brünette Babette: Prost!«, riefen wir.
Sie war gar nicht brünett, sondern schwarzhaarig, aber auf »Babette« reimten sich sonst nur Worte wie »Pinzette« oder »Toilette«, deswegen blieben wir, auch wegen des korrekten Versmaßes, bei diesem Trinkspruch.