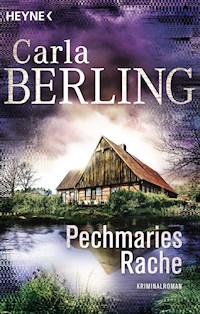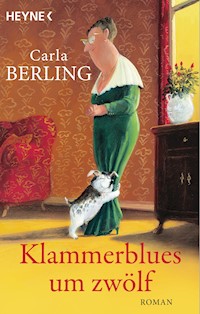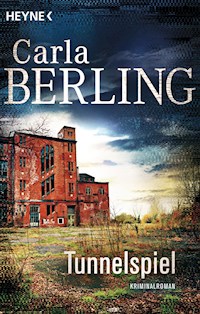9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Wittekind-Serie
- Sprache: Deutsch
Das Böse hat einen Namen: Morgenstern
Mitten in der beschaulichen Provinz kommt eine alte Dame auf grausame Weise ums Leben. Schnell findet Reporterin Ira Wittekind heraus, dass ihr Schicksal eng verknüpft war mit drei anderen Bewohnerinnen der Seniorenstiftung Morgenstern. Als Ira sie befragen will, benehmen sich alle drei äußerst merkwürdig. Ira wühlt in der Vergangenheit und deckt Stück für Stück eine lang zurückliegende Tragödie auf, die bis heute nachwirkt. Dann passiert ein zweiter Mord. Und schließlich ein dritter ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ZUM BUCH
Das Böse hat einen Namen: Morgenstern
Mitten in der beschaulichen Provinz kommt eine alte Dame auf grausame Weise ums Leben. Schnell findet Reporterin Ira Wittekind heraus, dass ihr Schicksal eng verknüpft war mit drei anderen Bewohnerinnen der Seniorenstiftung Morgenstern. Als Ira sie befragen will, benehmen sich alle drei äußerst merkwürdig. Ira wühlt in der Vergangenheit und deckt Stück für Stück eine lang zurückliegende Tragödie auf, die bis heute nachwirkt. Dann passiert ein zweiter Mord. Und schließlich ein dritter …
ZUR AUTORIN
Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als Lokalreporterin und Pressefotografin.
LIEFERBARE TITEL
Mordkapelle
Sonntags Tod
Carla Berling
Königstöchter
Kriminalroman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Vollständig überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 2014 by Carla Berling
Copyright © 2018 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda, Hamburg
Umschlaggestaltung © Bürosüd
Umschlagabbildungen © Arcangel/Ayal Ardon, GettyImages/Ventura Carmona, www.buerosued.de
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-19470-3V002
www.heyne.de
Für Martin
Prolog
Es ist hübsch. Geradezu liebevoll präsentiert.
Es wird mich natürlich umbringen, daran zweifle ich keine Sekunde. Ich weiß es. Hat diese Person tatsächlich geglaubt, dass ich sie nicht sehe? Dass ich nicht mitkriege, wenn sie sich in mein Zimmer schleicht? Lächerlich. Stellt mir fast lautlos dieses Ding hin, als Geschenk getarnt – wie durchschaubar das alles doch ist!
Von der Mutter hat dieses hinterhältige Stück so ein Verhalten nicht, das sind die Gene des Vaters.
Wer mag es verpackt haben?
Keine Ahnung, was dieser Mensch damit erreichen will. Das bisschen Zeit, das mir noch bleibt … Er müsste wissen, dass ich niemandem mehr gefährlich werden kann. Welcher perfide Plan steckt dahinter?
Ein Geschenk für mich, an ihrem Geburtstag. Der ihr letzter war. Geburt und Tod am selben Datum. Spielt keine Rolle. Kann man bedeutungsvoll interpretieren, ist aber Unsinn.
Natürlich war es Mord.
Ich hab diese unsägliche Person ja gesehen. Nicht den Mord, aber die Person habe ich gesehen. Es kann niemand anders gewesen sein. Aber mir glaubt keiner mehr. Verstehe ich auch. Sie müssen zusammenarbeiten, anders ist es nicht möglich. Haben sie etwa gehofft, dass ich das Zeug sofort saufe?
Geschenkt. Die ganze Selbstbeherrschung, zum Teufel noch mal, wozu denn? Um mir zu beweisen, dass ich auf den letzten Drücker doch noch was zustande kriege?
Ich höre sie auf meiner Beerdigung tratschen: Kurz vor dem Abkratzen war sie so unglaublich tapfer … hat nichts angerührt … hat auf ein Wunder gehofft … wollte die ganze Scheiße zum Stillstand bringen.
Ich hab das Ding tagelang nicht angepackt. Ich brauche keine Geschenke, jetzt nicht mehr, schon gar nicht von denen. Wann hab ich die Karte gelesen? War das gestern? Oder erst vorhin?
Es war eine steife Schrift, sie wurde natürlich verstellt, diese gestelzte Diktion, absichtlich krude formuliert, natürlich, um mich zu täuschen. Wie billig. Was haben sie sich dabei gedacht? Dass ich mit zitternden Fingern danach greife und es mir sofort an den Hals setze?
War wieder jemand hier, um zu sehen, ob ich es schon getan habe? Hab ich das wieder nicht mitgekriegt, haben sie einen der Momente erwischt, die ich vergesse? Habe ich die Verpackung selbst aufgerissen, oder wer war es?
Ist es Tag oder Nacht? Ich mag die Augen nicht öffnen. Jemand sitzt an meinem Bett, jemand streichelt meine Hand. Ich bin zu müde, um zu sehen, wer es ist.
Ein Gruß, allein und mit Genuss zu trinken.
Wie raffiniert. Das Schlüsselwort zu benutzen. Trinken. Trink ich? Trink ich nicht? Trink ich? Es ist Alpenbitter. 40 Kräuter, 29 Prozent.
Dieses Pochen im Kopf, mein Gott, wer soll das ertragen. Mir ist übel. Ich muss kotzen. Ich kann nicht, es ist doch gar nichts in meinem Magen.
Wessen Hand liegt da auf meinem Arm? Mein Arm zittert so. Wer hält ihn? Ich muss die Augen öffnen. Ich kann nicht.
Trink ich. Trink ich nicht. Tue ich es nicht, lebe ich ein paar Tage länger. Drauf geschissen.
Ein Gruß, allein und mit Genuss zu trinken.
Ich bin nicht allein. Irgendwer ist bei mir. Er ist es nicht, das spüre ich. Die Flasche steht rechts von mir. Mit einem Griff habe ich sie. Dafür reicht die Kraft. Das schaffe ich. Sie hat einen Schraubverschluss. Im Mund wird es bitter sein. Dann rinnt das Zeug durch die Kehle, scharf, würzig. Danach hört das Zittern auf, der Schmerz wird vergehen, das Verlangen auch. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß doch, was geschehen wird.
Ein Griff. Aufschrauben. Ansetzen. Noch einmal die Wärme spüren, bevor ich sterbe.
Einmal noch. Jetzt.
1
Es war Donnerstag, der 25. November, 11:38 Uhr. Bis vor einer Stunde hatte es geregnet, ein fieser, eisiger Nieselregen – dunkler Himmel, kalter Wind, nasses Laub auf den Straßen.
Ihr Auto hatte sie ein Stück entfernt parken müssen, rund um die Morgenstern-Stiftung waren die Straßen durch Polizeiwagen versperrt.
Die Kollegin von der Neuen Westfälischen kam ihr in der Mitte der Straße entgegen. Sie ging langsam, mit gesenktem Kopf, und ihre Schultern zuckten.
Ira kannte Nadine Saalfeld nur fröhlich und forsch, aber jetzt blieb die junge Kollegin zitternd vor ihr stehen und zerfetzte mit den Händen ein Papiertaschentuch. Spontan griff Ira nach ihrem Arm. Nadine blickte sie an, rang nach Worten, bekam aber keinen Ton heraus. In ihrem Gesicht stand das blanke Entsetzen.
»So schlimm?«, fragte Ira.
Nadine knüllte das zerfetzte Taschentuch zusammen und presste es vor ihren Mund. Sie nickte nur.
»Horstmann hat mich eben im Auto angerufen«, erklärte Ira. »Er hat gesagt, dass es einen Unfall mit einem Kehrwagen gab und eine Person tot ist. Sie wollen Fotos, Interviews, Stellungnahmen.«
Nadine räusperte sich, bevor sie sprach, ihre Stimme klang fremd und heiser. »Na denn … viel Spaß beim Fotografieren. Die Frau ist unter die Besen der Kehrmaschine geraten … Die Metallbürsten haben ihr das Fleisch von den Knochen gefegt … Sie hat noch gelebt … und sie hat den Fahrer des Wagens noch einmal angeschaut … Es ist so grauenhaft!« Nadine wischte sich mit dem Handrücken ein paar Tränen ab. »Ira, so was hab ich noch nie gesehen … und ich hab schon viel erlebt … Jetzt ist alles abgesperrt, aber eben konnte man noch sehen, wie sie die einzelnen Teile …« Nadine schüttelte den Kopf, verschloss den Mund mit dem Handballen, drückte mit der anderen Hand ihre Kameratasche vor den Bauch, als wolle sie sich daran festhalten, und ging weiter.
Ira schluckte. Sie hasste solche Einsätze. Und sie fürchtete sich vor dem, was sie hinter der Straßenecke erwartete.
Ich kann da nicht hingehen. Das will ich nicht sehen. Keine Fotos, nein, ich will keine Fotos machen. Ich kann nicht. Hoffentlich sieht man nichts von der Leiche. Von den Leichenteilen. Unter die Stahlbesen geraten. Lebendig. Oh mein Gott. Haben diese Fahrzeuge nicht so einen Auffangkorb? Die Leute, die sie bergen müssen … wie entsetzlich.
Einen Moment lang schloss sie die Augen, atmete tief ein, lockerte ihren roten Schal, nahm die Schultern zurück, straffte sich und ging entschlossen weiter.
Die dichten Koniferen im Park der Morgenstern-Stiftung hatten ihr die Sicht versperrt. Als sie um die Ecke bog, blickte sie unmittelbar in die Hölle.
Feuerwehrleute hielten dunkle Planen hoch, die Blutlache auf dem nassen Asphalt konnten sie jedoch nicht verbergen. Der wuchtige, orangefarbene Kehrwagen war mit hydraulischen Geräten angehoben worden.
Ira wusste, dass die Leiche hinter den Planen geborgen wurde. Sie versuchte sich nicht vorzustellen, wie jemand aussah, der vom Drecksauger der Kehrmaschine unter die rotierenden Bürsten gerissen worden war.
Das Führerhaus ragte über die Planen hinaus. Am Spiegel pendelte ein Duftbäumchen.
Der Fahrer. Der wird doch seines Lebens nicht mehr froh. Was ist hier geschehen? Hat er die Frau nicht gesehen? Natürlich nicht, er wird sie ja nicht absichtlich überfahren haben. Der hat sicher einen Schock, der kann nie wieder ruhig schlafen. Vermutlich wird er hier irgendwo versorgt.
Rettungswagen standen halb auf dem Bürgersteig. Männer in Uniformen saßen in der Hocke, den Kopf gesenkt, ihre Schultern vorgebeugt. Feuerwehrleute, Sanitäter, Polizisten. Ein junger Mann lehnte am Zaun und weinte.
Entsetzte Gesichter. Und diese Stille. Niemand sagte etwas. Das Blaulicht der Rettungswagen klickte.
Klick. Klick. Klick.
Wie kann es hier so still sein, obwohl so viele Leute da sind?
Ein Polizist kam mit fragendem Blick auf Ira zu. Sie nestelte ihren Presseausweis aus der Jackentasche und zeigte ihn vor. Der Polizist flüsterte: »Okay. Gehen Sie bitte rüber zu Ihren Kollegen.«
Ira nickte. Sie sah sich um, während sie die Straße überquerte. Im Tor der Morgenstern-Stiftung standen Leute, die Augen weit aufgerissen vor Entsetzen, die Hände vor dem Mund, als wollten sie ihre Schreie zurückhalten. Über ihnen, im Torbogen, das Logo der Stiftung: ein vergoldetes, metergroßes, vierblättriges Kleeblatt.
Das ist heute kein Glücksbringer, dachte Ira.
Auf dem Rasen südlich des Kirchturms standen sie in Habachtstellung: Kamerateams, Fotografen mit armlangen Objektiven, am Übertragungswagen des Regionalfernsehens lehnten Reporter mit Mikrofonen. Auch dort: Stille.
Ira ging hinüber und reihte sich wortlos in die wartende Gruppe ein.
Als hinter den Planen plötzlich jemand laut stöhnte, kam für Sekunden Bewegung in die Szenerie. Auch Ira riss automatisch ihre Nikon hoch und knipste blind drauflos. Nur mit Mühe gelang es ihr, die Kamera mit ausgestreckten Armen über ihrem Kopf ruhig zu halten.
Offenbar war hinter der Plane jemandem schlecht geworden. Ein Mann taumelte an den Zaun, klammerte sich an den eisernen Stäben fest und kotzte gegen die Koniferen.
Jemand eilte herbei und kümmerte sich um ihn.
Wie mag die Tote aussehen? Lieber Gott, nein, schick mir keine Bilder, die werde ich nie wieder los. Wie konnte das passieren? Es riecht nach nassem Laub. Und nach Blut? Riecht es wirklich nach Blut, oder bilde ich mir das ein? Ich halte das nicht aus. Scheiße, seit über zwanzig Jahren mache ich diesen Job, aber so was braucht kein Mensch. Verdammt, warum haben sie mich angerufen und nicht irgendeinen Kollegen? Tief durchatmen. Ich mache meine Arbeit und dann haue ich hier ab. Ich will das nicht sehen, ich will nicht. Wenn nachher der Pressebericht der Polizei kommt, werde ich wissen, was passiert ist. Wer ist die Frau, deren Teile da drüben aufgesammelt werden? Hat sie Familie? Einen Mann? Kinder? Eltern? Wie geht man denn damit um, wenn einem jemand sagt, deine Mutter oder deine Frau oder deine Oma ist von einer Kehrmaschine zerfetzt worden. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Für die Angehörigen ist nichts mehr, wie es heute Morgen noch war. Und für den Fahrer des Kehrwagens auch nicht. Ich mach jetzt ein paar Bilder von der anderen Seite, und dann hau ich hier ab. Mehr kann man nicht von mir verlangen.
Zitternd tauschte Ira das Weitwinkelobjektiv gegen das Tele. Beinahe wäre sie auf dem nassen Gras ausgerutscht. Sie fokussierte, knipste, stolperte, lief weiter, fotografierte die Absperrungen, den sichtbaren Teil des aufgebockten Kehrwagens, Polizisten, Sanitäter, Leute vom Technischen Hilfswerk, Feuerwehrmänner.
Als sie plötzlich durch einen Spalt zwischen den Planen die Rücken einiger Männer erspähte, unterdrückte sie einen Aufschrei und drehte den Kopf weg. Bloß nicht hingucken.
Ira hastete dicht an den Mauern der Kirche vorbei und lief bis zum Parkplatz vor dem Portal, auf dem sich nun etliche Schaulustige drängten und mit ihren Handys filmten und Fotos schossen.
Jemand sagte: »Siehste, die Geier vonne Presse sin auch schon da!«
Sie drehte sich um, ganz langsam. Ein älterer Mann in einer grauen Windjacke schaute sie herausfordernd an. Ira ging wie in Zeitlupe auf ihn zu, sah in seine geröteten Augen, kam ihm so nah, dass sie seinen schlechten Atem riechen konnte. Er wich einen Schritt zurück, Ira folgte ihm, sah im Augenwinkel, dass die Umstehenden gafften. Sie sprach leise, aber betont deutlich: »Ich bin nicht freiwillig hier, das können Sie mir glauben. Ich mache meine Arbeit. Und Sie? Sie sind doch wohl freiwillig hergekommen. Warum? Was tun Sie hier? Kam nichts im Fernsehen?«
Der Mann schnappte nach Luft.
Ira ließ ihn stehen, drehte sich um, zischte »Arschloch« und überquerte die Straße.
Vor dem Eingang der Goldschmiede stellte sie sich auf eine Bank. Einatmen, ausatmen, ganz ruhig. Es ist dein Job. Nicht weglaufen, bring es zu Ende.
Die erhöhte Perspektive war gut, sie schoss noch ein paar Querformate. Klar, dass die Redaktion diesen Artikel als Aufmacher bringen würde und dafür mindestens ein dreispaltiges Foto brauchte. Dann packte sie die Kamera in die Tasche.
Als sie aufsah, entdeckte sie Kommissar Brück. Er stand keine zehn Meter entfernt vor der Tür der Apotheke und telefonierte. Ira hatte ihn und seinen Kollegen Rondorf letztes Jahr bei einer Nachtschicht begleitet. Die geplante Reportage, die von der Routinearbeit der Polizei handeln sollte, hatte Ira in eine grauenhafte Tragödie verstrickt. Sie war dabei gewesen, als die Polizei eine halb verweste Leiche in einer Messie-Wohnung gefunden hatte – und hatte plötzlich mittendrin gesteckt in einem Mordfall, an dessen Aufklärung sie maßgeblich beteiligt war und der schließlich ihr ganzes Leben verändert hatte.
Kommissar Brück klappte sein Handy zu. Sein graues Gesicht wirkte versteinert. Er war groß und kantig, ging etwas gebückt, vielleicht, um seine Größe zu kaschieren. Brück trug einen Mantel mit ausgepolsterten Schultern, der seine Statur noch breiter wirken ließ. Sein blondes Haar wurde an den Schläfen grau, der Bart glich farblich dem Fell eines Yorkshire-Terriers. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn, die von tiefen Querfalten durchzogen war.
Nun erkannte er Ira und kam auf sie zu. »Frau Wittekind, herrje, haben Sie wieder die Arschkarte gezogen und müssen über diese Sauerei berichten?« Er zeigte mit einer Geste hinüber zum Haus Morgenstern.
»Das ist einfach grauenhaft! Wissen Sie schon Näheres?«
»Nein, Sie müssen den Pressebericht abwarten, hier ist überhaupt noch nichts geklärt. Sie sehen ja, auch die Kollegen und die Sanitäter stehen unter Schock.«
Ira warf einen Blick hinüber. Der Mann, der in die Koniferen gekotzt hatte, lehnte bibbernd am Zaun. Er war kreidebleich.
»Wissen Sie, wer die Frau war?« Ira bemerkte, wie schnell man von einem Menschen in der Vergangenheit sprach. Vor einer Stunde hatte die Frau noch gelebt, geatmet, gedacht, geredet, vielleicht sogar gelacht. Jetzt war sie tot.
Brück schüttelte den Kopf. »Mutmaßlich eine Bewohnerin der Morgenstern-Stiftung, aber mehr kann ich Ihnen jetzt natürlich noch nicht sagen.«
Sie gingen schweigend ein paar Schritte auf den Unfallort zu. Dann blieb Ira unschlüssig stehen. Sie wusste, dass sie jetzt keine weiteren Informationen mehr bekommen würde.
Brück und Ira zuckten zusammen, als plötzlich die Glocken der Kirche zu läuten begannen. Laut. Energisch.
»Was ist das denn?«
»Zwölf Uhr«, antwortete Brück und schaute dabei auf seine Armbanduhr.
»Wie makaber!« Ira sah zum Glockenturm hinauf, dann fiel ihr Blick auf einen der Rettungswagen. Die Türen standen offen. Eine zierliche grauhaarige Frau saß darin, in Decken gehüllt, neben ihr ein Gestell, an dem ein Tropf hing. Ira sah den Kommissar erstaunt an. »Ist das da drinnen eine Zeugin? War sie bei dem Unglück dabei? Hat sie das etwa mitbekommen?«
Brück nickte.
Ira kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. »Sagen Sie mal, ist das Tilly Jacobsen? Kino-Tilly?«
»Kennen Sie sie?«
»Ja, klar. Wer kennt sie nicht? Ich war letztes Jahr bei ihr zu Hause und habe ein Porträt für Tag 7 geschrieben, als sie fünfundsiebzig wurde.«
Der Kommissar hob die Augenbrauen. Dabei vertieften sich seine Stirnfalten wie bei einem chinesischen Faltenhund. »Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, mit ihr reden zu wollen. Erstens wird sie noch medizinisch betreut, die ist natürlich völlig durch den Wind, und zweitens sind wir zuerst dran.«
Ira schnitt eine Grimasse. »Das ist mir klar. Ich muss sowieso los. Wann können wir mit dem Pressebericht rechnen?«
Brück schnaubte und sah sie an, als habe sie etwas Anzügliches gesagt.
»Schon gut.«
Ira verabschiedete sich und überlegte dann, was sie als Nächstes tun konnte. Erst mal tief durchatmen, den Gedanken an die Szenerie hinter den Planen verdrängen und in den Reportermodus schalten. Sie brauchte Bilder. Und Zeugenaussagen. Vielleicht hatte jemand im Haus Morgenstern etwas gesehen. Schließlich hatte Brück gesagt, dass es sich bei der Toten vermutlich um eine Bewohnerin der Stiftung handelte. In jedem Fall konnte Ira aktuelle Fotos des Gebäudes gebrauchen, am besten aus anderen Blickwinkeln als denen der Kollegen, die an der Kirche standen und auf ihr Sensationsfoto warteten. Bilder der Leiche würde allerdings keiner ins Blatt heben – kaum eine Tageszeitung brachte Fotos von Leichen, schon gar nicht von Teilen einer Leiche.
Sie ging betont langsam Richtung Bahnhofstraße, um niemanden auf sich aufmerksam zu machen, bog rechts ab, begann jetzt zu laufen, stoppte, stand nun auf der Rückseite der Stiftung, schaute rechts, links, nein, es war tatsächlich niemand da. Schwein gehabt. Kaum zu glauben, dass noch kein Kollege von den anderen Zeitungen oder vom Fernsehen den Hintereingang gesucht hatte. Ira überquerte den Parkplatz, der hinter einer niedrigen Mauer und immergrünem Gebüsch von der Straße aus kaum zu sehen war. Sie schoss ein paar Querformate vom Haus, packte die Nikon samt Weitwinkelobjektiv dann ein und schob die Kameratasche auf den Rücken, um nicht sofort als Reporterin erkannt zu werden, falls ihr jemand begegnete. In der rechten Jackentasche steckte ihr iPhone. Falls sie spontan ein Motiv fand, war dessen Kamera sofort startklar.
Sie ging ein paar Meter an den Säulen der Terrasse entlang, die sich über die gesamte Südseite des Hauses erstreckte, stieg dann die Stufen zum Wintergarten hinauf – und hatte Glück: Die Tür war unverschlossen.
Ira kannte das Gebäude, sie hatte im August über das Sommerfest berichtet und für ihre wöchentliche Kolumne »Ein Tee mit Frau W.« eine Bewohnerin interviewt. Sie kannte auch den Weg durch Lesesaal und Bibliothek ins Foyer. Niemand begegnete ihr.
In der imposanten Halle hingegen schienen sich alle Bewohner und das gesamte Personal versammelt zu haben. Ira schaute auf Rücken, Hinterköpfe, gereckte Hälse, Leute, die durch die bodentiefen Fenster einen Blick auf das grausige Geschehen draußen zu erhaschen versuchten.
Hinter dem Tresen des Empfangs, unter einem feudalen Art-déco-Leuchter, stand Philipp Holle, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Mit leiser Stimme und ruhigen Bewegungen gab er zwei Frauen in weißen Kitteln Anweisungen.
Ira drängelte sich zwischen Rollstühlen, Kinderwagen und Menschen hindurch. Die riesigen Flügel der antiken Eingangstür gaben den Blick auf den Weg zur Straße frei. Auch hier standen Bewohner und Angestellte und starrten hinüber zum Unglücksort.
Sie wartete, bis Philipp Holle sich ihr zuwandte. Er erkannte sie offenbar nicht, sah sie fragend an.
Ira streckte ihm die Hand hin. »Ira Wittekind von Tag 7. Wir haben uns im Sommer bei einer Reportage über Ihr Sommerfest kennengelernt.«
Holle knipste das charmante Lächeln an, das Ira schon von der letzten Begegnung kannte. »Ich habe jetzt leider überhaupt keine Zeit, Sie sehen ja, drüben steht das Fernsehen, sogar der WDR ist da, die Bildzeitung hat angefragt, wann die Leiche … also ich meine, wann die Frau Klabunde … oder besser das, was noch …«
Ira registrierte den Namen sofort und fiel ihm ins Wort: »Selbstverständlich, Herr Holle, die Kollegen warten draußen auf Sie, und ich möchte Sie auch gar nicht lange aufhalten. Eben habe ich mit dem zuständigen Kommissar gesprochen, und genau deswegen bin ich jetzt hier.«
Holle runzelte die Stirn. »Ach so?«
Ira ließ ihn nicht nachdenken und bluffte: »Ja, ich brauche bitte von Ihnen die Bestätigung, dass es sich bei der Verunglückten um Frau Klabunde – wie war der Vorname? Tilly?«
»Nein, Maria.«
»Natürlich, ich hab in der Aufregung verwechselt, dass es sich um Maria Klabunde handelt und dass Tilly Jacobsen Zeugin des Unglücks war. Frau Jacobsen ist mit Ihnen zusammen im Vorstand der Stiftung, richtig?«
Holle nickte eifrig. »Ja, Frau Dr. Deppendorf, Frau Jacobsen, meine Mutter und ich bilden den Vorstand.« Dabei spähte er zur Tür, als habe er Angst, seinen Auftritt verpassen zu können.
»Und wegen der Verunglückten hat man mich korrekt informiert, Frau Klabunde gehörte zum Haus Morgenstern?«
»Ja, sie ist eine Bewohnerin.«
»Wissen Sie, wie alt sie war?«
»Nein, Ende siebzig, glaube ich.«
»Das war’s schon, vielen Dank! Wenn Sie später oder morgen Zeit für ein Interview mit Fotos hätten, würde ich Sie gern in Ruhe sprechen. Wäre das für Sie in Ordnung?«
Philipp Holle nickte, griff in die Brusttasche seines Anzugs und gab ihr eine lackschwarze Visitenkarte. »Handynummer steht unten rechts.«
Ira warf einen flüchtigen Blick auf die goldene Schrift und steckte die Karte ein. »Ich gehe hinten raus und melde mich bei Ihnen per SMS wegen der Uhrzeit für unser Gespräch. Vielen Dank.«
Holle wandte sich wieder seinen Mitarbeitern zu.
Ira verließ die Stiftung auf demselben Weg, den sie gekommen war. Draußen wählte sie sofort die Nummer des Redaktionsleiters. »Horstmann? Die Tote heißt Maria Klabunde, aber das müssen wir natürlich abkürzen mit Maria K. Sie war Bewohnerin der Morgenstern-Stiftung. Es gibt vielleicht eine Zeugin: Tilly Jacobsen wurde im Krankenwagen versorgt, warum, weiß ich noch nicht, aber ich versuche mit ihr zu reden. Ja, Kino-Tilly, genau die. Das habe ich bis jetzt exklusiv, ja, die Kollegen sind alle direkt am Unfallort, ich vermute, sie warten auf den Leichenwagen. Ich schicke Ihnen gleich Fotos, Artikel folgt zeitnah.« Sie wartete die Antwort ab und sah auf ihre Armbanduhr. »Fünfzehn Uhr schaffe ich.«
Ira lief zu ihrem Mini Cooper und wurde stürmisch von Tante Erna begrüßt, die auf dem Rücksitz schlafend auf sie gewartet hatte. Die schwarze Königspudeldame sprang graziös aus dem Wagen, pinkelte vor die Mauer einer vornehmen Anwaltskanzlei und setzte sich, nachdem sie sich ihre Streicheleinheiten abgeholt hatte, wieder auf ihren Platz.
Ira rief Andy an. »Liebling, ich komme doch wieder zurück nach Eskendor. Nein, ich bin nicht in Bielefeld. Horstmann aus der Redaktion hat mich angerufen, kurz bevor ich auf die Autobahn fahren wollte. Es ist etwas Schreckliches passiert, und ich muss in Oeynhausen bleiben und arbeiten. Ist in deinem Bett heute noch mal Platz für zwei?«
Sie hörte die Antwort, lächelte und legte auf.
2
Ira parkte den gelben Mini Cooper neben Andy Weyers Lieferwagen. Sie ließ Tante Erna aussteigen, die sich sofort unter einer der Eschen in die Hocke setzte, pieselte und dann ein paar Runden auf der Wiese vor der alten Kate drehte. Angesichts der offensichtlichen Lebensfreude des Tieres musste Ira unwillkürlich lächeln.
Drüben im Hofladen brannte Licht. Hinter den Sprossenfenstern, in deren hölzernen Blumenkästen winterfestes Grünzeug wuchs, arbeiteten Thomas und seine Frau Gundis.
Wenn man Andy und Thomas nebeneinander sah, konnte man kaum glauben, dass sie Brüder waren. Andy, immerhin knapp eins neunzig groß, mit Bauchansatz, wirkte neben dem fünf Jahre jüngeren Thomas wie ein Spargeltarzan. Andy hatte graublondes Haar, etwas schütter, etwas zu lang, und graublaue Augen. Er trug meist Jeans, T-Shirts und Lederjacke. An Thomas fielen zuerst die leuchtend roten Wangen in seinem flächigen Gesicht auf, seine Frisur bestand aus einem spärlichen, kreisförmigen Rest dunkler Stoppeln. »Tennisplatz mit Waldumrandung« nannte er seine Frisur. Ira hatte ihn noch nie ohne seine braunen Cordhosen mit den breiten Hosenträgern gesehen, wahrscheinlich besaß er zehn Mal dasselbe Modell. Und während Andy ruhig und verschmitzt wirkte, war Thomas das Paradebeispiel eines ostwestfälischen »Muffelkopps« mit Hang zu cholerischen Ausbrüchen. Die kämen vom Blutdruck, erklärte Gundis stets entschuldigend. Thomas hatte sein Leben auf Hof Eskendor verbracht, und mit Gundis hatte er die perfekte Partnerin mit derselben Liebe zur Natur gefunden. Die beiden hatten im Hofladen gut zu tun, ihre Kunden kamen sogar aus Bielefeld und Bückeburg, um hier Bioprodukte zu kaufen.
Kaum zu glauben, dass in diesem Haus früher Schweine gehaust hatten. Hof Eskendor, über viele Generationen ein traditioneller westfälischer Betrieb mit Vieh- und Felderwirtschaft, sah nur noch auf den ersten Blick wie ein klassisches Gehöft aus. Scheune, Haupthaus, Remise, die alte Kate – alle anderen Gebäude auf Hof Eskendor waren zu modernen Wohnungen umgebaut worden, nachdem Andys Mutter Elsa nach dem tragischen Tod ihres Mannes alles geerbt hatte.
Ira war gegenüber aufgewachsen. Über die Mauer, die den Hof umgab, konnte sie als Kind nur schauen, wenn jemand ihr eine Räuberleiter hielt, heute reichten ihr die roten Klinker kaum bis zur Brust. Sie hatte fast jeden Abend mit der Blechkanne rübergehen und zwei Liter Milch kaufen müssen. Dicker Schmand hatte sich darauf gebildet, wenn die Milch kalt wurde, und Iras Mutter hatte sie im Sommer in bunten Plastikschälchen auf die Fensterbank in der Küche gestellt, damit sie sich über Nacht in köstliche Dickmilch verwandelten konnte.
Ira schaute zum ehemaligen Kuhstall hinüber. Früher musste man durch die dustere Deele gehen, in der Gerümpel und Geräte herumstanden. An Sensen, Spaten und Forken, Eimer, Futtersäcke und alte Schubkarren erinnerte sie sich und an die alte Oma Weyer, wenn sie die Emaillekelle in ihren knorrigen Händen gehalten und Iras Milchkanne gefüllt hatte. Dabei hatte sie gelächelt und ihren einzigen Zahn, den Kuchenzahn, gezeigt. Wenn sie gesprochen hatte, kam aus ihrem Mund ostwestfälisches Plattdeutsch, von dem Ira kaum ein Wort verstanden hatte. Heute erinnerte nichts mehr an die dunkle Deele und den stinkenden Kuhstall.
Ira pfiff die Hündin bei Fuß, schloss ihr Auto ab und ging zur Haustür. In ihrer Kindheit hatte ein alter Ackergaul seinen Kopf durch den oberen Teil einer maroden grünen Holztür gesteckt, von der die Farbe abblätterte. Die neue Tür war weiß, mit einer Drahtglasscheibe in Form eines Bullauges und einem langen Griff aus mattem Metall.
Andy stand im Türrahmen. Groß, breitschultrig und mit diesem besonderen Lächeln. Vertraut.
War es erst ein knappes Jahr her, dass Ira in Köln ihre Zelte abgebrochen hatte und in ihre Heimat Ostwestfalen zurückgekehrt war? Nicht hierher nach Rehme, nein, im Dorf ihrer Kindheit hatte sie nicht mehr leben wollen. Sie war nach Bielefeld in eine Wohnung am Johannisberg gezogen.
Als sie kurz nach ihrer Rückkehr in den grausamen Fall mit der verwesten Leiche verwickelt worden war, war sie Andy Weyer, ihrem Kumpel aus Kindertagen, wieder begegnet. Ausgerechnet bei einem Begräbnis hatte er plötzlich vor ihr gestanden …
Ira schüttelte sich, sie wollte nicht an die brutalen Tragödien denken. Für sie war letztlich alles gut ausgegangen, sie hatte eine Liebe gefunden, an die sie längst nicht mehr geglaubt hatte.
Andy strich ihr übers Haar, gab ihr einen Kuss auf den Mund, tätschelte Tante Erna den Kopf und nahm Ira die Kameratasche ab.
»Du hast ja ein Glück, wenn es um die Verteilung der richtig harten Jobs geht«, sagte er, nachdem sie ihm von dem Unglück vor der Morgenstern-Stiftung erzählt hatte.
»An solchen Tagen hasse ich meinen Beruf.«
Ira überspielte die Fotos von der Kamera auf ihr MacBook und wählte aus den über hundert Bildern, die sie geschossen hatte, drei aus, die scharf genug waren und die zugleich die lähmende Stimmung am Unfallort wiedergaben. Sie formulierte die Unterzeilen und schrieb zweihundert Zeilen Text.
Andy bereitete in der Küche irgendwas für das Catering einer Hochzeitsfeier vor, kam aber ab und zu an den Tisch und schaute ihr über die Schulter. Er atmete scharf ein, als er eine der Nahaufnahmen betrachtete. »Das ist ja grässlich, obwohl man gar keine Details erkennt. Weiß man, wer die Tote ist?«
»Ja. Ich habe Holle, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, kurz befragen können. Die Frau heißt Maria Klabunde, war Ende siebzig und wohnte im Haus Morgenstern. Morgen kann ich mich ausführlicher mit ihm unterhalten. Aber ich fahre heute Abend noch mal hin. Es gibt nämlich vielleicht eine Augenzeugin, die ich kenne, und du kennst sie auch, und es würde mich wundern, wenn sie nicht mit mir spricht. Mit Kino-Tilly bin ich so«, sagte Ira und hielt Andy ihre Hand mit gekreuztem Zeige- und Mittelfinger hin. »Weißt du noch? Ich habe sie doch letztes Jahr ausführlich interviewt. Und danach waren wir sogar noch einige Male Kaffee trinken.«
»Und die wohnt im Haus Morgenstern?«
»Nein, sie wohnt in einer traumhaften Villa am Augustaplatz, aber sie hat in der Stiftung ein Büro. An einem der beiden Orte werde ich sie bestimmt antreffen.«
Es gab wohl nur wenige Menschen in Bad Oeynhausen, die Tilly Jacobsen, genannt Kino-Tilly, nicht kannten: Mitte der Fünfzigerjahre hatte sie das heruntergewirtschaftete Kino ihres ersten Mannes übernommen. Gernot Grote hatte die »Badestädter Lichtspiele« von seinem Vater geerbt, sich aber mehr um seine Liebschaften, um Tennis, Golf und »Badekuren« gekümmert. Das Kino war so gut wie pleite gewesen. Tilly hatte die Insolvenz abgewendet, indem sie es ihm abkaufte. Aus dem »Puschenkino« wurde die Kette »Grote-Kinos«, den Namen behielt Tilly auch nach ihrer zweiten Heirat bei. Fünfunddreißig Jahre lang saß sie fast jeden Abend höchstpersönlich im Kassenhäuschen des »Mutterkinos«, und kaum ein Oeynhausener Filmfan erinnerte sich nicht an die sportliche, immer gut gelaunte Tilly.
Die Mail mit der Pressemeldung der Polizei kam am späten Nachmittag. Ira las sie laut vor:
»Gegen 10:30 Uhr wurde über den Notruf 110 die Einsatzleitstelle der Polizei über einen schweren Verkehrsunfall informiert. Nach Angaben des Anrufers soll eine Person unter eine Kehrmaschine geraten und dort eingeklemmt worden sein. Gleichzeitig mit der Information an die Polizei erging eine Meldung an die Feuerwehr, die sofort einen Notarzt, ein Rettungswagenteam und einen Rüstwagen an die Unfallstelle schickte. An der Unfallstelle konnte nur noch der Tod der achtundsiebzigjährigen Frau festgestellt werden. Mithilfe des Rüstwagens wurde die Verstorbene geborgen und in die Rechtsmedizin gefahren.«
»Was ist das, ein Rüstwagen?«, fragte Andy.
»Ein Fahrzeug mit besonderem Werkzeug und Spezialgeräten. Damit kann die Feuerwehr Personen nach Verkehrsunfällen aus ihren Autos befreien, umweltschädigende Substanzen auffangen, Einsatzstellen ausleuchten, so was in der Art.« Sie las weiter vor. »Während der Unfallaufnahme musste die Straße vollständig gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache und zur Überprüfung des Fahrzeugs hinzugezogen. Der fünfundfünfzigjährige Fahrer der Kehrmaschine erlitt einen Schock und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.«
Wie es dem Fahrer ging, mochte Ira sich gar nicht ausmalen. War er schuld am Tod der Frau? Hatte er nicht aufgepasst? Wie lebte man mit dem Wissen, dass man so etwas vielleicht hätte vermeiden können?
Sie fuhr fort: »Bei der Benachrichtigung der Angehörigen wurden die Polizisten von einem Notfallseelsorger begleitet.« Ira schaute auf. »Wie findet man die richtigen Worte, um jemandem so etwas mitzuteilen? Die Polizisten werden in solchen Dingen geschult. Aber trotzdem kann man in einer solchen Situation nicht richtig handeln, oder?«
Andy zuckte mit den Schultern. »Als Angehöriger kriegst du das gar nicht richtig mit. Einerseits brennen sich die Worte der Hiobsbotschaft für immer in dein Gedächtnis ein, andererseits verstehst du den Sinn solcher Worte zuerst gar nicht. Besser gesagt: Du verstehst sie, willst sie aber nicht begreifen. Das ist so, als würdest du einen Film sehen, in dem du die Hauptrolle spielst.«
Ira wusste, dass er jetzt an seinen toten Vater, seinen Neffen und seinen Bruder dachte. Eigentlich verging kein Tag, an dem sie nicht irgendwie an das Drama erinnert wurden, das sie und Andy aber letztlich zusammengeschweißt hatte. Ira dachte an früher, an die Zeit, als sie Kinder waren. Die vier Weyer-Brüder Andy, Markus, Thomas und Michel lebten gegenüber, und sie waren so unterschiedlich, wie Menschen nur sein konnten. Michel war tot, und es war Ira zu verdanken gewesen, dass man herausgefunden hatte, wie er gestorben war. Markus war danach weggezogen, er telefonierte ab und zu mit seiner Mutter, hielt sich aber vom Familienleben fern.
Sie wandte sich wieder der E-Mail zu. »Über den Unfallhergang können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern noch an. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat die Situation beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer sowieso entgegen.«
»Ich denke, Kino-Tilly war Zeugin«, sagte Andy. »Reicht das nicht?«
»Schaden kann es nicht, wenn man mehrere Augenzeugen hat. Und keine Ahnung, ob die anderen Reporter Tilly gesehen haben oder mit ihr sprechen konnten. Ich hoffe nicht. Deswegen will ich so schnell wie möglich zu ihr, bevor mir jemand zuvorkommt. Tante Erna lass ich dir hier, damit du was zu tun hast.«
Andy schnappte sich einen Zuckerwürfel aus der Schale und warf ihn lachend nach Ira. »Blöde Kuh. Ich hab genug zu tun, ich mache das Catering für eine Hochzeit in Bergkirchen, und zwar für dreihundert Leute. Glaubst, du, ich verdiene mein Geld im Schlaf?«
Ira ergänzte ihren Artikel um die Infos aus der Pressemeldung und mailte ihn, zusammen mit den Fotos und den Bildunterzeilen, in die Redaktion.
Horstmann rief schon wenige Minuten später an. »Frau Wittekind, bleiben Sie dran. Das Ding geht durch alle Medien, und ich möchte, dass wir exklusiv darüber …«
Ira unterbrach ihn: »Bin so gut wie unterwegs, um sofort mit Kino-Tilly zu sprechen, bevor die Kollegen sie sich schnappen.«
Die Unfallstelle war inzwischen geräumt worden, die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Dieses Mal benutzte Ira den Haupteingang der Morgenstern-Stiftung. Sie marschierte auf die Rezeption zu. Eine weiß gekleidete, junge Frau mit schwarz gefärbten Haaren und einem Nasenring stand hinter dem Tresen. Ihr Namensschild wies sie als Josie Falldorf aus.
»Guten Tag, ich bin Ira Wittekind, würden Sie Frau Jacobsen bitte Bescheid sagen, dass ich hier bin und sie sprechen möchte?«
»Tut mir leid, hier ist heute … etwas Schlimmes passiert … und … es geht Frau Jacobsen nicht gut«, sagte Josie Falldorf.
»Das verstehe ich, aber deswegen bin ich hier. Die Kollegen vom Fernsehen und von den anderen Zeitungen werden ihr keine Ruhe lassen. Sie kennt mich, wir hatten schon oft beruflich und auch privat miteinander zu tun. Bitte sagen Sie ihr, sie muss unbedingt erst mit mir sprechen, bevor sie in die Fänge der Kollegen gerät, die reißerisch und unseriös über das Unglück berichten werden.«
Josie Falldorf schüttelte energisch den Kopf, aber Ira ließ sich nicht abwimmeln. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und hielt es demonstrativ hoch. »Bitte rufen Sie Frau Jacobsen an, und fragen Sie, ob sie mit mir reden möchte, ansonsten mache ich das selbst, ich habe ihre Durchwahl und auch die Mobilnummer.«
Widerwillig griff Josie Falldorf zum Telefonhörer, wählte und sah Ira dabei feindselig an. »Hier ist eine Frau von der Zeitung … ja, ich habe ihr gesagt, dass Sie nicht zu sprechen sind.«
Ira rief: »Sagen Sie ihr, dass Ira Wittekind hier ist und dass es nicht lange dauern wird.«
Die junge Rezeptionistin schwieg einen Moment, während sie das Telefon ans Ohr presste, dann legte sie auf und wies Ira mit einem knappen Kopfnicken an, ihr zu folgen.
Josie Falldorf führte Ira zu Tillys Büro, klopfte, lauschte und öffnete die Tür, nachdem von drinnen ein leises »Herein« zu hören war.
Ira verschlug es fast den Atem, als sie den überheizten Raum betrat. Hier sah es aus wie in einem altmodischen Wohnzimmer, nicht wie in einem Büro. Durch hohe Sprossenfenster schaute man in einen Teil des beleuchteten Parks. Exakt in der Mitte der mit Kordeln gerafften Damastvorhänge leuchtete in jedem Fenster eine Tiffany-Lampe. Auf altrosa Auslegeware standen helle Chippendale-Möbel mit schimmernden Chintzbezügen, die Schirme der Wandlampen waren aus demselben Stoff wie die Vorhänge. Vor dem mittleren Fester stand ein Schreibtisch, symmetrisch ausgerichtet, der Stuhl dahinter war jedoch leer.
Tilly Jacobsen saß in einem Ohrensessel in der dunkleren Ecke des Zimmers. »Sie sind mir nicht böse, wenn ich sitzen bleibe?« Ihre Stimme klang müde und brüchig.
Ira setzte sich auf einen Stuhl neben der alten Frau und nahm ihre Hand. »Es ist entsetzlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe Sie vorhin zufällig im Krankenwagen gesehen. Geht es Ihnen besser? Hoffentlich haben Sie das nicht mit ansehen müssen.«
Tilly Jacobsen starrte Ira wortlos an, als habe sie den Satz gar nicht verstanden.
Sie war vor drei Wochen sechsundsiebzig geworden. Normalerweise sah sie mindestens zehn Jahre jünger aus, aber heute wirkte sie wie eine Greisin. Ihre Lider waren geschwollen und wund vom Weinen, die sonst rosigen Wangen bleich, die Lippen farblos, ihre Bewegungen wirkten wie in Zeitlupe. Die Jeans, die bunten Sneakers und das Shirt unter dem Lederblazer ließen sie heute verkleidet wirken.
»Wenn Sie lieber nicht darüber reden möchten, lassen wir es. Ich will Sie nicht quälen«, sagte Ira.
Tillys Blick gab nichts preis. Sie zog ihre Hand weg und zeigte auf ein gerahmtes Foto an der Wand. Ira stand auf und sah sich das Bild an.
Vier Frauen. Eine ältere Aufnahme, wie an den Frisuren und der Kleidung zu erkennen war, vielleicht aus den Siebzigern. Die Gesichter sagten Ira nichts, bis auf das zweite von links. Das glatte Haar schulterlang und aschblond, nicht kurz und silbergrau wie heute, aber die braunen Augen erkannte Ira sofort.
Sie wandte sich an Tilly: »Sind Sie das?«
»Ja. Es entstand, als wir die Stiftung gegründet haben.« Sie machte eine kurze Pause. »Die rechte Frau im Bild ist Maria.«
Ira verstand sofort. Die Tote unter der Kehrmaschine, die zerfetzte Leiche, die heute Morgen auf der Straße geborgen werden musste. Jetzt hatte sie ein Gesicht.
Maria Klabunde hatte also einmal kinnlange dunkle Locken und ein etwas dralles Gesicht gehabt. Schon damals trug sie eine Brille, und sie war offensichtlich kleiner als die drei anderen Frauen gewesen. Auf dem Foto lächelte sie, ohne dass man ihre Zähne sehen konnte, es wirkte schüchtern.
Ira entdeckte eine kleine Jahreszahl auf dem Bild. »1973? So lange kannten Sie sich?«
Tilly nickte. »Noch viel länger.« Sie faltete ihre zierlichen Hände, löste sie wieder, legte die Fingerspitzen aneinander und rieb die Handflächen, als würde sie sie waschen. »Maria hat seit der Nachkriegszeit mit uns, also mit meiner Familie gelebt. Sie haben sie doch kennengelernt, als Sie bei mir waren, beim Interview zu meinem fünfundsiebzigsten Geburtstag. Erinnern Sie sich denn nicht? Maria hat uns den Kaffee serviert, das müssen Sie doch noch wissen?«
»Tut mir leid, ich habe nicht darauf geachtet. Sie war Ihre Haushälterin?«
»Ja, schon, aber sie ist mehr … sie war mehr … wie eine Schwester.«
»Philipp Holle sagte, sie sei eine Bewohnerin der Stiftung gewesen?«
»Zuletzt, ja. Seit zwei Jahren, hier wurde sie bestens betreut. Ich konnte sie doch nicht pflegen, ich bin auch nicht mehr die Jüngste.«
»Betreut? War sie krank?«
Tilly blickte auf das Foto an der Wand. »Sie war dement. Es wurde immer schlimmer. In den letzten Wochen hat sie mich gar nicht mehr erkannt, wenn ich sie morgens zum Spaziergang abgeholt habe.« Sie schluchzte. »Wissen Sie, dass heute ihr Geburtstag ist? Maria war etwas älter als ich, heute ist sie achtundsiebzig geworden.«
Ira setzte sich wieder auf den Stuhl und wartete.
Tilly räusperte sich. Dann erzählte sie stockend, was sie auch der Polizei erzählt hatte: »Ich habe Maria gegen zehn Uhr in ihrem Zimmer abgeholt. Als ich kam, band eine Pflegerin ihr gerade einen Schal um und redete mit ihr wie mit einem Kind: ›So, Frau Klabunde, da haben wir ja die Frau Jacobsen, und jetzt machen Sie beide einen schönen Spaziergang, ja?‹ Ich habe Maria untergehakt und sie in den Park geführt.« Tilly Jacobsen nestelte ein Taschentuch aus ihrem Ärmel und putzte sich die Nase. Sie sah hinüber zu dem Foto an der Wand.
»Wir gehen immer denselben Weg, wissen Sie, das ist wichtig für die Demenzkranken. Jeden Tag gehen … gingen … wir aus ihrem Zimmer, dann den Gang hinunter, wir fuhren mit dem Lift ins Erdgeschoss, gingen durch die Bibliothek in den Wintergarten und draußen auf dem Hauptweg bis zum Ende des Grundstücks. Dort setzten wir uns immer einen Moment auf die Bank neben der griechischen Statue, aber heute hatte es doch so geregnet. Die Bank war nass, deshalb gingen wir weiter. Ganz langsam, sie konnte nicht mehr so schnell. Die ganze Zeit habe ich mit Maria geredet, das tut ihr gut, wissen Sie … es tat ihr … gut. Nur manchmal sprach sie, ein paar Sätze nur, oft unzusammenhängend … sie redete von früher, wie ein Kind, dann wieder sah sie mich an und wirkte, als wäre sie ganz klar.«
Tilly schien den täglichen Weg vor sich zu sehen. Sie führte ihre Freundin durch den Park, dann hatten sie das Grundstück durch das kleine Südtor verlassen. Wie jeden Tag.
»Es waren bis zur Straßenecke nur ein paar Meter. Wir blieben an der Ecke stehen, schauten auf die Kirche, bogen rechts ab, und dann gingen wir bis zum Haupttor und durch den Hauptweg wieder zurück.«
Ira hörte aufmerksam zu, machte sich aber keine Notizen. Sie zeichnete das Gespräch auch nicht auf, um die vertrauliche Atmosphäre nicht zu zerstören.
Tilly Jacobsen bemühte sich sichtlich um Haltung. Es gelang ihr nicht. Weinend erzählte sie, dass sie um die Ecke gebogen seien und plötzlich ihr Handy geklingelt habe. »Ich habe es aus der Manteltasche gezogen, bin rangegangen, habe aber nichts verstehen können, weil der Kehrwagen so schrecklich laut gewesen ist. Dieses Piepen, als er rückwärts gefahren ist, hat alles übertönt.
»Maria, du musst ganz kurz hier warten, ich bin sofort zurück!«, hatte sie gesagt. Sie schob die Freundin an den hohen, eisernen Zaun vor die Koniferenhecke, lief ein paar Schritte, suchte Schutz hinter dem Mauerpfeiler des Eingangstores und hielt sich das Ohr zu, um den Anrufer verstehen zu können.
Ira dachte an die parkenden Autos, den angehobenen Kehrwagen, die Feuerwehrleute, die Maria Klabunde hinter den Planen geborgen hatten.
Tilly hielt sich plötzlich die Ohren zu und rief: »Und dann hörte ich den Schrei. Danach war das Piepen vorbei.« Sie flüsterte die nächsten Worte: »Ich wusste, dass etwas Furchtbares passiert war, ich wusste es sofort, verstehen Sie?«
Sie hatte das Handy vom Ohr genommen, sich umgedreht und gesehen, dass der Kehrwagen angehalten hatte und der Mann in der orangefarbenen Arbeitskleidung aus dem Führerhaus gesprungen war. Er hockte nun hinter dem Wagen und brüllte etwas. Wie in Trance ging Tilly zum Tor. Marias Brille lag neben dem Rad des riesigen Fahrzeugs. Das Auto war aus, aber die Metallbürsten drehten sich noch langsam und schleifend nach. Als sie die Blutlache immer größer werden sah, war Tilly neben dem Mauerpfeiler zusammengesackt.
Die arme Frau. Diese Bilder wird sie doch nie wieder los. Ira ließ ihr Zeit, um sich zu beruhigen, sagte nichts, strich mit ihrer Hand über Tillys Arm.
Tilly zuckte zusammen, als es an der Tür klopfte.
»Ja?«, rief sie, und eine üppige, ältere Dame kam herein. Ihr blondes Haar war im Nacken mit einer schwarzen Samtschleife zu einem Mozartzopf frisiert, sie trug einen schwarzen Hosenanzug und Pumps. »Ilsemarie!« Tilly stand auf und ging ihr entgegen. Die Frauen umarmten sich. Sie wischten sich gegenseitig die Tränen aus den faltigen Gesichtern, sprachen leise miteinander, abgehackt, leidend. Ein intimer Moment. Ira war nicht abgebrüht genug, um zu bleiben, sie hatte genug Taktgefühl, um jetzt zu gehen. Die beiden Frauen standen dicht voreinander, wischten sich die Tränen von den Wangen, sprachen leise miteinander. Sie bemerkten nicht, dass Ira ihre Tasche nahm und diskret das Zimmer verließ. Als sie an den beiden vorbeiging, hörte sie Tilly flüstern: »Wir müssen es doch Konstanze sagen, wir müssen es trotzdem sofort Konstanze sagen!«