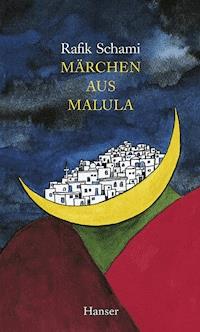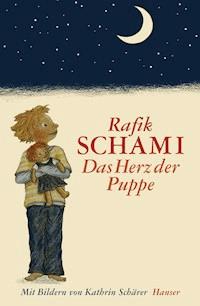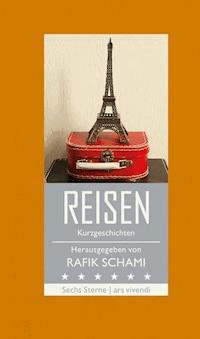Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Mädchen war Sophia heftig in Karim verliebt, dennoch heiratete sie einen reichen Goldschmied. Als Karim jedoch unschuldig unter Mordverdacht geriet, rettete sie ihm das Leben. Wann immer sie ihn brauche, verspricht er, wird er ihr helfen, auch unter Lebensgefahr. Viele Jahre später kehrt Sophias einziger Sohn Salman aus dem Exil in Italien nach Damaskus zurück. Plötzlich entdeckt er sein Fahndungsfoto in der Zeitung und muss untertauchen. Jetzt erinnert sich Sophia an das Versprechen Karims, der im Alter eine neue Liebe gefunden hat. In seinem neuen Roman erzählt Rafik Schami von der Macht der Liebe, die Mut und Tapferkeit gibt, die verjüngt und die Leben retten kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hanser E-Book
Rafik Schami
SOPHIA
oderDer Anfang allerGeschichten
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25009-3
© Carl Hanser Verlag München 2015
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München © akg-images / Gerard Degeorge
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhalt
Vom Traum, das Gleichgewicht zu halten
Die Flucht oder Ein Etappensieg gegen den Tod
Tante Amalia oder Die große Krise
Die Zeit vor Sophia
Stella oder Von der Sanftmut der Löwinnen
Lieben heißt aufbäumen gegen den Tod
Die erste Versuchung oder Von der Herrschaft der tierischen Wollust
Feuer der Liebe und Wasser der Vernunft
Der Riss oder Zwei Vorstellungen vom Leben
Sophia, die Retterin in Not
Das Doppelleben oder Die Lügen eines liebenden Ehemannes
Eine dreißigjährige Fahrt in ruhigen Gewässern
Lola und Alice oder Die Zeit nach Violetta
Muniras Vorschlag und das Wagnis
Der Traum oder Die Sehnsucht einer vertriebenen Schwalbe
Amira oder Ein Schaukelstuhl im Herzen
Die Absicherung oder Die Angst eines Hürdenläufers
Vom abrupten Abschied und langsamen Scheitern
Mosaik einer Ankunft oder Von verlorenen Orten und Zeiten
Was Liebe kostet
Begegnungen oder Von Täuschung und Selbsttäuschung
Vorsätzliche Provokation oder Eine gefährliche Wette
Aida oder Die Wiedergeburt der Hoffnung
Die Treibjagd oder Wie Katastrophen anfangen
Maha oder Die Unmöglichkeit, Eltern zu erziehen
Ein Pechvogel oder Die erste Sackgasse
Mosaik der Liebe
Verblasste Liebe oder Die zweite Sackgasse
Nahaufnahmen einer kranken Gesellschaft
Von der Untauglichkeit alter Kameradschaften oder Die dritte Sackgasse
Die Zuverlässigkeit des Geliebten oder Das Gewicht eines Versprechens
Hanis Narben und Tareks Hand oder Der Weg der Hoffnung
So weit und doch so nah
Aida und Karim oder Eine Oase vor dem Aufbruch ins Ungewisse
Weihnachten oder Die Erinnerung an Blumen
Schwere Zeiten oder Die Hoffnung im Labyrinth
Abschied nehmen oder Die Vorbereitung auf eine harte Probe
Selbstgespräch einer Mutter
Das seltsame Gespür der Tauben oder Ein bitterer Abschied
Zerstreutheit einer Liebenden
Ein Liebesbrief an einen Toten oder Der Tanz auf dem Hochseil
Die härteste Prüfung oder Der Sprung über den Abgrund
Die Musik im Inneren einer Geliebten
Für
Root und Emil,
die stets meine Geschichten vorkosten
&
für alle,
die eine Fata Morgana
für ihr verlorenes Paradies halten
Vom Traum,das Gleichgewichtzu halten
Geduld und Humor sind zwei Kamele,
mit denen man jede Wüste überqueren kann.
Arabisches Sprichwort
Damaskus, Sommer 2006
Aida fuhr an diesem Tag besonders unsicher, sie hielt zwar das Gleichgewicht auf dem Fahrrad, aber sie schaute dauernd auf den Lenker, und ihr Vorderrad malte eine Schlangenlinie auf den Boden. Karim ermahnte sie: »Nach vorne schauen, vergiss den Lenker, er folgt sklavisch deinem Blick«, aber ihre Augen richteten sich wie hypnotisiert auf den glänzenden Bügel zwischen ihren Händen.
Es war die Feuertaufe, wie Aida die Fahrt durch die Jasmingasse nannte. Sie trug an diesem Tag weiße Espadrilles, eine blaue Hose und ein rot-weißes Streifenshirt. Ihr langes graues Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie geriet immer wieder ins Schlingern und lachte dabei laut, als wollte sie ihr Herzklopfen überspielen. Karim hielt das Fahrrad fest am Sattel.
Es war ein robustes Hollandrad, das er vor dreißig Jahren gebraucht gekauft hatte. Er liebte das Fahrrad und ließ in all den Jahren niemand anderen darauf. Und er hatte sich nie vorgestellt, dass das jemals anders würde, bis ihn Aida vor etwa einem Monat fragte, ob es etwas gebe, was er nicht beherrsche und immer gewünscht habe zu können. Sie waren bereits über ein halbes Jahr zusammen.
»Ein Musikinstrument spielen«, antwortete er und zögerte kurz, »genauer gesagt, meine Lieblingsmelodien mit einer Oud hervorzaubern«, fügte er leise hinzu und schluckte den Rest hinunter: »wie du es kannst«, weil er sicher war, es war zu spät. Er hatte zwar geschickte Hände, aber sie waren bereits über fünfundsiebzig Jahre alt.
Schon als Kind hatte er davon geträumt, doch im Elternhaus war Musizieren verpönt, die wohlhabende Familie besaß zwar ein Radio, und sein Vater hörte neben den Nachrichten und Berichten gelegentlich das eine oder andere Lied oder Musikstück, aber er erlaubte niemandem, zu singen oder Musik zu spielen. Karims Mutter besaß eine wunderschöne Stimme, aber sie sang nur heimlich, wenn der Vater außer Haus war. Als sein Bruder Ismail es einmal wagte, leise die Flöte zu spielen, die er gekauft hatte, bekam er Prügel. »Das ist Zigeunerzeug«, sagte sein Vater verächtlich.
Aida strahlte ihn an. »Das kann ich dir in drei Monaten beibringen. Wenn du dann täglich fleißig übst, finden die Melodien den Weg zu deinen feinen Fingern. Das braucht aber etwas Geduld«, sagte sie, zögerte, »und Humor«, ergänzte sie und streichelte ihm das Gesicht.
»Und du, was hast du dir immer gewünscht und nie gewagt zu tun?«, fragte er verlegen lachend, um seine Unsicherheit zu überspielen.
»Rad fahren. Das war mein Traum als Mädchen. Ich beneidete meinen Bruder, seine Freunde und all die Jungen in meiner Nachbarschaft um dieses federleichte Schweben, aber als ich den Wunsch einmal geäußert habe, reagierte meine Mutter laut und ungehalten, und das war sie immer, wenn sie Angst bekam. Ich solle mir das aus dem Kopf schlagen. Frauen blieben zu Hause, und da bräuchten sie kein Rad. Rad fahren könne böse Folgen haben, erklärte sie bedeutungsvoll. Und als ich erstaunt und zugleich naiv fragte, was das für Folgen seien, behauptete sie, manch eine junge Frau sei durch das Radfahren nicht mehr Jungfrau gewesen. ›Erkläre dann den blöden Männern, dass du noch unberührt bist‹, sagte sie verzweifelt. Es war nichts zu machen.
Ich habe es nicht geglaubt. Es war wie alles, was meine Mutter sagte, wenn sie Angst bekam. Sie dramatisierte so sehr, dass man sich bald in einem Dschungel aus Aberglaube, Furcht und Scheu befand und schwer durch diese Düsterheit zur Wahrheit gelangen konnte. Kaffeetrinken führt bei jungen Mädchen zu Bartwuchs, zerbrochene Spiegel bringen sieben Jahre Unglück, Rauchen macht die Frau unfruchtbar, spaßiges Schielen kann zu Dauerschielen werden, schwangere Frauen sollten alle Früchte bekommen, die sie zu essen wünschen, sonst wird das Baby Feuermale in Form der ersehnten Frucht im Gesicht oder auf dem Leib tragen. Onkel Barakat, Tante Maries Ehemann, soll damals in vier Tagen nach Jaffa und zurück geritten sein, um seiner schwangeren Frau Jaffa-Orangen zu bringen. Sie bekam einen Korb der berühmten süßen Früchte und dazu später ein gesundes Baby.
Ich fand Radfahren elegant, und das Gleichgewicht zu halten glich dem Gang eines Zirkusartisten auf dem Hochseil. Und vor allem diese Erhabenheit!«
»Das hast du in zwei bis drei Wochen«, sagte er und merkte erst spät seinen Leichtsinn. Beim Oudspielen kann man sich weder Arm noch Bein brechen, beim Radfahren schon. Sie strahlte ihn mit ihren dunklen Augen an, stürmte zu ihm und küsste ihn innig auf die Lippen, so dass all seine Gewissensbisse wie Fledermäuse aus seinem Kopf hinausflatterten.
»Bring es mir bei«, flehte sie ihn an, und er sah die Freudentränen in ihren Augen.
Merkwürdig, wie lange man mit seinen geheimen Wünschen lebt. Über sechs Monate waren sie bereits ein Paar, und sie hatten sich offen von ihrem bisherigen Leben erzählt, und auf einmal entdeckten beide, dass sie immer noch nicht genug voneinander wussten.
»Ich hatte vielleicht Angst davor, dass du mich auslachst«, sagte Aida, eher um sich selbst das Zögern zu erklären. Karim nickte. »Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe es ab dem zwanzigsten Lebensjahr niemandem mehr verraten. Und wenn jemand mich nach meinen unerfüllten Wünschen fragte, so sagte ich tanzen und wie eine Schwalbe fliegen. Tanzen wollte ich später, nach dem Tod meiner Frau Amira nicht mehr.«
»Und ich konnte mich beim Tanzen nie entspannen. Ich habe immer mitgezählt und darauf geachtet, dass die Schritte stimmten. Irgendwann mit zehn, zwölf Jahren gab ich es auf. Aber das Radfahren, das blieb mein Traum.«
Aida war eher klein. Wenn sie barfuß ging, war ihre Stirn auf der Höhe seiner Schulter. Sie war schlank und athletisch, und wenn man nicht wusste, dass sie Mitte fünfzig war, hielt man sie für eine Vierzigjährige. Wenn man ihr Komplimente machte, erwiderte sie: »Liebe verjüngt! Verliebt euch und ihr werdet sehen«, und lachte.
Aida war immer schon verwegen. Das erfuhr auch Karim bald und hatte immer Angst um sie, wegen ihres Übermuts.
Nach einer Woche mit Übungen auf dem großen, fast immer leeren Parkplatz einer pleitegegangenen Textilfabrik vor dem Osttor, nicht weit von ihrem und Karims Haus entfernt, wollte er, dass sie auch lernte, durch eine belebte Gasse zu fahren. Er begleitete sie zu ihrer Gasse, die etwas breiter war und auf der westlichen Seite parallel zur Jasmingasse verlief. Aida fuhr ganz ruhig, und Karim hielt sie am Sattel. Mehrere Frauen und Männer beobachteten sie am Fenster oder an der Tür stehend und schüttelten missbilligend den Kopf. Aber das beeindruckte Aida nicht. Bald konnte Karim loslassen, ohne dass sie es merkte. Er rannte neben ihr her, und als sie ihn sah, wäre ihr fast schwindelig geworden. »Halte mich fest«, rief sie verzweifelt, »bist du verrückt?«, und sie fuhr fast gegen die Wand. Karim hielt sie fest, sie bremste und kam zum Stehen. Sie atmete erleichtert auf.
Es dauerte weitere fünf Tage, bis sie Karim nach den ersten Metern zurufen konnte, jetzt könne er loslassen, und sie fuhr durch die Gasse, klingelte dauernd und drehte dann an der Ecke zur Judengasse um. Breit lachend kehrte sie zu ihm zurück. Im Kurvenfahren aber blieb sie schwach, zweimal schrammte sie ihr Knie an der Mauer auf, weil sie den Bogen zu groß nahm, ihre Knie bluteten und ihre braune Hose bekam einen Riss, aber sie stürzte nicht. Nachdem sie eine Woche später tadellos fuhr, schlug Karim vor, sie solle nun in der Saitungasse üben, wo auch Autos fuhren, wenn auch langsam. Die Saitungasse war formlos und breit. Sie beherbergte den Sitz des katholischen Patriarchen und die große katholische Kirche.
Aida war dagegen. »Dort wimmelt es nur so von Pfarrern und Bischöfen, ihr Anblick macht mich nervös.« Sie lächelte bei der Vorstellung im Beichtstuhl, den sie seit fünfzig Jahren nicht mehr aufgesucht hatte, zu knien und zu sagen: »Pater, ich habe gesündigt.«
»Was haben wir getan? Wie haben wir gesündigt? In Gedanken? Körperlich?«
»Ja, körperlich, mit einem Fahrrad«, würde sie antworten. Ihre Freundin Sahra hatte ihr erzählt, Radfahren würde Frauen sexuell befriedigen. »Du weißt schon«, sagte sie, »der Sattel tut seine Aufgabe besser als mancher Mann.« Sahra glaubte daran, ohne je selbst ein Fahrrad gefahren zu haben.
»Und wie wäre es mit der Jasmingasse?«, holte Karim sie ins Jetzt.
»Das wäre nicht schlecht.« Sie wollte den Frauen vorführen, dass sie nun eine Radfahrerin geworden war. »Am besten um drei Uhr nachmittags, wenn sie alle vor ihren Türen sitzen«, sagte sie und lachte über die Gesichter mit den offenen Mündern, die sie vor ihrem inneren Auge sah. Karim verdrehte die Augen. Es war seine Gasse. »Wenn ich das bestehe, werde ich auch freihändig durch die Hölle fahren«, sagte sie. Sie kannte die Gasse schon lange, und die Frauen näher seit einem halben Jahr, seitdem sie Karims Geliebte war.
Die Jasmingasse liegt im christlichen Viertel der Stadt Damaskus an der historischen Geraden Straße zwischen der Abbara- und der Saitungasse und verläuft parallel zu beiden.
Man gelangt durch einen Steinbogen über einen schmalen, nicht einmal einen Meter breiten dunklen Korridor ins Innere dieser Gasse, die dann etwa vier Meter breit wird. Dieser Flaschenhals hat die Gasse gerettet, sie blieb vom Auto- und Motorradverkehr verschont. Auch die meisten Touristen haben den Eingang übersehen, der eher dem Tor eines Hauses als dem Durchgang zu einer Gasse ähnelt. Über dem Bogen sperren zwei Fassadenhälften den fremden Blick aus und perfektionieren die Tarnung.
Bis zu den fünfziger Jahren schmückte den Eingang sogar ein mit Schmiedeeisen und Bronze verziertes Tor, das aber nach der Ausstellung »Tore von Damaskus« 1959 plötzlich verschwunden war. Auch Jahrzehnte später hielten sich noch hartnäckig die Gerüchte, dass ein Ölscheich dem Ausstellungsdirektor viel Geld für das schmucke Stück gezahlt und es nach Kuwait mitgenommen hätte.
Aber auch neugierige Touristen, die durch den Tunnel gingen, stellten bald enttäuscht fest, dass die Jasmingasse außer einem ungewöhnlich gepflegten, mit Steinplatten gepflasterten Boden und vielen Sitzbänken, Kletterpflanzen und Blumentöpfen, die fast kitschig anmuteten, nichts zu bieten hatte. Es gab keine auffällig raffinierten Bauten, sondern zu beiden Seiten nur die schlichten Lehmfassaden einstöckiger Häuser, die fast alle gleich aussahen. Die Touristen wussten nicht, dass die Bescheidenheit der Fassade eine raffinierte Tarnung war, jahrhundertealt und wirksam. Sie hielt Neider und Steuereintreiber fern. Drinnen, hinter den Türen, öffneten sich Innenhöfe unter freiem Himmel, die vom sinnlichen Leben der Damaszener zeugten.
Die Jasmingasse endete nach fünfhundert Metern am runden Klosterplatz, der zum großen Teil von Häusern und zwei Läden für Lebensmittel und Haushaltwaren umsäumt war. Karims großes Haus stand an der Ecke. Seine Haustür war die letzte auf der linken Seite der Gasse. Eine zweite Tür in der langen hohen Steinmauer am Platz führte zu seinem Garten. Unmittelbar daneben befand sich eine uralte, etwas verwitterte Bank. Sie war aus einem einzigen weißen Steinblock gemeißelt. Karim genoss oft im Sommer am späten Nachmittag seinen Kaffee auf dieser Bank. Das kleine Panorama einer Klosterruine bot sich dem Betrachter, spärliches Grün lugte zwischen den großen Steinquadern und Mauerresten hervor. Das Kloster, das im zehnten Jahrhundert gebaut worden und dem heiligen Johannes geweiht war, wurde durch ein Erdbeben im Jahre 1157 völlig zerstört. Damals zählte man allein in Damaskus und Umgebung achtzigtausend Tote. Das waren zwei Drittel der Bevölkerung, doch die Damaszener erhoben sich aus den Trümmern, wie so oft in der Geschichte, und bauten ihre Stadt wieder auf. Das Kloster jedoch wurde nie wieder aufgebaut, seine Steine wanderten in die vielen Häuser des christlichen Viertels, als sollten das Kloster und Johannes, sein Patron, in jedem dieser Häuser weiterleben.
Die historische Stadtmauer im Hintergrund war an dieser Stelle unattraktiv, eilige und dürftige Reparaturen mit diversen kleinen Steinen aus verschiedenen Jahrhunderten raubten ihr jedwede Schönheit, obwohl man an jeder dieser Zerstörungen, die den Reparaturen vorausgingen, Tragödien ablesen konnte. Auch erreichte der durch Erdbeben und Brand angesammelte Schutt aus Lehm und Asche diesseits der Mauer bis zu zwei Drittel ihrer Höhe. Die Damaszener durften den Schutt nie aus der Stadt hinaustragen, um die umliegende fruchtbare Ebene, die die Stadt ernährte, nicht zu zerstören. Die Stadtmauer war von außen, zur belebten Ibn-Assaker-Straße hin, über neun Meter, von innen aber am Rande des Klosterplatzes nicht einmal drei Meter hoch.
Zwei Pappeln ragten in der Mitte der Ruine vor der Mauer hoch in den Himmel, erhaben über diese niedrige Umgebung. Fremde interessierten sich kaum dafür, dass die Sonne am 23. Juni um Punkt sieben Uhr genau zwischen die Stämme schien und die Spitze der schlichten Grabstele, einer zwei Meter hohen rechteckigen Säule aus Granit, die sich nach oben verjüngte, aufblitzen ließ. Das unscheinbare Grab unter der Stele war oft mit Blumen bedeckt. Die meisten Besucher wissen wenig über dieses Liebespaar, das der Tod vereinigte, als das Leben die Erfüllung ihrer Liebe untersagte. Die Bewohner des christlichen Viertels aber wissen die Geschichte von Fadi und Fatima zu erzählen, die zwei verschiedenen Religionen angehörten und deshalb nicht miteinander leben durften. Dort, wo sie umschlungen lagen, begrub man sie. Man erzählt so viele Geschichten über diese Liebe und darüber, wie die Pappeln wuchsen, um bei jeder Windbö flüsternd an Fadi und Fatima zu erinnern. Der Grabstein trug keine Namen, aber jedes Kind im Viertel kannte die Namen der Märtyrer der Liebe. Und jedes Jahr bewegte sich eine Prozession von Hunderten von Frauen aus dem ganzen christlichen Viertel zu diesem Grab, und sie warteten geduldig, bis die Sonne schien, und dann sangen sie ein langes Klagelied über das Unrecht, das die beiden erlitten hatten. Zwei Stunden dauerte die Prozession, und die Frauen kehrten mit verheulten Augen nach Hause zurück. Aber das ist eine andere Geschichte.
Durch die glückliche Fügung, vom motorisierten Verkehr verschont geblieben zu sein, wirkt die gepflegte Gasse wie der Innenhof einer Wohnkolonie. Abgesehen von den drei Monaten im Jahr, die kalt und regnerisch sind, pflegten die Frauen und die alten Männer gegen fünfzehn Uhr auf die Gasse zu gehen und sich vor den Eingang ihrer Häuser zu setzen. Die Kinder samt Bällen, Murmeln und Tretrollern wurden für zwei Stunden vertrieben und spielten auf dem Klosterplatz oder in den Ruinen. Die Gasse wurde nun mit Wasser bespritzt, nicht nur, um sie sauber zu waschen, sondern um eine angenehme Kühle herbeizuführen. Es wurden Kaffee und Tee getrunken, Gerüchte gesammelt und verbreitet und viel gelacht. Gegen siebzehn Uhr war die Sitzung beendet, und die Kinder kehrten mit ihrem Lärm und Lachen in die Mitte der Gasse zurück.
Kein Verkäufer und kein Radfahrer wagten es in diesen zwei Stunden, die Ruhe und Stimmung zu stören. Die Zunge der Frauen in dieser Gasse war nicht nur im christlichen Viertel gefürchtet. Ihre Schärfe kannten viele Straßenhändler, Postboten, Polizisten und Bettler. Man sagte, die Damaszener haben ihre legendären Stahlmesser, und die Jasmingasse hat die Zungen der Frauen. Karim wusste das. Aida aber wollte unbedingt zu dieser Stunde an den Frauen vorbeiradeln. Sie wusste, dass viele Frauen sie um ihre Liebe zu Karim beneideten. Solange sie nur verwitwet gewesen war, hatten die Frauen in ihrer und in dieser Gasse Mitleid mit ihr gehabt, dass sich aber eine Witwe verliebte, »noch bevor die Erde auf dem Grab ihres verstorbenen Mannes trocken war«, das verbot die Moral. Doch Liebe fragt nicht einmal das Herz um Erlaubnis, und am allerwenigsten kümmert sich die Liebe um Gräber. Aber das Komischste war: Diese Frauen waren dieselben, die jedes Jahr am 23. Juni den Tod der zwei Verliebten beklagten, obwohl auch in jener Legende der Mann ein Muslim und die junge Frau eine Christin war.
Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer im christlichen Viertel verachteten Aida, die sich ausgerechnet in den Muslim Karim verliebt hatte. »Als ob es keine christlichen Männer mehr gäbe«, brummten sie, wenn sie Aida sahen. Sie, die immer mit geschwellter Brust das gelungene Zusammenleben der Angehörigen vieler Religionen in der Gasse lobten, betrachteten diese Liebe als Überschreitung der roten Linie, die sie sich selber setzten. Als ob die Liebe nach dem Pass schielt, bevor sie ein Herz erobert.
Und Karim? Er hatte eine Antwort parat, ob beim Gemüsehändler oder beim Friseur: »Ich bin kein Muslim, auch kein Christ, Druse oder Jude, meine Religion ist die Liebe, verstehst du?« Aber ob man aus Höflichkeit nickte, den Kopf schüttelte oder verlegen lächelte, man verstand ihn nicht.
Durch die seit dem Herbst des vergangenen Jahres entflammte Liebe zu Karim schien Aida sich Tag für Tag zu verjüngen. Das war den Frauen in der Gasse aufgefallen, nicht nur ihre Kleider wurden bunter, nein, auch ihr Gang, ihr Lachen und ihre Aufmerksamkeit hatten plötzlich etwas von einem frechen Mädchen, das neugierig und furchtlos durchs Leben ging. Aber hätten die Frauen das ehrlich zugegeben, wäre es ein Geständnis ihrer Niederlage gewesen. Deshalb behauptete man in beiden Gassen, Aidas lockere Moral und ihre Nichtachtung der eigenen christlichen Religion seien der Grund der Abneigung gegen sie. Es spielte dabei keine Rolle, dass die meisten Frauen und Männer vom Christentum nur das »Gegrüßet seist du, Maria« und das »Vaterunser« kannten.
Nachbarinnen, die jeden Passanten zum Tee oder Kaffee einluden, weigerten sich nun, Aida einzuladen. Nein, man mochte die Witwe nicht mehr, die sich diesen attraktiven und witzigen Witwer geschnappt hatte, noch bevor einige Frauen ihre Pläne mit ihm zu Ende gedacht hatten. Das alles wusste Aida, und deshalb wollte sie unbedingt diese Feuertaufe durchstehen.
»Ich werde auf dich aufpassen«, versprach Karim, weil er seine Gasse gut kannte und auch spürte, wie unsicher Aida auf einmal war. Er stand mit ihr an jenem wichtigen Tag mit dem Fahrrad auf der historischen Geraden Straße vor dem Eingang zur Jasmingasse. Wie so oft trug er auch an diesem Sommertag Hemd wie Hose aus Khaki-Baumwolle. Er schaute sie fest an. »Willst du das wirklich?«
»Ja«, sagte sie, »unbedingt.«
»Dann darfst du dich nicht umdrehen. Kennst du die Geschichte mit Lots Ehefrau?«
»Ja, sie ist zur Salzsäule erstarrt, weil sie keinen Namen hatte, ich aber heiße Aida und werde mich in Schokolade verwandeln, damit du mich abschleckst«, sagte Aida und küsste ihn auf den Mund.
»Oh Gott! Wir müssen uns beeilen! Du schmeckst bereits nach Schokolade«, sagte er. Männer schauen nie zurück, dachte Aida, sie folgen jedem, der sie überzeugt, und verlieren die Bindung zur Vergangenheit schnell. Frauen drehen sich immer wieder um, aus Sorge, Sehnsucht, Neugier und Mitgefühl. Deshalb zögern sie öfter als Männer. Das war immer so.
»Darf ich bitten, Madame Schokolade«, sagte Karim. Sie fuhr los. Der Schneider Benjamin, der gerade eine kleine Pause an der Tür seines Ladens machte und einen Mokka trank, schüttelte den Kopf. Sein Urteil war eindeutig: ein schiefes Lächeln.
Karim eilte hinter ihr her. In dem schmalen Durchgang, den die Bewohner »Korridor« nannten, spürte er ihre Unsicherheit. Er packte das Fahrrad an der Sattelstange, ohne dass sie es merkte. Die Gasse war von Frauen und alten Männern gesäumt. Sie schauten auf, einige tuschelten miteinander. Die entrüsteten Blicke umzäunten jeden Winkel ihres Körpers. Sie fühlte ihre Stiche und mied die Augen. Stattdessen starrte sie auf den Lenker und trat in die Pedale.
Eine alte Frau saß am Fenster und aß eine Apfelschnitte. Sie erstarrte bei Aidas Anblick, schüttelte den Kopf und rief etwas ins Hausinnere, eine beleibte junge Frau eilte herbei und gesellte sich zu ihr, sie schlug die Hände vor ihren Mund, als wollte sie einen Schrei unterdrücken.
Etwa auf halber Strecke, auf der Höhe des Schusterhauses, sprang die zwanzigjährige Tochter des Konditors plötzlich auf, rannte über die Gasse und setzte sich wiehernd auf einen freien Stuhl neben dem Haus ihres Vaters auf der anderen Seite. Karim kannte diese junge Witwe. Man erzählte, dass ihr Mann, ein Marineoffizier, bei einem Seemanöver ums Leben gekommen sei. Sie hatte vor Trauer um ihn den Verstand verloren. Oft übernachtete sie auf dem katholischen Friedhof auf dem Grab ihres Mannes. Manchmal nahm sie ihm sogar seine Lieblingsgerichte mit.
Aida hielt den Atem an, sie schwankte und riss den Lenker in die andere Richtung, aber das geschah mit zu viel Wucht, und das Vorderrad berührte leicht die Knie der Nachbarin Afifa, der Frau des Schusters Tuma, diese schrie auf und schüttete etwas Kaffee auf den Boden. Aida lenkte rasch wieder zur Mitte der Gasse hin und rettete sich im letzten Augenblick. Schweiß eroberte augenblicklich ihren Körper.
»Pass doch auf!«, rief Afifa entsetzt.
»Sie braucht eine Brille«, lachte eine Frau.
»Die kaufe ich ihr vom Krämer«, erwiderte eine Nachbarin.
»Sie ist verrückt geworden«, rief eine beleibte Frau, die Aida nicht kannte.
»Die Hormone machen ihr zu schaffen.«
»Fehlt noch, dass sie rote Shorts trägt!«
»Und Karim ist auch nicht mehr der Alte.«
»Er vertrottelt langsam.«
»Wenn alte Leute kurz vorm Ende geil werden, ist das wie der Furz eines Sterbenden, er ekelt die Trauernden und vertreibt die Engel, die gekommen sind, um seine Seele zu holen. Da bleibt nur der Teufel! Und das ist …«, rief eine andere Frau. Alle lachten, und man verstand die letzten Worte nicht mehr.
Aida konnte die Stimmen nicht zuordnen, aber sie fühlte einen Krampf in der Magengegend. So viel Hass allein wegen des Radfahrens? Auch in anderen Gassen lachten die Leute über sie, aber solche giftigen Kommentare hörte sie zum ersten Mal. Es war Hass. Wo rührte dieser Hass her? Was nahm sie ihnen, wenn sie Karim liebte oder Fahrrad fuhr? Hatte Karim nicht jahrzehntelang einsam unter ihnen gelebt? Hätte er eine dieser Frauen gewollt, hätte er ihr das gesagt. War der Neid der Vater ihres Hasses oder hatte der Hass schon lange in ihren Seelen gelauert und fand nun den Ausgang, das Ventil? Karim spürte, wie ihm eine Gänsehaut den Rücken hinunterlief. Am liebsten hätte er angehalten und den Frauen geantwortet. Die harten Worte drängten sich in seinem Hals wie Igel, die hinauswollten und nicht konnten. Sein Kehlkopf schmerzte. Er ging schweigend weiter, fast mechanisch hielt er sich an der Sattelstange. Dann, als das Lachen verebbte, lockerte er seinen Griff und lief neben Aida her bis zum Ende der Gasse. Dort blieb er stehen, und Aida fuhr auf dem Klosterplatz im Kreis herum, und als sie ihn erreichte, rief sie ihm zu: »Bleib hier, ich drehe eine Runde allein. Ich komme gleich«, sie klingelte und fuhr nun sicher zurück, das Fahrrad zog geradlinig durch die Gasse, und sie wendete dort, wo sich die Gasse verjüngt und zum Flaschenhals wird. Karim sah sie nun besser, weil Aida auf den Pedalen stehend zurückfuhr. Sie klingelte freudig, trat übermütig in die Pedale, erhob sich vom Sattel und stand, den Lenker nur locker mit den Fingerspitzen haltend. Sie ließ sich auch nicht mehr verrückt machen durch die Frauen, die plötzlich vor ihr Rad sprangen, sie klingelte, streckte Afifa die Zunge heraus und fuhr davon!
»Diese schamlose Verrückte … Wenn sie Scham besitzen würde, wäre sie daran erstickt«, hörte sie Afifa rufen. Endlich sah sie Karim mit ausgebreiteten Armen, wie wenn er Jesus auf einem unsichtbaren Kreuz wäre, und sie flüsterte: »Ich liebe dich, solange mein Herz schlägt.«
Als sie ihn erreichte, bremste sie langsam und stieg mit geradezu majestätischer Eleganz ab. Sie lehnte das Fahrrad an die Mauer seines Hauses neben der steinernen Bank am Klosterplatz und drückte ihn an sich, »Danke«, flüsterte sie in seine Brust. Als sie zu ihm aufblickte, merkte sie, wie verschwitzt er war. Seine Stirn glänzte und einzelne Schweißtropfen hingen zwischen den Falten wie silberne Musiknoten. Er streichelte ihr den Kopf. »Du warst bezaubernd … und frech«, sagte er, ließ das Fahrrad dort stehen, wo Aida es an die Mauer gelehnt hatte, und ging mit ihr langsamen Schrittes zum Platz, um im Schatten die frische Luft zu genießen. Die steinerne Bank glühte fast unter der prallen Sonne.
Sie setzten sich auf einen Steinquader im Schatten, und er begann eine Melodie zu pfeifen, die Aida liebte. Aber er musste lachen in Erinnerung an Afifas vor Schreck verzerrtes Gesicht, da schaffte er es nicht mehr zu pfeifen. Aida ignorierte sein Lachen und pfiff die Melodie vor, es glich dem Gesang eines Kanarienvogels. Karims Pfeifen hörte sich an wie das Quietschen einer alten Fahrradpumpe und zwischendurch wie ein Ballon mit einem Loch, aus dem gerade die Luft entweicht. Kinder, die in der Nähe Murmeln spielten, hielten inne, betrachteten das ältere Paar und mussten ebenfalls lachen, auch sie konnten lachend nicht pfeifen, was sie zu noch mehr Lachen reizte.
»Das geht nicht«, sagte Aida laut, »Lachen und Pfeifen sind Feinde. Du musst dich für eins von beiden entscheiden.«
Karim und Aida saßen noch lange auf dem Stein, und als es überall schattig wurde, zogen sie um und setzten sich auf die bequemere Bank an Karims Gartenmauer. Sie sprachen, lachten, pfiffen und küssten sich. Ein rothaariger Junge mit einem hellen, mit Sommersprossen übersäten Gesicht stupste seinen Spielkameraden an, der gerade mit einer Murmel auf eine andere zielte. »Schau, schau, sie sind verrückt«, sagte er zu seinem Spielkameraden, aber der beachtete ihn nicht. Er hatte schon vor einer Weile von seiner Mutter gehört, dass die zwei verrückt seien. Er konzentrierte sich lieber auf sein etwa drei Meter entferntes Ziel – »Sie sind so alt wie Opa und Oma und küssen sich wie die im Kino« –, der andere traf die Murmel und sprang schreiend vor Begeisterung hoch, erschreckte den Rothaarigen.
Auch Karim schreckte der Schrei aus der Tiefe seines Kusses auf. »Bleib hier, ich komme gleich«, flüsterte er Aida zu und ging durch die hölzerne Gartentür ins Haus. Kurz darauf kehrte er mit einem Tablett zurück, darauf standen zwei Gläser, eine Flasche Arak, eine Glaskaraffe mit Wasser und Eiswürfeln und eine Schale mit gesalzenen Erdnüssen.
Die Glaskaraffe war beschlagen, die Eiswürfel klirrten bei jedem Schritt wie ferne Glocken, Aida schaute ihn an und verliebte sich aufs Neue in diesen begnadeten Genießer.
Sie stießen auf die gelungene »Feuertaufe« an und stellten ihre Gläser auf das Tablett.
»Jetzt saufen sie auch noch«, sagte der rothaarige Junge. Der andere beachtete ihn immer noch nicht, er wollte seine Glückssträhne nicht unterbrechen lassen und zielte auf eine Murmel.
Als die Sonne hinter den Häusern unterging, liefen die letzten Kinder nach Hause. Manche machten zwischendurch kleine Luftsprünge wie junge Fohlen.
Aida und Karim beobachteten still, wie die Abenddämmerung begann, die Farben der Häuser und das Grün der Klosterruine zu trüben. Die Dämmerung warf ihren dunklen Mantel über die Welt. Nur einzelne kleine Lichter im dunklen Leib der Stadt widersetzten sich der Dunkelheit. »Ich habe Hunger«, sagte Aida, schaute ihren Geliebten an, »und danach wollen wir ein Stündchen die Oud kitzeln«, fügte sie hinzu.
Karim ging voraus, er wollte an diesem Tag Aida besonders verwöhnen und ihr Lieblingsgericht zubereiten, Kebbeh im Backofen. Er nahm das Tablett mit der Arakflasche, der leeren Karaffe und den Gläsern. Aida schob das Fahrrad durch die Haustür in den Innenhof, wo der Fahrradschuppen stand.
Karim begann erneut zu pfeifen, diesmal die Melodie eines alten Liedes, das er mit Aidas Hilfe der Oud zu entlocken hoffte. Er dachte in der Küche daran, wie schwer es ihm fiel, die Oudsaiten präzise mit dem Federkiel zu treffen und dabei mit den Fingern der linken Hand die entsprechende Stelle an der Saite fest zu drücken.
Aida hatte ihm eine Oud geschenkt. Er hatte mehrere Instrumente probiert, bis er ein genau passendes gefunden hatte. Sie zeigte ihm, wie er sitzen und die Oud halten musste, damit sie nicht wegrutschte. Jeden Tag trainierte sie seine Finger, damit Karim lernte, genau zu greifen und saubere Töne zu erzeugen.
Und Karim staunte über Aidas Wissen. Sie schien nicht nur die Beschaffenheit des Instruments, sondern auch dessen Geschichte genau zu kennen.
»Vor dem Islam besaß die Oud drei Saitenpaare«, sagte sie ihm am ersten Tag, »dann fügte man im siebten oder achten Jahrhundert ein viertes Paar hinzu. Man ordnete damals jedem »Körpersaft / Element« ein Saitenpaar zu, und man färbte die Saiten zusätzlich ein, und zwar die höchste Saite gelb (gelbe Galle / Feuer), die zweite rot (Blut / Luft), die nächste weiß (Schleim / Wasser) und die tiefste schwarz (Schwarze Galle / Erde). Später, im neunten Jahrhundert, fügte man ein fünftes Saitenpaar hinzu für die Seele, ohne die die vier Körpersäfte nicht musizieren können.«
»Was für eine Farbe hat die Seele?«, fragte Karim.
»Man ließ das Saitenpaar durchsichtig«, sagte Aida, »weil die Seele unfassbar und wechselhaft ist.«
»Aber ich kann meine Seele fassen«, erwiderte Karim und zog Aida an sich, gab ihr einen Kuss, »und sogar küssen«, fügte er hinzu. Sie lachte: »Wie soll man so einen verliebten Schüler vernünftig unterrichten? Zurück zur Übung«, sie bemühte sich, ihre Stimme mit einem herrischen Ton zu verkleiden, aber ihr glucksendes Lachen schlug sofort wieder durch.
Karim übte täglich geduldig, aber die Melodie seiner simplen Übungen klang – verglichen mit der von Aida – zum Weinen schlecht. Er beschloss, es mit Humor zu nehmen. Allein dafür, Aida als geduldige, fürsorgliche und bescheidene Lehrerin zu haben, lohnte es sich, und er hoffte, dass er das Oudspiel eines Tages doch noch lernen würde. Er musste lächeln, als ein kleiner innerer Teufel ihm plötzlich ein Schild vor die Augen hielt, worauf stand: Die Illusion ist die Nahrung der Hoffnungslosen.
Aber auch ein Teufel kann sich irren.
Die FluchtoderEin Etappensieg gegenden Tod
Damaskus–Beirut–Heidelberg–Rom,
Frühjahr 1970 – Sommer 2010
Die Angst vor der Falle
Seit Salman Baladi mit falschen Papieren Syrien verlassen hatte, bis zu dem Tag im Sommer 2010, an dem er beschloss, nach Damaskus zu fliegen, waren vierzig Jahre, zwei Monate und siebzehn Tage vergangen. Deshalb brauchte er sechs weitere Monate, um die Lage genau zu prüfen. Er wollte hundertprozentig sicher sein, dass kein Haftbefehl mehr gegen ihn vorlag. Er hatte von Fällen gelesen, bei denen die Sehnsucht des Exilanten nach seinem Geburtsort, die Raffinesse des Geheimdienstes oder auch die Übereilung dazu geführt hatte, dass der arme Heimkehrer bereits auf dem Flughafen verhaftet wurde und nun die Hölle der Folter und Entwürdigung durchleiden musste. Manche überlebten es nicht. Andere zahlten Millionen, um freizukommen. Deshalb wollte Salman alles in Ruhe überprüfen. Aber von Rom aus war das schwierig.
Erst als er Gewissheit hatte, dass beim Geheimdienst nichts gegen ihn vorlag, bestieg er am 5. Dezember in Rom, seiner zweiten Heimatstadt, das Flugzeug Richtung Damaskus. Seine Frau Stella und sein fünfzehnjähriger Sohn Paolo wollten nicht mitkommen. Es war ihm recht. Er wollte sich allein in die Arme seiner geliebten Stadt Damaskus begeben, so wie er sie verlassen hatte, sich frei in ihr bewegen, ohne Rücksichten auf Begleiter, denen er alles hätte erklären und übersetzen müssen.
Stella merkte als Erste, wie sehr Salman die Reise nach Damaskus beschäftigte. Im Januar 2010 wurde offiziell eine Generalamnestie für alle politischen Vergehen der Vergangenheit erlassen. Die Regierung hoffte, damit viele reiche Emigranten wieder in ihr Geburtsland zu locken und neue Investitionen zu ermöglichen. Der Ministerpräsident bestätigte am 3. Juli die Amnestie, um anderslautende Gerüchte, die viele Emigranten von der Rückkehr abhielten, einzudämmen. »Ein Beamter, der einen unserer Brüder am Flughafen verhaftet«, rief er laut vom Podium aus, mit einem leichten Zögern, als hätte er einen Fehler in seiner Rede entdeckt, »oder irgendwo anders belästigt, wird auf der Stelle entlassen. Die zurückkehrenden Brüder sind Gäste Seiner Exzellenz.« Der erfahrene Ministerpräsident kannte seine Landsleute und wusste, sie hätten sofort Witze über Verhaftungen außerhalb des Flughafens gemacht. Salman verfolgte die Rede live im Fernsehen über Satellit. Sie zerstreute auch etwas sein Misstrauen gegenüber allen Behauptungen der syrischen Regierung.
Er ging zwar nach wie vor täglich in sein Büro in der Via Principe Amedeo und arbeitete fleißig, aber seit Juni zog er sich abends in sein Arbeitszimmer zurück, hörte arabische Musik und telefonierte stundenlang. Zu Stellas und Paolos Freude kochte er auch so oft wie nie zuvor Damaszener Gerichte. Daneben aber hatte er kaum noch Zeit für sie und Paolo, fuhr nicht mit ihr zu ihren Eltern nach Triest und wollte auch nicht mehr zu Geburtstagsfeiern oder Treffen mit Freunden in Bars oder Restaurants mitkommen. Ihre gemeinsamen Freunde in Rom fragten immer häufiger nach ihm. Carlo, der Goldschmied, rief Stella beim letzten Treffen im Oktober zu: »Sage deinem Pascha, wir vermissen ihn sehr. Damaskus in Ehren, aber er lebt in Rom, und wir, die Römer, haben auch ein Recht auf ihn.« Das war nicht geheuchelt. Salman war mit seinem Charme und Witz die Seele dieser abendlichen Treffen, die mindestens einmal in der Woche stattfanden.
Auch die Wirte seiner Lieblingslokale vermissten ihn. Der Wirt des »New Station« in der Giuseppe-Parini-Straße fragte sogar besorgt, ob Salman sauer auf ihn sei und deshalb nicht mehr zum Essen komme.
Stella beruhigte ihn, dass Salman ihn und sein Restaurant auch vermisse. Aber nach vierzig Jahren wolle er seine Heimat besuchen, und diese Reise sei nicht einfach. Sie fühlte einen gewissen Stolz auf Salman, der von so vielen Menschen vermisst wurde. Seine Firma »Oasi« mit der Zentrale in Rom und Filialen in Mailand und Ancona war die größte Firma für den Import von Lebensmitteln aus den arabischen Ländern und den Export für italienische Spezialitäten in die reiche Golfregion, mit zwei großen Niederlassungen in Kuwait und Dubai.
Immer mehr Italiener waren neugierig auf die orientalische Küche geworden und immer mehr reiche Araber wollten die berühmte italienische Küche kennenlernen.
Salman war trotz der Krise in Italien mit den Umsätzen seines Handels zufrieden. Ja, die zwei Verkaufsstände in der großen Markthalle »Nuovo Mercato Esquilino«, die er seit der Eröffnung 2001 gepachtet hatte und von vier tüchtigen Mitarbeitern führen ließ, machten mehr Umsatz als je zuvor. Er hatte ehrgeizige Pläne für weitere Filialen in Florenz, Bologna, Neapel, Turin, Palermo und Triest sowie Filialen in weiteren Hauptstädten der arabischen Länder, aber jetzt legte er die Pläne und ihre Ausarbeitung durch eine Investmentberatungsfirma im Frühjahr erst einmal auf Eis. Seine Reise nach Damaskus ging vor.
Nostalgie und Gedächtnis
In dieser Zeit, vom Juni bis zu seinem Abflug im Dezember 2010 dachte Salman viel an seine Kindheit und Jugend in Syrien. Die Lieder, die er teils vom -Player, teils auf Youtube hörte, waren alle über vierzig Jahre alt. Die modernen arabischen Lieder konnte er nicht ertragen.
Er legte sich ein großes Heft zu und machte sich Notizen über Ereignisse, an die er sich erinnerte, Namen von Personen, die sein früheres Leben begleitet hatten, Freunde, Verwandte und Gegner, von deren Schicksalen er nichts mehr erfahren hatte, Orte und Personen, die er unbedingt noch einmal sehen wollte. Sein Gedächtnis arbeitete auf vollen Touren.
Aber was war das überhaupt, das Gedächtnis? Salman überlegte, schrieb auf, strich vieles wieder durch und fand, dass es zu simpel wäre, das Gedächtnis nur als Archiv zu betrachten. Es war viel mehr. Tage brauchte er, bis er das passende Bild fand: Das Gedächtnis ist eine unsichtbare Stadt. Die hat mehrere Vergnügungsviertel, Geheimverstecke, Reparaturwerkstätten aller Art, einen Friedhof, eine Leichenhalle, ein Krematorium, mehrere Tempel für Heilige, dunkle Gebiete, die man fürchtet und meidet, ein Museum, Verliese für Verhasste, Kühlräume, einen Heizkessel zum Aufwärmen alter Erlebnisse und Gärten, die gegossen, gepflegt oder vernachlässigt werden. Auch Supermärkte für glitzernden Schrott, Lügen und Legenden, die er in der Familie, Schule und Kirche für wahr gehalten und gespeichert hatte und die sein Denken beeinflussten. Ihm gefiel das deutsche Sprichwort: Lügen haben kurze Beine. Während er in seinem Zimmer hörte, wie Paolo ein Fußballspiel im Fernsehen anschaute, fiel ihm plötzlich eine Ergänzung dazu ein: »Lügen haben kurze Beine, aber sie treffen ins Tor!«, schrieb er in sein Heft.
Wie diese seltsame Gedächtnisstadt funktioniert, bleibt trotz aller Bemühungen der Wissenschaft ein Geheimnis, so tiefgründig wie die dunklen Tiefen der Ozeane. Ganze Bibliotheken kann man füllen mit den Spekulationen und Forschungsergebnissen über Erinnern, Vergessen, Verdrängen, Kurz- und Langzeitgedächtnis, aber eine letzte Klarheit über seine Arbeitsweise hat man bisher nicht bekommen.
Tatsächlich kann man ein bestimmtes Erlebnis ein Jahr, zehn, ja vierzig Jahre vergessen, die Zeit verwischt, wie man sagt, die Spuren, dann aber geschieht etwas, der Tod eines nahestehenden Menschen, eine unerwartete Begegnung mit einer Person, mit einem Ort, ja manchmal reicht ein Duft, und plötzlich ist alles wieder da. Seine Nase schien Salman der Schlüssel zum Tor vieler Erinnerungen zu sein. Der Geruch einer Gasse in Rom genügte, und schon stand ihm ein Ereignis in seiner Gasse fünfzig Jahre zuvor vor Augen …
Salman hatte das meiste aus seiner bewegten Vergangenheit in Syrien vergessen und lebte zufrieden in Rom mit seiner Familie. Nie aber vergaß er, weshalb er sein Land illegal verlassen hatte. Die Schießerei, der schwerverletzte Polizist und sein um Gnade flehender Blick, die Flucht und die drohende Verhaftung, der er im letzten Augenblick entkommen war, suchten ihn in seinen Albträumen heim, in den ersten Jahren häufig, später immer seltener.
In den Anfangsjahren kamen seine Eltern ihn von Zeit zu Zeit in seiner ersten Exilstadt Heidelberg besuchen. Aber sein Vater fühlte sich in der alten romantischen Stadt am Neckar nicht wohl, ebenso wenig wie später in Salmans zweiter Exilstadt Rom. Sophia, seine Mutter, liebte dagegen seine freundlichen Nachbarn hier wie dort, vor allem aber war sie neugierig auf fremde Sitten und Gerichte. Als Salman ihr sowohl in Heidelberg als auch in Rom vorschlug, in einem arabischen Lokal zu essen, winkte sie ab. »Ich komme nicht hierher, um arabisch zu essen. Das habe ich in Damaskus.«
Neugieriger als ein Ethnologe betrachtete sie die Lebensweise der Deutschen und Italiener, sie wollte genau wissen, wie sie essen, lachen, weinen, trauern, sich freuen, arbeiten, sich amüsieren, heiraten und sich scheiden lassen. Und noch bevor Salman sich versah, stand Sophia eines Tages schwarz gekleidet auf dem Friedhof bei der Beerdigung einer seiner Nachbarinnen und weinte erbärmlich, obwohl sie die Frau nicht einmal gekannt hatte. »Ich weine über meine toten Freunde, über mich, da ich von dir getrennt wurde, und über diese elende Menschheit, die den Tod nicht versteht«, sagte sie auf Salmans Frage.
Sein Vater blieb dagegen in der Wohnung sitzen, mit einer Miene, als läge ihm ein Pfund Reißnägel im Bauch. Er hatte Angst, allein irgendwo hinzugehen, als lauerte die Mafia hinter der nächsten Straßenecke. Nur wenn Salmans Frau Stella ihn in ihrer unnachahmlichen Art darum bat, kam der alte Herr mit, ließ sich aber anmerken, dass er es nur ihr zu Gefallen tat. Er nörgelte leise auf Arabisch, damit Stella ihn nicht hörte, er vermisse sein Stammcafé und seine Freunde und seine Tageszeitung. Auch schmeckte ihm weder die deutsche noch die italienische Küche. In späteren Jahren erlitt der Vater einen leichten Herzinfarkt und hatte nun eine glaubwürdige Begründung, jede Reise abzusagen.
Normalerweise ging es ihm recht gut. Sobald aber die Mutter anfing, von ihrem Sohn und von Rom zu erzählen, legte er sich ins Bett und wollte tagelang nicht mehr aufstehen. Einmal sagte die Mutter lachend zu Salman am Telefon, immer wenn sie ihren Mann ruhigstellen wolle, erzähle sie ihm, sie hätte sich gerade nach einem günstigen Last-minute-Flug nach Rom erkundigt. Der Vater bekäme dann sofort Fieber, das man tatsächlich messen konnte, und sie habe ihre Ruhe und könne ihre Damaszener Freundinnen alleine besuchen, ohne den ewigen Nörgler.
Salmans Verbindung nach Damaskus war also seit dem Herzinfarkt seines Vaters lockerer geworden. Sie beschränkte sich auf ein Telefonat im Monat, bei dem es immer um dieselben Dinge ging, was die Mutter gerade koche, wen sie besucht habe und wer sich einen Skandal geleistet oder geheiratet habe, wer sich scheiden ließ oder gestorben war. Oft lachte Salman Tränen bei diesen Gesprächen mit der Mutter. Sie war witzig und besaß ein unerschöpfliches Reservoir an Gerüchten und Anekdoten. Aber die in seinem Gedächtnis schlummernden Jahre waren bei diesen Gesprächen nicht zum Leben erwacht.
Und dann kam im Januar 2010 die Generalamnestie für alle politisch motivierten Vergehen. Hassan Kadur, der syrische Botschafter in Rom, ein sympathischer Mann, mit dem Salman seit fast einem Jahr gut bekannt war, fragte im März noch einmal in Damaskus nach, ob etwas gegen Salman vorliege: Antwort negativ. Aber obwohl der Botschafter ein äußerst kluger und welterfahrener Diplomat war, weigerte sich Salman, ihn in der syrischen Botschaft, an der Piazza d’Aracoeli, zu treffen. Er lud ihn lieber in das nahe und vornehme »Gran Caffè Roma« ein, wo man köstliche Gerichte vorgesetzt bekam und in aller Ruhe miteinander sprechen konnte, ohne Angst, dass man abgehört wurde.
Salman wollte kein Risiko eingehen. Er hatte zwar einen deutschen Pass, aber was hilft das in einer Diktatur? Er erinnerte sich an die engagierte Studentin und Sozialarbeiterin Elisabeth Käsemann, die 1977 vor den Augen der Welt vom argentinischen Geheimdienst verhaftet, gefoltert und ermordet worden war. Die Menschen waren empört gewesen, aber die deutschen Politiker hatten nichts für sie getan. Salman wusste von ähnlichen Fällen in Chile, Kuba, Brasilien, Irak und Saudi-Arabien. Im Augenblick der Verhaftung ist man absolut isoliert und die Diktatur, die einen gefangen hält und foltern lässt, wird auch noch von West und Ost hofiert. Die Angst saß Salman also tief in den Knochen, und er wollte ganz sichergehen.
Er bat über seine Mutter seinen Cousin väterlicherseits, Elias, in Damaskus Nachforschungen anzustellen, und dieser versicherte nach einer Woche: In keiner der fünfzehn Abteilungen des Geheimdienstes und an keiner Grenzstelle des Landes sei irgendetwas gegen Salman verzeichnet. Elias musste es wissen. Er war selbst ein hoher Offizier des Geheimdienstes.
Nachdem Salman diese letzte Sicherheit erhalten hatte, wurde die Erinnerung an die Jahre in Damaskus und an die Flucht so lebendig, als wäre alles gestern erst geschehen.
Ein Leben auf der Flucht
Auf einmal konnte Salman die Ereignisse vor vierzig Jahren wie einen gut erhaltenen Dokumentarfilm vor seinem inneren Auge ablaufen lassen und jede Aufregung mit klopfendem Herzen wieder erleben.
Er wusste genau, wie der Augenblick seiner gelungenen Flucht schmeckte. Erleichtert hatte er aufgeatmet, als das Sammeltaxi den Kontrollpunkt an der syrisch-libanesischen Grenze passierte. Der Taxifahrer hatte dem syrischen Grenzpolizisten versichert, es sei alles in Ordnung, und ihm die vier Pässe seiner Fahrgäste überreicht. Vorn saß eine beleibte Dame, in Schweigen und schlechte Laune gehüllt. Sie trug eine Sonnenbrille und schaute während der zweistündigen Fahrt regungslos nach vorne wie eine Gipsfigur, ohne ein Wort mit dem Taxifahrer oder den anderen Fahrgästen zu wechseln. Hinten rechts am Fenster saß Salman, neben ihm ein kleiner alter Mann, der, sobald man nicht mit ihm redete, in tiefen Schlaf fiel. Wenn er aufwachte, verfluchte er seine Altersschwäche und schlief sofort wieder ein. Hinter dem Taxifahrer saß ein düster dreinblickender dunkelhäutiger Palästinenser.
Salman konnte vor Spannung kaum noch atmen. Sein Herz raste. Sein Pass war zwar eine sehr geschickte Fälschung, aber er hatte trotzdem Angst, weil er wusste – obwohl damals keine elektronische Überprüfung möglich war –, dass die Grenzpolizei über geheime Methoden verfügte, um gefälschte Pässe zu erkennen. Seine Sorge erwies sich als unnötig. Der Polizist war mit dem Taxifahrer befreundet und erledigte die Sache in eigener Regie, ohne die Pässe bei der Prüfstelle im Gebäude abzugeben. Willkür gepaart mit einem niedrigen Pflichtbewusstsein konnte, wenn es auch selten vorkam, durchaus von Vorteil sein.
Der Polizist war stämmig und dunkelhäutig, Salman betrachtete ihn mit Herzklopfen, ein Beduine, dachte er, als er die drei blauen Punkte auf Kinn, Nase und Wange des Mannes sah. Es war ein primitives Tattoo, das vor allem Beduinen trugen. Dieser blätterte gelangweilt in den Pässen, warf immer wieder einen Blick ins Wageninnere und flüsterte die Namen halblaut vor sich hin. Dann gab er dem Taxifahrer die Pässe zurück und fragte: »Und was gibt es als Nachtisch?«
»Mandur, die beste Schokolade«, erwiderte der Taxifahrer routiniert.
»Gut, aber wehe, du vergisst sie«, sagte der Polizist und winkte mit der Hand das nächste Auto in der Warteschlange zu sich. Der Taxifahrer gab Gas, und als er sicheren Abstand gewonnen hatte, sagte er: »Seitdem er aufgehört hat zu rauchen, ist er süchtig nach Schokolade. Früher hat mich eine Stange amerikanischer Zigaretten am Beiruter Hafen drei Dollar gekostet, jetzt kostet die Schachtel Mandur-Pralinen zehn libanesische Lira, das sind ebenfalls drei Dollar. Dem verlausten Beduinen schmecken nur libanesische Pralinen.« Nach einer Pause setzte er hinzu: »Habe ich euch nicht versprochen, mit mir werdet ihr eine glatte Fahrt haben? Manchmal beschweren sich die Fahrgäste, dass ich zwei Lira mehr verlange, aber ist das nicht besser, als eine Stunde in der Sonne zu schmoren, bis sie drinnen die Pässe untersucht haben?« Mit diesen Worten fuhr er winkend an den libanesischen Grenzpolizisten vorbei in den Libanon.
Salman schaute nach hinten, der syrische Grenzposten verschwand langsam, und er hätte am liebsten ausgerufen: »Ihr kriegt mich nicht, Hurensöhne!«, aber er dachte an den alten Mann neben sich, der wieder eingeschlafen zu sein schien, und wollte ihn nicht erschrecken. Die Frau war auch während der Kontrolle stumm geblieben. Der düstere Palästinenser entpuppte sich jetzt als ein simpler Damenfriseur. Er erzählte weitschweifig, er wolle sich in Beirut ein Visum für Kanada verschaffen, da in Kanada Damenfriseure sehr gefragt seien. Er habe für diese Information zweihundert Dollar bezahlt und dazu noch ein Empfehlungsschreiben vom Chef der Friseurgilde bekommen.
Auch der Dummkopf wird für weise gehalten, solange er schweigt, dachte Salman. Der Taxifahrer dachte wahrscheinlich ähnlich. Er lachte höhnisch. »Ja, weil den Kanadierinnen dauernd die Haare zu Berge stehen, durch die Kälte«, sagte er giftig. Salman vergaß seinen Kummer und musste lachen über den naiven Palästinenser. »Junge, Junge«, sprach der Taxifahrer vor sich hin, als würde er zu sich sprechen, »wenn du zweihundert einzelne Dollarscheine aus dem Fenster segeln ließest, hättest du damit vielleicht hundert Kindern Freude gemacht.« Der junge Palästinenser fühlte nagenden Zweifel und zog die Maske seiner schlechten Laune wieder über. Auch der Taxifahrer verkroch sich in seine Gedankenwelt, rauchte bei offenem Fenster und widmete Salman ab und zu einen prüfenden Blick über den Rückspiegel.
Salman schloss die Augen, Schlaf vortäuschend, und flüchtete in seine Erinnerungen. Flucht, dachte er auf einmal, ist wie ein Schicksal, wie ein Omen und stetiger Begleiter der arabischen Kultur. Merkwürdig! Die Juden beginnen ihre Zeitrechnung mit der Erschaffung der Welt, die nach rabbinischer Tradition auf das Jahr 3761 v. Chr. zurückgeht. Die Christen beginnen ihre Zeitrechnung mit der Geburt Christi, aber der Islam verbindet die Zeitrechnung mit der Flucht des Propheten Muhammad von Mekka nach Medina, die sein Leben und seine Mission rettete. Alle Versuche, den muslimischen Kalender auf die Geburt oder den Tod des Propheten umzudatieren, sind gescheitert.
»Flucht ist Neubeginn, ist Hoffnung. Sie ist Klugheit, und Klugheit wird oft als Feigheit missverstanden«, hörte Salman sich sagen. Durch die Flucht war er dem Tod entkommen.
Sein bisheriges Leben war eine Kette von Auswanderungen und Trennungen gewesen. Seine Mutter hatte ihm erzählt, dass sie mit ihrem Mann damals in der Bagdader Straße gewohnt hatte, dort war er auch zur Welt gekommen. Drei Wochen nach seiner Geburt musste seine Familie aus Damaskus flüchten, weil Musa Bandar, der Chef einer Erpresserbande, Salmans Vater bedrohte, wenn er keine Schutzgelder zahle, würde man seine Goldschmiede plündern und ihn töten.
Sie flüchteten nach Aleppo, wo Salmans Vater mit Hilfe seiner Verwandten schnell eine neue Goldschmiede eröffnen konnte und vier Jahre lang erfolgreich arbeitete. Erst als der Verbrecher Musa Bandar von der Polizei erschossen worden war, kehrten sie mit dem Jungen nach Damaskus zurück. Hier wohnten sie sechs Jahre im neuen Stadtviertel Salihije in einem kleinen Haus. Salman ging dort in eine katholische Schule, in der es ihm gefiel. Mit seinem Charme eroberte er die Herzen der anderen. Doch dann kaufte sein Vater das große herrschaftliche Haus in der Altstadt, in der Miskgasse, nahe der Eliteschule der »Lazaristen«, und Salman musste mit zehn Jahren als völliger Neuling wieder von null anfangen. Später sollte er sagen, das dauernde Umziehen in seiner Kindheit sei die beste Übung für das Exil gewesen.
Ein Theatermann am falschen Ort
Der französische Orden der Lazaristen war im Jahre 1625 in Paris gegründet worden, um den Armen zu helfen. In Damaskus aber war diese Schule eine von vier Eliteschulen für die Söhne der Reichen.
Die Schule wurde seit Ende der fünfziger Jahre von einem libanesischen Pfarrer namens Josef Ata geleitet, einem bekannten Theologen und strengen, aber gerechten Mann. Er verlangte von Schülern und Lehrern den Respekt, den er auch ihnen entgegenbrachte. Er scheute sich nicht, vor der versammelten Schüler- und Lehrerschaft seine Fehler zuzugeben und um Entschuldigung zu bitten. Das grenzte in der arabischen Kultur an ein Wunder, wenn ein Mächtiger seine Fehler zugab. Bereits Anfang der sechziger Jahre hatte er die besten Lehrer, die das Land aufzubieten vermochte, um sich geschart. Darunter befand sich auch Pater Michel Kosma, der Rhetorik und Ethik unterrichtete. Er hatte in seiner Jugend in Paris Theaterwissenschaft und Philosophie studiert. Nach einer katastrophal unglücklichen Liebe zu einer jungen Schauspielerin zog er sich für immer in sein theologisches Schneckenhaus zurück. 1956 trat er dem Orden der Lazaristen in Paris bei und wurde Priester, kurz darauf kehrte er in seine Heimatstadt Damaskus zurück.
Er war ein genialer Regisseur, und schon nach kurzer Zeit konnten die Schüler der Oberstufe Theaterstücke von Weltrang aufführen, die in Damaskus, Beirut, Amman und Bagdad Kritiker wie einfache Zuschauer begeisterten. Salman spielte leidenschaftlich mit, er lernte deutlich und frei vorzutragen und seine Mimik und Gestik zu beherrschen. Pater Michel Kosma behandelte ihn wie ein fürsorglicher Bruder. Er nannte Salman, auch als dieser bereits sein Abitur gemacht hatte, »mon petit cousin«. Salman hielt dies zuerst für einen netten Scherz, später sollte er von seinem Vater erfahren, dass ihre Urgroßväter Brüder gewesen waren. Für die weiblichen Rollen engagierte Michel Kosma Mädchen aus der Oberstufe der Herz-Jesu-Mädchenschule (Sacré ). Er mahnte seine pubertierenden Schüler, die Mädchen unter allen Umständen rücksichtsvoll zu behandeln. »Weil sie mutig und auch weil sie eure Gäste sind«, wiederholte er immer wieder, doch die von Hormonen getrübten Hirne der Jungen sahen in den frühreifen Mädchen nur willige Objekte ihrer Begierde, und so kam es immer wieder zu erotischen Liebschaften und 1963 zur Katastrophe.
Ein Jahr bevor Salman das Abitur machte, erlitt Pfarrer Kosma eine herbe Niederlage. Ein brunftiger Junge, blind vor Geilheit, vergriff sich an einer blassen Schülerin aus einer mächtigen christlichen Familie. Er hätte sie beinahe vergewaltigt, wenn der Pförtner das schreiende Mädchen nicht im letzten Augenblick gerettet hätte. Auf der Stelle und ohne den Pfarrer anzuhören, verbot Maximus ., der damalige Patriarch der katholischen Kirche, das Theater in der Lazaristenschule. Kosma wurde scharf gerügt und ein Jahr von all seinen Tätigkeiten suspendiert. Salman besuchte ihn oft in seiner Zelle, einem kargen Zimmer mit einer Pritsche und einem kleinen schäbigen Tisch. Kosma weinte wie ein verlassenes Kind.
Ein zweiter Lehrer fing Salman auf, der nach der Bestrafung und Misere seines Cousins jedwede Lust an der Schule verloren hatte. Es war der Physiklehrer, ein junger französischer Pfarrer namens François Seumeux. Er besuchte Michel Kosma täglich und konnte ihn als Einziger zum Lachen bringen.
Wie wenn er von diesem beauftragt worden wäre, begann er sich um Salman zu kümmern. Im Gegensatz zu dem konservativen Cousin war Pater François linksradikal. Er versorgte Salman mit französischen Büchern und debattierte mit ihm über Filme und Romane. Physik war seine Leidenschaft, aber er war belesen und kannte sich sehr gut aus in der Weltliteratur.
Es war ein Buch mit Theaterstücken von Jean Genet, das Salmans Freundschaft mit dem jungen Pfarrer Seumeux besiegelte. Von nun an trafen sich die beiden öfter, machten ausgedehnte Spaziergänge und sprachen über Gott und die Welt. Wie Genet nahm auch Seumeux Partei für die Schwachen. Er vertraute Salman an, er sei ins Kloster gegangen, um keine Waffe tragen zu müssen. Damals war es in Frankreich unmöglich, den Militärdienst zu verweigern, darauf stand eine harte Gefängnisstrafe. Wie Genet trat auch Seumeux für die Befreiung der Kolonien ein und vor allem für Algeriens Unabhängigkeit.
Seumeux lieh Salman Bücher über den Sozialismus und debattierte auch darüber lange mit ihm. Er las mit ihm Schriften von Saint-Simon, Camus, Sartre und die Klassiker der Aufklärung. Salman saugte alles auf und fühlte eine große Empörung gegen das Unrecht, das auf der Welt geschah, doch er konnte sich noch nicht vorstellen, selbst etwas dagegen zu tun.
Die Metamorphose eines Idealisten
Eines Nachts sah Salman auf dem Weg nach Hause einen Mann, der neben der Mülltonne einer Villa saß und etwas aus dem Abfall aß. Salman traute seinen Augen nicht. Er näherte sich dem Mann und erfuhr, dass dieser seit zwei Tagen nichts erbettelt und deshalb auch nichts gegessen hatte. Er war ein Bauer, der wegen seiner Schulden in die Stadt geflüchtet war. Salman gab ihm alles Geld, das er in seiner Tasche fand, und lief schnell davon. Zu Hause saßen seine Eltern an diesem Sonntag mit Geschäftsfreunden bei Champagner, Wein und bester Küche. Zum ersten Mal fühlte Salman eine tiefe Abneigung gegen seinen Vater und gegen seine wohlhabende Familie. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen.
Nach einer kurzen Phase der Demokratie von nicht einmal 18 Monaten putschte die Armee im März 1963 und verhängte das Notstandsgesetz. Unter den Putschisten kämpften mehrere Fraktionen um die Oberhand. Langsam stieg ein unauffälliger Offizier der Luftwaffe namens Hafiz al-Assad erst zum heimlichen und dann zum unheimlichen Herrscher des Landes auf. Er besaß weder Charme noch die Gabe der Rede, aber er war verschwiegen, brutal und ein Meister der Verschwörungen.
Salman wurde im Herzen ein Sozialist, aber mit der syrischen Kommunistischen Partei wollte er nichts zu tun haben. Seiner Meinung nach war sie moskauhörig, korrupt und wurde genau wie die Regierung von einer Sippe geführt. Die Kommunistische Partei wurde zur Firma der Familie Bakdasch. Sie war dem syrischen Regime und Moskau zugleich untertan. Er und seine Freunde aber glaubten, dass die Diktatur in Syrien durch selbstlose Kämpfer gewaltsam gestürzt werden müsste.
Salman studierte Mathematik und Physik, nebenbei aber besuchte er Vorlesungen über Geschichte und Philosophie. Er studierte, um nicht in der Armee einen zweijährigen brutalen Militärdienst ableisten zu müssen. Solange er studierte, war er davon freigestellt. Und er brauchte Zeit, um nachzudenken, was er mit seinem Leben anfangen wollte.
Ende Juni 1967, kurz nach der verheerenden Niederlage der arabischen Staaten gegen Israel, ging er mit vier Freunden und seinem Cousin Elias, der gerade siebzehn geworden war, in den bewaffneten Untergrund. Er tat das nicht, um gegen Israel zu kämpfen, sondern um das syrische Regime zu stürzen. Die überwältigende Mehrheit der Araber glaubte, dass weniger die Stärke Israels ihre Niederlage verursacht hatte, als vielmehr die Unfähigkeit der arabischen Regierungen, die sich allein auf die Demütigung ihrer eigenen Völker spezialisiert hatten. Aber nur wenige Oppositionelle waren auch bereit, ihr Leben für die Niederwerfung dieser Regime zu opfern. Salman war einer von ihnen. Von da an war er offiziell auf der Flucht.
Beirut, die Fata Morgana der Schweiz
Der Taxifahrer hupte einem entgegenfahrenden Kollegen zu. Salman öffnete die Augen und schaute zum Fenster hinaus. Sein Blick wanderte über die grünen Hügel. Die Apfelbäume standen in voller Blüte. Er atmete tief den Duft ein und dachte, dass Freiheit nach Apfelblüte riecht. Und für einen Augenblick vergaß er Flucht und Exil.
In jenem Frühjahr lebte der Libanon noch in Frieden. Erst 1975 fünf Jahre später, sollte der Bürgerkrieg ausbrechen und fünfzehn Jahre lang wüten. Man nannte das kleine Land am Mittelmeer seiner Banken und schneebedeckten Berge, seines europäischen freiheitlichen Lebensstils und seiner Neutralität in allen politischen Konflikten wegen auch die »Schweiz des Orients«. Eine beliebte, aber falsche Bezeichnung, ein Schlagwort, erfunden für Leute, die hilflos zur erstbesten Orientierungshilfe greifen. Weder in seinen schönen noch in seinen hässlichen Seiten hatte der Libanon irgendetwas von der Schweiz. Und Beirut, das große Herz des kleinen Landes, kann mit keiner Stadt in der Schweiz verglichen werden. Zürich ist im Vergleich zu Beirut ein geordnetes, braves Pensionat mit einer Bank, einer Boutique und einem Restaurant im Erdgeschoss. Beirut war ein Planet mit eigenen Gesetzen oder eher ohne jedes Gesetz. Die Stadt empfing großzügig alle, Verbrecher wie Unschuldige, Milliardäre wie Bettler, Pazifisten wie Waffen- und Drogenbarone. Nirgends in der arabischen Welt wurden so viele Bücher gedruckt wie hier. Die meisten davon waren für die anderen arabischen Länder bestimmt, dorthin wanderten sie legal und illegal über mutige Passagiere, Touristen, Händler, Taxi- und Lastwagenfahrer.
In Beirut waren damals die Oppositionsparteien aller arabischen Länder aktiv. Sie agierten gegen die Diktatoren in ihrem jeweiligen Land und wurden nicht selten von einem anderen Diktator finanziert. Hier ließ es sich illegal gut leben, wenn man keinem der über zwanzig Geheimdienste, die auf der Drehscheibe Beirut tanzten, auf den Fuß trat. , , Mossad und die Agenten der arabischen Geheimdienste waren hier Dauergäste. Auch über zehn bewaffnete Organisationen der Palästinenser beherbergte die Stadt.
Salman selbst kannte den Libanon von einem illegalen Aufenthalt vor drei Jahren in einem Trainingslager für Guerilleros. Neben den Palästinensern und anderen Arabern wurden dort auch Deutsche und Japaner ausgebildet.
Mit einer kleinen Gruppe von radikalen Männern und Frauen aus Syrien war Salman damals zu den Palästinensern gegangen, um zu lernen wie man mit der Waffe kämpft, wie man im Untergrund agiert und lebt, kurz, um sich als Revolutionär in den Volksmassen wie »ein Fisch im Wasser« bewegen zu können, wie es Mao ausdrückte. Die meisten unter den Kämpfern waren ehemalige Studenten, die Mao, Ho Chi Minh und Che Guevara lasen und nachahmen wollten.
Zu jener Zeit hatte Salman unauffällig mit einer falschen Identität in einem Palästinenserlager im Süden des Libanon gelebt. Kälte und Misstrauen herrschte unter den verschiedenen Gruppen, und es war streng verboten, Kontakt zu Fremden aufzunehmen. Die Trainer waren brutale, primitive Sadisten. Das Ganze glich eher einem Gefangenenlager als einem Ort, an dem das idealistische Projekt einer freiheitlichen Zukunft geschmiedet wurde.
Nun, wenige Jahre später, kam er wieder in den Libanon, auch diesmal mit falschen Papieren, aber nicht, um den Umgang mit Waffen und Sprengstoff zu lernen, sondern einfach um zu überleben. Diesmal durfte er bei seiner Tante Amalia wohnen. Sophia, seine Mutter, hatte ihn im Untergrund über Umwege wissen lassen, wenn er aus Syrien lebend herauskomme, wolle Tante Amalia ihn gerne aufnehmen. Das überraschte ihn, weil Tante Amalia zwar seine Mutter mochte, mit ihrem Bruder, Salmans Vater, aber auf Kriegsfuß stand.
Tante Amalia und die drei Rebellionen
Der Grund der Feindseligkeit lag über dreißig Jahre zurück. Amalia hatte den Mann geheiratet, den sie liebte, und nicht den, den ihre Mutter, ihr Vater und ihre zwei Brüder, Salmans Vater Jusuf und Onkel Anton, Elias’ Vater, für geeignet hielten. Sie hatte Said Bustani an der Universität kennengelernt. Beide studierten Literatur und Philosophie. Er war ein hochbegabter Libanese aus armen Verhältnissen und, als hätte das nicht genügt, auch noch »evangelisch« – dieses Wort benutzte Salmans Vater nie. Er sagte Protestant, gepresst ausgesprochen mit dem Hinweis, das seien armselige, durch amerikanische und deutsche Missionare in die Irre geführte arabische Christen. Und obwohl Amalia ein paar Jahre älter als ihre Brüder Jusuf und Anton war, galt deren Meinung mehr als ihre.