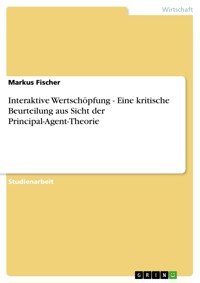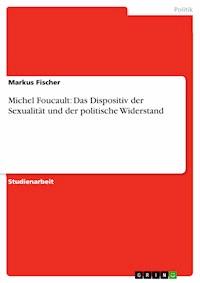Soziale Kompensation mit Hinblick auf Chancengerechtigkeit im Vergleich zwischen John Rawls 'Theorie der Gerechtigkeit' und Amartya Sens 'Verwirklichungschancen-Ansatz' E-Book
Markus Fischer
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 2,0, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Sprache: Deutsch, Abstract: Für die moderne Gesellschaft kann es nicht ausreichend sein, den formalen Schein zu wahren, es ginge gerecht zu, wenn dies bedeutet, so viele Güter und Mittel wie möglich nach unten zu verteilen. Es ist im Sinne der Chancengerechtigkeit nicht richtig, dass sich jeder mit seinem Leben zufrieden geben kann, weil es ihm durch Umverteilungen besser geht als ohne, wenn er niemals die Chance hatte seine Ziele verfolgen zu dürfen. Wenn die Chancengerechtigkeit einen positiven Begriff von Freiheit benutzt, dann vor allem aus dem Grund, dass es für ein Leben in Würde notwendig ist, nicht allein auf Hilfe anderer angewiesen zu sein, sondern die Chance zu erhalten, sein Leben selbstbestimmt zu führen. Wenn sich bestimmte soziale Ungleichheiten systematisch über Generationen fortpflanzen, dann bedeutet negative Freiheit nichts anderes, als die Verteidigung von Privilegien gegenüber weniger Privilegierten oder allgemeiner gesagt: die Verteidigung eines beliebigen gesellschaftlichen Zustands. Die „basal equality“ der Chancengerechtigkeit wäre also die Freiheit des Individuums, sich gemäß seiner Wünsche und Fähigkeiten ausleben zu können. Dies wäre eine ungleiche oder anders gesagt komplexe Gleichheit: Eine Form sozialer Kompensation, die berücksichtigt, dass menschliches Wohlbefinden auch jenseits des Materiellen entsteht, aber auch zur Kenntnis nimmt, dass der Selbstverwirklichung Grenzen gesetzt sind. Grenzen, die im Individuum selbst und in der gesellschaftlichen Struktur liegen. Nötig ist also ein differenzierter Ansatz zur Beurteilung menschlichen Wohlbefindens, wie ihn Sen vorschlägt und die Schaffung gerechter gesellschaftlicher Grundstrukturen, wie sie Rawls fordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Verteilungsgerechtigkeit und Kompensation
2.1 Warum Verteilen ein Problem der Gerechtigkeit ist
2.1.1 Soziale Ungleichheit
2.1.2 Formen der Verteilungsgerechtigkeit
2.1.3 Bedarfsprinzip
2.1.4 Leistungsprinzip
2.2 Chancen und Gerechtigkeit
2.2.1 Bildung und Einkommen
2.2.2 Vererbte Ungleichheiten – schichtspezifischer Zugang zu Bildung
2.2.3 Gerechtigkeitsvorstellungen der Deutschen
2.2.4 Von der Chancengleichheit zur Chancengerechtigkeit
3. John Rawls „Theorie der Gerechtigkeit“
3.1 Das Ziel der Gerechtigkeit
3.2 Der Urzustand und die Wahl der Grundsätze
3.3 Der Vorrang der Freiheit
3.4 Prinzipien der Verteilung
3.4.1 Ansprüche auf Grundgüter und Existenzminimum
3.5 Die Rolle der Chancengleichheit in der Theorie der Gerechtigkeit
3.6 Rawls und die Chancengerechtigkeit
4. Amartya Sens „Verwirklichungschancen-Ansatz“
4.1 Freiheit und Unterschiedlichkeit von Menschen
4.2 Capabilities and functionings
4.3 Der „evaluative space“ und interpersonale Vergleiche
4.4. Sen und die Chancengerechtigkeit
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
7. Abstract / Zusammenfassung
1. Einleitung
Der Vorsitzende der FDP, Guido Westerwelle, sagte in einer Rede auf dem Dreikönigstreffen der FDP im Januar 2005: „Sozial ist eben nicht die noch so intelligente Verteilung von staatlichen Leistungen. Sozial ist, was Arbeit schafft.“[1] Wird der etwas inhaltsleere Begriff des Sozialen ergänzt durch Begriffe wie Gerechtigkeit oder Solidarität, um die es in dieser Rede auch ging, dann scheint der FDP-Vorsitzende den gesamten Gerechtigkeitsdiskurs der vergangen Jahrzehnte absichtlich oder unabsichtlich auf einmal vom Tisch zu wischen und ihn auf einen kleinen Teilausschnitt zusammenzuschmelzen. Soziale Gerechtigkeit sei demnach ein bloßes Messinstrument gesellschaftlicher Effizienz und eine Gesellschaft dann gerecht, wenn alle oder wenigstens der größte Teil in Lohn und Brot stünden. Dass sich die Frage nach sozialer Gerechtigkeit nicht ganz so einfach beantworten lässt, zeigt schon der Unwille vieler Menschen einen Arbeitsplatz anzunehmen, der nicht ihren Qualifikationen entspricht oder aber beispielsweise die Unzufriedenheit mit einer lediglich befristeten Stelle. Das Gerechtigkeitsempfinden hat also auch etwas mit Zufriedenheit mit der eigenen sozialen Lage zu tun oder allgemeiner gesagt: mit dem Wohlbefinden.
Manche Eltern müssen ihre Kinder über immer längere Zeiträume finanziell unterstützen und bekommen im Alter weniger zurück[2]: die Umkehrung des Generationenvertrags. Ein anderer Aspekt ist also die mangelnde Perspektive, die beklagt wird, denn eine Teilzeitarbeit oder ein bezahltes Praktikum tragen selten zum persönlichen Fortschritt oder sozialen Aufstieg bei. Gerechtigkeit lässt sich nicht nur auf Effizienz reduzieren, sie ist eine moralische Forderung.
Soziale Ungleichheit liegt vor, wenn „Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den wertvollen Gütern einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere erhalten.“[3] Aus dem Tatbestand der sozialen Ungleichheit lassen sich dann Gerechtigkeitsforderungen ableiten, wenn systematische Vor- oder Nachteile mit einer sozialen Position verbunden sind. Dass bestimmte Berufe oder Positionen mit mehr oder weniger Gehalt verbunden sind, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch ungerecht zugeht. Ungerecht wäre es aber, wenn systematische Ungleichheiten z.B. aufgrund des Geschlechts oder der Schichtzugehörigkeit produziert würden.
Für die soziale Situation in Deutschland lassen sich wenigstens zwei Aspekte festhalten: 1. Bildung ist das entscheidende Gut für Wohlstand in Deutschland und 2. Der Zugang zu Bildung in Deutschland hängt stark von der sozialen Herkunft ab. Ein fairer Wettbewerb um die Verteilung sozialer Vor- und Nachteile liegt in Deutschland nicht vor.
In Umfragen bestätigen die Deutschen, dass ihnen dieser Umstand intuitiv bewusst ist. Eine Mehrheit wünscht sich mehr Chancengleichheit und eine Verteilung gemäß dem Leistungsprinzip.
Gerechtigkeit ist nicht nur eine Frage des Outputs. Es genügt nicht Menschen in irgendeine Art von Arbeit zu bringen, sie müssen das Gefühl haben, selbstbestimmt zu handeln und für ihre Leistungen belohnt zu werden.
Aus diesen Ergebnissen folgt, dass soziale Ungerechtigkeit durch ein Prinzip angegangen werden sollte, das den Menschen die Möglichkeit einräumt ihre Fähigkeiten und Vorstellungen zu realisieren. Dieses Prinzip soll Chancengerechtigkeit genannt werden. Der Chancengerechtigkeitsbegriff ist eine Reinterpretation des von Sylvia Ruschin verwendeten Begriffs[4]:
Chancengerechtigkeit bedeutet 1. die Maximierung der relativen Chancen aller (Chancenprinzip), also die Bereitstellung auf die persönlichen Fähigkeiten zugeschnittener Angebote, auch wenn dies 2. den Wohlstand einzelner Personen oder Gruppen mindern sollte (Solidaritäts- oder Generationenprinzip) und 3. Ungleichverteilung durch einen fairen Wettbewerb zu legitimieren (Leistungsprinzip).
Chancengerechtigkeit enthält also zwangsläufig eine positive Bestimmung des Freiheitsbegriffs: die tatsächliche Möglichkeit sich gemäß seiner Fähigkeiten verwirklichen zu können. Chancengerechte Ergebnisse können nur durch diese Voraussetzung erzielt werden. Ein negativer Freiheitsbegriff, der in seiner Wirkung als ein Abwehr- oder Verteidigungsrecht von Eigentumsverteilungen oder bestehenden sozialen Verhältnissen verstanden wird, kann dem Prinzip gerechter Chancenverteilungen nicht genügen. Der Begriff der Chancengerechtigkeit verfolgt die Idee jeder Person eine gerechte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, den hier verwendeten Gerechtigkeitsbegriff an zwei populären Gerechtigkeitstheorien der Gegenwart zu messen.
Wird sich mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt so ist dies heute ohne Bezug auf John Rawls „Theorie der Gerechtigkeit“ fast unmöglich. Wolfgang Kersting ist sogar der Ansicht, dass Rawls der erste politische Philosoph seit Aristoteles ist, der sich wieder ernsthaft dem Problem der sozialen Gerechtigkeit gewidmet hat.[5] Ob diese Aussage nun zutrifft oder nicht, John Rawls „Theorie der Gerechtigkeit“ galt schon zu seinen Lebzeiten als Klassiker. Für John Rawls geht es um die Herstellung einer gerechten Grundstruktur der Gesellschaft, also gerechter Verfahren, die zu gerechten Ergebnissen führen. Ungleichheiten sind nur gemäß seinem berühmten „Differenzprinzip“ zuzulassen, welches fordert, die Lage der am wenigsten Begünstigten einer Gesellschaft zu verbessern. Seine Idee fairer Chancengleichheit folgt diesem Prinzip.
Ein anderer Ansatz für gerechte Verteilungen stammt von dem Nobelpreisträger Amartya Sen. Sein „capability approach“ nimmt seinen Ausgang in der Kritik an den etablierten Gerechtigkeitstheorien vor allem utilitaristischer Prägung und eben ausdrücklich der Theorie von John Rawls. Nach Sen können gerechte Ergebnisse nicht aufgrund einer (Gleich-)Verteilung von Einkommen oder Ressourcen, wie z.B. die Grundgüter bei Rawls, erzielt werden. Für eine Beurteilung der Lebenssituation von Personen müssen ihre tatsächlichen Freiheiten, bestimmte, für eine gesellschaftliche Teilhabe relevante, Fähigkeiten auszubilden, betrachtet werden.
Nach dem ein Begriff von Chancengerechtigkeit expliziert wurde, ist die Frage, mit der sich hier beschäftigt werden soll:
Genügen die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls und der Verwirklichungschancen-Ansatz von Amartya Sen dem Begriff der Chancengerechtigkeit?
Also die Frage ob sich mit den Konzeptionen John Rawls und Amartya Sens soziale Kompensationen rechtfertigen lassen, die sich im Sinne der Chancengerechtigkeit ergeben.
John Rawls Prinzip fairer Chancen führt häufig zu kontraintuitiven Ergebnissen und kann keine der Forderungen gerechter Chancen erschöpfend bedienen. Für Rawls ist es wichtiger den Lebensstandard (im Sinne des Besitzes bestimmter materieller Güter) der „worst-off“ zu verbessern, als ihren Möglichkeitsraum, bestimmte soziale Positionen einzunehmen, zu vergrößern. Es ist nach Rawls gerecht, wenn die am wenigsten Begünstigten geringere Chancen haben, falls sie von den Leistungen der Begünstigten profitieren.
Amartya Sens Verwirklichungschancen-Ansatz kritisiert u.a. dieses Prinzip der Güterverteilungen. Menschen sind nach Sen mit sehr unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften ausgestattet und leben in sehr unterschiedlichen sozialen und natürlichen Umgebungen. Dies kann ihre Fähigkeiten soziale Güter in Wohlbefinden umzuwandeln stark einschränken. Ein Aspekt der nach Sen von Rawls Differenzprinzip vernachlässigt wird. Für gerechte Verteilungen müssen bestimmte Menschen oder Gruppen in verschiedenster Weise gefördert, d.h. beispielsweise mit unterschiedlichen Güterbündeln ausgestattet werden, um ihre Möglichkeiten und Ziele zu verwirklichen. Sens Ansatz lässt sich weitesgehend mit dem Begriff der Chancengerechtigkeit vereinbaren. Allerdings muss beachtet werden, dass Sen keine vollständige Theorie der Gerechtigkeit zur Verfügung stellt. Es fehlen explizite normative Kriterien zur Messung von Ungerechtigkeit.
Geht es Rawls um die möglichst gleiche Ausstattung von Grundgütern, um jeder Person die formale Chance zu geben, ein gutes Leben zu führen, so ist bei Sen eine möglichst spezifische, d.h. ungleiche, Verteilung von Gütern wichtig um jedem die gleiche (substantielle) Chance einzuräumen, sich gemäß seinen Fähigkeiten zu verwirklichen.
Damit hat die Würde des Individuums, ihre Möglichkeit selbstbestimmt zu leben, bei Sen einen höheren Rang als bei Rawls. Soziale Kompensation bedeutet für Sen Hilfe zur Selbsthilfe.
Auch wenn Rawls Bedeutung für die Gerechtigkeitsdebatte nicht hoch genug bewertet werden kann, sind seit Erscheinen der Theorie der Gerechtigkeit nunmehr drei Jahrzehnte vergangen. Sens „capability approach“ weist trotz theoretischer Schwächen in die richtige Richtung, indem er Gerechtigkeit als Freiheit versteht. Es ist im Sinne der Chancengerechtigkeit nicht richtig, dass sich jeder mit seinem Leben zufrieden geben kann, weil es ihm durch Umverteilungen besser geht als ohne, wenn er niemals die Chance hatte seine Ziele verfolgen zu dürfen.
2. Verteilungsgerechtigkeit und Kompensation
2.1 Warum Verteilen ein Problem der Gerechtigkeit ist