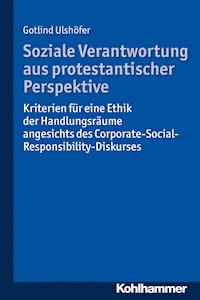
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Diskurs um soziale Verantwortung angesichts neuerer "Governance-Strukturen" im politischen und ökonomischen Bereich ist dringlicher denn je. Immer deutlicher zeigt sich die Notwendigkeit, eine Verantwortung des Sozialen im globalen Kontext zu einer Ethik der Handlungsräume zu entwickeln, die den neuen Verschränkungen von Politik und Wirtschaft im transnationalen Kontext gerecht werden kann. Das Aufgabenfeld wird in der vorliegenden Arbeit theoretisch positioniert und insbesondere auch an den vielfältigen wirtschaftsethischen Diskussionen konkretisiert, die die Entscheidungsformen wirtschaftlichen Handelns seitens der Unternehmen und des Finanzmarkts thematisieren. Dabei werden zwei Ziele verfolgt: eine Bestimmung sozialer Verantwortung in Auseinandersetzung mit der Debatte um die Corporate Social Responsibility vorzunehmen sowie eine Ethik der Handlungsräume zu entwickeln, die soziale Verantwortung in ihrer interindividuellen und institutionellen Komplexität begreifen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 853
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gotlind Ulshöfer
Soziale Verantwortung aus protestantischer Perspektive
Kriterien für eine Ethik der Handlungsräume angesichts des Corporate-Social-Responsibility-Diskurses
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2015
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Reproduktionsvorlage: Andrea Siebert, Neuendettelsau
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-028344-2
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-028345-9
epub: ISBN 978-3-17-028346-6
mobi: ISBN 978-3-17-028347-3
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich.
Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort
I. Einführung und Problemstellung
1. Soziale Verantwortung und der Bezug zur Corporate Social Responsibility-Debatte
2. Eine protestantische Perspektive auf Soziale Verantwortung und Verantwortlichkeiten und eine vorläufige Definition
3. Die Bedeutung des Sozialen im Hinblick auf die Analyse Sozialer Verantwortung
4. Soziale Verantwortung in Relation zu Handlungen und zur Vorstellung von Handlungsräumen
5. Zu den Grenzen Sozialer Verantwortung
6. Ziele, Methode und Disposition der Untersuchung – Die Bestimmung Sozialer Verantwortung und zur Entfaltung einer „Ethik der Handlungsräume“
II. Corporate Social Responsibility und die Relevanz der Rede von Sozialer Verantwortung
1. Die Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR)
1.1 CSR im Kontext einer theologisch-ethischen Analyse
1.2 Geschichtliche Entwicklungen zur Frage nach Sozialer Verantwortung der Unternehmen und Nachhaltigkeit
1.3 Charakteristika von CSR – zwischen gesellschaftspolitischer Relevanz, Unternehmensverständnis und Managementlehre
1.4 Grundlegende ethische Fragestellungen von CSR hinsichtlich des Verlaufs der Untersuchung
2. Das Phänomen CSR im sozialen Handlungsraum
2.1 CSR in Deutschland und die Betonung der Freiwilligkeit
2.2 CSR in Südafrika und die Bedeutung verbindlicher Regelungen
2.3 Zwischenüberlegung zu den Handlungsräumen in Deutschland und Südafrika und Sozialer Verantwortung
3. Die Vorstellungen über Soziale Verantwortung in wissenschaftlichen Ansätzen zur CSR
3.1 Hinführung
3.2 Soziale Verantwortung als ökonomische Verantwortung
3.3 Soziale Verantwortung als Stakeholder-Orientierung und Management-Verantwortung
3.4 Soziale Verantwortung als gesellschaftspolitische Verantwortung und das Unternehmen als Bürger
3.4.1
Einleitung
3.4.2
Die Verantwortung des Unternehmens als „Welt“-Bürger: Global Business Citizenship
3.4.3
Soziale Verantwortung als Verantwortung für bürgerliche Rechte
3.4.4
Corporate Citizenship und die Verantwortung für den Aufbau von Sozialkapital
3.4.5
Das Unternehmen als verantwortlicher politischer Akteur und sein Beitrag zur Gesellschaftsgestaltung
3.5 Zwischenüberlegung zu den wissenschaftlichen Ansätzen von CSR
4. Ertrag und Perspektiven für die weitere Untersuchung: CSR als Herausforderung für eine Sozialethik
4.1 CSR und die Relevanz Sozialer Verantwortung
4.2 Die Bedeutung des Handlungsraums Sozialer Verantwortung und das Handlungsverständnis
4.3 Die Verschiedenheit der Träger Sozialer Verantwortung
4.4 Inhalte, Ziele und Arten Sozialer Verantwortung
4.5 Weiteres Vorgehen im Hinblick auf die Entwicklung einer Ethik als handlungsorientierte Sozialethik angesichts von CSR
III. Handlungen und Handlungsräume ökonomischen Geschehens im Hinblick auf Soziale Verantwortung
1. Zur Analyse der Handlungen und Handlungsräume des Wirtschaftens und der Verankerung von Sozialer Verantwortung
1.1 Zum Verständnis von wirtschaftlichem Handeln
1.2 Der Zusammenhang von moralischem und ökonomischem Handeln
1.3 Handlungsräume des Wirtschaftens, soziales Handeln und die Verankerung Sozialer Verantwortung
2. Die Rekonstruktion von Handlungsräumen in der Neuroökonomie und Soziale Verantwortung
2.1 Wirtschaftliches Geschehen jenseits des homo oeconomicus?
2.2 Neuroökonomie – Neue Relevanz des Sozialen in der Ökonomie?
2.2.1
Die Bedeutung der Hirnforschung für das Verständnis von Sozialer Verantwortung
2.2.2
Die Forschungsrichtung der Neuroökonomik und ihr Selbstverständnis
2.2.3
Ein neuroökonomisches Experiment
2.2.4
Soziale Verantwortung und Handlungsräume im neuroökonomischen Experiment
2.3 Zwischenüberlegung zur Neuroökonomie und Sozialen Verantwortung
3. Soziale Marktwirtschaft, Global Governance und Finanzmärkte – Handlungsräume des Wirtschaftens im Wandel angesichts Sozialer Verantwortung
3.1 Soziale Marktwirtschaft und Soziale Verantwortung
3.1.1
Hinführung
3.1.2
Charakteristika der Sozialen Marktwirtschaft
3.1.2.1 Das Wirtschaftsverständnis der Sozialen Marktwirtschaft und die Verantwortung der Unternehmen
3.1.2.2 Soziale Marktwirtschaft und der Staat als Träger Sozialer Verantwortung
3.1.3
Kritische Würdigung der Sozialen Marktwirtschaft
3.2 Die Selbstorganisation Sozialer Verantwortung im globalen und lokalen Handlungsraum jenseits der Sozialen Marktwirtschaft
3.2.1
Orientierung durch Global Governance
3.2.2
Der Global Compact (GC) und die Principles for Responsible Investment (PRI) und ihre Soziale Verantwortung
3.2.3
Finanzmärkte als marktförmige Handlungsräume sozialer Interaktion – Selbstregulierung jenseits Sozialer Verantwortung
3.2.3.1 Hinführung
3.2.3.2 Der Finanzmarkt als Handlungsraum multipler Akteure und die Rolle der Finanzwissenschaften
3.2.4
Die Selbstregulierung bei Gemeinschaftsgütern als Ausdruck Sozialer Verantwortung
3.2.5
Kritische Würdigung der Selbstorganisation Sozialer Verantwortung im lokalen und globalen Handlungsraum
3.3 Zwischenüberlegung zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Selbstorganisation über Märkte und Sozialer Verantwortung
4. Ertrag: Handlungsräume wirtschaftlichen Geschehens und ihre Bedeutung für eine theologisch-ethische Analyse Sozialer Verantwortung
4.1 Soziale Verantwortung und die Spezifizität von Handlungsräumen und Handeln
4.2 Die Dimensionen des Handlungsraums und Soziale Verantwortung
4.3 Die Bedeutung der Analysen des Handelns und der Handlungsräume für ein theologisch-ethisches Verständnis Sozialer Verantwortung
IV. Analysen zum Verständnis von Verantwortung und Sozialer Verantwortung in theologischen und philosophischen Entwürfen
1. Theologische und philosophische Vorstellungen von Verantwortung als Beitrag zu einem Verständnis von Sozialer Verantwortung
2. Theologische Vorstellungen von Verantwortung: Zwischen Individuum, Gesellschaft und Gemeinwohl
2.1 Hinführung
2.2 Verantwortung für die Gesellschaft
2.2.1
Einleitung
2.2.2
Verantwortung für die Gesellschaft − Eilert Herms
2.2.2.1 Soziale Verantwortung als Verantwortung für die Wohlordnung der Gesellschaft
2.2.2.2 Handeln, Soziale Ordnung und Verantwortung in wirtschaftlichen Prozessen
2.2.2.3 Verantwortungszusammenhänge der Interaktionsordnungen
2.2.2.4 Die Verantwortung in Institutionen und die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Verantwortung
2.2.2.5 Verantwortung in pluralen Gesellschaften
2.2.2.6 Grenze der Verantwortung
2.2.3
Verantwortung in der „Theologie der Gesellschaft“ − Heinz-Dietrich Wendland
2.2.3.1 Wendlands „Theologie der Gesellschaft“
2.2.3.2 Das Verständnis der Verantwortung in der „Theologie der Gesellschaft“ und ihre Verkehrung
2.2.3.3 Das normative Verständnis der „verantwortlichen Gesellschaft“
2.2.3.4 Theologische Grundlegungen in Wendlands Ansatz
2.2.4
Kritische Würdigung der gesellschaftlich-orientierten Ansätze
2.3 Verantwortung von Individuen in Gesellschaft und Gemeinschaft
2.3.1
Einleitung
2.3.2
Verantwortung in wirklichkeitsgemäßem Handeln – Dietrich Bonhoeffer
2.3.2.1 Sozialität und Verantwortung
2.3.2.2 Das Verhältnis von Verantwortung, Person und Stellvertretung
2.3.2.3 Die „Kollektivperson“, Gemeinschaft und Gesellschaft
2.3.2.4 Verantwortung und wirklichkeitsgemäßes Handeln
2.3.3
Verantwortung in wirtschaftlichen Zusammenhängen − Arthur Rich
2.3.3.1 Verantwortlich-Sein des Menschen als anthropologische Grundkonstante
2.3.3.2 Das ausgewogene Verhältnis von Sachgerechtem und Menschengerechtem als Kennzeichen einer Wirtschaftsethik und Ausdruck Sozialer Verantwortung
2.3.3.3 Inhalte der Verantwortung bei Arthur Rich
2.3.4
Verantwortung in kommunikativer Freiheit – Wolfgang Huber
2.3.4.1 Verantwortung als zentraler theologischer Begriff
2.3.4.2 Verantwortung als Soziale Verantwortung zwischen Freiheit und Gerechtigkeit
2.3.5
Kritische Würdigung der individuell-gesellschaftlich-gemeinschaftlich ausgerichteten Ansätze
2.4 Responsive Verantwortung in der Gemeinschaft
2.4.1
Einleitung
2.4.2
Verantwortung als responsives Geschehen − H. Richard Niebuhr
2.4.2.1 Anthropologische Grundlagen des Verantwortungsverständnisses
2.4.2.2 Verantwortung als responsives Geschehen auf der Suche nach der „fitting action“
2.4.2.3 Der Gottesbezug der Verantwortung
2.4.3
Ubuntu als Ausdruck von Gemeinschaftsverantwortung – Desmond Tutu
2.4.3.1 Der gesellschaftspolitische Kontext von Ubuntu
2.4.3.2 Ubuntu als Verantwortung für die Harmonie der Gemeinschaft
2.4.3.3 Ubuntu in theologischer Perspektive
2.4.4
Kritische Würdigung der responsiv-gemeinschaftsorientierten Ansätze
2.5 Verantwortung für das Gemeinwohl
2.5.1
Einleitung
2.5.2
Integrative Verantwortung − William Schweiker
2.5.2.1 Schweikers differenziertes Verständnis von Verantwortung
2.5.2.2 Die Bedeutung Sozialer Verantwortung
2.5.3
Verantwortung für das Gemeinwohl – Die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
2.5.3.1 Die Denkschriften der EKD als Ausdruck der öffentlichen Verantwortung der protestantischen Kirche
2.5.3.2 Verantwortung für das Gemeinwohl: Die wirtschaftspolitischen und -ethischen Denkschriften der EKD
2.5.3.3 Beispiele für den Verantwortungsdiskurs: Die Eigentums- und die Unternehmer-Denkschrift
2.5.4
Kritische Würdigung der gemeinwohl-orientierten Ansätze
2.6 Zwischenüberlegung: Die Varianten der Verantwortung in theologisch-ethischen Ansätzen und ihre Relevanz für ein Verständnis von Sozialer Verantwortung
3. Philosophische Vorstellungen von Verantwortung: Zwischen Menschheit, Korporation und Gerechtigkeit
3.1 Hinführung
3.2 Gesellschaftliche Mit-Verantwortung
3.2.1
Einleitung
3.2.2
Integrative Wirtschaftsethik als Verantwortungsethik − Peter Ulrich
3.2.2.1 Ulrichs Verantwortungsverständnis
3.2.2.2 Die Verortung des Verantwortungsverständnisses in Ulrichs Wirtschaftsethik
3.2.3
Gesellschaftliche Mitverantwortung von Unternehmen − Deon Rossouw
3.2.3.1 Aspekte der Verantwortung von Unternehmen
3.2.3.2 Die Anwendung von Sozialer Verantwortung im Konfliktfall: Rational Interaction for Moral Sensitivity (RIMS)
3.2.4
Gesellschaftliche Mit-Verantwortung aller Menschen − Karl-Otto Apel
3.2.4.1 Postkonventionelle Verantwortung
3.2.4.2 Die doppelte Dialogverantwortlichkeit
3.2.4.3 Mit-Verantwortung bezüglich der Institutionen und des wirtschaftlichen Geschehens
3.2.5
Kritische Würdigung der diskursethisch-orientierten Ansätze
3.3 Korporative und kollektive Verantwortung
3.3.1
Einleitung
3.3.2
Kollektives Handeln und kollektive moralische Verantwortung in der Pluralsubjekt-Theorie – Margaret Gilbert
3.3.2.1 Das „Wir“-Verständnis
3.3.2.2 Die „Plural Subject Theory“
3.3.2.3 Die gemeinsame Verantwortung des „Pluralsubjekts“
3.3.3
Soziale Verantwortung in der stellvertretenden Handlung – Larry May
3.3.3.1 Mays Verständnis von Gesellschaft und „individuals in relationship“
3.3.3.2 Unternehmen und die „vicarious agency“
3.3.4
Korporative Verantwortung von Unternehmen – Patricia Werhane
3.3.4.1 Die Verortung von Werhanes Ansatz
3.3.4.2 Unternehmen und ihre korporative Verantwortung
3.3.5
Kritische Würdigung der Ansätze korporativer und kollektiver Verantwortung
3.4 Verantwortung und globale Gerechtigkeit
3.4.1
Einleitung
3.4.2
Verantwortung und globale Gerechtigkeit: Ein Modell sozialer Verbundenheit – Iris Young
3.4.2.1 Die Vorstellung der sozialen Verbundenheit
3.4.2.2 Youngs Verantwortungsverständnis
3.4.3
Kritische Würdigung des Ansatzes globaler Gerechtigkeit
3.5 Zwischenüberlegung: Die Varianten der Verantwortung in philosophischen Ansätzen und ihre Relevanz für ein Verständnis von Sozialer Verantwortung
4. Erträge und offene Fragen: Inhalte, Ziele und Arten Sozialer Verantwortung angesichts der theologischen und philosophischen Entwürfe
4.1 Hinführung
4.2 Arten der Verantwortung und ihr Beitrag zu Sozialer Verantwortung
4.2.1
Theologische und philosophische Verortungen von Sozialer Verantwortung
4.2.2
Direkte und indirekte Soziale Verantwortung
4.3 Inhalte Sozialer Verantwortung
4.3.1
Soziale Verantwortung als Geschehen vor Gott
4.3.2
Freiheit und Soziale Verantwortung
4.3.3
Nächstenliebe und Soziale Verantwortung
4.3.4
Gerechtigkeit und Soziale Verantwortung
4.4 Ziele Sozialer Verantwortung: Gemeinwohl, verantwortliche Gesellschaft oder die „fitting action“
4.5 Handlungen, Handlungsräume und Träger Sozialer Verantwortung
4.6 Offene Fragen
V. Eine protestantisch-theologische Bestimmung Sozialer Verantwortung und ihr Beitrag zur CSR-Debatte
1. Die normative Ausrichtung Sozialer Verantwortung an Gerechtigkeit und Freiheit und ihre Auswirkungen auf das Verständnis von Sozialer Verantwortung
1.1 Gerechtigkeit und Freiheit als zentrale Inhalte eines theologischen Verständnisses von Sozialer Verantwortung
1.1.1
Soziale Verantwortung in Relation zu Gerechtigkeit
1.1.2
Soziale Verantwortung in Relation zu Freiheit
1.2 Auswirkungen: Die Präzisierung der Definition Sozialer Verantwortung und die Funktionen des Begriffs
1.2.1
Die Präzisierung der Definition Sozialer Verantwortung
1.2.2
Funktionen des Begriffs Soziale Verantwortung
2. Ziele, Arten und Typen Sozialer Verantwortung – über das Gemeinwohl hinaus
2.1 Der Zusammenhang zwischen Zielen, Arten und Typen Sozialer Verantwortung
2.2 Ziele Sozialer Verantwortung: Gemeinwohl und darüber hinaus
2.3 Arten Sozialer Verantwortung und ihre Bestimmung: freiwillig oder verpflichtend, direkt oder indirekt
2.4 Typen des Begriffs Soziale Verantwortung
2.4.1
Zur Bedeutung unterschiedlicher Typen Sozialer Verantwortung
2.4.2
Soziale Verantwortung als gesellschaftliche Verantwortung
2.4.3
Soziale Verantwortung als Verantwortung für das Gemeinwohl
2.4.4
Soziale Verantwortung als Verantwortung für Marginalisierte
2.4.5
Soziale Verantwortung als korporative und kollektive Verantwortung
2.4.6
Soziale Verantwortung als personale Verantwortung
3. Die Verortung Sozialer Verantwortung im Handlungsraum und dessen Relevanz
3.1 Die Vorstellung von Handlungsräumen und der Interaktionsbereich „Wirtschaft“
3.1.1
Der Interaktionsbereich „Wirtschaft“ in Zusammenhang mit den Handlungsräumen angesichts Sozialer Verantwortung
3.1.2
Sachzwänge und Eigengesetzlichkeit als Spezifika des Wirtschaftens?
3.1.2.1 Zur Bestimmung von Charakteristika des Wirtschaftens
3.1.2.2 Sachzwänge als Charakteristika des Wirtschaftens?
3.1.2.3 Die Vorstellung der Eigengesetzlichkeit des Wirtschaftens
3.1.3
Die Bedeutung des Handlungsraums als Zusammenspiel der Interaktionsbereiche
3.2 Die Konstituierung von Handlungsräumen und ihre strukturellen Herausforderungen angesichts Sozialer Verantwortung
3.2.1
Zur Konstituierung von Handlungsräumen
3.2.2
Macht und Strukturen des Handlungsraums in Relation zu Sozialer Verantwortung
3.2.3
Die zeitliche Dimension von Handlungsräumen und Soziale Verantwortung
3.3 Die Verortung Sozialer Verantwortung im Handlungsraum und der Sinnhorizont von Handlungen
4. Die Pluralität der Träger Sozialer Verantwortung: Individuen, Korporationen und Kollektive
4.1 Zur Pluralität der Träger Sozialer Verantwortung
4.2 Grundlegende theologische Zusammenhänge
4.2.1
Die Bedeutung der Sozialität des Menschen als Träger Sozialer Verantwortung vor Gott
4.2.2
Träger Sozialer Verantwortung und deren Handlungsräume – eine Verhältnisbestimmung zwischen Individuen, Korporationen und Kollektiven
4.3 Individuen, Korporationen und Kollektive als Träger Sozialer Verantwortung
4.3.1
Individuen und Soziale Verantwortung
4.3.2
Korporationen und Soziale Verantwortung
4.3.3
Kollektive und Soziale Verantwortung
5. Ein theologisch-qualifiziertes Verständnis von Sozialer Verantwortung als Beitrag zur CSR-Debatte
5.1 Die inhaltliche Präzisierung der CSR-Debatte: CSR angesichts von Gerechtigkeit und Freiheit
5.1.1
Zur Relevanz eines theologische-qualifizierten Verständnisses von Sozialer Verantwortung
5.1.2
Inhalte, Ziele und Arten Sozialer Verantwortung und ihre Bedeutung für CSR
5.1.3
Träger Sozialer Verantwortung hinsichtlich CSR
5.2 Eine theologische Perspektive auf Unternehmen als korporative Träger Sozialer Verantwortung
5.2.1
Unternehmen als verantwortliche Akteure jenseits von Corporate Citizenship
5.2.2
Gerechtigkeit und Freiheit durch Management? Die verschiedenen Ebenen unternehmerischen Handelns
5.2.2.1 Unternehmensführung und die Soziale Verantwortung des Managements
5.2.2.2 Unternehmerisches Handeln im Sinne einer qualifizierten Sozialen Verantwortung im Handlungsraum
5.3 CSR im Handlungsraum und ihre Grenzen
5.3.1
CSR im Handlungsraum – die Aufgaben Sozialer Verantwortung und ihre Träger
5.3.2
Grenzen von CSR im Handlungsraum
5.4 Kirche und Diakonie als Träger Sozialer Verantwortung hinsichtlich CSR
5.4.1
Kirche und Diakonie und ihr Beitrag zur CSR-Debatte
5.4.2
Das wirtschaftliche Handeln von Kirche und Diakonie im Sinne Sozialer Verantwortung
6. Veränderungen von Ökonomie und Wirtschaftswissenschaften durch die Perspektive Sozialer Verantwortung
6.1 Soziale Verantwortung als Grundelement von Ökonomie
6.2 Auf dem Weg zu einer Methodenvielfalt in den Wirtschaftswissenschaften hinsichtlich ihrer Relevanz als Fachwissen
7. Perspektiven für eine „Ethik der Handlungsräume“ als kritische Leitorientierung
7.1 Über eine Bereichsethik hinaus – Aspekte einer „Ethik der Handlungsräume“
7.2 Möglichkeiten für eine „Ethik der Handlungsräume“ als kritische Leitorientierung jenseits der CSR-Debatte
VI. Literaturverzeichnis
VII. Register
1. Personenregister
2. Sachregister
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im April 2013 von der Evangelisch-theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen als Habilitationsschrift im Fach Systematische Theologie angenommen. Für den Druck habe ich sie durchgesehen und überarbeitet.
Mein herzlicher Dank gilt an erster Stelle Frau Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, die das Erstgutachten übernommen und die Arbeit über die Jahre sowohl an der Universität Gießen als auch an der Universität Tübingen mit großem Interesse und Unterstützung begleitet hat. Ihr theologisches Denken und ihre Nachfragen sind in höchstem Maße anregend und haben mich auf vielfältige Weise bereichert. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Doktorand/innen- und Habilitand/innen-Kolloquiums von Frau Prof. Elisabeth Gräb-Schmidt sowie den Teilnehmenden des Graduiertenkollegs des Pfullinger Theologischen Arbeitskreises danke ich für interessiertes Zuhören und spannende Diskussionen der Arbeit. Das Zweitgutachten schrieb Herr Prof. Dr. Friedrich Hermanni. Ihm danke ich für hilfreiche Hinweise und Präzisierungen, die in die Überarbeitung einfließen konnten.
Die Arbeit ist in verschiedenen Kontexten entstanden. Insbesondere die Möglichkeit zur eigenständigen Arbeit als Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Arnoldshain/Frankfurt motivierten mich, die Tagungen und Veranstaltungen auch wissenschaftlich zu begleiten und die Ideen für die Habilitationsschrift weiter zu entwickeln und ist verbunden mit herzlichem Dank an die dortigen Verantwortlichen, Kolleg/innen und Mitarbeitenden sowie an die Kooperationspartner/innen, Referierenden und Teilnehmenden der Veranstaltungen, die immer wieder neue Fragen und Perspektiven aufzeigten und Freiraum auch für Forschungsaufenthalte boten.
Der Stiftung Bonhoeffer Lehrstuhl, insbesondere Herrn Prof. Dr. Helmut Reihlen sowie Prof. Dr. Wolfgang Huber und Bischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm sowie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, danke ich für die Möglichkeit, dass ich als „Visiting Teaching Fellow in the Bonhoeffer Exchange Program“ am Union Theological Seminary in New York, USA, 2009 mehrere Monate lehren und forschen und so US-amerikanische Perspektiven des Themas der Sozialen Verantwortung, auch dank des Austausches mit Prof. Dr. Gary Dorrien, erfahren konnte.
Dem Beyers-Naudé-Zentrum an der Universität Stellenbosch, Südafrika, Prof. Dr. Nico Koopman und Prof. Dr. Dirk Smit und dem Evangelischen Entwicklungsdienst und Paul Hell danke ich für einen dortigen Forschungsaufenthalt 2005, der mir die südafrikanische CSR-Diskussion nahe gebracht hat.
Ein weiterer Dank geht an die Studierenden meiner Veranstaltungen an der Universität Frankfurt im Fachbereich Evangelische Theologie und im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, an den Universitäten Tübingen und Hohenheim sowie den Studierenden während meiner Vertretung des Lehrstuhls für Systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen an der Universität Bamberg und den Studierenden am Union Theological Seminary in New York, die mir immer wieder die Relevanz gerade ethischer Fragestellungen für die nachfolgenden Generationen aufzeigten und deren globale Bedeutung deutlich machten.
Herrn Jürgen Schneider und Frau Janina Schüle vom Verlag Kohlhammer danke ich sehr herzlich für die hervorragende Betreuung bei der Drucklegung der Arbeit. Mein Dank für die Erstellung der Druckvorlage gilt Frau Andrea Siebert.
Für die freundliche Unterstützung hinsichtlich der Druckkostenzuschüsse danke ich sehr herzlich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Landeskirche Württemberg.
Da ein Projekt dieser Art auch des familiären, freundschaftlichen und interdisziplinären Austauschs und der Unterstützung bedarf, gilt mein letzter und sehr herzlicher Dank meiner Familie sowie meinen Freunden und Freundinnen, die die Arbeit stets wohlwollend, interessiert und kritisch-hinterfragend über die Jahre begleitet haben.
Frankfurt, im November 2014
Gotlind Ulshöfer
I. Einführung und Problemstellung
1. Soziale Verantwortung und der Bezug zur Corporate Social Responsibility-Debatte
Die Rede von Sozialer Verantwortung1 ist vielfältig. Insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird Soziale Verantwortung in theologischen, kirchlichen, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Kontexten zu einem häufig gebrauchten Terminus. Ob von Sozialer Verantwortung von Unternehmen2 oder der Kirche3 die Rede ist, der Begriff weist auf Verantwortungszuschreibungen hin, die über individuelle Zusammenhänge hinausgehen und kann damit auch Ausdruck einer Ausweitung des Verantwortungsprinzips sein. Nicht mehr nur der oder die Einzelne ist der einzige Verantwortliche, sondern Verantwortungsbezüge umfassen Institutionen, gesellschaftliche Akteure sowie Strukturen. Paradigmatisch kann hierfür die Forderung nach einer größeren Verantwortungsübernahme transnationaler Konzerne stehen – wie sie beispielsweise im Rahmen der Diskussion um Corporate Social Responsibility (CSR), der sozialen bzw. gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, thematisiert wird.4 Durch eine Intensivierung ausländischer Direktinvestitionen und die damit verbundene gestiegene Präsenz multinationaler Konzerne auf verschiedenen Kontinenten kommt es zur Frage nach den Aufgaben und dem Verhalten von Unternehmen zum Beispiel in Entwicklungsländern.5 Die Rede von der Sozialen Verantwortung von Unternehmen fokussiert dabei nicht allein auf deren ökonomische Rolle. Neben der Erzielung von Gewinnen wird von Unternehmen eingefordert, dass sich ihre Verantwortung über rechtliche Regelungen hinaus, auch auf ihr gesellschaftliches Umfeld und ihre globalen Aktivitäten erstreckt.6 Dies bedeutet beispielsweise, dass Unternehmen Verantwortung für die Bereitstellung von Infrastruktur, für die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeitenden oder auch für die Handlungen ihrer Zulieferer zugeschrieben wird. Dieses Phänomen findet seinen Ausdruck im Begriff CSR, der im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte in der wirtschafts- und sozialpolitischen sowie wirtschaftsethischen Diskussion immer bedeutsamer geworden ist. Es kann von einem „gestiegene[n, G. U.] Interesse am Thema CSR, das durch die Flut von Studien und Veröffentlichungen zum Ausdruck kommt“7, gesprochen werden. Angetrieben wurde die Verbreitung dieses Begriffs und des damit zusammenhängenden veränderten Verantwortungsverständnisses auch durch die Politik der Europäischen Kommission, die kurz nach der Jahrtausendwende CSR nicht nur als wirtschaftspolitische Aktivität förderte, sondern als Teil der „Social Agenda“ der Europäischen Union (EU) versteht und immer weiter vorantreibt.8
CSR stellt den Ausgangspunkt der in dieser Schrift vorgenommenen Überlegungen dar. Die Arbeit will jedoch darüber hinausgehend den Begriff der Sozialen Verantwortung vertiefend auf seine „soziale Dimension“ aus theologischer Perspektive analysieren, denn über den ökonomischen Kontext hinaus wird mit der Rede von Sozialer Verantwortung auf ein erweitertes Verantwortungsverständnis Bezug genommen, das sich sowohl bei Subjekten als auch bei Objekten der Verantwortung auf mehr als individuelles Handeln bezieht. Neben der Verantwortung des Einzelnen, dem eine Tat oder eine Unterlassung zugeschrieben werden kann, wird Soziale Verantwortung zu einer relevanten Kategorie bei beispielsweise korporativen Verantwortungs-Subjekten. Außerdem geht auch bei den „Objekten“ der Verantwortung eine Ausweitung und „Sozialisierung“ vonstatten. Nicht nur direkte individuelle Handlungsbezüge und die darin implizierte Verantwortung zwischen einem Individuum und einer zum Beispiel von ihm oder ihr hergestellten Sache werden thematisiert, sondern auch kollektive Bezüge und Forderungen nach einer Verantwortung für „die Gesellschaft“ werden mit dem Begriff Soziale Verantwortung angesprochen. Insofern kann von einer Ausweitung des Verantwortungsverständnisses ausgegangen werden. Dies entspricht auch dem Umgang mit dem Begriff der Sozialen Verantwortung in theologischen und kirchlichen Diskussionen. Hier bezeichnet er oft eine Verantwortung für „Kollektive“ oder „kollektive Sachverhalte“, wie das Gemeinwohl, die Bedürftigen der Gesellschaft bzw. die Gesellschaft als Ganzes. Des Weiteren lässt sich diese Ausdehnung der Verantwortung auch bei der Frage nach der Instanz der Verantwortung verorten: Für etwas „sozial verantwortlich“ zu sein, bedeutet nicht nur eine Verantwortung vor Gott und dem eigenen Gewissen, sondern beispielsweise auch vor einer politischen Öffentlichkeit zu haben. Mit dieser „Sozialisierung des Verantwortungsverständnisses“ geht eine gewisse Diffusion von Verantwortung einher. Dabei sind es genau die Unschärfe und die Offenheit des Begriffs der Sozialen Verantwortung, die zur Analyse und präziseren Bestimmung des Ausdrucks herausfordern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























