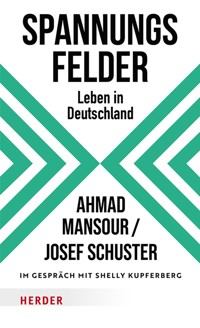
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, in der die AfD zunehmend an Einfluss gewinnt und die Welt und besonders der Nahe Osten immer unsicherer werden, rückt die Frage in den Fokus: Wie gestaltet sich eigentlich das Leben von Juden und Muslimen in Deutschland? Die Sorge um die Zukunft ist spürbar. Doch die Lage verschärft sich weiter: Antisemitische Vorfälle und Ausschreitungen aus dem islamistischen Milieu prägen den Alltag seit dem 7. Oktober 2023. Wie können Staat und Gesellschaft reagieren? Gibt es Wege, sich von Stereotypen zu befreien und die Perspektiven der anderen Seite differenziert zu betrachten? In einem tiefgründigen Gespräch, moderiert von Shelly Kupferberg, beleuchten Josef Schuster und Ahmad Mansour diese drängenden Fragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ahmad Mansour & Josef Schuster Im Gespräch mit Shelly Kupferberg
Spannungsfelder
Leben in Deutschland
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: ZeroMedia GmbH, München
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print 978-3-451-07498-1
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83414-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83421-9
Inhalt
Vorwort
Gespräch I Von gepackten Koffern, Israel als Lebensversicherung und dem Schmerz der anderen
Gespräch II Wahlergebnisse, Bauchschmerzen und die deutsche Mentalität
Gespräch III Nach dem 7. Oktober
Gespräch IV Ein Abschluss?
Über Shelly Kupferberg, Ahmad Mansour und Josef Schuster
Vorwort
Begonnen haben unsere Gespräche im Sommer 2023. Sie waren als eine Art Bestandsaufnahme gedacht: Wie lebt es sich derzeit in Deutschland? Als Moslem, als Jude, als zivilgesellschaftlicher Akteur, der regelmäßig in der Öffentlichkeit steht? Welche Beobachtungen und Entwicklungen bereiten Kopfschmerzen, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus? Woher rührt das Engagement beider Akteure, sich einerseits für Belange jüdischer Menschen in Deutschland einzusetzen, so, wie es der Mediziner Josef Schuster schon seit vielen Jahrzehnten, seit 2014 als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland tut, und andererseits in der Extremismusprävention zu arbeiten wie der Psychologe Ahmad Mansour, der als Beobachter und Praktiker ein viel gefragter Redner und Gesprächspartner ist. Der eine als Kind deutscher Juden in Israel geboren, aufgewachsen in Deutschland. Der Andere: Moslem, Araber, in Israel geboren und aufgewachsen mit palästinensischem Hintergrund, in Tel-Aviv studiert und als junger Mann mit 28 Jahren nach Deutschland gekommen. Die eigene Herkunft zum Thema und zur Aufgabe des eigenen Tuns zu machen, zumal in thematischen Feldern, die immer wieder hochemotional in der Öffentlichkeit diskutiert und auch gerne instrumentalisiert werden – nicht immer von Seiten, die den beiden Akteuren lieb sind: Das ist eine bewusste Entscheidung. Was motiviert beide dabei? An welchen Stellen begegnen sich ihre Themenfelder? Sicherlich nicht nur bei der traurigen Tatsache, dass beiden Gesprächspartnern Personenschutz an die Seite gestellt wird.
Ausgehend von zwei sehr unterschiedlichen Biografien und Erfahrungen ging es in unseren Gesprächen um Fragen des Selbstverständnisses, des Selbstbilds und der Fremdwahrnehmung. Dabei schälten sich schnell Themen heraus, die sich wie rote Fäden durch alle Treffen und Gespräche zogen. Sei es die Frage nach einer zukunftsorientierten Erinnerungskultur in Deutschland, Identitäten, die Besorgnis über das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsradikaler Parteien, diverse muslimische Religionsverständnisse oder den Wunsch, einen Islam in Deutschland zu schaffen, der unabhängig vom Ausland ist. Auch das Thema Migration spielte immer wieder eine Rolle, des Weiteren unterschiedliche Facetten des Antisemitismus, digitale Räume und Narrative – und Nahost. Dabei stellte Ahmad Mansour mehrfach fest, dass das Fehlen didaktischer Methoden für den Umgang an Schulen mit dem Nahostkonflikt als wichtigem Baustein, um aufzuklären und Empathiefähigkeit zu entwickeln, uns als Gesellschaft auf die Füße fallen werde. Josef Schuster wiederum beobachtet seit vielen Jahren, wie sehr sich – was auch immer in Nahost an Konflikten eskaliert – die Situation negativ auf jüdische Menschen weltweit auswirkt, sie in »Mithaftung genommen würden« und nicht genug differenziert werde. Beide sprechen von der Dringlichkeit einer politischen Lösung für Nahost, denken über die Tatsache nach, dass der politische Wille für eine Zweistaatenlösung von keiner Seite – auch weltweit – ausreichend gegeben sei. Beiden bereitet das demokratische Miteinander hierzulande wiederum große Sorgen. Ahmad Mansour plädiert u. a. für eine Demokratieoffensive im digitalen Raum, um Fake News und Verschwörungserzählungen etwas entgegenzusetzen, und macht sich für offene Debatten stark, um auch klar und deutlich Probleme innerhalb migrantisch geprägter Communitys zu führen, ansonsten drohten diese Diskurse von Rassisten und Rechtspopulisten vereinnahmt zu werden.
Bei jedem der vier Treffen spielten die jeweils aktuellen politischen Ereignisse eine Rolle.
Dass unsere Gespräche mit dem 7. Oktober 2023 eine neue Brisanz und Dringlichkeit bekamen, hätte niemand ahnen können und wollen. Wobei Ahmad Mansour bei unserem Treffen Mitte September 2023 anmerkte: »Ich glaube, vor allem die, die den Terror bevorzugen, sehen in der Situation in Israel eine Chance, Israel zu schwächen und anzugreifen« – gemeint waren die massiven Proteste gegen die Vorhaben der israelischen Regierung in Bezug auf einen undemokratischen Umbau der Justiz.
In Anbetracht der politischen Lage ist uns zu jedem Zeitpunkt der Gespräche bewusst gewesen, wie volatil einige der angesprochenen Themen sind. Daher erheben die hier abgedruckten Texte nicht in allen Facetten einen Anspruch auf Aktualität. Sie sind vielmehr eine Momentaufnahme im Spiegel der jeweils aktuellen Vorkommnisse. Dennoch formulieren die beiden Gesprächspartner viele Gedanken und Analysen, die gesellschaftspolitisch von Belang sind und Relevanz und Bestand haben, auch jenseits des aktuellen Tagesgeschehens.
Unser Dank gilt den Initiatorinnen und Initiatoren dieses Gesprächsbandes. Zu nennen ist hier vor allem Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen und stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, für die vielfältige und nachhaltige Unterstützung des Projekts. Ein großer Dank geht an die Lektorin Susanne Fischer und den ehemaligen Programmleiter der wbg, Clemens Heucke, die uns ein gutes Stück bei unseren Gesprächen und deren Vorbereitungen begleitet haben. Und natürlich danken wir dem Verlag Herder, der sofort bereit war, dieses Projekt als Buch in sein Programm aufzunehmen.
Shelly Kupferberg, im Sommer 2024
Gespräch I
Von gepackten Koffern, Israel als Lebensversicherung und dem Schmerz der anderen
13. Juli 2023
Shelly Kupferberg: Ich freue mich, mit euch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich kenne Ahmad schon lange, aus verschiedenen Zusammenhängen, und wir sind schon immer beim »Du« gewesen. Aber auch Sie, Herr Schuster, kenne ich schon lange.
Ich habe mir natürlich vorher überlegt: Was wollen wir eigentlich? Und wo gibt es Schnittmengen? Es gibt jede Menge Schnittmengen, in Ihrem, in eurem Leben, und das beginnt, ganz oberflächlich gesehen, schon mal damit, dass Sie beide Menschen sind, die offenbar Personenschutz benötigen, in vielen Situationen zumindest. Ich würde gerne wissen, was das für Sie bedeutet, Herr Schuster. Welche Gedanken machen Sie sich? Ist das etwas, was inzwischen selbstverständlich für Sie geworden ist, oder gibt es manchmal dann doch »Störgeräusche« Ihrerseits?
Josef Schuster: Es ist ja nicht so, dass ich völlig unverhofft in diese Situation mit Personenschutz gekommen bin. Alle meine Vorgänger hatten Personenschutz. Seit 1999 bin ich im Präsidium des Zentralrats der Juden und habe bei den jeweiligen Präsidenten den Personenschutz erlebt … Das war also eine Situation, die nicht unerwartet auf mich zukam. Die natürlich eine gewisse Art von Sicherheit gibt, von der ich wusste. Und ich denke, wir haben eine praktikable Lösung gefunden. Ich habe es immer das »Frankfurter Modell« genannt, also angelehnt an das, wie es bei meinem Vorgänger Dieter Graumann war. Ein gewisser Freiraum muss bleiben. Und der bleibt auch. Also im Schlafzimmer ist kein Polizeibeamter.
SK: Ahmad, was bedeutet das für dich? Und wie selbstverständlich ist es für dich geworden? Machst du dir darüber noch Gedanken?
Ahmad Mansour: Ich habe mir mein Leben nicht so vorgestellt, als ich nach Deutschland kam. Für mich ist Polizei immer etwas, was Stress auslöst. Da sind Beamte, die stoppen mich, wenn ich etwas falsch gemacht habe, zu schnell gefahren bin oder irgendetwas nicht beachtet habe.
Als ich angefangen habe, Artikel zu schreiben, mit Jugendlichen zu arbeiten, hätte ich nie gedacht, dass es so eskalieren würde wie 2015. Das hat auch, wenn man so will, eine jüdische Dimension. Denn angefangen hat es in der Düsseldorfer jüdischen Gemeinde, als wir damals den Preis bekommen haben.1 Die Ehrung fand in der Synagoge statt. Da bin ich natürlich aus Respekt – den habe ich genauso in einer Moschee – mit Kippa hineingegangen und auch wieder herausgekommen.
Und dann gab es Bilder: ein Muslim mit einer Kippa … Was eigentlich in einer Synagoge der interreligiösen Verständigung dienen sollte, wurde anders verstanden in der arabischen Welt, vor allem unter Muslimen hier in Deutschland. Also unter bestimmten Muslimen, bei denen das Klima sehr homogen ist.
Da war ich zum ersten Mal mit etwas konfrontiert, von dem ich nicht genau wusste, wie ich damit umgehen sollte. Die Polizei hat dankenswerterweise sehr schnell bemerkt, was da vor sich geht, und hat sich gemeldet, und dann hieß es erst mal: »Ja, wir sperren jetzt die Daten, und dann schauen Sie mal, was passiert.« Damals war (noch) nicht an Personenschutz zu denken.
Und dann war ich an der Uni Mainz, ich wollte mit den Studierenden beim AStA einen Vortrag über Radikalisierung und Antisemitismus halten. Auch das Thema Gaza wurde hier angesprochen. Und ich habe damals schon mehrere Betrachtungen über Nahost vor allem auf Deutschland bezogen, also erst mal gar nicht auf Israel, Palästina, Gaza und so weiter … Sondern es ging darum, warum Jugendliche auf die Straße gehen und auf Demos Juden beschimpfen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu analysieren, und da saßen zwei Reihen voller meist islamistisch aussehender Personen mit Handys und haben angefangen zu stören und zu drohen. In diesem Moment wusste ich: Das geht so nicht weiter. Ich habe das gemeldet, und dann ging alles sehr schnell. Seitdem ist die Situation eskaliert.
Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bin natürlich dankbar, denn nicht jedes Land bietet Menschen Schutz aufgrund ihrer Position oder ihrer Aussagen. Aber trotzdem ist das eine unfassbare Einschränkung, die etwas mit mir macht. Ich versuche immer eine Art humorvollen Umgang damit zu finden – vor allem, wenn meine Tochter dabei ist. Gestern hat sie die Süddeutsche Zeitung zu Hause gelesen. Ich hatte die nur gekauft, um das irgendwie zu archivieren … Dann steht da ganz, ganz groß: »Wer hat Angst vor Ahmad Mansour?«2 Und sie liest das und lacht sich tot.
Meine Privatsphäre ist mir sehr wichtig. Wir haben ein paar Freunde, auch in Brandenburg, die wir auch ohne Personenschutz besuchen, wir bringen unsere Tochter zur Schule, gehen zum Spielplatz, kaufen ein … Ich versuche, meine Tochter nicht in meine Arbeit zu involvieren, ihr zu zeigen: Das Leben ist anders.
Ansonsten sind das Menschen, die zu meiner Familie geworden sind. Acht Jahre dieselben Leute, fast immer, man kennt sich, man redet … Wir fahren ja oft ganz lange. Und dann hat man nach der Veranstaltung manchmal Hunger, dann isst man zusammen. Ich glaube, das gehört auch zur psychologischen Betreuung, neben der Sicherheit, dass man mit den Leuten auch kann und Freundschaften entstehen können.
SK: Man lernt sich gut kennen. Aber ich werde dennoch nie die Situation vergessen bei deiner Büroeinweihungsfeier, 2018 war das? Du, die Rechtsanwältin Seyran Ateş und viele Freunde, Gäste, Kolleginnen und Kollegen – und so viel Personenschutz. Das hat mich schon sehr irritiert und auf eine verstörende Weise beeindruckt, und man fragt sich, was das über dieses Land auch aussagt. Herr Schuster?
JS: Ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen uns beiden. Sie haben gerade gesagt, na ja Polizeikontakt, es sind ja immer Kontrollen … Meistens ist ein Kontakt mit der Polizei eher negativ besetzt. Da hatte ich es in meiner Vita ein bisschen anders. Von Beruf bin ich ja Mediziner, war auch viele Jahre in Würzburg im Notarztdienst, und ungefähr seit meinem 30. Lebensjahr habe ich regelmäßig für die Polizei in Würzburg Blutentnahmen gemacht. Das läuft so, dass es nicht einen festen Arzt gibt, sondern die haben eine Liste, und dann rufen sie an, und man fährt halt nachts um drei Uhr auf die Polizeidienststelle und macht die Blutentnahme. Das habe ich zeitweise relativ viel gemacht, sodass der Umgang mit Polizeibeamten für mich eigentlich etwas Normales war, eine positive Situation. Ich kam da hin, habe meine Blutentnahmen gemacht, kannte auch schon viele. Das hat sicherlich in der Einstellung von Haus aus etwas anderes bewirkt.
SK: Und dennoch, Herr Schuster, was würden Sie denn sagen, was bedeutet diese Art von Schutzbedürftigkeit, die ja auch, soweit ich weiß, staatlich auferlegt ist? Das ist jetzt nicht nur etwas, was von jüdischer Seite gewünscht oder gewollt ist, das muss gestellt werden?
JS: Das kommt automatisch.
SK: Das kommt automatisch, ja. Was sagt das über den Zustand dieses Landes heute aus?
JS: Ich glaube, der Zustand des Landes ist gar nicht so viel anders als in anderen Ländern. Aber wir haben in Deutschland natürlich die Geschichte dieses Landes. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass von politischer Seite in Deutschland eine große Sorge besteht, dass der Vertreter des Judentums in Deutschland gegebenenfalls durch einen Anschlag oder irgendetwas zu Schaden kommt. Eine solche Schlagzeile wäre in der Welt, auf Deutschland bezogen, nicht besonders gut. Ich glaube, das spielt eine Rolle, dass man staatlicherseits hier besonders darauf achtet …
SK: Ahmad, gab es für dich einen definitiven Auslöser, dass du dich mit Antisemitismus so intensiv befasst hast? Wenn du mal zurückschaust in deiner Biografie?
AM: Mehrere. Erst einmal meine Biografie an sich, also wo ich aufgewachsen bin. Mein Opa kämpfte ja gegen diesen neu gegründeten Staat Israel, ich bin mit seinen Geschichten groß geworden. Über die irakischen Soldaten, die bei meinem Opa übernachtet haben, die dann gekämpft haben, über den Verrat der Araber, darüber, dass die Waffen – also laut meinen Großeltern – nicht gut funktioniert haben. Über die Immobilien oder Grundstücke, die Bauernhöfe, die sie verloren haben. Wenn wir zum Krankenhaus gefahren sind oder so, also außerhalb meiner kleinen Stadt, dann erzählte meine Oma: »Hier haben wir gearbeitet, hier haben wir einen Brunnen gehabt und Wasser geholt.« Also mit dieser Erzählung bin ich groß geworden.
Das habe ich nie infrage gestellt. Es war normal. 1991 haben wir uns auf Saddam Husseins Attacken auf Israel vorbereitet. Bis dahin fand ich Nachrichten langweilig, konnte damit nichts anfangen, aber da wusste ich, es geht um die Schule – wird die Schule offen bleiben oder wird sie schließen? Möchte ich eigentlich, dass dieser Krieg passiert, damit es keine Schule gibt, oder nicht? Ich war damals 12, 13 Jahre alt.
Dann habe ich angefangen, ganz anders Fernsehen zu schauen, und zwar das israelische Fernsehen. Wir haben in den 1990er Jahren drei Kanäle gehabt … Das war der jordanische Sender, wo die ganze Zeit nur irgendwelche Königsbilder gelaufen sind, dann syrisches Fernsehen, wo damals immer die Abenteuer von Assad gezeigt wurden und ab und zu Kinderprogramme. Und dann der israelische Kanal. Israelisches Fernsehen haben wir nie geschaut, weil meine Mutter nicht so gut Hebräisch kann und weil mein Vater das ablehnte.
Und auf einmal habe ich das angeschaut, Nachrichten und Programme … und habe eine absolut neue Welt entdeckt. Ich bin groß geworden mit arabischen Serien. Und auf einmal mache ich um 14 Uhr nach der Schule den Fernseher an und sehe Jugendliche, Teenies, die gegen ihre Eltern rebellieren, sich verlieben, ins Kino gehen, am Strand sitzen. Das fand ich faszinierend. Das war für mich etwas, was nicht zu meinem Leben gehörte. Es hat mich dazu bewegt, mich mehr und mehr damit zu beschäftigen. Ich habe dann begonnen, nicht nur Teenie-Serien zu schauen, sondern auch Nachrichten. Die Sichtweise der jüdischen Nachrichtensender hat mich interessiert. Aber ich habe sie abgelehnt.
Und dann gab es dieses Ereignis im Januar 1991, als die ersten Raketen kamen. Wir haben geschlafen, und dann hat mein Vater uns in Panik aufgeweckt, und wir mussten in den Schutzraum und Gasmasken tragen. Ich hörte die Nachbarn schreien. Und ich dachte am Anfang: Okay, also das ist jetzt Krieg, so passiert das. Ich konnte das nicht einschätzen. Ich dachte, die Leute sterben. Aber das waren Nachbarn, die gefeiert haben, weil es endlich jemand Israel gezeigt hat. Vor lauter Begeisterung für Saddam Hussein haben die Menschen behauptet, er wäre von Allah erwählt, und als Zeichnen dafür sei sein Gesicht auf dem Mond zu sehen. Auch meine Eltern sagten das.
Und dann war es das Studium, wo ich Leuten mit einer anderen Sichtweise begegnet bin. An der Uni Tel Aviv, dann an der-Fachhochschule Tel Aviv. Ich hatte Begegnungen mit Menschen, die frisch als Soldaten zurückgekommen waren und studieren wollten, und auf einmal hatte ich mit meinen Feinden (oder was ich als Feinde betrachtet habe) zu tun. Diese Begegnungen haben mich noch mal neugieriger gemacht, und ich habe angefangen zu zweifeln – und zwar an allem. An meinem Vater, an meiner Biografie, am Antisemitismus, an den islamistischen Milieus, mit denen ich groß geworden bin. Aber trotzdem war das nicht linear.
Ich glaube, zwischen 1996 und 2000 wollte ich Israeli sein. Ich erinnere mich an die Spiele der israelischen Nationalmannschaft, wo ich »El el, Israel!« gerufen habe, weil ich begeistert von diesem Fußball war und immer der Nationalmannschaft gefolgt bin, ich fühlte mich als Teil dieser Bevölkerung, dieses Landes.
Bis die zweite Intifada kam. Da ist eine Art von Rückschlag passiert. Die ganzen Unruhen haben ja bei uns, bei den arabischen Israelis, angefangen, an Jom Kippur damals, und breiteten sich aus. Dann sieht man natürlich diese Bilder und ist beeinflusst. Aber trotzdem hatte ich gute Kontakte zu ganz, ganz vielen Menschen. Ich habe auch jahrelang dort gearbeitet.
Dann kam ich nach Deutschland und erlebte noch mal einen Rückschlag. Wenn man die Sprache nicht beherrscht, wenn man in einem fremden Land ist, dann greift man zurück auf etwas, was man kennt. Und das waren die Moscheen in Neukölln, die palästinensische Community, wo ich mich wohlgefühlt habe. Die haben dann auch erzählt, »Haim Saban beherrscht die ganzen Medien«, »das ist ein Israeli …« Das sind Verschwörungserzählungen, die man irgendwie übernimmt.
An der Humboldt-Uni habe ich kaum Leute getroffen. Ich hatte den B.A. in Israel abgeschlossen, aber viele Kurse wurden hier in Deutschland anerkannt und dadurch habe ich das Diplom-Studium hier in Deutschland ab dem 5. Semester begonnen. Somit hatten alle meine Mitstudenten bereits vier Semester lang ohne mich studiert. Da hatten sich die Cliquen schon gebildet. Und dann habe ich eine Anzeige gesehen, an der Tafel, handgeschrieben, von einem Studenten, der nach einem Lernpartner suchte. Ich habe mich gemeldet – und es war eine Israelin. Ausgerechnet eine Isaelin. Da ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Von Fremden, die sich als Fremde fühlten an dieser Uni. Durch diese Freundschaft – Rosch Haschana und Pessach zusammen feiern, die Familie des anderen kennenlernen, die Kinder beim Großwerden beobachten, die Ängste, die antisemitischen Vorfälle, die man in der Schule bei dem Sohn gesehen hat – entstand eine ganz andere Qualität der Begegnung, die sehr gut hilft, differenziert und sachlich zu betrachten.
All das, um es zusammenfassend zu sagen, ist meine Motivation.
Ich bin jetzt hier in einer Wahlheimat, ich habe Deutschland ausgewählt. Ich war nicht immer angekommen und nicht immer zufrieden mit diesem Land. Aber ich kann nicht mit 47 Jahren noch mal migrieren, nach Kanada oder nach New York. Ich habe eine Tochter, die hier groß wird, die sich als Deutsche fühlt, und ich sage es auch immer: Es geht nicht nur um den Schutz von Juden. In dem Moment, in dem sich der Antisemitismus hier breitmacht, ist das Fundament, auf dem diese Republik nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, verloren. Und das kann – Entschuldigung, dass ich so pessimistisch bin – sehr schnell gehen, wenn wir nicht darauf achten und nicht dagegenarbeiten. Das ist meine Motivation.
Und ich merke auch, dass ich Leute erreiche. Ich merke, dass nicht jeder, der irgendwie antisemitisch sozialisiert wurde, auch antisemitisch bleiben muss. Wenn man die Leute erreicht, wenn man mit ihnen biografisch arbeitet, wenn man Emotionalität schafft, dann sind sie bereit nachzudenken.
SK: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was in den letzten Jahren, Herr Schuster, immer wieder, auch auf Tagungen, die ich moderieren durfte, zum Thema gemacht wurde: Antisemitismus ist tatsächlich so eine Art Lackmustest für die Verfasstheit dieses Landes, der Umgang mit Minderheiten sowieso, aber vor allem auch mit Jüdinnen und Juden, auch antimuslimischer Rassismus spielt eine ganz wichtige Rolle. Man muss natürlich diese Bestandteile einzeln betrachten, weil sie ganz eigenen Logiken folgen, aber das sind ganz wichtige Bausteine einer Demokratie.
Wenn Sie sich heute selbstverorten, eine Art Selbstbestimmung vornehmen, Herr Schuster, wie hat sich Ihr Jüdischsein über all die Jahre und Jahrzehnte in Deutschland verändert? Was beobachten Sie an sich? Gibt es da eine Entwicklung?
JS: Eine starke Veränderung, würde ich sagen, merke ich nicht. Ich bin ja in Haifa geboren und mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Weil ich mit zwei Jahren hierhergekommen bin, spielt sich das ganze Leben für mich in Deutschland ab, man kann sogar sagen, konkret in Würzburg. An die ersten zwei Lebensjahre erinnert man sich einfach nicht. So ist es.
Ich bin also in Würzburg aufgewachsen, allerdings etwas atypisch. Viele meiner jüdischen Bekannten und Freunde im selben Alter sind so aufgewachsen: Wir sind aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend hier, wir sitzen auf gepackten Koffern, und wenn wir wirtschaftlich etwas erreicht haben, dann gehen wir zurück nach Israel, dann wandern wir aus in die USA, wandern wir nach Kanada aus, was weiß ich, wohin.
Das war in meinem Elternhaus ganz anders. Zurückgekommen sind wir ja deshalb, weil sich mein Großvater seinen Grundbesitz in Bad Brückenau hat restituieren lassen.3 Er war damals über 80, und mein Vater hat gesagt, er kann seine betagten Eltern nicht alleine zurückgehen lassen. Er hatte sich zunächst eigentlich nur beurlauben lassen in Israel, aber ich bin zu jedem Zeitpunkt mit dem Bewusstsein erzogen worden oder aufgewachsen, dass ich ein jüdisches Kind bin, das aber bewusst in Deutschland lebt. Also nicht nur mal vorübergehend.
Deutschland, und in dem Fall halt Würzburg, war meine Heimat. Über die Geschichte wurde gesprochen, aber nicht bei jedem Frühstück, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen. Wenn es zu dem Thema kam, wurde darüber gesprochen, es war aber nicht das Thema Nummer eins, das mit Gewalt bei jeder Gelegenheit aufgetischt werden musste.
Auf der anderen Seite: Mein Vater war ja im KZ Dachau inhaftiert, zu den Gedenkfeiern zum Befreiungstag ist er jedes Jahr hingefahren, und als ich sechs Jahre alt war, haben mich meine Eltern zum ersten Mal dorthin mitgenommen. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber meine Eltern haben gesagt, ich hätte dort immer nur gesagt: »Ich will hier weg, ich will hier weg!«
Also ich wurde schon in Kenntnis der Geschichte erzogen, aber die Geschichte stand nicht über allem. Mein Vater war ja Vorsitzender der Gemeinde in Würzburg geworden. Ich war es gewohnt, dass wir am Freitagabend und am Schabbat früh in die Synagoge gingen, hatte aber in der Schule ausschließlich nichtjüdische Freunde. Es gab zu wenige jüdische Kinder, um überhaupt jüdische Freunde zu haben … Und es war dann zum Beispiel so, dass bei diesem Würstchen-Schnappen-Spiel bei Kindergeburtstagen für mich ein Erdnussbeutel anstatt der Wurst aufgehängt wurde, weil die anderen Eltern wussten, dass ich in einem koscheren Haushalt aufwuchs. Das war dann einfach selbstverständlich, auch für mich nicht irgendwie problematisch, und durch die Schulzeit, Grundschule und Gymnasium, bin ich völlig unproblematisch gekommen.
Ich muss sagen, dass ich auch im Gymnasium keinen Antisemitismus erlebt habe, obwohl meine Religion in der Klasse bekannt war. Allein schon deshalb, weil ich am Religionsunterricht nicht teilgenommen habe. Ich habe nicht hinterm Berg gehalten damit, habe aber auch kein Schild um den Hals gehabt: »Ich bin Jude.« Das war einfach selbstverständlich.
Auch im Studium hat sich eigentlich nichts substanziell verändert. Ein Beispiel: Hier in Berlin haben Sie, Herr Mansour, einen israelischen Freund gewonnen; einer meiner besten Freunde im Studium war ein Iraker. Wir haben uns bestens verstanden, haben auch voneinander abgeschrieben. Nur über Israelpolitik waren wir völlig konträrer Meinung, aber haben zu zweit dann auch sachlich darüber reden können. Das war unproblematisch und hat der Freundschaft in keiner Weise Abbruch getan. Im Kleinen funktioniert es eigentlich immer, so ist meine Erfahrung. Schwieriger wird es, wenn es größere Gruppen werden.
Also insgesamt hat sich mein Verhältnis zum Judentum nicht verändert. Im Studium und auch erst mal danach war Religion nicht das Thema Nummer eins, das ist ja bei vielen so. Da gibt es andere Themen, die wichtig sind: Beruf, Existenzgründung, Familiengründung. Eigentlich geht der Weg immer, wenn dann Kinder da sind, auch wieder Richtung Religion. Aber grundsätzlich hat sich bei mir im Verhältnis zur Religion eigentlich nichts verändert.
AM: Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Vor Kurzem habe ich in Deutschland einen Professor wiedergetroffen, der mich damals in Israel unterrichtet hat, Nathan Schneider. Er lebte ja in Deutschland, und der Moment, wo er sich entschieden hat, dieses Land zu verlassen, war 1972, die Olympischen Spiele in München. Darf ich fragen, wie das für Sie war, als jemand, der hier aufgewachsen ist, wenn auf einmal auf deutschem Boden Juden, weil sie Juden oder Israelis sind, ermordet werden?
JS: Ja, für mich war das sogar emotionaler als für manche andere, denn ein Teil der Olympiamannschaft war während der Olympischen Spiele – die waren ja in München – für einen Tag in Würzburg gewesen; in der jüdischen Gemeinde dort hatte es einen Empfang gegeben, also habe ich auch einige von denen, die ermordet wurden, persönlich kennengelernt. Ja, es hat mich natürlich betroffen gemacht, ich habe dies aber nicht auf Deutschland projiziert, sondern ich habe es so interpretiert, wie es letztlich auch war: Die Täter waren Palästinenser. Es ist in Deutschland passiert.
Rückblickend kann man heute sagen: Wie konnte das passieren? Warum war der Schutz so schlecht? Aber ich sah zur damaligen Zeit primär kein Verschulden Deutschlands an dem Olympiaattentat. Später wurde deutlich, dass viele Fehler gemacht wurden, auch von deutscher Seite.
SK: Herr Schuster, ich werde Sie gleich noch nach den Entwicklungen befragen, die Sie in diesem Land in Bezug auf jüdisches Leben wahrnehmen. Ahmad, du hast in dieser Konstellation eine Doppelrolle als jemand, der in Tira geboren ist, als arabischer Israeli, palästinensischer Israeli, muslimischer Israeli, Palästinenser. Wie bezeichnest du dich heute selbst?
AM: Als alles! Ich habe das Gefühl, manche wollen von mir, dass ich mich entscheide.
Steht auf meiner Twitter-Seite »arabischer Israeli«, dann bekomme ich von propalästinensischer Seite zu hören: »Ja, na klar, ignoriere halt das Palästinensersein!« Das ist natürlich ein Teil von mir, aber auf Twitter kann man das nicht so ausführlich erklären. Und wenn ich sage: »Ich bin palästinensischer Israeli«, dann zweifeln manche, vor allem Rechtsradikale, Israelis, dran und sagen: »Ja, was ist denn palästinensisch eigentlich? Du bist arabischer Israeli!«
Die anderen wollen entscheiden, was ich bin. Aber ich bin alles, das gehört zu mir. Die Uni, das Studium, die Arbeit, die Freunde, die Nachrichten, die Kriege, die Begegnungen, das ist alles Israeli in mir. Ich liebe die hebräische Sprache, ich habe sie so perfekt beherrscht, damals, damit ich in Discos in Tel Aviv nicht als Araber abgestempelt werde. Und ich liebe es bis heute, Nachrichten auf Kanal 12 anzuschauen. Fast jeden Abend, zum Schlafengehen, genieße ich diese Streitkultur und diese sieben Leute, die in einem Studio reden und alle durcheinanderschreien … Ich merke ein gewisses Gefühl des Ankommens auch nach 20 Jahren, wenn ich in Ben Gurion lande und die Luft rieche, die immer warm ist. Das gehört alles zu mir. Warum soll ich das ignorieren? Warum soll ich mich für etwas anderes entscheiden?





























