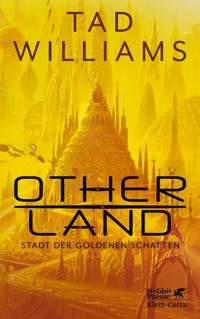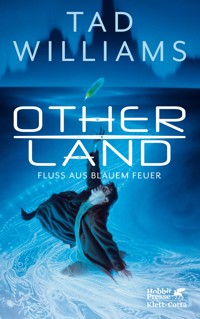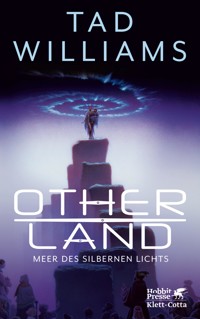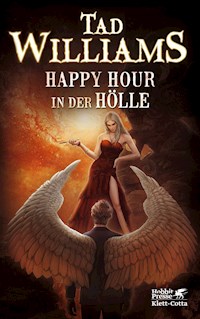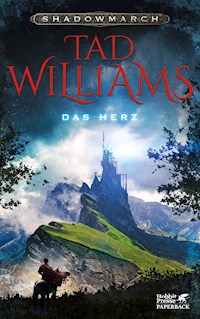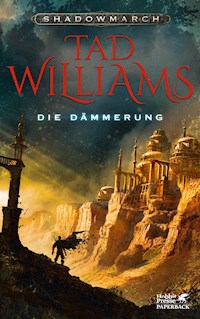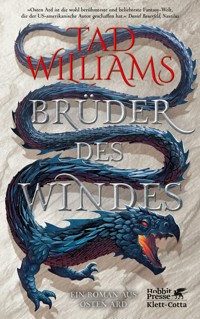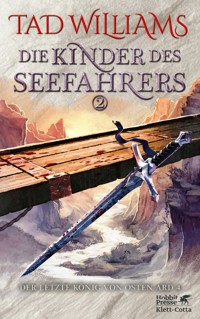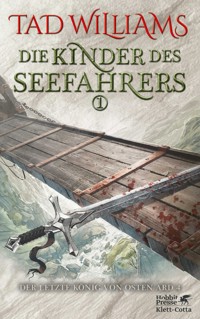9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bobby Dollar
- Sprache: Deutsch
»Bobby Dollars Suche nach der Wahrheit hat im Himmel und in der Hölle zahllose Lügen und Betrügereien offengelegt, und so treibt die Handlung einer faszinierenden Auflösung entgegen.« The Guardian Der Engel und Anwalt der verlorenen Seelen ist aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, seine Geliebte Caz befindet sich noch immer in den Fängen des Erzdämons Eligor. Und Bobby wird nun auch von seinen letzten Freunden im Himmel fallengelassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
TAD WILLIAMS
SPÄT DRAN AM JÜNGSTEN TAG
BOBBY DOLLAR 3
Aus dem Englischen von Cornelia Holfelder-von der Tann
KLETT-COTTA
Impressum
Hobbit Presse Paperback
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Sleeping Late on Judgement Day« im Verlag DAW Books, Inc., New York
© 2014 by Tad Williams
Für die deutsche Ausgabe
© 2015, 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: © Birgit Gitschier, Augsburg;
Illustration: © Kerem Beyit
Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94967-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10836-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Widmung
Prolog
1 Nur ein Engel
2 Alte Freunde, neue Feinde
3 Himmlisches Aftershave
4 Zu heiß
5 Spuk
6 Die Schwarze Sonne
7 Am Ende der Welt
8 Gehirnkrampf
9 Buddhistisch-druidische Weihnachten
10 Vierhändig
11 Tee und Wurfsterne
12 Geschmolzener Frosch sucht ebensolche Partnerin
13 Diktat
14 Die Probleme anderer Leute
15 Fun in Amerika
16 Let It Bleed
17 Konzentration
18 Zündende Idee
19 Karma-Korrektur
20 Die Löwin
21 Autoprobleme
22 Günstling des Glücks
23 Ein in Licht schwimmender Schatten
Zwischenspiel: Per Rotzglobin
24 Werschweinsorgen
25 Schickeria
26 Die Jugend von heute
27 Noch eine Morddrohung
28 Was nach Ozeanien gehört
29 Brombeergelee
30 Scherbensturm
31 Gesindel
32 Schöne, traurige Musik
33 Kaninchenloch
34 Tief drinnen
35 Maulkorb
36 Bobby hat mal wieder die Nase vorn
37 Besenrein
38 Starthilfe
39 Narwale und Empanadas
40 Der Teufel, den man kennt
41 Geradeaus bis zum Morgen
42 Zorn
43 Eine schöne Suppe
44 Weiß auf schwarz
45 Das Ende einer Welt
46 Bobbys Segen
47 Direkt gefragt
48 Nur ein Ticken desPaslogions
49 Bahnhof
Epilog
Dank
Widmung
Ich habe damals den ersten Band der Bobby-Dollar-Story meinem Freund David Pierce gewidmet, der uns kurz zuvor verlassen hatte. Seither habe ich noch einige wichtige Menschen verloren und unser Bereich Science Fiction/Fantasy ebenfalls.
Sterblichkeit ist schmerzlich, aber sie stiftet auch Gewichtungen.
Wir vermissen euch alle, ihr Schriftsteller, Künstler, Schöpfer, und Dave fehlt mir immer noch sehr, aber das ist die schreckliche, wunderbare Aporie unseres Lebens: Wir können nicht lieben, ohne eines Tages zu erfahren, was Verlust ist.
Prolog
Ich hatte noch nie einem Gerichtsprozess im Himmel beigewohnt – nicht in Person. Schon deshalb, weil solche Prozesse nicht so oft stattfinden.
Aber Moment mal, o weiser Engel, höre ich Sie sagen. Wie kann es denn im Himmel überhaupt Prozesse geben?
Gute Frage, denn wenn man’s einmal in die ewige Seligkeit geschafft hat, sollte doch alles geritzt sein, oder? Man ist unter die Gerechten einsortiert worden, sonst hätte man ja gar keinen Einlass erhalten, und danach tut man das Werk des Höchsten, wie also könnte man da noch etwas falsch machen?
Tja, erstens mal ist da das Ding mit dem freien Willen – Menschen und Engel müssen die Freiheit haben, Fehler zu machen, sonst würden wir in einem Uhrwerk-Universum leben, in dem alles vorherbestimmt und vollkommen ist. Die meiste Zeit wirkt der Himmel tatsächlich wie ein Schwarm heiterer, leuchtender Wesen, die in völliger Harmonie zusammenleben, ein Bienenstock, summend von Glück und Frohsinn und gemeinsamem Streben. Aber jeder weiß: In der Natur, so gut da auch alles eingerichtet sein mag, gibt es immer ein paar dämliche Vögel, die im Winter, wenn alle anderen nach Süden ziehen, nach Norden fliegen, oder den einen Schwachkopf von Lachs, der die Stromschnellen runtersurft und »Hey, yeah! Schaut mal!« ruft, wenn er volle Kanne mit den vernünftigeren Fischen zusammenknallt, die zum Laichen stromaufwärts schwimmen. Dass diese nichtrepräsentativen Deppen erfroren vom Himmel fallen oder nachkommenlos sterben, ist nicht der Punkt – der Punkt ist der freie Wille, und wir Engel sind offenbar genauso anfällig für mangelnde Impulskontrolle wie sonst irgendwer. Ergo gibt es im Himmel Prozesse, und ich war im Begriff, meinem ersten beizuwohnen.
Obwohl »beiwohnen«, zugegeben, etwas irreführend ist. Und mein erster war es auch nicht wirklich, weil ich schon mehrere andere mitbekommen hatte. Hier in der Ewigen Freude kann man nämlich solche wichtigen Dinge mitkriegen und sogar ganz genau verfolgen, ohne wirklich dabei zu sein, auch wenn das schwer zu erklären ist, weil – na ja, das ist auch so ein Himmelsding. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer vollen Kneipe, wenn die Playoffs im Fernsehen laufen und ein lokales Team spielt: Da brauchen Sie nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm zu starren, um zu wissen, was auf dem Spielfeld läuft, es teilt sich Ihnen auf vielfältige Art mit. Und so hatte ich Prozesse bisher immer verfolgt.
Aber dieser Prozess war etwas Besonderes, also hatte ich mir einen exzellenten Platz gesichert, ganz vorn in der Mitte. Der arme Teufel von Engel, dem der Prozess galt, würde die volle Wucht der himmlischen Gerechtigkeit zu spüren bekommen, und die gesamte Leuchtende Stadt sah dem gespannt entgegen. Die Halle des Gerichts funkelte und pulsierte vom Licht der Zuschauer – all der Engel, die von diesem Prozess mehr mitbekommen wollten als nur einen generellen Eindruck, die ihn persönlich und von Nahem miterleben wollten. Ich glaubte sogar, meinen Vorgesetzten, Erzengel Temuel (von uns himmlischem Fußvolk gewöhnlich »der Mull« genannt), nicht weit von mir zu entdecken.
Aus der Menge der Geretteten, die sich in der mächtigen, leuchtenden Halle drängten, obwohl sie nur semimateriell waren (noch so ein Himmelsding, das man nicht wirklich erklären kann), kam erwartungsvolles Murmeln und Flüstern, als jetzt das Gericht erschien, eine Reihe strahlender Engelsflammen, die die Großen und Bedeutenden waren – einige der Größten und Bedeutendsten, die unsere dritte Sphäre zu bieten hatte. Ich erkannte sie alle.
»Wir sind hier im Angesicht des Höchsten zusammengetreten, um Gerechtigkeit zu üben.« Diese Worte kamen von dem diamantartig funkelnden weißen Licht, das Terentia war, eine mächtige Engelsgestalt, die als Zeremonienmeisterin fungierte. Die anderen vier himmlischen Richter, Karael, Raziel, Anaita und Chamuel, flankierten sie schweigend, das ganze Ensemble wie eine Menora am fünften Tag von Chanukka. »Gott liebt Sie alle«, setzte Terentia hinzu und richtete ihre Aufmerksamkeit dann auf mich. »Anwaltsengel Doloriel, Sie werden der Verschwörung gegen die Gesetze des Himmels beschuldigt. Neben mehreren Straftaten werden Ihnen die Sünden des Zorns, des Hochmuts, des Neids und der Habgier zur Last gelegt, allesamt äußerst schwerwiegend. Sollten wir Sie für schuldig befinden, werden Sie des Himmels verwiesen und in die Grube der Verdammnis gestürzt, um dortselbst in ewigem Leiden und Elend zu verbleiben. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, ehe wir beginnen?«
Ja, okay, dass ich einen so guten Platz hatte, lag daran, dass ich der Angeklagte war. Und falls Sie jetzt Fragen haben, glauben Sie mir, ich hatte auch welche, wahrscheinlich dieselben, beginnend mit »Wie bin ich hier gelandet?« und »Wie komme ich hier wieder raus?«. Doch aus Gründen, die ich Ihnen noch darlegen werde, hielt ich es nicht für opportun, sie zu stellen.
»Hören Sie, es ist doch sowieso schon alles beschlossen«, sagte ich in der Hoffnung, eine coole Gelassenheit rüberzubringen, die meinem inneren Zustand kein bisschen entsprach. »Also lassen Sie uns zur Sache kommen. Wir wissen doch alle, dass der spannende Teil die Urteilsverkündung ist.«
Aber halt mal, höre ich Sie sagen. Wie sind Sie denn vor einem himmlischen Gericht gelandet, Bobby Dollar? Wie konnte Ihnen, einem der beliebtesten und geachtetsten Engel im ganzen Himmel, so etwas passieren?
Ha, ha, sehr lustig. Einem armen Kerl, der vor Gericht steht und um seine unsterbliche Seele fürchten muss, nochmal vors Schienbein zu treten, weil das so witzig ist!
Ach, Sie wollen wirklich wissen, wie ich hier gelandet bin? Tja, dann fange ich wohl am besten mit dem Traum an.
1
Nur ein Engel
Das aufgeschichtete Holz überragte die johlenden Zuschauer. Auf dem riesigen Scheiterhaufen lehnte die gefesselte Gestalt kraftlos an dem Pfahl wie etwas Lebloses, eine ausrangierte Schaufensterpuppe oder ein vergessenes Spielzeug. Sie trug die glänzende Rüstung eines Kriegers, aber die zierliche Figur erzählte etwas anderes. Es war eine Frau, die da verbrannt werden sollte. Es war die Heilige Johanna.
Sie hob den Kopf und schaute über den gedrängt vollen Marktplatz. Unsere Blicke trafen sich. Ich sah das weißgoldene Haar, die Augen, so rot wie Blut, und mein Herz gefror. Das war nicht die Jungfrau von Orleans, es war Caz – meine Caz, meine wunderschöne Dämonin, das Geschöpf, das meine Seele bezaubert und zugleich in Gefahr gebracht hatte.
Jemand hielt eine Fackel an den Holzhaufen. Zuerst entzündete sich das Reisig, Fäden von weißem Rauch schlängelten sich aufwärts und um ihre Füße. Binnen Sekunden kletterten Flammen den Scheiterhaufen hinauf und färbten den aufsteigenden Rauch mit Sonnenuntergangstönen. Caz zerrte an ihren Fesseln, immer verzweifelter, je höher die Flammen emporstiegen.
Ich konnte mich nicht rühren. Ich öffnete den Mund, um ihren Namen zu rufen, brachte aber keinen Laut heraus. Ich war starr, hilflos. In dem Moment, da sie mich am dringendsten brauchte, konnte ich nichts tun.
»Ich kann dich nicht erreichen!«, rief sie, während Rauchstränge sich an ihr emporwanden wie Schlangen. »Oh, Bobby! Ich kann dich nicht erreichen!« Dann wurden ihre Worte zu verzweifelten Schreien.
Flammen loderten auf, bis ich sie durch das Hitzeflimmern kaum noch erkennen konnte. Ihre sich windende Gestalt, der Rauch, die Häuser im Hintergrund, alles waberte wie unter Wasser. Dann, plötzlich, sah ich durch die quellende Wolke ein Geflatter in der Luft – geflügelte Wesen, die vom Himmel herabstießen.
Halleluja! Die Glocken der Stadt begannen zu läuten, das Lied der Erlösung anzustimmen. Halleluja! Die Geflügelten tauchten durch den Rauch herab – Engel, Engel, die kamen, um sie zu retten!
Doch dann konnte ich die Gestalten genauer erkennen. Vielleicht war es ja nur das verzerrende Hitzeflimmern, aber die vermeintlichen Retter sahen finster und schrecklich aus, mit blitzgrellen Augen und mit Flügeln, schwarz wie verkohltes Papier und an den Rändern glühend – als wäre das Feuer ihr natürliches Element.
Engel, fragte ich mich, oder Dämonen? Gekommen, um sie zu retten – oder um sie zu verschleppen und endloser Folterqual auszuliefern? Gelähmt und stumm konnte ich nur zuschauen, während die Glocken immer lauter wurden.
Halleluja.
HAA-lle-lu-ja!
HAA-lle-lu-ja!
Ich fuhr hoch, in meine Bettdecke verheddert. Das Zimmer um mich herum war dunkel bis auf ein klein wenig Straßenlaternenlicht, das durch die Ritze zwischen den billigen Vorhängen kroch. Keine Flammen, kein Rauch, aber mein Handy dudelte immer und immer wieder diese schrecklich witzige Melodie.
HAA–lle-lu-ja!
Mein Handy. Es war nur mein Handy.
Yeah, dachte ich, während mein Herz hämmerte und mein konfuses Denken sich allmählich sortierte. Leck mich, Händel – mitsamt deinem verfickten Ohrwurm. Und leck mich, du unbekannter Blödmann im Himmel, der du beschlossen hast, uns das als Klingelton zu verpassen.
Nachdem ich die Hälfte des Krempels von meinem Nachttisch gefegt hatte, fand ich das Handy und dann die Annahmetaste. Endlich verstummte das Lobgepreise.
»Was ist?« Mein Puls raste, als wäre ich gerade von einer Klippe ins Leere getreten. »Wehe, es ist nichts Dringendes, dann gibt es Tote.«
»Es hat schon einen gegeben.« Es war Alice aus dem Downtown-Büro – der hiesigen Verwaltungszweigstelle des Himmels. »Sie haben einen Klienten, Dollar.« Sie übermittelte mir die Details, als läse sie eine Einkaufsliste ab. »Auf geht’s, Cowboy. Und vielleicht wären Sie ja nicht so ein grantiges Ekel, wenn Sie sich nicht in den Schlaf saufen würden.«
Sie legte auf, bevor mir eine geistreiche Replik einfiel.
»Ich kann dich nicht erreichen!«, hatte Caz in meinem Traum gerufen. Und ich konnte sie auch nicht erreichen, weil uns mehr trennte als nur räumliche Entfernung. Eine von uns war in der Hölle. Und der andere fühlte sich, als wäre er dort.
Als ich so dalag und wartete, dass die erste schwarze Verzweiflungswelle des Tages verebbte, kam in der Nähe meines Kopfes ein kratzendes Geräusch aus der Wand. Es war mir schon beim Zubettgehen aufgefallen, und ich hatte es auf Ratten geschoben oder vielleicht auf einen Nachbarn, der etwas von der Wand abschabte. Diesmal hielt es eine ganze Weile an, ein monotones Kritz-Kratz-Kritz, das mir rasch auf die Nerven ging. Schließlich bummerte ich mit der Faust an die Wand, und es herrschte Ruhe.
Ich war nicht gerade begeistert von meiner neuen Bleibe im alles andere als noblen Tierra-Green-Apartmentkomplex, doch aufgrund der Tatsache, dass immer wieder Leute und Kreaturen, die mir an den Kragen wollten, herausfanden, wo ich wohnte, hatte ich in letzter Zeit nie lange irgendwo bleiben können. Und ich hasse Umziehen.
Nach dem Albtraum von meiner brennenden Liebsten und den Geräuschen in der Wand musste ich erst mal ein, zwei Minuten den Kopf in ein Waschbecken mit kaltem Wasser stecken, bevor ich meine Gedanken auf die Arbeit richten konnte.
Anwaltsengel, ermahnte ich mich. Jemand braucht dich.
Der Klient war nicht weit weg, nur ein Stück den Bayshore Freeway entlang, doch als ich meine Wohnung verlassen hatte, musste ich erst mal zehn Minuten mein Auto suchen. Nicht, wie ich gleich klarstellen möchte, weil ich am Vorabend besoffen nach Hause gekommen wäre (wenn ich vielleicht auch einen winzigen Schwips gehabt haben mochte), sondern weil ich nach gewissen Erlebnissen mit einem mörderischen Halbzombie namens Smyler meine Karre jeden Abend woanders parkte.
Ich fühlte mich, als hätte ich nur etwa zehn Minuten geschlafen, aber es wurde schon langsam hell, was hieß, dass ich eine ganz ordentliche Menge Schlaf bekommen hatte: Ich war nach dem Nachhausekommen sofort weggeknackt. Wiederum nicht wegen Besoffenseins, obwohl ich zum Essen schon das eine oder andere Bier getrunken hatte. (Ich versuche in letzter Zeit weniger zu trinken und überhaupt ein bisschen verantwortungsvoller zu sein.) Nein, ich pennte zu merkwürdigen Zeiten ein und vergaß, wo mein Auto stand, weil ich so schlecht schlief. Und ich schlief schlecht, weil ich immer von der Hölle träumte. Ich hatte nämlich gerade ein gefühltes halbes Jahr dort verbracht, und es war haargenau so schlimm, wie man sich’s vorstellt. Nein, schlimmer. Das steckt man nicht so einfach weg. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nur hingegangen war, um die Dämonin, die ich liebte, Casimira, Gräfin von Coldhands, zu befreien, und dass ich versagt hatte. Übelst. Daher die permanenten Unzulänglichkeitsgefühle ihres Freundes Bobby und seine nahezu allnächtlichen Albträume.
Der von dieser Nacht war allerdings neu gewesen und schlimmer als die üblichen. Gewöhnlich träumte ich einfach nur von Marmora, der falschen Caz, mit der mich der Erzdämon Eligor reingelegt hatte wie den letzten Dilettanten. Dann durchlebte ich wieder, wie sich die Caz-Attrappe in meinen Armen in flüssiges Nichts verwandelte. Manchmal träumte ich auch von den schrecklichen Dingen, die ich Caz hatte widerfahren sehen, während ich von Eligor, ihrem Boss und Exlover, gefoltert wurde. Ich träumte davon, obwohl ich überzeugt war, dass ihr das meiste davon gar nicht wirklich widerfahren war. (Das musste ich einfach glauben.) Was also war an diesem Traum anders gewesen? Caz hatte mir mal erzählt, dass sie bei ihrer Hinrichtung an Jeanne d’Arc gedacht habe, also war es kein Wunder, dass mein Unterbewusstsein dieses Detail in das normale Albtraummuster einwob.
Aber etwas war diesmal anders gewesen, etwas Tieferes, das ich nicht zu fassen bekam – fast, als hätte sie wirklich mit mir zu kommunizieren versucht. Aber wie, warum und worüber? Ich hatte keine Ahnung.
Schließlich fand ich meinen eckigen alten Datsun in einer Seitengasse der Heller Street, die als Parkplatz erkoren zu haben ich mich nur sehr dunkel erinnerte. Es war Ende November, aber klar und trocken, also war der Verkehr selbst in Zentrumsnähe nicht schlimm; ich brauchte keine Viertelstunde bis zu der Unfallstelle ein kleines Stück südlich des Woodside-Expressway-Kreuzes. Ein Minivan mit einer seitlichen Aufschrift lag am Ende einer Trümmerspur böse zerknautscht auf dem Dach. Streifen- und Rettungswagen parkten auf der Bankette, und überall blinkte es blau und rot. Das einzige Opfer lag auf dem Boden, mit einem blutigen Tuch bedeckt, und niemand schien es sonderlich eilig zu haben.
Engelzeit.
Ich parkte gut dreißig Meter jenseits der Unfallstelle auf der Bankette und ging durch das Eiskraut zurück. Keiner der Cops beachtete mich, aber so ist das nun mal: Wenn wir Engel bei der Arbeit sind, besonders am Ort eines Todesfalls, bemerkt uns niemand. Wobei ich für die Cops und Rettungssanitäter gleich noch unsichtbarer sein würde. Wenige Meter von dem Toten entfernt blieb ich stehen und öffnete das aus hellem, aber unstetem Licht bestehende Portal, das wir Engel einen Reißverschluss nennen. Das ist eine Öffnung, durch die wir treten, um unsere Arbeit zu machen. Es sind Löcher in der Zeit, und alles auf der anderen Seite ist eine Art Blase, bestehend aus dem jeweiligen Moment.
Als ich hindurchtrat, verstummten die Geräusche des Freeways. Drüben waren die Einsatzfahrzeuge und die vorbeifahrenden Autos, ja selbst die Menschen allesamt erstarrt, als wären ein paar Milliarden Liter klares Kunstharz über alles gegossen worden. Cops, mitten im Winken eingefroren, ebenso Lichtleisten in verschiedenen Stadien der Illumination, eine ganze Welt, in Grabesstille verfallen. Außer mir war das einzige, was sich bewegte, ein Mann in Arbeitskleidung, der zwischen den reglosen Fahrzeugen umherging und an Scheiben pochte, einen der Fahrer auf sich aufmerksam zu machen versuchte. Was natürlich nicht klappte, denn er war außerhalb der Zeit, sie alle dagegen innerhalb.
Er sah mich und kam auf mich zugelaufen. Er hatte einen dicken Schnauzbart und dunkle Haut, aber das Hervorstechende war das Weiß seiner schreckgeweiteten Augen. »Hilfe!«, rief er. »Ich hatte einen Unfall!«
»Gurdeep Malhotra«, sagte ich. »Gott liebt Sie.«
»Wer sind Sie?«, fragte er und kam stolpernd zum Stehen.
»Ich bin Doloriel, Ihr Anwaltsengel.« Ich ließ das erst mal zu ihm durchdringen. »Leider haben Sie den Unfall nicht überlebt.«
Er starrte mich an. Wenn die Möglichkeit kreislauftechnisch noch bestanden hätte, wäre er blass geworden. So schien ihn einen Moment lang die Kraft zu verlassen, als der Schock durch ihn hindurchbrandete. »Aber … aber das geht nicht! Mein Sohn! Er hat heute …« Er schüttelte langsam den Kopf. »Meine Frau! Werde ich sie nie mehr wiedersehen?«
»Es gibt da vieles, was ich Ihnen nicht sagen darf«, sagte ich, so freundlich ich konnte. Tatsächlich gibt es vieles, was ich selbst nicht weiß. »Jetzt müssen wir aber zuerst mal Ihre Gerichtsverhandlung vorbereiten. Das ist mein Job. Ich werde alles für Ihre Verteidigung tun. Ich weiß, Sie waren ein guter Mensch.« (In Wahrheit wusste ich das bislang keineswegs, aber es schadet nie, einen Klienten so weit zu beruhigen, dass man mit ihm arbeiten kann.)
Er starrte mich immer noch an. »Aber … Sie sind ein Engel? Wie kann das sein? Ich bin kein Christ!«
»Schon okay, Mr Malhotra. Ich bin kein christlicher Engel. Ich bin einfach nur ein Engel.«
Die Verhandlung ging nicht so zügig vonstatten, wie ich es mir gewünscht hätte. Der Anklägerdämon war ein kleiner Ehrgeizling namens Ratpiddle, einer von der Sorte, die glaubt, jede Sache durch irgendeinen raffinierten Schachzug à la Perry Mason gewinnen zu können. Er zerrte jede kleinste Verfehlung hervor, die der arme Verstorbene je begangen hatte – eine Verwarnung wegen rücksichtslosen Fahrens, das der Polizist nicht mal mit einem Strafzettel geahndet hatte! –, und versuchte das Bild eines absolut eigensüchtigen Menschen zu zeichnen, obwohl Gurdeep es an diesem Morgen nur deshalb so eilig gehabt hatte, weil er noch die Geburtstagsgeschenke für seinen Sohn einpacken wollte, bevor der Junge aufstand, um in die Schule zu gehen. Das brachte mich wirklich auf die Palme, und ich fürchte, ich titulierte den Ankläger als »Abschaum der Höllenlatrinen«, was zwar sachlich gerechtfertigt, aber nicht besonders kollegial war. Doch zu meinem und Mr Malhotras Glück war die Richterin ein phlegmatisches kugelförmiges Strahlen namens Sashimiel, vor dem ich schon mehrfach plädiert hatte. Sie würde sich nicht davon aufputschen lassen, dass irgendein Ankläger sich einen Namen zu machen versuchte. Nach einer gewissen Anstandsfrist schnitt sie Ratpiddle mitten in einem neuerlichen Schlenker das Wort ab und verkündete das Urteil zugunsten meines Klienten. Und schwupp war Gurdeep Malhotra auf dem Weg zur wie auch immer gearteten nächsten Etappe des Geschehens. (Obwohl ich die auch durchlaufen haben muss, habe ich keinerlei Erinnerung daran, sodass ich hier leider nicht präziser werden kann.) Die Richterin kehrte dorthin zurück, wo sich Mächte und Fürstentümer zwischen ihren Richtereinsätzen aufhalten, wo auch immer das sein mag. Ratpiddle verschwand, vor Wut qualmend, und ich konnte mich meinem Tag zuwenden.
2
Alte Freunde, neue Feinde
Als ich aus der Zeitlosigkeit des Außerhalb in die sogenannte reale Welt zurückkehrte, war es kurz vor neun. Nur weil wir aus ihr hinaustreten, bleibt die Zeit nämlich nicht stehen. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir erdbasierten Engel sterbliche Körper tragen. Sobald wir wieder durch den Reißverschluss treten, holen wir die Zeitdifferenz zwischen dem Außerhalb und der realen Welt auf – in diesem Fall zwei, drei Stunden. Ich bin zwar nicht gerade ein Morgenmensch, aber die Vorstellung, wieder ins Bett zu kriechen und erneut von Caz zu träumen, war deprimierend, also fuhr ich durch die Hafengegend zum Oyster Bill’s, einer Bar, in der es auch Essen gibt, jedenfalls so was Ähnliches. Ich habe eine Schwäche für dieses Lokal und bin dort schon Stammgast, solange ich mich erinnern kann, was beweist, dass meine Loyalität ausgeprägter ist als meine Vernunft. Ja, wenn ich nicht schon tot wäre, könnte das mal auf meinem Grabstein stehen.
Ich verputzte gerade den letzten Rest der Mischung aus Mehrfachzuckern und Fett, die Bill schelmisch »Frühstück« nennt, als ein alter Alki von der Straße hereinkam und sich diskret bettelnd die Theke entlangarbeitete. (Bill will keine Bettelei in seiner Bar – er sagt, dadurch verlöre sie an Niveau, was wirklich extrem drollig ist.) Die meisten anderen Gäste nahmen den Mann gar nicht zur Kenntnis, warteten einfach nur, dass er das kapierte und weiterging, doch als er zu mir kam, fischte ich in meiner Jackentasche nach lose herumklimperndem Kleingeld. Der Alte hatte Triefaugen, und sein Haar stand ab, als hätte er es irgendwann in den Achtzigerjahren schaumgestylt und seither nicht mehr daran gerührt. Außerdem roch er, als hätte er etwas getrunken, das nicht zum Trinken gedacht ist – Billigrasierwasser vielleicht, durch ein altes T-Shirt gesiebt.
Ich drückte ihm das Geld in die Hand und sagte: »Viel Glück. Gott liebt Sie.« Ich sagte es nicht sehr laut, denn im Oyster Bill’s nett zu sein ist ungefähr so, wie auffällig hinkend an einem Rudel hungriger Löwen vorbeizugehen, aber er schien es zu hören. Er lächelte zahnlos und klopfte mir auf die Schulter.
»Danke, mein Freund«, sagte er weniger verwaschen, als ich erwartet hätte. »Ich möchte Ihnen für Ihre Freundlichkeit auch etwas geben.«
»Nein, das ist wirklich nicht …«
Er griff in die Hosentasche und zog ein verknittertes, ehemals weißes Blatt Papier hervor, das wie ein Brief gefaltet war. Er reichte es mir, als wäre es etwas wert, was auch irgendwie traurig war. »Versprechen Sie mir, dass Sie’s lesen. Versprechen Sie, dass Sie drüber nachdenken. Gott kennt Sie und will Sie für seinen großen Plan.« Dann schlurfte er davon und auf die Promenade hinaus.
Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass ein Alki einem Engel erklärte, er werde für Gottes großen Plan gebraucht. Ich warf einen Blick auf das Machwerk, aber es schien eher politischer als religiöser Natur zu sein. Als Überschrift stand da sowas wie: »Jemand im Weißen Haus will Sie vernichten!« Ich hätte das Blatt am liebsten auf der Theke liegen lassen, aber ich wusste ja nicht, ob der alte Säufer mich vielleicht von draußen beobachtete, voller Entzücken, dass endlich mal jemand eins seiner verknitterten Pamphlete angenommen hatte, also steckte ich es ein, ehe ich rausging.
Ich wollte immer noch nicht nach Hause, aber zehn Uhr morgens war viel zu früh, um ins Compasses zu gehen und mich in Gesellschaft mitfühlender Arbeitskollegen zu betrinken, also beschloss ich, mal bei meinem Kumpel und Mitengel Sam anzurufen, von dem ich schon zwei Tage nichts gehört hatte. (In den größten Teil der Scheiße, in der ich jetzt steckte, hatte mich Sam geritten, also spricht es Bände, dass ich ihn immer noch als meinen besten Freund betrachtete.)
Im Gehen zu telefonieren, hasse ich fast so sehr, wie ich Leute hasse, die im Gehen telefonieren, daher ergriff ich, als ich an einer Bushaltestelle an der Parade Street – wo normalerweise alle Sitzgelegenheiten von frühstückenden Büroangestellten, Touristen oder jenen in allen Innenstädten vertretenen leicht vergammelten jungen Leuten mit Halstuch tragenden Hunden okkupiert sind – eine freie Bank sah, die Gelegenheit beim Schopf, setzte mich hin und nahm mein Handy heraus. Dabei fiel mir das Pamphlet des Penners aus der Tasche, und während ich dem Handytuten lauschte, schaute ich noch mal drauf.
Besonders inhaltsreich war es nicht. Unter der in handgemalten Blockbuchstaben geschriebenen Mitteilung, dass mich jemand im Weißen Haus vernichten wolle, war ein Bildchen des nämlichen Gebäudes, inmitten von Wolken schwebend. Darunter wiederum stand: »Sie haben Feinde. Wollen Sie nicht mehr über sie wissen? DIE wissen alles über SIE!« Es folgte der für Spinnerschrifttum geradezu obligatorische Bibelspruch:
Prediger 9:12
Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern, wie die Fische gefangen werden mit einem verderblichen Haken und wie die Vögel mit einem Strick gefangen werden, so werden auch die Menschen berückt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt.
Den Abschluss bildete ein seltsames Arrangement von Zeug, das offensichtlich aus Zeitschriften ausgeschnitten und vor dem Kopieren auf das Original geklebt worden war. Die ersten beiden Sujets waren ein Engel und etwas Maulwurfartiges. Das mit dem Engel war ja schon ein interessanter Zufall. Ich betrachtete das Wühltier und überlegte, ob es für einen Maulwurf im Weißen Haus stehen sollte. Sams Handy klingelte immer noch. Schließlich legte ich auf. Irgendwas regte sich in meinem Hinterkopf.
Plötzlich ging es mir auf. Maulwurf. Mull. Der Mull. Erzengel Temuel, mein Vorgesetzter.
Noch zwei Bildchen waren da am unteren Ende des Handzettels, ein Wecker wie aus einem Bilderbuch und eine Cartoon-Gartenbank. Auch das schien ein ziemlich unwahrscheinlicher Zufall, da ich den Erzengel in der Vergangenheit ein paarmal auf einer Bank am Beeger Square getroffen hatte. Und wenn es kein Zufall war, war es die Einbestellung zu einem Meeting.
Ich trabte rüber zum Platz und suchte alle Bänke ab, doch von dem geruchsintensiven Alten war nichts zu sehen. Konnte es wirklich Temuel gewesen sein? Unser Erzengel liebte Verkleidungen, vor allem, wenn er etwas Konspiratives vorhatte, und es war durchaus möglich, dass er wusste, wie ihn alle in meiner Abteilung nannten. Und »das Weiße Haus« war nicht allzu weit entfernt von »das hohe Haus« oder schlicht »das Haus«, wie wir gemeines Engelsfußvolk den Himmel zu nennen pflegten. Aber musste man mir extra mitteilen, dass Leute im Himmel es auf mich abgesehen hatten? Das wusste ich auch so. Und Temuel wusste, dass ich es wusste. Also war dieses Blatt entweder das, wofür ich es zunächst gehalten hatte, ein Sendschreiben aus Hinterspinnerland, das ein paar bedeutungslose Zufallstreffer enthielt; oder aber mein Boss hatte sich eigens auf die Erde herabbegeben, um mich zu warnen, dass ich in noch schlimmeren Schwierigkeiten steckte, als ich dachte. Und ich hatte das Treffen verpasst.
Ich sah nochmal auf das Blatt und bemerkte jetzt, dass die Zeiger des Weckers auf elf Uhr standen. Ich checkte die Uhrzeit auf meinem Handy. Neun Uhr vierzig. Kein Wunder, dass von Temuel nichts zu sehen war – noch fast eineinhalb Stunden! Also würde ich doch ins Compasses gehen müssen, denn auf dem windigen Beeger Square gedachte ich nicht so lange zu sitzen. Und ich ging ja nicht hin, um zu trinken, sondern nur, um die Zeit herumzubringen, bis ich herausfinden konnte, ob das hier eine echte Botschaft war. Also zählte es eigentlich nicht.
Wie oft haben Sie schon ein Blatt Papier in der Hand gehalten und gebetet, dass es von einem echten Alki mit einer Wolke von echtem Schweißgeruch und einer echten Rasierwasserfahne stammen möge und nicht von einem Erzengel?
Bei mir war es das erste Mal.
Als ich ins Compasses kam, war fast niemand da, nur zwei Engel, die ich nicht näher kannte, French Didi und noch einer, die in einer Sitznische saßen und zusammen eine Flasche Wein leerten, als wäre es zehn Uhr abends und nicht morgens. Sie schauten gerade lange genug auf, um mir zuzunicken, und setzten dann ihre Diskussion über irgendwelche Formel-1-Rennen fort. Ich kannte sie wie gesagt kaum, und die Formel 1 ist nicht so mein Ding, also wäre ich fast wieder gegangen. Aber ich begab mich dann doch an die Bar und bat den Barmann Chico, mir ein Bier rüberzuschieben.
Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich würde mit dem Trinken zurückstecken. Aber, wissen Sie, Wodka, das ist Trinken. Bier – na ja, Bier, das ist nur den Mund befeuchten.
Jedenfalls, als Chico mir die Flasche Negra Modelo hinschob, sagte er: »Heute kommt ihr Spezialfälle anscheinend alle heim ins Nest.«
»Wieso? Wer noch?«
»Bin ich Ihr Sekretär oder was? Gehen Sie selbst ins Hinterzimmer und schauen Sie nach.«
Ich dachte, es müsste Sam sein, der schon mal einen hochriskanten (und, soweit ich es beurteilen konnte, völlig unnötigen) Heimatbesuch in der Bar gewagt hatte, wo er vom ganzen restlichen Kaputten Chor wie ein zurückkehrender Kriegsheld behandelt worden war, aber was er um diese Zeit hier wollen sollte, war mir schleierhaft. Der Gedanke machte mich hochgradig nervös, und das lag nicht an der frühen Tageszeit. Wegen seiner bekannt gewordenen Zugehörigkeit zum Dritten Weg war Sam bei unseren himmlischen Bossen persona angelica mehr als non grata.
Das Hinterzimmer des Compasses ist eigentlich ein kleiner Alkoven am Weg zu den Klos – eine Art Separee. Ich schob den Vorhang auf, und da saß, über ein Bier gebeugt, Walter Sanders.
Ja, der Walter Sanders: der Engel, der, als er mir gerade etwas Wichtiges erzählen wollte, von einem verrückten Toten erstochen worden war, wobei ich damals davon ausgegangen war, dass der Kerl mich hatte erstechen wollen. (Inzwischen war ich mir ziemlich sicher, dass der Angriff von vornherein Walter gegolten hatte, um ihn zum Schweigen zu bringen.) Dann war Walter verschwunden. Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, war er in der Hölle gewesen, in einem Dämonenkörper als Hilfskraft auf einem Sklavenschiff. Dort hatte er mir zuletzt noch einen Hinweis darauf gegeben, dass Anaita, eine meiner mächtigsten Vorgesetzten, hinter dem Dritten Weg (der derzeit meistgejagten himmlischen Rebellenorganisation) und einem Gutteil meiner derzeitigen Probleme steckte. Und dort in der Hölle hatte ich Walter Sanders zurückgelassen, weshalb ich verständlicherweise mehr als nur gelinde erstaunt war, dass er jetzt im Mantel hier vor einem Bier saß wie ein ganz normaler Compasses-Stammgast.
»Walter!« Ich warf mich auf die Sitzbank ihm gegenüber. »Was zum Teufel – pardon – machen Sie hier?«
Er war zunächst zusammengeschreckt, doch als er sah, dass ich es war, lächelte er. Es war ein müdes Lächeln. »Hey, Bobby. Schön, Sie zu sehen. Ich bin wieder da.«
»Hab ich schon gemerkt. Aber wieso? Seit wann? Was ist passiert?«
»Weiß ich immer noch nicht genau. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir beide den Bürgersteig entlanggehen, dann … nichts mehr. Als ich den neuen Körper bekommen hatte, stellte sich raus, dass ich wochenlang weg war! Schon merkwürdig. Bisschen schwer, wieder … auf Touren zu kommen.« Er lachte wenig überzeugend und nahm einen Schluck von seinem Bier. »Aber es ist schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen.«
All die Fragen, die eben noch im Begriff gewesen waren, aus mir herauszuströmen, stauten sich plötzlich in meinem Gehirn. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu verarbeiten, was er gerade gesagt hatte. »Moment mal. Sie erinnern sich an gar nichts? Nachdem Sie erstochen wurden?«
Er schüttelte den Kopf. »Da ist nichts, nicht das kleinste Bisschen. Und an den Abend, an dem es passiert ist, erinnere ich mich auch kaum. Ich weiß nur noch, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Sie nicht allzu sehr strapaziert. Ich weiß, dass Sie versucht haben, Hilfe zu holen.«
Ich konnte nur stumm dasitzen und ihn anstarren, mein Bier noch unangerührt vor mir. Was ging hier vor? War Walters Gedächtnis gelöscht worden, nachdem man ihn aus der Hölle zurückgeholt hatte? Oder war er einfach nur vorsichtig – zu schlau, um in einer Engelbar über das zu plappern, was wirklich passiert war? Ich atmete tief durch, versuchte das Zittern meiner Hände abzustellen und machte angemessen Konversation, während wir unser Bier tranken, obwohl mir die Lust auf meins vergangen war. Als ich es halb geleert hatte, stellte ich die Flasche hin und erklärte, ich müsse jetzt gehen. Ich fragte ihn, ob er zu Fuß da sei und ich ihn begleiten solle, aber Walter schüttelte nur wieder ein wenig benommen den Kopf.
»Nein«, sagte er. »Nein, danke. Ich will ehrlich sein, Bobby. Ich bin heute den ersten Tag wieder hier, und mir reicht’s jetzt erst mal mit Reden – hab vorhin schon ein paar aus der Gang getroffen. Ich bin … weiß nicht … müde. Total müde. Ich trinke das da noch aus und rufe mir dann ein Taxi.«
Mich überkam jetzt eine gewisse Verzweiflung. »Okay. Aber sind Sie sicher, dass da nicht noch irgendwas ist, worüber Sie mit mir reden wollen? Muss ja nicht heute sein. Von mir aus gern jederzeit. Weil Sie an dem Abend doch mit mir reden wollten. Sie wollten mir was erzählen.«
Er sah mich merkwürdig an. »Eine Sache ist da schon. Sagt Ihnen das was?« Er nahm seine Brieftasche heraus, kramte kurz darin herum und zog dann ein zusammengefaltetes Blatt hervor. Es war aus einem Terminplaner, eine der Blanko-Notizseiten, und darauf stand: Mit D. wegen?? v. A. reden.
Mein Puls beschleunigte sich etwas. »Ist das Ihre Schrift?«
»Ja. Aber es ist von vor dem Abend, an dem ich erstochen wurde, und ich weiß nicht mehr, was es heißen soll. Mir ist nur gerade der Gedanke gekommen, dass ›D‹ Sie sein könnten. Klingelt da was?«
»Möglich.« Und ob. Mit Dollar wegen Anaitas Fragerei reden, das hieß es. »War nett, Walter. Ich werde mal drüber nachdenken. Gute Besserung.«
Als ich die noch halbvolle Bierflasche auf die Bar zurückstellte, fragte Chico: »Krank?«
»Bisschen«, sagte ich. »Geschockt« hätte es besser getroffen. Weil ich jetzt wusste, dass das alles war, was ich aus Walter Sanders herauskriegen würde. Das, was er mir an jenem verhängnisvollen Abend hatte erzählen wollen, war verschwunden, vom Machtapparat des Himmels aus seinem Gedächtnis getilgt. Doch dank der Notiz, die sich Walter gemacht hatte, bevor er aus dem Verkehr gezogen wurde, brauchte ich jetzt keine Zeit mehr damit zu vergeuden, mich zu fragen, ob ich mit meinem Verdacht gegen diese Ober-Bitch Anaita richtig lag. Für mich war jetzt klar: Sie hatte es auf mich abgesehen.
Womit immer noch die unerfreuliche Tatsache blieb, dass mich jemand sehr viel Mächtigeres als ich zum Schweigen bringen, wenn nicht gar ganz beseitigen wollte.
Als ich aus dem Compasses kam und mir wünschte, ich würde noch rauchen, huschte am Rand meines Gesichtsfelds etwas unter ein Auto. Normalerweise hätte ich es nicht weiter beachtet, aber jetzt, nach Walters Rückkehr – oder besser, der Rückkehr eines Teils von Walter, der nicht der war, den ich brauchte –, war ich doch einigermaßen nervös, also schaute ich genauer hin. Falls der messerschwingende Smyler zurückgekehrt war und befunden hatte, ich sei doch wieder Bobby Böser-Engel, wollte ich nicht kalt erwischt werden. In dem Sekundenbruchteil, den ich es sah, bevor es in einem Wasserablauf verschwand, wirkte das huschende Etwas nicht viel größer als eine Katze, aber Katzen rannten nicht so: die Beine seitlich weggespreizt, den Bauch fast am Boden.
Wenn ich nicht gewusst hätte, dass das nicht sein konnte, hätte ich gesagt, das, was da lautlos ins Dunkel hinter einem Müllcontainer flitzte, sah aus wie eine Spinne von der Größe eines Fahrradreifens. Aber es war wohl nur eine Fehlleistung meines nervösen, hypergestressten Gehirns.
3
Himmlisches Aftershave
Ich sah den alten Penner schon von der anderen Seite des Beeger Square aus. Er hatte die Bank für sich, was nicht so erstaunlich war.
»Das mit dem Geruch haben Sie wirklich drauf.« Ich setzte mich neben ihn, aber nicht zu dicht.
Falls ich noch irgendwelche Zweifel hatte, zerstreute sie sein scheues Lächeln. »Gut so? Ich hab’s nicht übertrieben?«
»Untertrieben haben Sie’s mit Sicherheit nicht.« Ich streckte die Beine aus. Jedenfalls würde sich niemand zu uns setzen und uns stören. Die aromatischen Obertöne von sockengefiltertem Rasierwasser lagen auf einer tieferen Note von ranzigem Schweiß mit einem fruchtigen Hauch von menschlichem Urin. »Ich war gerade im Compasses. Habe Walter Sanders getroffen.«
»Ach«, sagte Temuel.
»Ja – ›ach‹. Was ist mit ihm passiert?«
»Er ist wieder arbeitsfähig. Alles wieder beim Alten.«
»Quatsch! Dieser Typ ist entkernt worden wie ein Apfel, man hat ihm die Erinnerungen einfach rausgenommen. Und zwar meinetwegen, wie wir beide verdammt genau wissen. Weil er etwas darüber wusste, warum mir dieser ganze Scheiß widerfährt.« Etwas über Anaita, wollte ich sagen, dieses Höllenluder, das alle als Engel bezeichnen.
»Als ich Walter das letzte Mal gesehen habe, arbeitete er auf einem Sklavenschiff in der … na ja, sagen wir einfach, an einem sehr unwirtlichen Ort. Haben Sie ihn da rausgeholt?«
Kein Blickkontakt diesmal, da Temuel ein paar Tauben beobachtete, die sich um einen Tortilla-Chip zankten. »Auf Ihre Information wurde reagiert. Walter … Anwaltsengel Vatriel … ist wieder in den aktiven Dienst eingegliedert worden. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.«
Das war ein unübersehbares Sackgassenschild. »Okay, anderer Versuch. Wenn es nicht wegen Walter ist, warum wollten Sie mich dann hier treffen? Warum haben Sie mir Ihr kleines Bilderrätsel zugesteckt?«
Er sah mich irritiert an. Die Schraffur von kleinen lila Äderchen auf seinen Wangen und seiner Nase war genauso realistisch wie sein Geruch. »Weil ich im Himmel nicht mit Ihnen reden kann. Und weil mich niemand dabei sehen darf, wie ich woanders mit Ihnen rede. Aber Sie müssen wissen, dass die Lage ernst ist, Bobby. Gewisse wichtige Leute droben verlieren allmählich die Geduld mit Ihnen.«
Es war immer noch komisch, von ihm mit meinem Erdennamen angesprochen zu werden, obwohl er mich außerhalb des Himmels kaum je anders zu nennen schien, was mich verblüffte. Ich kam auch immer noch nicht ganz mit diesem Mein-Vorgesetzter-mein-heimlicher-Gönner-Ding klar, obwohl ich ohne ihn nie in die Hölle gelangt wäre und gar nicht erst die Chance gehabt hätte, Caz zu retten. Dass das nicht geklappt hatte, war zwar nicht Temuels Schuld – soweit ich wusste jedenfalls –, aber ich hatte für meinen Geschmack immer noch zu viele unbeantwortete Fragen, was ihn betraf. »Was heißt das? Wie ernst?«
»Sehr ernst. Es war nicht leicht, Ihre lange Abwesenheit zu kaschieren. Und es ist jetzt nicht mehr nur das Ephorat, das Fragen stellt, es sind inzwischen auch noch andere in den höheren Etagen. Sie haben ja keine Ahnung, wie schwer es ist, Mächten und Fürstentümern etwas zu verheimlichen.«
Allmählich war ich es leid, mir Schuldgefühle machen zu lassen. »Warum tun Sie’s dann?«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich meine, was springt für Sie dabei raus, Erzengel? Warum sollten Sie auch nur einen Finger rühren, um mir zu helfen? Warum Ihre eigene Seele aufs Spiel setzen? Weil Sie mich mögen? Das wäre seltsam, wo mich doch sonst niemand mag.«
»Ich würde schon sagen, dass ich Sie mag, Bobby.« Er betrachtete mich mit großväterlicher Miene, jedenfalls unter der Voraussetzung, dass der betreffende Großvater ein nach Pisse stinkendes, verwahrlostes Individuum war. »Aber damit ist es nicht getan, Bobby, längst nicht. Karael, Terentia, Anaita, die sind alle viel, viel mächtiger als ich – und sie gehören noch nicht mal zur Hohen Schar, den obersten Dienern des Höchsten. Sie sind auch nur Teil der Dritten Sphäre, so wie wir, dafür zuständig, über die Erde zu wachen. Es gibt Mächte über den Mächten, verstehen Sie?« Er spreizte die schmutzigen Finger mit den rissigen Nägeln, wie um zu illustrieren, dass das Universum ein Fadenspiel war. »Meine Güte, es geht immer noch höher und höher hinauf!«
»Okay, kapiert, es gilt zu verhindern, dass die Immer-noch-Höheren so viel über mich nachdenken. Was also soll ich gegen diese unerwünschte Aufmerksamkeit tun? Auf die Knie fallen und in geduckter Haltung verharren?«
»Das wäre gar keine schlechte Idee, jedenfalls fürs Erste.« Er war jetzt wieder streng, ein alttestamentarischer Prophet in einer schmuddeligen Marinejacke. »Versuchen Sie einfach, sich eine Zeitlang bedeckt zu halten, okay? Nehmen Sie nicht frei. Tun Sie nichts Auffälliges. Und ziehen Sie um Himmels willen nicht mehr andauernd um. Sie hatten im letzten Jahr etliche Apartments, von Ihrer Tour durch diverse unappetitliche Motels mal ganz abgesehen.«
»Ich hätte ja bessere nehmen können, wenn uns der Himmel anständig bezahlen würde.« Wie Sie sich wohl denken können, war ich schon nicht der große Teamplayer gewesen, bevor dieser ganze verrückte Dritter-Weg- und Engel-und-Dämonen-Schlamassel begonnen hatte. »Hören Sie, ich weiß, Sie wollen mir helfen. Das ist mir klar, und dafür bin ich Ihnen dankbar. Aber Sie wissen doch selbst, warum ich so oft umgezogen bin! Sie erinnern sich doch noch an die verschiedenen Etwasse, die mir in ihrer extremen Voreingenommenheit den Garaus machen wollten?«
»Ja, aber das ist für den Himmel kein Argument, weil es anderen Anwaltsengeln nicht passiert. Es geht um Sie, Bobby. Sie ziehen Probleme an wie ein Magnet, und selbst diejenigen dort oben, die Ihnen … selbst diejenigen, die nichts gegen Sie haben, fragen sich allmählich, warum Ihr Name so oft auftaucht.«
»Gut, okay, kapiert – ich soll keinen Wind machen, nichts Absonderliches tun. Aber das Absonderliche hört nicht auf, mir was zu tun.«
Nichts drin diesmal. Er zog sein Programm durch. »Sie wissen, dass es nicht nur das ist.«
Und er hatte recht. Ja, ich habe andauernd verrückten Scheiß am Hals, aber das liegt schon größtenteils daran, dass ich ihn mir selbst auflade.
»Aber für mich geht’s um zu viel, als dass ich einfach aussteigen könnte«, sagte ich. »Sie wissen doch, warum ich dort war. An dem bewussten Ort.« In der Hölle, meinte ich. »Und warum es nicht geklappt hat.«
»Sagen Sie mir nichts.« Temuel hob die Hände, wie um sich die Ohren zuzuhalten. Er sah aus wie Munchs Schrei. »Was auch immer Sie ansonsten tun, halten Sie sich aus allem raus, was irgendwelche Wellen schlagen könnte. Bleiben Sie für die da oben sichtbar. Bleiben Sie an einem Ort. Und machen Sie Ihren Job, Ihren eigentlichen Job. Ich werde Ihnen helfen, wenn ich kann.« Und damit stand er abrupt auf und ging davon.
Dass das eigene Leben ganz schön verpfuscht ist, merkt man dann, wenn sich selbst die versoffenen Penner von einem abwenden.
4
Zu heiß
In der Nacht wachte ich zweimal auf. Das erste Mal, weil ich etwas an mein Fenster klopfen zu hören glaubte. Ich nahm eine Taschenlampe und meine Pistole, einfach nur sicherheitshalber, fand aber nichts. Als ich ein paar Stunden später zum zweiten Mal hochschreckte, konnte ich keinen konkreten Grund benennen. Doch während ich so dalag und der dunklen Stille lauschte, nahm ich einen üblen Gestank wahr, als ob eine Ratte in die Heizungskanäle des Apartments gelangt und dort verendet war. Das dritte Mal wach wurde ich etwa fünf Minuten bevor der Wecker klingeln sollte. Ich blieb noch liegen und dachte über einige miese Entscheidungen nach, die ich im letzten Jahr getroffen hatte.
Da dudelte mein Handy los. Es war natürlich Alice mit ihrem unfehlbaren Timing. Sie hatte Arbeit für mich, eine achtundachtzigjährige Frau, die soeben im Orchard District, westlich von Spanishtown, gestorben war. Ich konnte nur noch eine Tasse aufgewärmten Kaffee runterstürzen, und mein Kopf fühlte sich an, als wäre er mit nassem Splitt gefüllt.
Es hätte schlimmer kommen können. Der Job selbst war nicht allzu schwer. Das Leben der Verstorbenen erwies sich als durchweg normal, genau genommen sogar richtig löblich, und gegen elf verabschiedete ich ihre Seele gen Himmel (jedenfalls war das der Zeitpunkt, zu dem ich wieder in die Erdenzeit eintrat).
Da nichts anstand, was sofort getan werden musste, parkte ich am Amtrak-Bahnhof von San Judas – von einigen Alteingesessenen immer noch »das Depot« genannt – und spazierte durch die Einkaufsarkaden des Bahnhofs, die vom Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts datierten, als der Bahnhof das Herz der Stadt war. Ich brauchte unbedingt ein Aufputschmittel, und dort befindet sich ein Coffeeshop, den ich mag, nicht weil man da etwas anderes bekäme als das teure Zeug, das es heutzutage überall gibt, sondern weil der Manager oder sonst jemand dort auf Jazz steht und entsprechende Sachen aus dem Sound-System kommen.
Überhaupt habe ich ein Faible für die Bahnhofsarkaden, nicht nur wegen des Coffeeshops oder des spektakulären Eisen-Glas-Daches, das sich vom Bahnhof bis zum Broadway erstreckt. Von einer der oberen Galerien an dem hohen Atrium auf das Einkaufsgetriebe hinabzuschauen, erinnert mich irgendwie an den Himmel. Wobei in den Bahnhofsarkaden natürlich, anders als im Himmel, alles mit Firmenlogos gepflastert ist, was der edwardianischen Eleganz das Bauwerks doch ein klein wenig Abbruch tut, aber ich bin trotzdem gern dort. Ich mag nämlich Leute, wirklich. Nur aus der Nähe mag ich sie nicht so.
Der Coffeeshop heißt Java Programmers, was wohl irgendein Nerdwitz ist, aber das verzeihe ich ihnen wegen der Hintergrundmusik. Ich bestellte normalen Kaffee, ein Hühnersalat-Sandwich und irgendwelche kartoffelfreien Chips (ein Fehler, den ich nicht noch mal machen werde, weil sie wie frittiertes Sägemehl schmeckten). Aus dem Sound-System kam etwas Modernes, ein Saxophon-Duett. Während ich kaute und schlürfte und lauschte, versuchte ich mir zu überlegen, was ich jetzt tun sollte.
Verstehen Sie mich nicht falsch, es war schön, wieder zu arbeiten und das gute alte Engelleben zu führen, von dem ich während dieser ganzen Strapazen in der Hölle schon nicht mehr geglaubt hatte, dass es mir noch mal zuteilwürde. Andererseits verdankte ich diesen kurzen Urlaub in der Normalität nur der Tatsache, dass ich es ein paar Dutzend Mal geschafft hatte, nicht von irgendwelchen Leuten in Stücke gerissen, erschossen oder erstochen zu werden – Leuten, die ebendieses wahrscheinlich immer noch mit mir vorhatten. Diverse ungelöste Probleme, die mein Höllentrip hinterlassen hatte, saßen mir immer noch im Nacken. Da waren zuvörderst Caz, die Frau, die ich liebte und die immer noch in der Hölle gefangen saß, und Anaita, die mächtige Engelsgestalt, die mir ständig ans Leder wollte, ohne dass ich wusste oder auch nur ahnte, warum. Man hätte meinen können, ich hätte ihr ihren reservierten Stellplatz in der Parkgarage für leitendes Himmelspersonal geklaut.
Der ganze Schlamassel drehte sich allem Anschein nach um einen Deal zwischen der mächtigen Engelsgestalt Anaita (getarnt als Engel Kephas) und Großfürst Eligor, dem hochrangigen Höllendämon, der Caz gefangen hielt. Eligor hatte von Anaita zum Zeichen ihrer Übereinkunft eine Engelsfeder bekommen. Wobei die Feder in Wirklichkeit ein Druckmittel darstellte, damit Anaita den Mund hielt, falls der Deal, bei dem es um die Erschaffung einer Heimstatt für das Dritter-Weg-Experiment ging, platzte. Die Feder war irgendwann in meinen Besitz gelangt (fragen Sie nicht, wie und warum, es sei denn, Sie hätten etwa eine Woche Zeit), und nach meiner Rückkehr aus der Hölle hatte ich versucht, sie gegen Caz’ Freilassung einzutauschen. Eligor hatte mich reingelegt: Er hatte die Feder bekommen, aber Caz dennoch in seiner Gewalt behalten.
Als ich gerade ernsthaft überlegt hatte, ob Engel wohl Selbstmord begehen konnten, hatte mich mein Juniorengelfreund Clarence gefragt, was denn Eligors Pfand bei dem Deal gewesen sei – was er Anaita im Tausch für die Feder gegeben habe. Auf den Gedanken war ich selbst noch gar nicht gekommen, und er war mit ein Grund, doch weiterzumachen. Wenn ich Eligors Pfand – bei dem es sich mit ziemlicher Sicherheit um eins seiner Hörner handelte, da ich das nachwachsende Minihorn gesehen hatte, als er mir einmal aus Versehen sein wahres (und wahrhaft furchteinflößendes) Gesicht zeigte – in die Hände bekäme, wäre es für ihn genauso viel wert wie die Feder, und ich könnte es gegen Caz eintauschen, aber diesmal wirklich.
Doch es gab da ein Problem: Ich hatte weder Eligors Horn noch auch nur die leiseste Ahnung, wo es sich befinden könnte. Ich musste herausfinden, wo Anaita es versteckt hatte, und es ihr dann stehlen. Ach ja, und damit davonkommen, ohne dass Anaita oder sonst jemand von meinen Bossen etwas merkte oder irgendetwas von alldem spitzkriegte, was ich in letzter Zeit getrieben hatte.
Kinderspiel, oder?
Während ich mein Sandwich und die Sägemehl-Chips aß, beobachtete ich ein paar Teenager, die vor einem Videospiel-Laden schräg gegenüber herumlungerten. Etwas an der Art, wie einer von ihnen sich im Kreis drehte und seinem Kumpel dabei seinen Wollschal um die Ohren schlug, erinnerte mich an Mr Fox, den tanzenden Spinner, dem ich ziemlich zu Beginn des ganzen verflixten Dritter-Weg-Schlamassels begegnet war. Foxy hatte mir geholfen, eine Auktion zu organisieren, bei der es um die Feder ging. Ich hatte sie nicht wirklich verkaufen wollen (zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass ich sie hatte), aber ich wollte herausfinden, was die Leute glaubten, was ich hätte, darum sollten alle möglichen seltsamen Leute zusammenkommen und dafür bieten.
Na ja, zum damaligen Zeitpunkt schien es eine gute Idee zu sein.
Aber wie so viele aufregende Abenteuer Ihres Lieblingshelden endete die Auktion damit, dass mich eine Horde übler Gestalten mit Kugeln zu durchsieben versuchte und anschließend ein riesiges babylonisches Dämonendingsbums – ein Ghallu – meinen Wagen zerfetzte, während Sam und ich drinsaßen. Doch jetzt, als mich der Bursche mit dem Schal an Mr Foxy-Foxy erinnerte, fiel mir wieder ein, dass der ja die Sorte Leute kannte, die sich für Objekte wie echte Engelsfedern interessierten. Also war es ja nicht undenkbar, dass er auch etwas über ein Großfürstenhorn wusste. Besonders logisch war die Parallele nicht – von der Feder hatte Foxy nur gewusst, weil sich herumgesprochen hatte, dass sie Eligor gestohlen worden war. Aber vielleicht konnte er mich ja an jemanden verweisen, der einen Tipp für mich hatte. Irgendwessen Hilfe brauchte ich, denn im Moment war mein Ideenfundus so leer wie der Riesenpappeimer vor mir – das, was sich heutzutage Kaffeebecher nennt.
Okay. Ich hatte vielleicht nicht direkt einen Plan, aber doch immerhin einen gewissen Koffeinpegel und einen nächsten Schritt: Foxy fragen.
Ich war so nah an Downtown, dass ich beschloss, meinen Wagen am Bahnhof stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen. Es war ganz schönes Wetter – November in Nordkalifornien ist wie September in den meisten anderen Gegenden –, und ein bisschen Bewegung kam mir ganz recht.
Ich traf auf mehrere städtische Hebebühnenwagen: In Jude wird die öffentliche Weihnachtsdekoration direkt nach Thanksgiving angebracht. Falls jemand noch nicht wissen sollte, dass Weihnachtseinkaufszeit ist, obwohl jeder Laden in der ganzen Stadt von Lametta glitzert und Konservenversionen von »The Little Drummer Boy« und »God Rest Ye, Merry Gentlemen« über die Lautsprecher jagt.
In den letzten zehn Jahren hat sich in Downtown-Jude wirklich viel getan. Ich gestehe, ich bin mittlerweile konservativ genug, um manches davon doch ein bisschen irritierend zu finden. Es wurde zwar darauf geachtet, die historischen Gebäude im Herzen der Stadt nicht zu verschandeln, aber so ziemlich alles Übrige ist jetzt in diesen Spielzeugstadtfarben gestrichen, die nicht so mein Fall sind – breite Streifen von Gelb, Lila und Blau, knallbunte Markisen, limettengrüne Laternenpfähle. Manchmal sieht es aus, als hätten sie aus ganz Downtown eine Tagesstätte für überalterte Kinder gemacht. Irgendwie ist das wohl der Fortschritt. Ich höre immer wieder, in den Siebziger- und Achtzigerjahren sei die Altstadt ganz schön trostlos gewesen, nichts als Penner, Schnapsläden und Striplokale, aber ich lebe hier, seit ich nicht mehr bei den Harfenmännern bin, und ich bin Romantiker genug, um zu sagen, dass mir die alte Version vermutlich lieber gewesen wäre, als in der Sesamstraße zu wohnen.
Als ich kurz vor dem Beeger Square stehenblieb, um eine Großfamilie vor mir über die Straße zu lassen, fiel mir auf, dass zwei Typen, die ich vorher schon gesehen hatte, immer noch hinter mir waren und dass auch sie stehengeblieben waren; sie guckten ins Schaufenster eines Babybedarfsgeschäfts namens Small Wonders, zeigten auf Sachen und diskutierten angeregt darüber. Die beiden sahen ein bisschen aus wie Mormonenmissionare: adrette, junge weiße Männer in langweiligen Anzügen. Klar hätten sie werdende Väter sein können, aber ihr Verhalten wirkte doch etwas forciert, und irgendwas an ihren Anzügen und schwarzen Schuhen passte auch nicht ganz. Cops? Die wurden ja mit jedem Jahr jünger, jedenfalls aus meiner Sicht. Oder waren diese Typen etwas Bedrohlicheres?
Ich war versucht, sie in eine Gasse zu locken und ihnen einen Heidenschiss einzujagen, aber vielleicht waren es ja doch nur zwei harmlose Jungs auf der Suche nach Leuten, die des Wortes Jesu bedurften. Unschuldige Mormonen zu terrorisieren wäre ja schon schlimm genug, aber wenn es Zivilbullen waren, konnte es kompliziert werden. Außerdem hatte ich etwas zu erledigen, wobei ich nicht beobachtet werden wollte, also spazierte ich auf den Beeger Square, verschwand hinter einem der Imbisswagen, die sich zur Mittag- und Abendessenszeit auf dem Platz versammelten, und schlüpfte dann in eins der öffentlichen Toilettenhäuschen. Ein paar charmante Minuten lang genoss ich die Gerüche menschlicher Verrichtungen, dann trat ich vorsichtig wieder hinaus. Von den Missionaren keine Spur, also marschierte ich in Richtung der Straßenecke, wo es mir das erste Mal gelungen war, Foxy-Foxy herbeizurufen, jedermanns tanzenden Lieblingshehler für gestohlene übernatürliche Objekte.
An der Kreuzung Marshall Avenue und Main Street erklomm ich die nächstgelegene Fußgängerinsel, drückte den Ampelknopf und tat so, als wartete ich auf Grün. Es schien niemand herzuschauen, also zog ich eine senkrechte Linie durch die Luft, und einer der himmlischen Patentreißverschlüsse erschien. Während sich ein Fußgängergrüppchen um mich sammelte, wartete ich ab, und als dann die Ampel umsprang und alle losmarschierten, beugte ich mich an den glühenden Schlitz, den nur Engel und ein paar andere Auserwählte sehen können, und rief leise Foxys Namen.
Beim ersten Mal war er praktisch sofort erschienen, also sah ich mich um. Der übliche Autostrom schob sich vorbei, aber von Mr Fox war nichts zu sehen – und glauben Sie mir, den übersieht man nicht so leicht. Ich wartete noch etwa eine Minute und wollte es dann gerade noch mal probieren, als ich aus dem Augenwinkel auf der anderen Seite der Marshall Avenue etwas flattern sah, etwas Weißes, wie ein sehr kleiner, sehr erregter Geist. Als ich genau hinsah, erkannte ich, dass es ein Taschentuch war, mit dem jemand um das Ende eines hölzernen Bauzauns herum winkte. Ich wartete auf Grün, weil selbst ein Engel nicht will, dass sein Erdenkörper mitten auf einer befahrenen Straße zu Mus zerquetscht wird, und ging dann hinüber.
Als ich den mit Graffiti übersäten Bauzaun erreichte, erschien die Hand wieder, diesmal ohne Taschentuch, und winkte mich in das Schattendunkel am Rand der Baustelle. Im Näherkommen erkannte ich eine vertraute Silhouette.
Mr Fox oder Foxy-Foxy, oder wie auch immer er eigentlich heißt, sieht aus wie eine Kreuzung aus Dick Van Dyke in »Mary Poppins« und dem Moderator einer extrem schrägen japanischen Gameshow. Er trägt Schlotteranzüge und Schlabberschals, und er ist ein Albino, glaube ich. Ich sage »glaube ich«, weil er ja auch etwas sein könnte, das nur wie ein Albino-Mensch aussieht. Wenn Sie sich vorschnelle Urteile abgewöhnen wollen, hängen Sie mal eine Weile mit Bobby D. rum und lernen Sie ein paar von den Leuten kennen, die er kennt. Im Ernst. Das wird Ihnen diese Neigung schnell austreiben. Einer der nettesten Typen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe, ist etwa drei Meter groß und hat eine riesige, klaffende Axtwunde im Schädel. Er sieht aus, als müsste er sich seine Sandwiches mit Kindergartenkindern belegen, ist aber in Wirklichkeit ein Schatz. Ein Jammer, dass er in der Hölle lebt.
Doch zurück zu Foxy. Ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte, denn es war zwar eindeutig er – dieselbe totenbleiche Haut, dieselben gelben Katzenaugen –, aber er tanzte nicht. Jedenfalls nicht so wie sonst – ein einziges Drehen und Biegen und Beugen mit etwas Soft-Shoe-Steppen, Jazzhands und furiosem Finish. Er blieb auf einer Stelle stehen, und die einzig durchgängige Bewegung war das nervöse Scharren seiner Füße.
»Mr Bob!« Er lächelte, aber nicht sonderlich überzeugend. »Schön, Sie zu sehen! Schade, dass ich jetzt nicht reden kann!«
»Was soll das heißen?« Ich drehte mich um, für den Fall, dass er etwas gesehen hatte, das mir entgangen war, aber wir standen ein ganzes Stück abseits des Fußgängerstroms, weitgehend verdeckt von Baugerüst und –zaun.
»Oh, Sie wissen ja, Dollar-Man – viel zu tun! Foxy-Foxy ist immer im Dienst. Aber wir sehen uns bald!« Er wich bereits tiefer ins Schattendunkel zurück.
»Moment. Ich muss Sie was fragen. Wegen der Auktion in der Insulanerhalle. Sie erinnern sich ja sicher.«
Er lachte – ein Spur bitter, dachte ich. »Oh, ja! Sehr aufregend! Große Schießerei! Total gut fürs Geschäft, Mr Bobby.«
»Hören Sie, das bedaure ich genauso wie Sie. Sie hätten mal sehen sollen, wie der Rest des Abends für mich gelaufen ist.« Nämlich so, dass das bereits erwähnte babylonische Dämonendingsbums nicht nur meinen Wagen killte, sondern auch noch das halbe Compasses zerstörte, nachdem es Sam und mir dorthin gefolgt war. »Aber ich muss wissen, wer bei dieser Auktion war. Oder genauer gesagt, ich muss wissen, wer sich für eine gewisse Sorte Objekt interessieren könnte. Nicht für das Objekt, das ich damals angeboten habe, sondern für ein … äh … ähnliches.«
Jetzt wurde das nervöse Füßescharren zu einem ausgewachsenen Herumhibbeln. »Tut mir echt leid, Mr Dollar Bob. Kann mich an nichts erinnern! Weiß nicht mehr, wer dort war! Weiß nicht mal, wovon Sie reden – ist plötzlich alles so weit weg.« Er verdrückte sich jetzt eindeutig rückwärts, immer noch hibbelnd, als müsste er dringend pinkeln.
»Was soll der Quatsch, Fox? Sie sind doch damals auf mich zugekommen, oder etwa nicht? Sie haben doch gesagt, Sie würden jederzeit gern wieder mit mir zusammenarbeiten.«
»O ja, würd ich auch, wirklich! Aber gerade jetzt? Nein. Ist mir einfach zu heiß. Zu viel Nix-Gut. Sorry.«
»Was meinen Sie mit zu heiß? Was ist zu heiß?«
»Sie. Alles. Ist nichts für Mister Foxy. Viel zu groß für den armen kleinen Fox-Man.«
Das gefiel mir alles ganz und gar nicht. »Sagen Sie mir, was Sie wissen.«
»Kann nicht. Sprechen uns bald, Mr Dollar Bobby. Bin sicher, Sie kriegen das alles superduper hin. Kein Problem. Nur … bloß …«
Während ich darauf wartete, dass er den Satz beendete, hupte es ganz in meiner Nähe. Ich schreckte zusammen, aber es war nur ein Taxifahrer, der einen wagemutigen Fußgänger anhupte, weil der beschlossen hatte, die Zone neben dem Ampelübergang zu erkunden. Als ich mich wieder umdrehte, hatte sich Foxy-Foxy in Luft aufgelöst wie ein Neujahrsvorsatz im Februar.
Gefiel mir der Gedanke, so eindeutig untergangsgeweiht zu sein, dass selbst verrückte Semi-Leute nichts mit mir zu tun haben wollten? Nein, er gefiel mir nicht. Tatsächlich wäre ich, wenn mein Wagen nicht auf der anderen Seite von Downtown gestanden hätte, gleich wieder ins Compasses verschwunden, um mir ein, zwei kleine Realitätsverscheucher zu gönnen. Aber ich wollte keinen Arbeitsanruf bekommen, während ich fünfzehn Gehminuten bzw. fünfundzwanzig Schwank- und Stolperminuten von meinem Wagen entfernt war, also drehte ich den Bayfront-Wolkenkratzern den Rücken zu und ging zurück in Richtung Bahnhof. Ich hielt die Augen offen, sah aber diesmal weder meine Freunde in den Missionarsanzügen, noch – worüber ich erst recht froh war – irgendwelche unter parkenden Wagen herumlungernden Riesenspinnen-oder-was.
Man soll ja auch für kleine Dinge dankbar sein.
Also zurück in mein nicht gerade gediegenes Tierra-Green-Apartment. Als ich durch die Wohnungstür trat und nach dem Lichtschalter tastete, huschte etwas Pelziges über meine Füße. Okay, in meiner momentanen Verfassung war ich vielleicht ein bisschen schreckhaft, was erklären mag, dass ich zusammenfuhr und so laut losbrüllte, dass der Nachbar von oben auf seinen Fußboden zu bummern begann. Und es mag auch erklären, dass ich nur noch das letzte Bisschen dessen sah, was da zum offenen Fenster meines im ersten Stock gelegenen Apartments hinauswieselte. Was es jedoch nicht erklärt, war, dass das Ding auf dem Fensterbrett wie ein haariger, dünner, grauschwarzer Arm aussah, mit einer verschrumpelten kleinen blutergussfarbenen Hand am Ende, wie eine nichtmumifizierte Version der Affenpfote. Doch bevor ich irgendwelche törichten Wünsche äußern oder auch nur wieder schreien konnte, ließen die festgekrallten Finger los, und das Ding verschwand außer Sicht.
Ich rannte natürlich ans Fenster, sah aber in dem schmalen Durchgang unten nichts als ein paar Recycling-Mülleimer, die zu klein waren, um auch nur den handlichsten Affen zu beherbergen.
Vielleicht war ja der ganze Wahnsinn um mich herum ansteckend. Oder es war der posttraumatische Schock. Jedenfalls schlief ich in dieser Nacht mit meiner Pistole unterm Kopfkissen.
5
Spuk
Echt«, sagte ich zu Clarence, dem Juniorengel, während wir darauf warteten, bestellen zu können, »allmählich wird es mir ein bisschen unheimlich. Es geht jetzt schon mehrere Tage. Zuerst war da so ein Kratzen in der Wand. Ach ja, und zeitweilig der Geruch von vergammeltem Fleisch. Reizend. Und dann diese Affenpfote oder was das war.«
»Affenpfote?«
Clarence klaubte sich einen Fussel vom Pullover, während ich ihm von der kleinen grauen Hand auf dem Fensterbrett erzählte. Der Junge hatte in letzter Zeit kleidungsmäßig eine Schippe draufgelegt. Er trug jetzt sogar eine coole Drahtgestellbrille und hatte sich die Haare etwas wachsen lassen, was so einen lässigen Komme-grade-von-meinem-Segelboot-Look ergab.