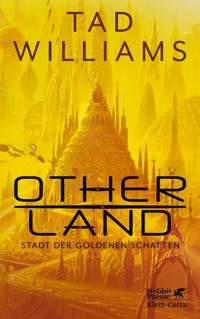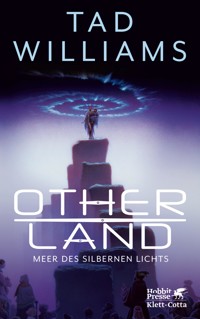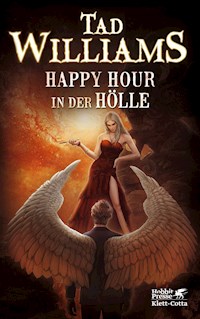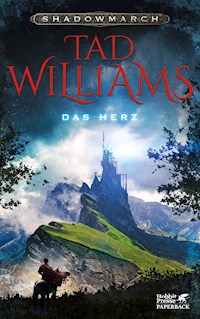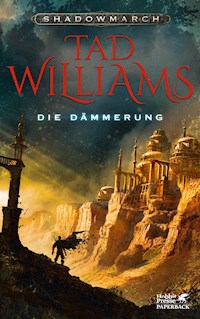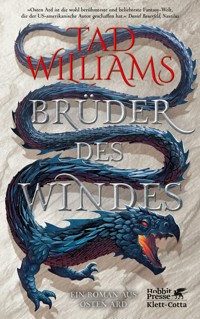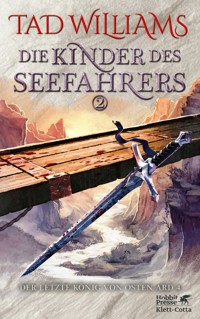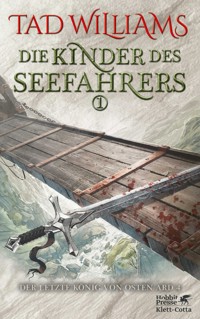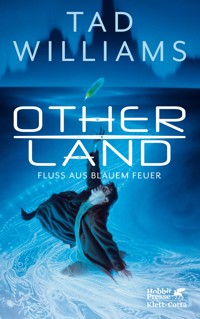
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Otherland
- Sprache: Deutsch
Ihre Welt wird sich verändern: Otherland - eine Verschwörung in der realen Welt und ein virtuelles Wunderland voller tödlicher Gefahren Im zweiten Band von »Otherland«, Fluß aus blauem Feuer, ist es einer kleinen Gruppe Verzweifelter gelungen, tatsächlich in Otherland einzudringen. Und da schnappt die Falle zu. Sie sind gefangen, unfähig, wieder in ihre Körper aus Fleisch und Blut in der realen Welt zurückzukehren. Zufälle und gefährliche Abenteuer zersprengen die Gruppe. Ihre einzige Hoffnung ist der Fluß. Der Fluß aus blauem Feuer, der durch alle virtuellen Welten Otherlands fließt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1345
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Tad Williams
Otherland
Band 2Fluß aus blauem Feuer
Aus dem Englischen übersetztvon Hans-Ulrich Möhring
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Otherland«
bei Daw Books, Inc. New York
© 1998 Tad Williams
Für die deutsche Ausgabe
© J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659,
Stuttgart 1999
Schutzumschlag: Dietrich Ebert, Reutlingen
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93422-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10127-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Buch ist meinem Vater Joseph Hill Evans gewidmet, von Herzen.
Aber wie schon gesagt, Vater liest keine Romane. Er hat noch gar nicht gemerkt, daß dieser Wälzer ihm gewidmet ist. Das ist jetzt der zweite Band – mal sehen, wie viele noch kommen müssen, bis er es mitkriegt.
Vorbemerkung des Autors
Der erste Band von OTHERLAND hat mir jede Menge Zuschriften beschert, per E-mail wie auch ganz traditionell per Post mit Briefmarke. Die meisten sind zu meiner großen Freude außerordentlich freundlich und sehr positiv. Beschwerden wurden nur von einigen Lesern laut, die sich ärgerten, weil sie fanden, daß der Schluß des ersten Bandes einen zu sehr in der Luft hängen läßt.
Ich verstehe die Kritik und bitte um Entschuldigung. Jedoch dieses Buch zu schreiben, ist insofern problematisch, als es eigentlich keine Fortsetzungsgeschichte ist – es ist ein einziger, sehr langer Roman, der von Rechts wegen zwischen zwei und nicht zwischen acht Buchdeckel gehört, nur daß 1. bis zur Fertigstellung des Ganzen meine Familie und meine Haustiere verhungert wären und daß man 2. Buchdeckel von solcher Größe aus einem Zirkuszelt herausschneiden müßte. Mit anderen Worten, ich muß eine schwierige Entscheidung treffen: Entweder ich beende die einzelnen Teile unvermittelter, als es manchen Lesern lieb ist, oder ich denke mir für jeden Band einen künstlichen Schluß aus, was meines Erachtens die Gesamtgestalt des Buches verändern und sich vielleicht sogar negativ auf den Zusammenhang der Handlung auswirken würde.
Mir bleibt daher nichts anderes übrig, als meine wohlwollenden Leser um Nachsicht zu bitten. Ich sehe nach Möglichkeit zu, daß die Bände nicht mitten im Satz abbrechen – »Und da stellte sie fest, daß sie … ups, Ende« –, aber bitte bedenkt, daß ihr Teile eines größeren Werkes bekommt und daß man das diesen Teilen anmerken wird. Ich werde mich trotzdem bemühen, jeden einzelnen Band in sich so rund wie möglich zu machen.
Danke.
Was bisher geschah
Stadt der goldenen Schatten
Klatschnaß im Schützengraben, nur dank seiner Kameraden Finch und Mullet vor Todesangst noch nicht völlig verrückt geworden, scheint sich Paul Jonas von den Tausenden anderer Infanteristen im Ersten Weltkrieg nicht zu unterscheiden. Doch als er sich unversehens auf einem leeren Schlachtfeld wiederfindet, allein bis auf einen in die Wolken wachsenden Baum, beschleicht ihn der Verdacht, er könnte doch verrückt sein. Als er den Baum emporklettert und oben ein Schloß in den Wolken, eine Frau mit Flügeln wie ein Vogel und ihren schrecklichen riesenhaften Wächter entdeckt, scheint sich der Verdacht zu bestätigen. Doch als er im Schützengraben wieder aufwacht, hält er eine Feder der Vogelfrau in der Hand.
In Südafrika in der Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts hat Irene »Renie« Sulaweyo ihre eigenen Probleme. Renie ist Dozentin für Virtualitätstechnik, und ihr neuester Student, ein junger Mann namens !Xabbu, gehört zum Wüstenvolk der Buschleute, denen die moderne Technik eigentlich zutiefst fremd ist. Zuhause übernimmt Renie die Mutterrolle für ihren kleinen Bruder Stephen, der begeistert die virtuellen Teile des weltweiten Kommunikationsnetzwerks – des »Netzes« – durchforscht, und verbringt ihre wenige freie Zeit damit, ihre Familie zusammenzuhalten. Ihr verwitweter Vater Long Joseph scheint sich nur dafür zu interessieren, wo er was zu trinken herbekommt.
Wie die meisten Kinder fühlt sich Stephen vom Verbotenen magisch angezogen, und obwohl Renie ihn schon einmal aus einem gruseligen virtuellen Nachtclub namens Mister J’s gerettet hat, schleicht er sich abermals dort ein. Bis Renie herausfindet, was er getan hat, liegt Stephen schon im Koma. Die Ärzte können es nicht erklären, aber Renie ist sich sicher, daß ihm irgend etwas online zugestoßen ist.
Der US-Amerikaner Orlando Gardiner ist nur wenig älter als Renies Bruder, aber er ist ein Meister in mehreren Netzdomänen und verbringt wegen einer schweren Krankheit, an der er leidet, die meiste Zeit in der Online-Identität von Thargor, einem Barbarenkrieger. Doch als Orlando mitten in einem seiner Abenteuer auf einmal das Bild einer goldenen Stadt erblickt, die alles übertrifft, was er jemals im Netz gesehen hat, vergißt er darüber alles ringsherum, so daß seine Thargorfigur getötet wird. Trotz dieses schmerzlichen Verlusts kann Orlando sich der Anziehung der goldenen Stadt nicht entziehen, und mit der Unterstützung seines Softwareagenten Beezle Bug und der widerwilligen Hilfe seines Online-Freundes Fredericks ist er entschlossen, die goldene Stadt aufzuspüren.
Auf einem Militärstützpunkt in den Vereinigten Staaten stattet unterdessen ein kleines Mädchen namens Christabel Sorensen ihrem Freund Herrn Sellars, einem sonderbaren, von Verbrennungen entstellten alten Mann, heimlich Besuche ab. Ihre Eltern haben ihr das verboten, aber sie hat den alten Mann und die Geschichten, die er erzählt, gern, und er erscheint ihr viel eher bedauernswert als furchterregend. Sie weiß nicht, daß er sehr ungewöhnliche Pläne mit ihr hat.
Je besser Renie den Buschmann !Xabbu kennen und seine freundliche Ausgeglichenheit wie auch seinen Außenseiterblick auf das moderne Leben schätzen lernt, um so mehr wird er ihr zum Vertrauten, als sie sich aufmacht herauszufinden, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Sie und !Xabbu schmuggeln sich in Mister J’s ein. Die Art, wie sich die Gäste in dem Online-Nachtclub in allen möglichen virtuellen Widerwärtigkeiten suhlen, bestätigt zwar ihre schlimmsten Befürchtungen, aber zunächst sieht es nicht so aus, als hätte etwas ihren Bruder körperlich schädigen können – bis sie beide eine grauenhafte Begegnung mit der hinduistischen Todesgöttin Kali haben. !Xabbu erliegt Kalis raffinierter Hypnose, und auch Renie ist kurz davor, doch mit Hilfe einer geheimnisvollen Gestalt, deren simulierter Körper (»Sim«) eine gesichtslose weiße Leere ist, gelingt es ihr, sich selbst und !Xabbu aus Mister J’s zu befreien. Bevor sie offline geht, übergibt ihr die Gestalt noch Daten in Form eines goldenen Juwels.
Im Ersten Weltkrieg (oder was so aussieht) desertiert Paul Jonas unterdessen von seiner Einheit und versucht, durch das gefährliche Niemandsland zwischen den Linien in die Freiheit zu entkommen. Unter ständigem Regen und Granatenbeschuß taumelt und robbt er sich über Schlamm- und Leichenfelder, bis er sich irgendwann in einer gespenstischen Umgebung befindet, einer flachen, nebeligen Leere, die noch unheimlicher ist als sein Schloßtraum. Ein schimmerndes goldenes Licht taucht auf und zieht Paul an, doch bevor er in dieses Leuchten hineingehen kann, erscheinen seine beiden Freunde aus dem Schützengraben und verlangen von ihm, daß er mit ihnen zurückkehrt. Müde und verwirrt will er schon nachgeben, doch als sie näher kommen, erkennt er, daß Finch und Mullet überhaupt nicht mehr wie Menschen aussehen, und er flieht in das goldene Licht.
Der älteste und vielleicht reichste Mensch der Welt im einundzwanzigsten Jahrhundert heißt Felix Jongleur. Rein physisch ist er so gut wie tot, und er verbringt seine Tage in einem selbstgeschaffenen virtuellen Ägypten, wo er als Osiris, der Gott des Lebens und des Todes, alles beherrscht. Sein wichtigster Diener, sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt, ist ein Serienmörder, ein australischer Aboriginemischling, der sich selbst Dread nennt, das Grauen, und bei dem zu der Lust daran, Menschen zu jagen, noch eine erschreckende außersinnliche Fähigkeit zur Manipulation elektronischer Schaltkreise kommt, mit der er Sicherheitskameras ausschalten und sich überhaupt allen Nachstellungen entziehen kann. Jongleur hat Dread vor Jahren entdeckt, und er hat viel dafür getan, die Kräfte des jungen Mannes zu schulen, und ihn zu seinem hauptsächlichen Mordinstrument gemacht.
Jongleur/Osiris ist auch der Vorsitzende einer Gruppe, der einige der mächtigsten und reichsten Leute der Welt angehören, der Gralsbruderschaft. Diese Gruppe hat sich ein unvergleichliches virtuelles Universum errichtet, das Gralsprojekt, auch Otherland oder Anderland genannt. (Der letztere Name kommt von einem Wesen, das als der »Andere« bezeichnet wird und das im Gralsprojekt-Netzwerk eine zentrale Rolle spielt. Diese mächtige Kraft, ob künstliche Intelligenz oder eine noch rätselhaftere Erscheinung, ist weitgehend unter Jongleurs Kontrolle, zugleich aber das einzige auf der Welt, wovor sich der alte Mann fürchtet.)
Es gibt innere Streitigkeiten in der Gralsbruderschaft, weil es so lange dauert, bis das geheimnisvolle Gralsprojekt endlich zur Vollendung gediehen ist. Alle Mitglieder haben Milliarden darin investiert und warten schon ein Jahrzehnt ihres Lebens oder noch länger darauf. Angeführt von dem US-Amerikaner Robert Wells, dem Präsidenten eines gigantischen Technologiekonzerns, rebellieren einige gegen Jongleurs Vorsitz und seine Politik der Geheimhaltung, zu der es auch gehört, keine Auskünfte über den Andern zu geben.
Jongleur unterdrückt eine Meuterei und befiehlt seinem Lakaien Dread, einen Schlag gegen ein Gralsmitglied in die Wege zu leiten, das bereits aus der Bruderschaft ausgetreten ist.
Nachdem sie mit knapper Not dem virtuellen Nightclub Mister J’s entrinnen konnten, sind Renie und ihr Student !Xabbu fester denn je davon überzeugt, daß zwischen dem Club und Stephens Koma ein Zusammenhang besteht. Doch als Renie das Datenobjekt untersucht, das die geheimnisvolle weiße Gestalt ihr mitgegeben hat, entfaltet es sich zu dem erstaunlich realistischen Bild einer goldenen Stadt. Renie und !Xabbu bitten Renies frühere Professorin Doktor Susan Van Bleeck um Hilfe, aber sie kann das Geheimnis der Stadt nicht lüften, ja nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen real existierenden Ort handelt. Die Professorin beschließt, sich an eine Bekannte zu wenden, die möglicherweise helfen kann, eine Rechercheurin namens Martine Desroubins. Doch bevor Renie und die schwer aufspürbare Martine Kontakt aufnehmen können, wird Doktor Van Bleeck in ihrem Haus überfallen und furchtbar mißhandelt und wird ihre gesamte Anlage zerstört. Renie begibt sich eilig ins Krankenhaus, doch Susan hat gerade noch Zeit, sie auf die Fährte eines Freundes zu setzen, bevor sie stirbt und eine zornige und entsetzte Renie zurückläßt.
Unterdessen hat Orlando Gardiner, der kranke Teenager in den USA, dermaßen besessen die Spur der goldenen Stadt aufgenommen, die er im Netz gesehen hat, daß sein Freund Fredericks anfängt, sich Sorgen um ihn zu machen. Orlando ist schon immer sehr eigen gewesen – Simulationen von Todeserfahrungen üben auf ihn eine Faszination aus, die Fredericks nicht verstehen kann –, aber jetzt scheint er völlig abzuheben. Als Orlando auch noch in den berühmten Häckerknoten TreeHouse eindringen will, bestätigen sich Fredericks’ schlimmste Befürchtungen.
TreeHouse ist der letzte anarchische Freiraum im Netz, ein Ort, wo keine Vorschriften den Leuten diktieren, was sie machen können oder wie sie aussehen müssen. Doch obwohl Orlando TreeHouse faszinierend findet und dort unerwartete Verbündete in der Bösen Bande findet, einer Gruppe von Häckerkindern, die im virtuellen Raum als Haufen winziger, geflügelter gelber Affen auftreten, erregen seine Versuche, die Herkunft der goldenen Stadt zu ergründen, Verdacht, und er und Fredericks müssen fliehen.
Mit Hilfe von Martine Desroubins sind Renie und !Xabbu derweil ebenfalls in TreeHouse gelandet, weil sie hinter einem alten pensionierten Häcker namens Singh her sind, Susan Van Bleecks Freund. Als sie ihn finden, erzählt er ihnen, er sei der letzte aus einer Gruppe spezieller Programmierer, die einst das Sicherheitssystem für ein geheimnisvolles Netzwerk mit dem Decknamen »Otherland« bauten, und seine Kollegen seien alle unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen. Er sei der einzige Überlebende.
Renie, !Xabbu, Singh und Martine kommen zu dem Schluß, daß sie in das Otherlandsystem eindringen müssen, um herauszufinden, welches Geheimnis das Leben von Singhs Kollegen und von Kindern wie Renies Bruder wert ist.
Paul Jonas’ Flucht aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs hat nur dazu geführt, daß er jeden Bezug zu Raum und Zeit verloren hat. Weitgehend erinnerungslos irrt er durch eine Welt, in der eine weiße Königin und eine rote Königin sich gegenseitig bekriegen, und wird abermals von den Finch- und Mulletfiguren verfolgt. Mit Hilfe eines Jungen namens Gally und beraten von einem umstandskrämerischen, eiförmigen Bischof kann Paul ihnen entkommen, doch seine Verfolger ermorden Gallys Freunde, eine Schar Kinder. Ein riesiges Ungetüm, Jabberwock genannt, lenkt Pauls und Gallys Feinde ab, und die beiden springen in einen Fluß.
Als sie wieder an die Oberfläche kommen, sind sie in einer anderen Welt, einer sonderbaren, karikaturähnlichen Version des Mars, wo sich Ungeheuer und abenteuernde englische Gentlemen tummeln. Paul trifft die Vogelfrau aus seinem Schloßtraum wieder, die jetzt Vaala heißt, aber diesmal ist sie die Gefangene eines marsianischen Fürsten. Tatkräftig unterstützt von dem tollkühnen Hurley Brummond rettet Paul die Frau. Auch sie meint Paul zu kennen, aber weiß nicht, woher. Als die Finch- und Mulletfiguren wieder auftauchen, flieht sie. Bei dem Versuch, sie einzuholen, stürzen Paul und Gally mit einem gestohlenen fliegenden Schiff ab, in das sichere Verderben, wie es scheint. Nach einem seltsamen Traum, in dem er sich wieder in dem Wolkenschloß befindet und dort von Finch und Mullet in ihrer bislang bizarrsten Erscheinungsform unter Druck gesetzt wird, wacht Paul ohne Gally inmitten von Neandertalerjägern in der Eiszeit auf.
In Südafrika werden Renie und ihre Gefährten unterdessen von Fremden bedroht und müssen die Flucht ergreifen. Mit Hilfe von Martine (die sie noch immer nur als Stimme kennen) finden Renie und !Xabbu, begleitet von Renies Vater und Doktor Van Bleecks Hausangestellten Jeremiah, eine stillgelegte Militärbasis in den Drakensbergen, die ursprünglich für Versuche mit unbemannten Kampfflugzeugen gedacht war. Sie setzen zwei V-Tanks instand (Wannen zur Immersion in die virtuelle Realität), damit Renie und !Xabbu auf unbestimmte Zeit online gehen können, und bereiten ihr Eindringen in Otherland vor.
Auf dem Militärstützpunkt in den USA hingegen läßt sich die kleine Christabel überreden, dem gelähmten Herrn Sellars bei der Ausführung eines komplizierten Plans zu helfen, der sich erst dann als Fluchtversuch herausstellt, als er aus seinem Haus verschwindet und damit den ganzen Stützpunkt (vor allem Christabels Vater, den Sicherheitschef) in helle Aufregung versetzt. Mit dem Beistand eines obdachlosen Jungen von außerhalb hat Christabel ein Loch in den Zaun des Stützpunkts geschnitten, aber nur sie weiß, daß Herr Sellars gar nicht dort hindurch geflohen ist, sondern sich in Wirklichkeit in einem Tunnelsystem unter dem Stützpunkt versteckt hält, von wo aus er nunmehr seine mysteriöse »Aufgabe« frei weiterverfolgen kann.
In der verlassenen unterirdischen Militäranlage in den Drakensbergen steigen Renie und !Xabbu in die V-Tanks, gehen online und dringen zusammen mit Singh und Martine in Otherland ein. In einer grauenhaften Begegnung mit dem Andern, der das Sicherheitssystem des Netzwerks zu sein scheint, stirbt Singh an einem Herzanfall, doch die übrigen drei überleben und können zunächst gar nicht glauben, daß sie sich in einer virtuellen Umgebung befinden, so unglaublich realistisch ist das Netzwerk. Noch in anderer Hinsicht ist die Erfahrung merkwürdig. Martine hat zum erstenmal einen Körper, !Xabbu hat die Gestalt eines Pavians angenommen, und besonders folgenschwer ist ihre Entdeckung, daß sie sich nicht wieder offline begeben können. Renie und die anderen erkennen, daß sie in einem artifiziellen südamerikanischen Land gelandet sind. Als sie die Hauptstadt erreichen, ist sie die goldene Stadt, nach der sie so lange gesucht haben. Dort werden sie festgenommen und sind jetzt Gefangene von Bolívar Atasco, einem Mann, der mit der Gralsbruderschaft zusammenhängt und von Anfang an am Bau des Otherlandnetzwerks mitgewirkt hat.
In den USA hat Orlandos Freundschaft mit Fredericks die Bewährungsprobe zweier Enthüllungen überstanden, nämlich daß Orlando an der seltenen Krankheit der frühzeitigen Vergreisung leidet und nur noch kurze Zeit zu leben hat und daß Fredericks in Wirklichkeit ein Mädchen ist. Sie werden unerwarteterweise von der Bösen Bande an Renies Häckerfreund Singh angekoppelt, als dieser gerade die Verbindung zum Gralsnetzwerk herstellt, und rutschen mit hindurch nach Anderland. Nach ihrer eigenen fürchterlichen Begegnung mit dem Andern geraten Orlando und Fredericks ebenfalls in die Gefangenschaft Atascos. Doch als sie, zusammen mit Renies Schar und noch anderen, dem großen Mann vorgeführt werden, stellt sich heraus, daß Atasco sie gar nicht zusammengerufen hat, sondern Herr Sellars, und dieser erscheint jetzt in Gestalt des eigenartigen leeren Sims, der Renie und !Xabbu das Entkommen aus Mister J’s ermöglichte.
Sellars erklärt, daß er sie alle mit dem Bild der goldenen Stadt angelockt habe – die unauffälligste Methode, die ihm eingefallen sei, da ihre Feinde von der Gralsbruderschaft unglaublich mächtig und gnadenlos seien. Er berichtet, daß Atasco und seine Frau früher der Bruderschaft angehört hätten, aber ausgetreten seien, als ihre Fragen zum Netzwerk nicht beantwortet wurden. Dann schildert Sellars, wie er entdeckt habe, daß das geheime Otherlandnetzwerk in einem unerfindlichen, aber nicht zu leugnenden Zusammenhang mit der Erkrankung Tausender von Kindern wie Renies Bruder Stephen stehe. Bevor er das weiter ausführen kann, erstarren die Sims von Atasco und seiner Frau urplötzlich, woraufhin Sellars’ Sim verschwindet.
In der wirklichen Welt hat Jongleurs Mordwerkzeug Dread mit dem Angriff auf Atascos befestigte Insel in Kolumbien begonnen und nach der Ausschaltung der Abwehranlagen und der Wachmannschaften beide Atascos umgebracht. Mit seinen besonderen Fähigkeiten – seinem »Dreh« – zapft er daraufhin ihre Datenleitungen an, hört Sellars’ Ausführungen mit und gibt seiner Assistentin Dulcinea Anwin die Anweisung, eine der bei Atasco online versammelten Personen, zu denen auch Renie und ihre Freunde gehören, aus der Leitung zu werfen. Damit kann Dread die Identität dieser Person annehmen und sich als getarnter Spion in den Kreis von Renie und ihren Freunden einschleichen.
Sellars taucht noch einmal in der virtuellen Welt der Atascos auf und beschwört Renie und die anderen, in das Netzwerk hineinzufliehen, er wolle sich unterdessen darum bemühen, ihre Anwesenheit zu verbergen. Sie sollen nach Paul Jonas Ausschau halten, einem rätselhaften VR-Gefangenen, dem Sellars zur Flucht vor der Bruderschaft verholfen hat. Die Gruppe um Renie gelangt aus der Stadt der Atascos hinaus auf den Fluß und von dort durch ein elektrisches blaues Leuchten hindurch in die nächste Simwelt. Gequält und überwältigt von dem Übermaß auf sie einströmender Daten enthüllt Martine schließlich Renie ihr Geheimnis: sie ist blind.
Ihr Schiff ist ein riesiges Blatt geworden. Eine Libelle von der Größe eines Kampfflugzeuges saust über sie hinweg.
In der wirklichen Welt können Jeremiah und Renies Vater Long Joseph in ihrem Stützpunkt im Berg nur passiv die stummen V-Tanks beobachten, sich grämen und warten.
Inhalt
Was bisher geschah
Vorspann
Eins · Der geheime Fluß
1 Tiefe Wasser
2 Schminke
3 Der Stock
4 Sim-Salabim
5 Millionen auf dem Marsch
6 Ein Mann aus dem Totenreich
7 Begegnung mit dem Großvater
8 Im Kampf mit Ungeheuern
9 Der hohle Mann
10 Kleine Gespenster
11 Küchenleben
12 Im Zentrum des Labyrinths
Zwei · Stimmen im Dunkeln
13 Numerische Träume
14 Spiele im Schatten
15 Eine verspätete Weinaxfreude
16 Käufer und Schläfer
17 Im Werk
18 Die Schleier der Illusion
19 Ein Arbeitstag
20 Der unsichtbare Fluß
21 Im Gefrierfach
Drei · Götter und Genien
22 Kollaps
23 Am Rand von Bobs Ozean
24 Die schönste Straße der Welt
25 Rotes Land, schwarzes Land
26 In Erwartung der Traumzeit
27 Das geliebte Stachelschwein
28 Die Dunkelheit in den Leitungen
Vier · Klage
29 Imaginäre Gärten
30 Tod und Venedig
31 Die Stimme der Verlorenen
32 Die Feder der Wahrheit
33 Ein unfertiges Land
Ausblick
Vorspann
> Schnee, überall Schnee – die Welt war weiß.
Im Land der Toten muß es wärmer gewesen sein, ging es ihm durch den Kopf wie zum Hohn auf sich selbst, auf ein sinnloses Universum. Ich hätte es nie verlassen sollen.
Schnee und Eis und Wind und Blut …
Das Ding in der flachen Grube gab ein schreckliches Röhren von sich und schwenkte den Kopf. Geweihschaufeln von der Größe kleiner Bäume fegten hin und her, schleuderten Schnee und Erde in die Höhe und verfehlten nur knapp einen der Männer, der sich vorgebeugt hatte, um einen Stoß mit dem Speer zu führen.
Der Hirsch war größer als alle Vertreter seiner Art, die Paul je im gemütlichen alten Londoner Zoo gesehen hatte, übermannshoch an den Schultern und schwer wie ein Zuchtbulle. Er kämpfte seit fast einer Stunde schon mit furchterregender Kraft, und die Spitzen des riesigen geschwungenen Geweihs waren mit dem Blut eines Mannes namens Weint-nie besudelt, doch das zottige Fell des Tieres war auch von seinem eigenen Blut getränkt, ebenso der Schnee ringsherum am Rand des Loches.
Er sprang erneut hoch und glitschte mit scharrenden Hufen ab, die den Grund der Grube zu einem rötlichen Brei zerstampften. Speere, die der Hirsch in seinem dicken Pelz hängen hatte, rasselten wie exotische Schmuckstücke. Läuft-weit, der der furchtloseste Jäger des Trupps zu sein schien, sprang dicht heran und riß einen seiner Speere heraus. Sein Stoßversuch schlug fehl, weil er erst dem herumsausenden Geweih ausweichen mußte, aber dann bohrte er dem Tier die steinerne Spitze direkt unter das wuchtige Kinn. Das Blut aus der Schlagader spritzte drei Meter weit auf Läuft-weit und die beiden ihm am nächsten stehenden Jäger, die dadurch über das Ockergelb und Schwarz ihrer Jagdbemalung noch eine weitere Farbschicht erhielten.
Der Hirsch machte einen letzten verzweifelten Versuch, die Böschung zu erklimmen und aus der Grube zu entkommen, aber bevor er am Rand Fuß fassen konnte, stießen ihn die Speere der Jäger zurück, so daß er unbeholfen wie ein Kälbchen wieder hinunterrutschte.
Der aus dem Hals pulsende Blutfluß wurde schwächer. Der Hirsch stand auf wackligen Beinen unten in der Grube und holte stockend Luft. Ein Bein knickte ein, doch er rappelte sich noch einmal auf, bleckte mit letzter Anstrengung die Zähne und blickte funkelnd unter den weit ausladenden Schaufeln hervor. Der Mann namens Vogelfänger rammte ihm noch einen Speer in die Seite, aber das war eigentlich schon überflüssig. Der Hirsch taumelte einen Schritt zurück, und in sein Gesicht trat ein Ausdruck, den Paul bei einem Menschen als traurig bezeichnet hätte, dann fiel er auf die Knie und kippte mit pumpender Brust auf die Seite.
»Jetzt schenkt er sich uns«, sagte Läuft-weit. Unter seiner verschmierten Farbe verzerrte ein starres Grinsen erschöpfter Befriedigung seinen Mund, doch aus seinen Augen sprach etwas Tieferes. »Jetzt gehört er uns.«
Läuft-weit und ein anderer Mann kletterten in die Grube. Als der Gefährte das Geweih gepackt hatte und es dem japsenden und zuckenden Hirsch zum Trotz festhielt, schlitzte Läuft-weit dem Tier mit einer schweren Steinklinge die Kehle auf.
Es wirkte wie eine besonders grausame Ironie, daß der Jäger mit dem eigenartigen Namen Weint-nie nicht nur tiefe Geweihschmisse am Kopf und im Gesicht bekommen, sondern außerdem noch sein linkes Auge verloren hatte. Während einer der anderen Jäger das schrundige Loch mit Schnee ausstopfte und es mit einem rohen Lederstreifen verband, murmelte Weint-nie etwas vor sich hin, einen raunenden Singsang, der eine Klage oder ein Gebet sein mochte. Läuft-weit hockte sich neben ihn und bemühte sich, dem Verletzten mit einer Handvoll Schnee Blut aus dem Gesicht und dem Bart zu waschen, aber die Wunden bluteten weiter stark. Paul staunte darüber, mit welcher Gemütsruhe die anderen die schrecklichen Verletzungen ihres Gefährten hinnahmen, doch andererseits hatten alle selber Narben und Verstümmelungen vorzuweisen.
Es stirbt sich leicht hier, dachte er bei sich, deshalb muß einem alles darunter schon wie ein Sieg vorkommen.
Nachdem sie ihn abgehäutet hatten, zerlegten die Neandertaler den Hirschkörper mit ihren Feuersteinmessern flink und geschickt in große Stücke und wickelten die Innereien und selbst die Knochen zum Mitnehmen in das noch dampfende Fell. Die Menschen, wie sie sich selbst nannten, ließen nichts verkommen.
Als die Arbeit dem Ende zuging, richteten einige der Männer ihr Augenmerk wieder auf Paul, vielleicht um zu sehen, ob der Fremde, den sie aus dem zugefrorenen Fluß gerettet hatten, von ihrer Tapferkeit auch gebührend beeindruckt war. Nur der mit dem Namen Vogelfänger betrachtete ihn mit offenem Mißtrauen, aber alle wahrten Abstand. Da er weder bei der Erlegung noch bei der Zerteilung des Hirsches mitgewirkt hatte, kam Paul sich besonders nutzlos vor und war deshalb dankbar, als Läuft-weit zu ihm trat. Der Anführer der Jagd war bislang der einzige, der mit Paul sprach. Jetzt streckte er eine blutbesudelte Hand aus und hielt dem Fremden einen Streifen dunkelrotes Fleisch hin. Durchaus empfänglich für die freundliche Geste nahm Paul das Fleisch entgegen. Es war eigentümlich geschmacklos, als ob man blutgesalzenes Gummi kaute.
»Der Baumgehörnte hat wacker gekämpft.« Läuft-weit steckte sich das nächste Stück in den Mund. Als es nicht ganz hineinging, schnitt er den Rest mit seinem Steinmesser ab und behielt es in der Hand, bis er den ersten Happen verdrückt hatte. Er grinste und zeigte dabei eine Reihe abgewetzter und schartiger Zähne. »Wir haben jetzt viel Fleisch. Die Menschen werden sich freuen.«
Paul nickte und wußte nicht recht, was er sagen sollte. Ihm war etwas Merkwürdiges aufgefallen: Die Sprache der Jäger war ein gut verständliches Englisch, was bei einer Gruppe altsteinzeitlicher Jäger eigentlich äußerst unwahrscheinlich war. Gleichzeitig schienen ihre Lippenbewegungen zu dem, was sie sagten, nicht ganz zu passen, als ob er mitten in einen gut, aber nicht völlig perfekt synchronisierten ausländischen Film hineingestolpert wäre.
Wirklich, es machte den Eindruck, als hätte er eine Art Übersetzungsimplantat eingesetzt bekommen, so wie sein alter Studienfreund Niles bei seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst. Aber wie hätte das sein können?
Zum fünften oder sechsten Mal an diesem Tag wanderten Pauls Finger zu seinem Halsansatz am Hinterkopf und tasteten nach der Neurokanüle, von deren Nichtvorhandensein er sich längst überzeugt hatte, fühlten wieder nur kalte Gänsehaut. Er hatte niemals Implantate haben wollen und den Trend auch dann noch abgelehnt, als die meisten seiner Freunde schon längst welche besaßen, und doch kam es ihm jetzt so vor, als hätte ihm jemand eines ohne seine Zustimmung verpaßt – und es zudem noch verstanden, die physische Existenz des Dings vollkommen zu verbergen.
Wer könnte sowas machen? fragte er sich. Und warum? Und vor allen Dingen, wo um Gottes willen bin ich hier?
Er hatte die ganze Zeit immer wieder darüber nachdenken müssen, ohne einer Antwort näher gekommen zu sein. Er schien durch Raum und Zeit zu gleiten wie eine Figur aus einer besonders phantasiefreudigen Science-fiction-Story. Er war, erinnerte er sich, in einer Marswelt wie aus einem alten Abenteuerheftchen und in einer völlig hirnrissigen Version von Alices Land hinter den Spiegeln herumgeirrt. Er hatte noch andere unwahrscheinliche Orte gesehen – die Einzelheiten waren verschwommen, aber dennoch zu vollständig, um lediglich Traumreste zu sein. Doch wie war das möglich? Wenn jemand Kulissen bauen und Schauspieler anheuern wollte, um ihn derart gründlich hinters Licht zu führen, würde das Millionen – Milliarden! – kosten, und so sehr er sich auch bemühte, er konnte bei keinem dieser vermeintlichen Schauspieler den geringsten Riß in der Fassade entdecken. Genausowenig konnte er sich vorstellen, weshalb irgend jemand solche Unsummen auf ein Nichts wie ihn verschwenden sollte, einen Hilfskustos in einem Museum, der weder einflußreiche Freunde noch besonders tolle Zukunftsaussichten hatte. Auch wenn die Stimme aus der goldenen Harfe das Gegenteil behauptet hatte, dies alles mußte real sein.
Es sei denn, man hätte ihn irgendwie einer Gehirnwäsche unterzogen. Das war nicht auszuschließen. Eine Art Drogenexperiment vielleicht – aber warum? In seinem Gedächtnis klaffte nach wie vor eine Lücke, in der die Antwort schlummern mochte, aber im Gegensatz zu den absonderlichen Fahrten durch imaginäre Landschaften konnte keine noch so große Konzentration diesen einen dunklen Fleck in irgendeiner Weise erhellen.
Läuft-weit kauerte immer noch neben ihm, und unter den Brauenwülsten blitzte die Neugier aus den runden Augen. Verlegen und verwirrt zuckte Paul mit den Achseln, griff sich eine Handvoll Schnee und zerdrückte sie zwischen den krebsartigen Zangen seiner rohen Fäustlinge. Gehirnwäsche würde erklären, wieso er in einem zugefrorenen prähistorischen Fluß aufgewacht und von authentisch aussehenden Neandertalern gerettet worden war – die Kostüme und Kulissen für eine entsprechende Halluzination wären nicht sehr kostspielig. Aber sie konnte nicht das absolut und unbestreitbar reale und anhaltende Vorhandensein der Welt um ihn herum erklären. Sie konnte nicht den Schnee in seiner Hand erklären, kalt und körnig und weiß. Sie konnte nicht den Fremden neben ihm erklären, mit seinem andersartigen, aber ganz zweifellos vom Leben gezeichneten Gesicht.
So viele Fragen, aber nach wir vor keine Antwort. Paul seufzte und ließ den Schnee aus der Hand fallen.
»Werden wir heute hier übernachten?« fragte er Läuft-weit.
»Nein. Es ist nicht mehr weit bis dorthin, wo die Menschen wohnen. Wir werden dort sein, bevor es richtig dunkel ist.« Der Jäger beugte sich vor, runzelte die Stirn und starrte Paul in den Mund. »Du ißt, Flußgeist. Essen alle Leute aus dem Land der Toten?«
Paul lächelte traurig. »Nur wenn sie Hunger haben.«
Läuft-weit, dessen stämmige Beine ihn mit erstaunlicher Leichtigkeit durch den Schnee trugen, ging an der Spitze; wie alle Jäger, selbst der furchtbar verwundete Weint-nie, bewegte er sich mit der instinktiven Geschmeidigkeit eines wilden Tieres. Obwohl sie jetzt etliche hundert Kilogramm Hirschfleisch zu schleppen hatten, folgten die anderen ihm nicht minder flink, so daß Paul alle Mühe hatte, Schritt zu halten.
Er rutschte auf einem verschneit am Boden liegenden Ast aus und wäre gestürzt, wenn der Mann neben ihm nicht blitzschnell zugepackt und ihn festgehalten hätte, bis Paul wieder Tritt gefaßt hatte; die Hände des Neandertalers waren hart und rauh wie Baumrinde. Pauls Verwirrung wuchs. Angesichts solch schlagender Argumente konnte er seine Zweifel unmöglich aufrechterhalten. Auch wenn diese Männer nicht ganz so aussahen wie die übertrieben dargestellten Höhlenmenschen aus den Filmen seiner Kindheit, waren sie doch so deutlich von einem anderen, einem wilderen und einfacheren Schlag als er, daß er seine Skepsis aufgab; sie verschwand jedoch weniger, als daß sie in eine Art Winterschlaf versank, um wieder zu erwachen, sobald sie ihm zu etwas nutze sein konnte.
Ein Ton, der wie Wolfsgeheul klang, hallte den Hang hinunter. Die Jäger vom Menschenstamm schritten noch etwas schneller aus.
Nichts um dich herum ist wahr, und dennoch kann das, was du siehst, dich verletzen oder töten, hatte das goldene Juwel, die Stimme aus der Harfe, zu ihm gesagt. Wer oder was diese Männer auch waren, ob echt oder vorgespiegelt, sie waren in dieser Welt in einer Art und Weise zuhause, wie Paul es ganz offensichtlich nicht war. Er war notgedrungen auf sie angewiesen. Um seiner geistigen Gesundheit willen war es vielleicht geraten, davon auszugehen, daß sie genau das waren, was sie zu sein schienen.
> Als er ein kleiner Junge war, als er noch »Paulie« gerufen wurde und seinem exzentrischen Vater und seiner kränkelnden Mutter unterstand, hatte er jedes Weihnachten mit ihnen im Landhaus seiner Großmutter väterlicherseits in Gloucestershire verbracht, in dem waldigen Hügelland, das die Einheimischen gern »das wirkliche England« nannten. Aber es war gar nicht wirklich gewesen, durchaus nicht: Sein Reiz bestand gerade darin, daß es etwas symbolisierte, was es niemals richtig gegeben hatte, ein kleinbürgerliches England von einer idyllischen, ländlichen Schönheit, deren tatsächliche Fadenscheinigkeit mit jedem Jahr deutlicher zutage trat.
Für Oma Jonas war die Welt außerhalb ihres Dorfes mit der Zeit immer schattenhafter geworden. Sie konnte die Verwicklungen eines Nachbarschaftsstreites über einen Zaun mit der Kompetenz eines Rechtsexperten im Nachrichtennetz darstellen, aber hatte Mühe, sich zu erinnern, wer Premierminister war. Natürlich besaß sie einen Wandbildschirm – einen kleinen, altmodischen, mit barockem Goldrahmen an der Wohnzimmerwand wie um das Foto eines langverstorbenen Angehörigen. Er wurde kaum benutzt, Gespräche führte sie bildlos. Oma Jonas hatte der visuellen Kommunikation nie ganz über den Weg getraut, vor allem nicht der Behauptung, sie könne, wenn sie wolle, andere sehen, ohne von ihnen gesehen zu werden, und bei dem Gedanken, jemand Fremdes könnte bei ihr ins Haus hineinschauen und sie im Nachthemd sehen, wurde ihr, wie sie es ausdrückte, »ganz schwummerig, Paulie-Schatz, total schwummerig«.
Trotz ihres Mißtrauens gegen die moderne Welt, oder vielleicht sogar zum Teil deswegen, hatte Paul sie schrecklich lieb gehabt, und sie ihrerseits hatte ihn geliebt, wie nur eine Großmutter es konnte. Jeder kleine Erfolg auf seinem Lebensweg war ein strahlender Sieg, jeder Verstoß gegen elterliche Autorität ein Zeichen von Klugheit und Unabhängigkeit, die unterstützt und nicht verurteilt werden wollten. Wenn der kleine Paul in einem seiner Anfälle zielloser Rebellion sich weigerte, beim Abtrocknen zu helfen oder sonst eine Arbeit im Haus zu machen (und dafür keinen Nachtisch kriegte), kam Oma Jonas später am Abend an die Tür seines Gefängniszimmers, steckte ihm heimlich etwas Süßes zu und huschte atemlos wieder nach unten, bevor seine Eltern ihre Abwesenheit bemerkten.
Als er sieben war, gab es den großen Schneewinter. Es war Englands weißeste Weihnacht seit Jahrzehnten, und die Sensationsnetze überschlugen sich, weil jedes die phantastischsten Bildberichte bringen wollte – die Saint Paul’s Cathedral mit einer weißen Narrenkappe, Schlittschuhläufer auf der unteren Themse wie zu elisabethanischen Zeiten (viele kamen ums Leben, weil das Eis nicht dick genug war). In den ersten Wochen, vor den Horrormeldungen wie »Neues Atlantiktief bringt Schneesturminferno« und den täglichen Totenstatistiken (mit Bildern von jeder einzelnen Leiche), die angaben, wie viele Leute erfroren waren, weil sie draußen geschlafen oder einfach an den kleineren Stationen auf den Zug gewartet hatten, lösten die starken Schneefälle bei den meisten Leuten, und ganz gewiß bei dem kleinen Paul, eine unbändige Freude aus. Es war seine erste richtige Erfahrung mit Schneeballwerfen und Schlittenfahren und kalten Überraschungen, die einem von den Ästen der Bäume in den Kragen rutschten, mit einer Welt, die mit einemmal fast sämtlicher Farben beraubt war.
An einem milden Tag, als die Sonne schien und der Himmel weitgehend blau war, hatten er und seine Großmutter einen Spaziergang gemacht. Der jüngste Schneefall hatte alles zugedeckt, und während sie langsam über die Felder gingen, sahen sie keinerlei Zeichen anderer Menschen außer dem Rauch aus einem fernen Schornstein und keine Fußspuren als die ihrer eigenen Gummistiefel, so daß das Landschaftspanorama vor ihnen urtümlich wirkte, unberührt.
Als sie schließlich an einer Stelle zwischen den Feldhecken ankamen, wo sich vor ihnen ein sanftes Tal auftat, blieb seine Großmutter abrupt stehen. Sie breitete die Arme aus, und mit einer Stimme, die er bei ihr noch nie gehört hatte, leise und doch leidenschaftlich hingerissen, sagte sie: »Sieh nur, Paulie, ist das nicht herrlich! Ist das nicht vollkommen! Es ist, als wären wir wieder am Anfang der Zeit. Als ob die ganze sündige Welt es nochmal von vorne versuchen dürfte.« Und die geballten Fäustlinge ans Gesicht gepreßt wie ein Kind, das sich etwas wünscht, fügte sie hinzu: »Wäre das nicht wunderbar?«
Überrascht und ein wenig erschrocken über die Heftigkeit ihrer Reaktion hatte er sich bemüht, ihr Erlebnis zu teilen, doch es war ihm nicht gelungen. Gewiß, die Illusion der Leere, der unbegrenzten Möglichkeit hatte etwas Schönes. Aber anders als eine Großmutter lebt ein siebenjähriger Junge nicht mit dem Gefühl, die Menschen hätten alles zugrunde gerichtet, und er war durchaus noch klein genug gewesen, um den Gedanken einer Welt ohne vertraute Orte und Leute, einer Welt klarer, kalter Einsamkeit, beunruhigend zu finden.
Lange hatten sie so gestanden und die unbewohnte Winterwelt betrachtet, und als sie schließlich umkehrten – und zu Pauls heimlicher Erleichterung in ihren eigenen entgegenkommenden Fußspuren gingen, den Pfad der Brotbröcklein aus dem beschwerlichen Wald der Erwachsenenklagen zurückverfolgten –, hatte seine Großmutter grimmig vor sich hingelächelt und ein Lied gesungen, das er nicht richtig verstehen konnte.
Paul hatte an jenem Tag vor so langer Zeit vergebens versucht, ihr Glücksgefühl nachzuempfinden. Doch jetzt schien er derjenige zu sein, der in die von ihr ersehnte Welt hineingepurzelt war, eine Welt – Tausende von Generationen vor selbst der ewig weit zurückliegenden Kindheit seiner Großmutter –, von der sie nur träumen konnte.
Ja, wenn Oma Jonas das hätte sehen können, dachte er. Wie hätte sie sich gefreut. Das hier ist wirklich der Anfang – lange, lange vor den korrupten Politikern und den widerlichen Shows im Netz und den rüden und vulgären Umgangsformen der Leute und den ganzen ausländischen Restaurants, wo man Sachen vorgesetzt bekam, die sie nicht aussprechen konnte. Sie hätte sich gefühlt wie im Himmel.
Allerdings, mußte er zugeben, würde sie sich schwertun, eine gute Tasse Tee zu bekommen.
Die Leute vom Menschenstamm zogen scheinbar ohne jede Marschordnung am Rand eines Bergwaldes einen langen, tief verschneiten Abhang hinunter, aus dem hier und da schroffe Kalksteinfelsen herausstanden. Schlanke Baumschatten querten ihren Pfad wie Markierungen für eine noch zu bauende Treppe. Das Licht verglomm rasch, und der Himmel, über dem das weiche Grau einer Taubenbrust gelegen hatte, nahm einen kälteren, dunkleren Ton an. Paul fragte sich plötzlich zum erstenmal, nicht in welcher Zeit er sich befand, sondern an welchem Ort.
Hatte es überall Neandertaler gegeben oder nur in Europa? Er konnte sich nicht mehr erinnern. Das wenige, was er über die vorgeschichtliche Menschheit wußte, bestand aus zusammenhanglosen Einzelheiten wie auf Ratespielkarten – Höhlenmalerei, Mammutjagd, mühsam von Hand abgeschlagene Steingeräte. Es war frustrierend, daß sein Gedächtnis nicht mehr hergab. Die Leute in Science-Fiction-Filmen schienen immer nützliche Dinge über die Gegenden im Kopf zu haben, durch die ihre Zeitreisen führten. Wie aber, wenn der Zeitreisende in der Schule in Geschichte nie besonders gewesen war? Was dann?
Es kamen jetzt mehr Kalksteinfelsen, große Platten, die sich seitlich aus dem Boden zu schieben schienen, schattenhafte Rechteckformen, die im Dämmerlicht weniger hell schimmerten als der allgegenwärtige Schnee. Läuft-weit ließ sich in eine langsamere Gangart fallen und die übrige Gruppe vorbeieilen, bis Paul am Ende der Schlange ihn eingeholt hatte. Der bärtige Jäger gesellte sich wortlos zu ihm, und Paul, der ziemlich außer Atem war, hatte nichts dagegen.
Als sie um einen großen Felsvorsprung bogen, sah Paul warmes gelbes Licht auf den Schnee fallen. Seltsame knorrige Gestalten, die mit verformten Händen Speere umklammert hielten, standen als dunkle Silhouetten in einer breiten Öffnung in der Felswand, und im ersten Schreck mußte Paul an Märchen über Trollbrücken und Feenhügel denken. Läuft-weit faßte ihn am Ellbogen und schob ihn weiter; als er den Höhleneingang erreicht hatte, sah er, daß die Wächter nur vom Alter gebeugte Mitglieder des Menschenstammes waren, die zurückgelassen worden waren, um den heimischen Herd zu schützen wie Großbritanniens Home Guard in Kriegszeiten.
Der Jagdtrupp wurde sofort umringt, nicht nur von diesen greisen Wächtern, sondern auch von einem Strom in Felle gemummter Frauen und Kinder, die allesamt redeten und gestikulierten. Die Verletzungen von Weint-nie wurden mit vielen Bekundungen des Mitgefühls untersucht. Paul rechnete halb damit, daß sein Erscheinen abergläubische Panik auslösen würde, aber obwohl alle ihn mit einem Interesse beäugten, das von ängstlich bis fasziniert reichte, war er deutlich weniger wichtig als das Fleisch und die Geschichten, die die Jäger mitbrachten. Die Gruppe verzog sich vom Rand der Höhle und begab sich aus dem kalten Wind in das flackernde, rauchige Innere.
Auf den ersten Blick sah der Wohnsitz der Menschen am ehesten wie ein Heerlager aus. Aus Häuten gefertigte Zelte standen in einer Reihe mit dem Rücken zum Höhleneingang wie eine Herde von Tieren, die sich vor dem Wind zusammendrängten. Dahinter befand sich, von den Zelten geschützt, ein zentraler Bereich mit einer Mulde im Boden, in der ein großes Feuer brannte, ein natürlicher Kalksteinsaal, niedrig, aber weitläufig. Die wenigen Frauen, die drinnen geblieben waren, um auf das Feuer zu achten, blickten jetzt auf, lachten und riefen den heimkehrenden Jägern Bemerkungen zu.
Die übrigen vom Menschenstamm sahen ganz ähnlich aus wie die Männer, mit denen er gekommen war, klein und stämmig gebaut und mit Gesichtszügen, die bis auf die wulstigen Brauen und die breiten Kinnladen nichts mit den Karikaturen von Höhlenmenschen gemein hatten, die er kannte. Sie waren in rauhe Felle gekleidet; viele trugen Knochen- oder Steinstückchen an Sehnenschnüren, aber nichts, was sich mit dem Schmuck vergleichen ließ, der selbst die zurückgebliebensten Stämme aus Pauls Zeit zierte. Die meisten der kleineren Kinder waren nackt und hatten die Körper mit Fett eingerieben, das im Feuerschein glänzte, wenn sie aus den Zeltöffnungen hervorlugten, schimmernde kleine Wesen, die ihn an viktorianische Darstellungen von Gnomen und Wichteln erinnerten.
Es wurde überraschend wenig Aufhebens um die Rückkehr der Jäger gemacht, obwohl Läuft-weit ihm erzählt hatte, daß sie tagelang unterwegs gewesen waren. Die Männer begrüßten ihre Angehörigen und Lieben, indem sie sie behutsam mit den Fingern berührten, wie um sich zu vergewissern, daß sie wirklich waren, und hin und wieder rieb jemand sein Gesicht an das von jemand anders, aber es gab kein Küssen, wie Paul es kannte, kein Händeschütteln und kein Umarmen. Paul selbst wurde offensichtlich mehrmals erwähnt – er sah einige der Jäger auf ihn deuten, wie um zu belegen, was für ein seltsames Abenteuer es gewesen war –, doch er wurde niemandem vorgestellt, und soweit er sehen konnte, gab es auch keine klare Hierarchie. Ungefähr zwei Dutzend Erwachsene schienen die Höhle zu bewohnen und nicht ganz halb so viele Kinder.
Noch während einige der Menschen über das Hirschfleisch jubilierten, machten andere sich bereits auf höchst professionelle Art daran, es zuzubereiten. Zwei Frauen griffen sich lange Stöcke und schoben damit in einem Teil der Feuergrube die brennenden Holzklötze auf eine Seite, so daß ein Bett flacher Steine zum Vorschein kam. Dann legten sie mehrere Fleischstücke auf diesen heißen Steinen aus, und kurz darauf erfüllte schon Bratengeruch die Luft.
Paul ließ sich in einer Ecke nieder, wo er aus dem Weg war. Hier in der Höhle war es viel wärmer, aber immer noch kalt, und er zog seine Felle fest um sich und sah der raschen Rückkehr zum normalen Leben zu, der regen Geschäftigkeit, die alle außer den Jägern sofort entfalteten. Paul vermutete, daß sonst auch sie abends tätig waren, neue Waffen herstellten und alte reparierten, aber heute abend waren sie von einer langen, erfolgreichen Jagdpartie heimgekehrt und durften auf den Lohn der Sieger warten, die ersten Portionen des erlegten Wildes.
Eine der Frauen holte mit einem Stock einen ansehnlichen Batzen Fleisch aus dem Feuer, legte ihn auf ein Stück Rinde und überreichte ihn Läuft-weit wie eine Opfergabe. Er führte das Fleisch an den Mund, biß einen Happen ab und grinste beifällig, doch statt es aufzuessen, zerteilte er es mit seinem Messer in zwei Hälften, woraufhin er sich erhob und sich mit dem Rindenteller vom Feuer entfernte und in eines der Zelte trat. Niemand sonst schien dem Beachtung zu schenken, aber Paul war fasziniert. Brachte er das Essen einer bettlägerigen Frau oder einem kranken Kind? Einem altersschwachen Vater oder einer hinfälligen Mutter?
Läuft-weit blieb eine Weile in dem Zelt; als er wieder herauskam, steckte er sich gerade das letzte Stück Fleisch in den Mund und zerkaute es energisch mit seinen breiten Kinnladen. Nichts gab einen Hinweis darauf, was dort drinnen geschehen war.
Eine Bewegung an seinem Ellbogen erregte Pauls Aufmerksamkeit. Ein kleines Mädchen stand neben ihm und starrte ihn erwartungsvoll an. Wenigstens nahm er an, daß es sich um ein Mädchen handelte, obwohl die Jungen genauso zottelhaarig waren und eine eindeutige Aussage durch den Fellrock um die Hüften des Kindes erschwert wurde. »Wie heißt du?« fragte er.
Sie kreischte voll übermütigem Entsetzen auf und lief davon. Mehrere andere Kinder lösten sich aus dem allgemeinen Getümmel, um ihr lachend und in hohen, vogelähnlichen Tönen schreiend nachzujagen. Gleich darauf fiel ein anderer, größerer Schatten auf ihn.
»Sprich nicht mit dem Kind.« Vogelfänger blickte ärgerlich, aber Paul kam es so vor, als sähe er hinter der finsteren Miene des Mannes nackte Panik. »Sie ist nicht für dich.«
Paul schüttelte verständnislos den Kopf, doch der andere drehte sich einfach um und ging fort.
Meint er vielleicht, ich hätte es auf sie abgesehen? Oder ist es dieses Ding mit dem Land der Toten? Vielleicht dachte Vogelfänger, er wolle das Mädchen entführen, mit zurücknehmen in irgendein Reich des Todes jenseits des vereisten Flusses.
Das bin ich, der Sensenmann des Pleistozäns. Paul senkte den Kopf und schloß die Augen und war auf einmal so müde wie schon lange nicht mehr.
In seinem Traum hatte es eine Frau gegeben und blühende Pflanzen und Sonnenlicht, das durch ein verstaubtes Fenster fiel, aber jetzt zerrann alles, lief davon wie Wasser durch ein Abflußloch. Paul schüttelte den Kopf, und seine Augen flatterten. Läuft-weit stand vor ihm und sagte etwas, das er zuerst nicht verstand.
Der Jäger stupste ihn noch einmal sachte an. »Flußgeist. Flußgeist, du mußt mitkommen.«
»Mitkommen? Wohin?«
»Dunkler Mond sagt, du mußt kommen und reden.« Der Jagdführer war aufgeregt, wie Paul ihn noch nicht erlebt hatte, beinahe wie ein Kind. »Komm jetzt.«
Paul ließ sich von ihm hochziehen und folgte dann Läuft-weit zu dem Zelt, in das der Jäger das erste gebratene Fleisch des erlegten Hirsches gebracht hatte. Paul rechnete damit, hineingeführt zu werden, doch Läuft-weit bedeutete ihm zu warten. Der Jäger trat gebückt durch die Zeltklappe, und als er kurz darauf wieder zum Vorschein kam, führte er eine winzige Gestalt in einem dicken Fellumhang in den Feuerschein hinaus.
Die alte Frau blieb stehen und musterte Paul von Kopf bis Fuß, dann streckte sie ihren Arm in einer deutlich auffordernden, eigentlich eher befehlenden Geste aus. Paul trat vor und ließ zu, daß sie seinen Unterarm mit harten, knochigen Fingern umkrallte, woraufhin sie zu dritt langsam auf das Herdfeuer zutraten. Während sie die Frau zu einem rundlichen Stein am wärmsten Teil der Feuerstelle geleiteten, sah Paul, daß Vogelfänger ihn anstarrte und dabei den Arm des kleinen Mädchens hielt, das sich vorher Paul genähert hatte. Sein Griff war so fest, daß sie sich vor Schmerz wand.
»Bring mir Wasser«, sagte die alte Frau zu Läuft-weit und ließ sich langsam auf dem Felsen nieder. Als er fort war, wandte sie sich Paul zu. »Wie heißt du?«
Paul war sich nicht sicher, was für eine Antwort sie erwartete. »Die Männer vom Menschenstamm nennen mich Flußgeist.«
Sie nickte zufrieden, als ob er eine Prüfung bestanden hätte. Schmutz saß in den Runzeln ihres zerfurchten Gesichtes, und durch ihr dünnes weißes Haar zeichnete sich ihre Kopfform deutlich ab, doch die Stärke ihrer Persönlichkeit und die Achtung, in der sie bei den Menschen stand, waren unverkennbar. Sie hob eine klauenartige Hand und tupfte damit vorsichtig seine an.
»Ich werde Dunkler Mond genannt. Das ist der Name, den ich führe.«
Paul nickte, obwohl er nicht ganz einsah, wieso sie dieser Mitteilung soviel Bedeutung beizumessen schien. Das hier ist nicht meine Welt, erinnerte er sich. Für Primitive sind Namen etwas Magisches.
»Kommst du aus dem Land der Toten?« fragte sie. »Erzähle mir deine wahre Geschichte.«
»Ich … ich komme von einem sehr weit entfernten Ort. Die Menschen – die Jäger – haben mich gerettet, als ich im Fluß am Ertrinken war.« Er zögerte, dann verstummte er. Er glaubte nicht, daß er ihr seine wahre Geschichte würde begreiflich machen können, begriff er sie doch selbst nicht, nicht einmal die Teile, an die er sich deutlich erinnerte.
Sie schürzte die Lippen. »Und was hast du mit uns im Sinn? Was bringst du den Menschen? Was wirst du uns nehmen?«
»Ich hoffe, daß ich euch nichts nehmen werde, außer dem Essen und der Kleidung, die ihr mir gebt.« Es war schwer, einfach zu reden, ohne sich anzuhören wie ein Indianerhäuptling in einem schlechten amerikanischen Western. »Ich bin mit nichts aus dem Fluß gekommen, deshalb habe ich auch keine Geschenke.«
Dunkler Mond blickte ihn wieder an, und diesmal dauerte die Begutachtung eine ganze Weile. Läuft-weit kehrte mit einem Becher zurück, der aus einem Stück Tierhorn gefertigt zu sein schien; die alte Frau trank ausgiebig und richtete dann wieder den Blick auf Paul. »Ich muß nachdenken«, sagte sie schließlich. »Ich verstehe nicht, was du in der Welt tust.« Sie drehte sich um und tätschelte Läuft-weit auf die Schulter, bevor sie abrupt die Stimme hob und sich an den ganzen Menschenstamm wandte. »Jäger sind zurückgekehrt. Sie haben zu essen mitgebracht.«
Die anderen, die mit geradezu zivilisierter Zurückhaltung so getan hatten, als hörten sie bei ihrem Gespräch mit Paul nicht zu, ließen jetzt ein paar rauhe Beifallsrufe hören, obwohl die meisten emsig am Kauen waren.
»Heute nacht ist eine gute Nacht.« Dunkler Mond breitete langsam die Arme aus. Ihr winziger Körper schien für das Gewicht des Fellumhangs zu schwach zu sein. »Heute nacht werde ich eine Geschichte erzählen, und der mit dem Namen Flußgeist wird gut über die Menschen denken, die ihm zu essen gegeben haben.«
Der ganze Stamm trat heran, und die am nächsten waren, setzten sich Dunkler Mond zu Füßen. Viele nutzten die Gelegenheit, Paul genauer in Augenschein zu nehmen. Er sah Furcht und Sorge in den meisten Gesichtern, doch nur bei Vogelfänger war eine Angespanntheit zu erkennen, die unter Umständen in Gewalt umschlagen konnte. Die übrigen vom Menschenstamm sahen ihn an, wie manierliche Kunden einen geistig Verwirrten von der Straße betrachten mochten, der unmotiviert durch die Ladentür getreten war, aber noch keine Anstalten machte, herumzukrakeelen oder Sachen umzustoßen.
Erschöpft von der Aufregung und die Bäuche voll gebratenem Fleisch waren einige der kleineren Kinder schon eingeschlafen, doch ihre Eltern und Hüter nahmen sie einfach auf dem Arm mit zu der Versammlung, weil sie sich etwas so offensichtlich Wichtiges nicht entgehen lassen wollten. Vogelfänger, der letztlich doch nicht mißtrauisch genug war, um fernzubleiben, stellte sich an den äußeren Rand des Kreises, und obwohl er Paul immer noch böse Blicke zuwarf, hörte auch er zu.
»Ich werde euch von den vergangenen Tagen erzählen.« Die Stimme von Dunkler Mond nahm einen Singsangton an, und selbst Paul konnte die Befriedigung über einen vertrauten rituellen Anfang nachempfinden. »Das waren die Tage, bevor die Väter eurer Väter und deren Väter in der Welt wandelten.«
Als sie eine kurze Pause machte, stellte er eine unerwartete Spannung bei sich fest. Trotz seiner Vorbehalte, seiner Skepsis, konnte er sich, in dieser kalten Höhle kauernd, nur schwer dem Gefühl verschließen, daß er hier an einem Urquell des Geschichtenerzählens saß, daß ihm die Gnade zuteil wurde, einer der ältesten Sagen überhaupt lauschen zu dürfen.
»In jenen Tagen damals«, begann Dunkler Mond, »war alles dunkel. Es gab kein Licht, und es gab keine Wärme. Die Kälte war überall, und der Urmann und die Urfrau litten. Sie gingen zu den andern Urmenschen, den ganzen Tieren, und fragten sie, was sie tun konnten, um sich warm zu halten.
Langnase riet ihnen, sich am ganzen Leib zu behaaren, wie er es getan hatte. Weil er so groß war, dachten der Urmann und die Urfrau, daß er sehr alt und sehr weise sein müsse, aber so sehr sie sich auch anstrengten, sie konnten nicht genug Haare sprießen lassen, um warm zu bleiben. Da tötete der Urmann den großen Langnase und stahl sein haariges Fell, und ein Weilchen litten sie nicht mehr.
Bald aber wurde die Welt noch kälter, und selbst das Fell, das sie Langnase abgenommen hatten, reichte nicht aus, um sie warm zu halten. Da gingen sie zur Höhlenmutter und fragten sie, wie sie wohl warm bleiben konnten.
›Ihr müßt ein tiefes Loch im Berg finden‹, sagte die Höhlenmutter, ›und dort könnt ihr geschützt vor dem Beißewind wohnen, wie ich es tue, und eure Jungen aufziehen.‹
Aber der Urmann und die Urfrau konnten kein eigenes Loch finden, und so töteten sie die Höhlenmutter und zogen selber in ihr Loch, und ein Weilchen litten sie nicht mehr.
Und noch immer wurde die Welt kälter. Der Urmann und die Urfrau kauerten sich in ihrer Höhle zusammen und zogen ihre Felle fest um sich, doch sie wußten, daß sie bald sterben mußten.
Eines Tages sah die Urfrau den winzigen Nacktschwanz durch die Höhle flitzen. Sie fing ihn mit der Hand und wollte ihn aufessen, denn sie hatte großen Hunger, aber Nacktschwanz erklärte ihr, wenn sie ihn nicht verschlänge, würde er ihr etwas Wichtiges mitteilen. Sie rief den Urmann herbei, damit auch er hörte, was Nacktschwanz zu sagen hatte.
›Ich werde euch ein großes Geheimnis verraten‹, sagte Nacktschwanz. ›Gelbauge, der dort draußen im furchtbaren kalten Dunkel wohnt, hat ein Zauberding, ein Ding, das sich im lindesten Wind neigt und doch nicht wegweht, das keine Zähne hat und doch einen harten Baumast fressen kann. Dieser Zauber ist ein warmes Ding, das die Kälte fernhält, und an ihm liegt es, daß die Augen des alten Gelbauge in der Dunkelheit hell leuchten.‹
›Was kümmert uns das?‹ sagte der Urmann. ›Er wird uns dieses warme Zauberding niemals überlassen.‹
›Wir könnten ihn überlisten und es ihm stehlen‹, sagte die Urfrau. ›Haben wir nicht auch Langnase sein Fell und der Höhlenmutter ihr Haus abgenommen?‹
Der Urmann sagte nichts. Er fürchtete sich vor Gelbauge, denn dieser war grausam und stark und viel schlauer als Langnase oder die Höhlenmutter. Der Urmann wußte, daß die zerbrochenen, abgenagten Knochen vieler anderer Tiermenschen vor Gelbauges Bau lagen. Doch er hörte zu, als die Urfrau ihm die Gedanken sagte, die in ihrem Bauch waren.
›Ich werde tun, was du sagst‹, erklärte er schließlich. ›Wenn ich es nicht versuche, werden wir doch auf jeden Fall umkommen, und die Dunkelheit wird uns holen.‹«
Die Flammen flackerten unter einem Windstoß, der kalt durch den Raum schnitt. Paul schlotterte und zog seine Felle fester um sich. Er wurde allmählich schläfrig, und es fiel ihm schwer, klar zu denken. Alles war so seltsam. Hatte er diese Geschichte nicht schon irgendwo einmal gehört? Aber wie hätte das sein können?
Die Höhle wurde dunkler, bis die Glut alle Zuhörer in rot beschienene Gespenster verwandelte. Die brüchige Stimme von Dunkler Mond schwoll an und ab, während sie das Lied vom Feuerdiebstahl sang.
»Der Urmann begab sich zu der Stätte vieler Knochen, wo Gelbauge lebte. Er sah die hellen Augen schon aus weiter Ferne, doch Gelbauge sah ihn noch eher.
›Was willst du?‹ fragte er den Urmann. ›Wenn du es mir nicht sagst, werde ich dich in meinem Maul zermalmen.‹ Gelbauge zeigte dem Urmann seine schrecklichen Zähne.
›Ich bin gekommen, weil ich einen Handel mit dir schließen will‹, sagte der Urmann. ›Ich möchte gern das warme, helle Ding haben, das du besitzt.‹
›Und was willst du mir dafür geben?‹ fragte Gelbauge. Seine Augen leuchteten ein wenig heller.
›Ein Kind‹, sagte der Urmann. ›Die Kälte ist so groß, daß es sowieso umkommen wird, wenn wir nicht etwas von deinem warmen, hellen Ding bekommen.‹
Gelbauge leckte sich die Lippen und knackte mit seinen schrecklichen Zähnen. ›Du willst mir dein Kind für ein bißchen von meinem Feuer geben?‹
Der Urmann nickte.
›Dann leg das Kind dorthin, wo ich es sehen kann‹, wies Gelbauge an, ›und ich werde dir geben, was du begehrst.‹
Der Urmann langte in seine Felle und holte das Kind aus Lehm hervor, das die Urfrau mit ihren geschickten Händen geformt hatte. Er legte dieses Kind vor Gelbauge nieder.
›Es ist sehr still‹, sagte Gelbauge.
›Es fürchtet sich vor deinen Zähnen‹, erwiderte der Urmann.
›Das ist gut‹, sagte Gelbauge und riß seinen Rachen weit auf. ›Faß in mein Maul, und du wirst finden, was du begehrst.‹
Der Urmann fürchtete sich sehr, aber er trat dicht an Gelbauges Maul heran, das den Geruch des Todes ausströmte.
›Faß in mein Maul‹, sagte Gelbauge noch einmal.
Der Urmann steckte seinen Arm tief in Gelbauges Maul, an den schrecklichen Zähnen vorbei und durch die lange Kehle. Zuletzt langte er etwas sehr Heißes an und schloß seine Hand darum.
›Nimm nur ein wenig‹, sagte Gelbauge.
Der Urmann zog seine Hand zurück. Darin hatte er etwas Gelbes, das sich im Wind neigte, aber nicht wegwehte, das keinen Mund hatte, aber ihm in die Haut biß, da er es hielt. Der Urmann warf einen Blick auf Gelbauge und sah, daß dieser das Kind aus Lehm beschnüffelte, und da lief der Urmann los, das warme gelbe Ding fest in der Hand.
›Das ist gar nicht dein Kind!‹ schrie Gelbauge erbost. ›Du hast mich getäuscht, Urmann.‹
Gelbauge nahm die Verfolgung auf. Der Urmann rannte, so schnell er konnte, aber er hörte, wie sein Feind immer näher kam. Das warme Zauberding war sehr schwer in seiner Hand und biß ihm in die Haut, deshalb warf der Urmann es von sich, hoch in die Luft. Es flog an den Himmel und blieb dort hängen und erfüllte die Welt mit Licht. Gelbauge schrie abermals und rannte schneller, doch der Urmann erreichte die Höhle, wo er mit der Urfrau wohnte, und lief hinein. Sie schoben einen Stein in die Öffnung, damit Gelbauge sie nicht erwischen konnte.
›Ihr habt mich betrogen, das werde ich nicht vergessen‹, schrie Gelbauge. ›Und wenn ihr ein richtiges Kind bekommt, werde ich es euch wegnehmen.‹
Der Urmann lag völlig entkräftet auf dem Boden der Höhle. Die Urfrau sah, daß er noch ein klein wenig von dem warmen, hellen Ding an der Hand hängen hatte. Sie strich es mit einem Stock ab, und als es anfing, den Stock zu fressen, wurde es größer und wärmte die ganze Höhle. Das war das Feuer.
Von dem Tag an waren die Finger des Urmanns nicht mehr alle gleich wie bei den andern Tiermenschen. Ein Finger an jeder Hand war abgebogen, weil er das heiße Feuer getragen hatte, und aus diesem Grund haben alle Kinder des Urmannes und der Urfrau andere Hände als die Tiermenschen.
Das Feuer, das an den Himmel geflogen war, wurde zur Sonne, und wenn sie scheint, verbergen sich Gelbauge und sein Volk vor dem Licht, weil es sie daran erinnert, wie sie vom Urmann überlistet wurden. Aber wenn es weggeht und die Welt im Dunkeln liegt, kommt Gelbauge wieder hervor, und sein Auge ist der Mond, mit dem er nach dem Kind ausschaut, das der Urmann und die Urfrau ihm versprochen hatten. Seit den Tagen, bevor die Väter eurer Väter und deren Väter in der Welt wandelten, jagt er jede Nacht nach den Kindern des Urmannes und der Urfrau.«
Die Stimme von Dunkler Mond war sehr leise geworden, ein dünnes Wispern, das durch die atemlose Stille in der Höhle strich.
»Er wird auch dann noch nach ihnen jagen, wenn die Kinder eurer Kinder und deren Kinder in der Welt wandeln werden.«
> Er konnte ein mächtiges, langsames Stampfen hören, das Ticken einer titanischen Uhr oder die Schritte eines nahenden Riesen, aber er sah nichts als Finsternis, fühlte nichts als eisigen Wind. Er hatte keine Hände und keinen Leib, keine Möglichkeit, sich vor dem Unbekannten zu schützen, das in der schwarzen Leere hier am Rand aller Dinge lauerte.
»Paul.« Die Stimme in seinem Ohr war leise und sanft wie eine fliegende Feder, aber sein Herz hämmerte los, als ob sie geschrien hätte.
»Bist du das?« Entweder seine eigene Stimme machte außerhalb seines Schädels kein Geräusch, oder er hatte nicht mehr die Ohren, sich selbst sprechen zu hören.
Etwas war neben ihm im Dunkeln. Er konnte es spüren, auch wenn er nicht wußte, wie. Er konnte es fühlen, einen schnellen Herzschlag, einen zarten Hauch.
»Paul, du mußt zu uns zurückkommen. Du mußt zu mir zurückkommen.«
Und als ob sie seine Träume niemals verlassen hätte, sondern nur aus seinem Wachbewußtsein geschwunden wäre, sah er sie jetzt in der Erinnerung, konnte sich das Bild ihrer befremdlichen, aber wunderschönen geflügelten Gestalt, ihres traurigen Blicks vors innere Auge holen. Sie hatte einst in diesem goldenen Käfig gekauert, während er hilflos außen vor den Gitterstäben gestanden hatte. Er hatte sie diesem furchtbaren malmenden Ungetüm überlassen, dem Alten Mann.
»Wer bist du?«
Sie wurde ein wenig stärker spürbar, eine ganz feine Schwingung der Ungeduld ging von ihr aus. »Ich bin niemand, Paul. Ich weiß nicht, wer ich bin – es interessiert mich nicht mehr. Aber ich weiß, daß ich dich brauche, daß du kommen mußt.«
»Wohin kommen? Du hast gesagt ›zu uns‹. Zu wem?«
»Du stellst zu viele Fragen.« Es klang traurig, nicht verärgert. »Ich habe die Antworten nicht, die du wünschst. Aber ich weiß, was ich weiß. Wenn du zu mir kommst, werden wir beide es wissen.«
»Bist du Vaala? Bist du die Frau von neulich?«
Wieder die Ungeduld. »Diese Dinge sind unwichtig. Es ist so schwer für mich, hier zu sein, Paul – so schwer! Hör zu! Hör zu, und ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Es gibt einen Ort, einen schwarzen Berg, der bis zum Himmel reicht – der die Sterne verdeckt. Den mußt du finden. Dort liegen alle Antworten auf deine Fragen.«
»Wie? Wie komme ich dorthin?«
»Ich weiß es nicht.« Eine Pause. »Doch es kann sein, daß es mir einfällt, wenn du mich findest.«
Etwas störte seine Konzentration, ein unbestimmter, aber hartnäckiger Schmerz, ein Stechen, das Paul nicht ignorieren konnte. Der Traum sank in sich zusammen. Als er ihn entgleiten fühlte, versuchte er verzweifelt, sich an sie zu klammern, an diese Stimme im Leeren.
»Dich finden? Was bedeutet das?«
»Du mußt zu mir kommen … zu uns …« Sie wurde immer leiser, war kaum mehr wahrnehmbar, ein enteilendes Flüstern auf einem langen Korridor.
»Verlaß mich nicht! Wie kann ich dich finden?« Das vage Unbehagen wurde schärfer, forderte seine Aufmerksamkeit. »Wer bist du?«
Aus unbegreiflicher Ferne ein Raunen: »Ich bin … ein zersprungener Spiegel …«
Seine Kehle war wie zugeschnürt, ein Schmerz wie eine feurige Messerspitze saß ihm im Bauch. Sie war wieder fort – seine Verbindung zur normalen Welt! Aber wie konnte jemand oder etwas so offenbar Wahnsinniges ihn in die Wirklichkeit zurückführen? Oder hatte er nur geträumt …?
Der Schmerz wurde stärker. Seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, an die trübe Aschenglut, und er sah den formlosen Schatten über sich. Etwas Hartes, Scharfes wurde ihm in den Bauch gedrückt. Paul glitt mit der Hand dorthin und fühlte die kalte, steinerne Speerspitze tief in seinem Fellumhang stecken, dessen Haare bereits von warmen Blutstropfen verklebt waren. Noch ein kleines Stück weiter, und sie würde seine Gedärme durchbohren.