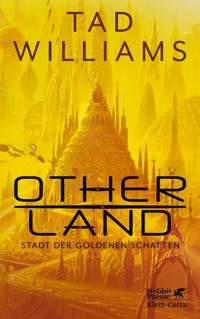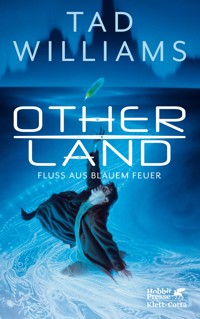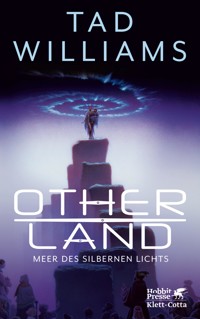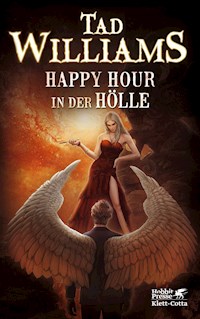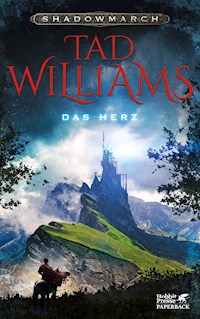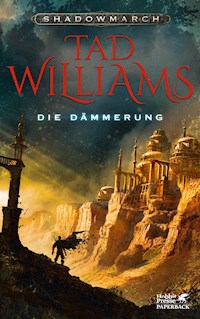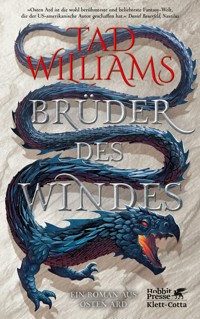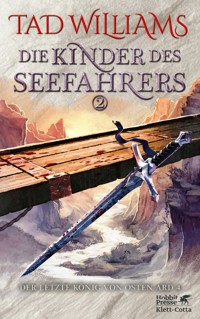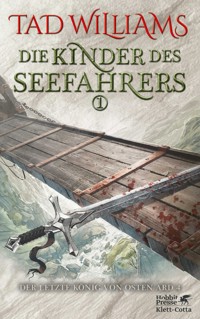19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der letzte König von Osten Ard
- Sprache: Deutsch
»Bahnbrechend« Patrick Rothfuss Die Geschichte von Osten Ard reicht tief zurück in eine uralte Vergangenheit. Auch wenn die Menschen hier ihre Königreiche, die miteinander im Streit liegen, errichtet haben, droht doch immer wieder Gefahr von den unberechenbaren Wesen, die alle Zeiten überdauert haben. Eine tödliche Armee der Nornen, angeführt von der alterslosen, rachsüchtigen Königin Utuk´ku, marschiert in Erkynland ein und hat die Festung Naglimund erobert, ihre Bewohner abgeschlachtet und das uralte Grab Ruyans des Seefahrers geöffnet. Mit Hilfe seiner sagenhaften Rüstung will Utuk´ku den Geist Hakatris beschwören, des Bruders des bösen Sturmkönigs. Selbst die Sithi, mit den Nornen verwandte Feen, können Utuk´kus Triumph nicht aufhalten. Utuk´kus Armeen marschieren zum Hochhorst und dringen gleichzeitig in das verbotene, von einem Ungeheuer bewachte Tal des Tanakirú ein, des Dunkelschmal. Dort wartet ein Geheimnis, das Simons Volk und seinen Sithi-Verbündeten die Rettung bringen könnte – oder aber den Untergang. »Ein meisterhafter Geschichtenerzähler« Brandon Sanderson »Inspirierte mich dazu, selbst eine siebenbändige Trilogie zu schreiben ... Es ist eine meiner liebsten Fantasy-Serien.« George R. R. Martin »Ein fesselndes Epos mit einer Mischung aus Abenteuer, Intrige und Magie« LOCUS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tad Williams
Im dunklen Tal 2
Der letzte König von Osten Ard 3
Aus dem Amerikanischen von Cornelia Holfelder-von der Tann und Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Impressum
Wegen des großen Textumfangs erscheint Im dunklen Tal. Der letzte König von Osten Ard 3 in zwei Teilbänden.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Into the Narrowdark.
The Last King of Osten Ard« im Verlag DAW Books, New York
© 2022 by Beale Williams Enterprise
© Karte by Isaac Stewart
Für die deutsche Ausgabe
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg
Illustration: © Max Meinzold, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98751-5
E-Book ISBN 978-3-608-12201-5
Inhalt
Zweiter Teil
Opfertanz
Hakatri
Zweites Intermezzo
22
Streit
23
Eine Lektion und ihre Folgen
24
Das Siegel
25
Die verwünschte Luft
26
Schwarze Fahnen
27
Im Dunkeln
28
Die Antwort des Bogenschützen
29
Ein Krüglein Pein
30
Ins Tal des Dunkelschmal
31
Piraten, Priester und Märtyrer
32
Der unsichtbare Fluss
33
Vollkommener Wahnsinn
34
Die Festung auf dem Berg
35
Für die Ehre
36
Ein entfernter Verwandter
37
Das Fass
38
Der König unter der Erde
39
Das Instrument der Königin
Hakatri
Drittes Intermezzo
40
Feuer in der Burg
Nachwort
Glossar
Personen
Erkynländer
Hernystiri
Nabbanai
Nornen (Hikeda’ya)
Perdruineser
Qanuc
Rimmersgarder
Thrithingbewohner
Sithi (Zida’ya)
Tinukeda’ya
Wranna
Andere
Geschöpfe
Orte
Sonstige Namen und Begriffe
Sterne und Sternbilder
Die Feiertage
Die Wochentage
Die Monate
Wurfknöchel
Die acht Schiffe
Orden der Hikeda’ya
Die Clans der Thrithinge (und ihr Thrithing)
Wörter und Sätze
Hernystiri
Nornen (Hikeda’yaso)
Qanuc
Sithi (Zida’yaso)
Sprache der Thrithinge
Anderes
Zweiter Teil
Opfertanz
Ich habe die Sa’onsera gesehen.
Ich würde sie mit geschlossenen Augen erkennen,
denn wo sie geht, ist ringsum Stille.
Ich habe die Sa’onsera gehört,
doch auch taub würde ich sie erkennen,
denn wo sie steht, verbeugt sich das Licht.
Dennoch brauche ich weder Auge noch Ohr,
um zu wissen, sie ist die Höchste,
denn wenn ihre Gedanken meine berühren, jauchzt mein Geist vor Freude.
Und in diesem quecksilbrigen Augenblick wohne ich im Garten,
in der Liebe, die wir alle verloren haben,
der Liebe, die kostbarer ist als alles.
Und das ist alles, was ich von ihr
oder mir selbst zu wissen brauche.
– Benayha von Kementari
Hakatri
Zweites Intermezzo
Die Zeit hatte wieder eingesetzt, und ihre Berührung war Pein.
Der Befehl hatte ihn aus der gesegneten ewigen Leere, in der er so lange geschwebt hatte, herausbeordert und schleuderte ihn jetzt in jenen prismatischen, albtraumhaften Moment zurück, als das Drachenherz von dem großen Hexenholzpfahl durchbohrt worden war und die kochende Fontäne von schwarzem Blut ihn für immer verändert hatte. Er fühlte, wie dessen schreckliche Essenz wieder durch ihn hindurchströmte, seinen Geist austilgte und nur Drachenleben übrig ließ. In dem Brennen verwandelte er sich – eine Agonie von Tod und Geburt. Die kochend heiße schwarze Flut sengte Zeit und Raum weg, sodass er in einem einzigen Augenblick alles wahrnahm, was in der wirbelnden Welt lebte, und vieles, das nicht mehr existierte.
Er sah seine Frau weinen, sah Tränen auf ihren Wangen glitzern wie Reif.
Auch seine Tochter erschien vor ihm, das Gesicht mit der Asche der Trauer beschmiert. Sie war kein Kind mehr, sondern zu einer Person herangewachsen, die er nur an ihrer Wildheit erkannte. Dann kam das Gesicht seines Bruders, zu einem irren Grinsen verzerrt, so erschreckend, dass er, hätte er einen Körper gehabt, zurückgewichen wäre.
Die Wahnsinnsmaske seines Bruders zerschmolz zu nichts, doch weitere Gestalten folgten, eine nach der anderen, wie Trauernde in einem Leichenzug. Manche kamen ihm vage bekannt vor, andere aber waren ihm völlig fremd – eine schlanke Hikeda’ya-Frau mit einer langen Hexenholzklinge, ein zottiger Riese, verfolgt von einem narbigen, hellhaarigen Sterblichen, und eine kindgroße Gestalt, allein an einem leeren Strand. Doch diese Visionen waren nur halbverrottete Spinnwebschwaden, so substanzlos wie Schatten oder wallender Nebel, und er spürte, dass sie nicht Wirklichkeit waren, sondern nur Möglichkeit. Und vor, über und hinter ihnen, ja, sogar irgendwie in ihnen war da etwas Hohes, Helles, eine Säule aus Stein, die über der Welt aufragte wie ein riesiger Zeigefinger, und darum herum spürte er die wirbelnden Winde unzähliger Schicksale.
Er versuchte verzweifelt, sich von diesen schrecklichen oder verwirrenden Phantomen abzuwenden, aber er konnte ihnen nicht entkommen. Er war durch ein Wort von gewaltiger, fast schon unfassbarer Macht aus seinem langen Schlaf gerufen worden, und dieser Ruf hatte ihn zurückgezerrt in das endlose Grauen, das das brennende schwarze Blut vor so langer Zeit über ihn gebracht hatte.
Wieder war er ein Gefangener der Zeit.
»Die Stunde ist gekommen.« Die seltsame, vielfach widerhallende Stimme kam überall und nirgends her, dröhnte wie das Läuten einer riesigen Glocke. »Du hast das Wort gehört, das dich ruft. Jetzt ist für dich die Stunde da, wahrhaft zu erwachen – deinem Volk zu dienen.«
Er kämpfte, aber sein Widerstand war sinnlos, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Zeit hatte ihn umschlungen wie eine Würgeschlange, wie ein grausames Seil, der Sog eines Strudels, und mit ihr war der Schmerz gekommen, der sein Leben zerstört hatte, das schreckliche schwarze Brennen.
»Du bist zurückgeholt worden, weil nur du tun kannst, was getan werden muss«, erklärte die Stimme. »Nur du von allen unseresgleichen trägst die Schwärze in dir. Nur du hast in dem feurigen, elementaren Blut gebadet, hast von dem tückischen Träumenden Meer getrunken.« Seltsamerweise schien er noch zwei Stimmen im Chor mit der ersten sprechen zu hören, wie beim gleichzeitigen Sprechgesang von Zelebranten, aber er war sich sicher, dass sie alle drei aus einem Denken, einem Willen sprachen. Es war zu viel für seinen verwirrten Geist, der so empfindlich, so frisch zurückgekehrt war, und er driftete der erschöpften Kapitulation entgegen, während die Stimme weitersprach. »Jetzt werden die bestraft werden, die alles zerstört haben, was dir etwas bedeutete. Gemeinsam werden wir zu einem Sieg gelangen, der ihre Vorstellung übersteigt.«
Er wusste nicht mehr, wie man sprach, aber irgendwie wurden seine Gedanken Worte: »Warum? Warum habt Ihr mich zurückgeholt? Warum habt Ihr mich wieder diesem Grauen ausgesetzt?«
»Weil nur du es richten kannst«, erklärte die Dreifachstimme.
»Das verstehe ich nicht.«
»Aber du wirst es verstehen, Kind des Jahresendes. Und wenn du verstehst, was die Sterblichen deinesgleichen – unseresgleichen – angetan haben, wirst du auch wissen, was du tun musst. Du wirst es verstehen. Und du wirst Strafe üben.«
22
Streit
Sisqi hatte den Vormittag damit zugebracht, Grünzeug zum Essen zu beschaffen, weil eine Kost, die immer nur aus Fisch bestand, sie zu sehr an Winter in Yiqanuc erinnerte und es in diesem Teil des großen Waldes viele interessante Pflanzen gab. Als sie zum Biwak am See zurückkehrte, war zu ihrer Beunruhigung Vaqana nirgends zu sehen. Die weiße Wölfin hatte die meiste Zeit der letzten zwei Wochen Binabik in seinem Fieberschlaf bewacht, und Sisqi konnte sich keinen guten Grund denken, warum Vaqana ihn jetzt allein gelassen haben sollte. Mit rasendem Herzen eilte sie den Hang hinab, aber zu ihrer Erleichterung war Binabik wach und hatte die Augen offen. Er lächelte sogar, als er sie sah. »Grüß dich, Frau«, sagte er ruhig.
»Tochter der Berge, bin ich erschrocken.« Sie kniete sich neben ihn und nahm den Blätterverband ab, damit sie sein Schienbein untersuchen konnte. Die Haut um die Zwillingslöcher war rot und die Wunden immer noch tief, wie kleine Teiche, obwohl sie zu heilen begonnen hatten. Ihr Mann würde für den Rest seines Lebens Narben zurückbehalten, aber der Biss hatte endlich aufgehört zu suppen. »Ich habe gesehen, dass Vaqana nicht da ist. Ich konnte mir nicht denken, warum sie von deiner Seite gewichen sein könnte«, sagte sie, »außer … außer wegen irgendwas Schlimmem.«
»Sie hat gesehen, dass es mir besser geht. Und dann hat sie ein Kaninchen gesehen.«
Sisqi lachte ein wenig, obwohl sie sich noch nicht ganz von ihrer Panik erholt hatte. »Hier. Ich habe Schneegänseblümchenblätter mitgebracht – ich glaube jedenfalls, dass sie so heißen.«
Binabik studierte die Blätter genau. »Ja, das stimmt wohl. Aber die soll ich essen? Ein Mann, der sich gerade von einer Vergiftung erholt, sollte doch wohl kräftigende Nahrung bekommen. Kannst du nicht ein, zwei Tauben fangen?«
»Ich bin froh, dass dein Appetit offenbar zurückkehrt, aber das heißt nicht, dass du wahllos irgendwelche Vögel verschlingen solltest.«
»Wer gut isst, schläft gut«, sagte Binabik ernsthaft. »Und wer gut schläft, dem geht es gut.«
»Ich glaube, das ist wieder so eine alte Spruchweisheit, die du selbst erfunden hast.« Sie beugte sich hinab und küsste ihn. Er roch immer noch nach Kranksein, aber das Weiße seiner Augen war nicht mehr gelb, und offenkundig kehrten all seine Gelüste zurück. »Und du könntest bitte aufhören, meinen nuluk zu begrapschen, weil ich kein Essen machen kann, wenn ich abgelenkt bin.«
»Aber wenn es mir gut geht, meine Sisqinanamook – und ich fühle mich heute viel besser – lenkst du mich immer ab.«
»Schmeicheleien eines Singenden Manns?« Sisqi nahm sanft seine Hand von ihrem Hinterteil weg und richtete sich auf. »Du kennst doch sicher eine alte Spruchweisheit darüber, wie wenig man auf so etwas geben kann.«
»Mir fällt keine solche Spruchweisheit ein«, antwortete er, sein rundes Gesicht ganz Unschuld.
»Dann erfinde eben auch so eine.« Einem plötzlichen Impuls gehorchend, beugte sie sich hinab und küsste ihn wieder. »Oh, mein Liebster, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön es ist, deine Stimme zu hören, auch wenn du gerade albern und störrisch bist. Ich hatte ja solche Angst, dich zu verlieren.«
Binabik setzte sich auf, nicht ohne Schnaufen und Ächzen. Als er saß, war seine Stirn schweißfeucht. »Als ich mit dir hierher an Geloës See gekommen bin, dachte ich nicht, dass wir immer noch hier sein würden, wenn Sedda sich das nächste Mal gerundet hätte.«
»Du dachtest eben nicht, dass dich eine Giftschlange beißen würde, und ich auch nicht.«
Sie wurden dadurch unterbrochen, dass Vaqana zurückkam: Sie hatte sich offenbar an der heimischen Tierwelt gütlich getan, jedenfalls deutete das Blut an ihrer Schnauze darauf hin. Als sie Binabik aufrecht dasitzen sah, kam sie in großen Sätzen den Hang heraufgestürmt und warf ihn beinahe wieder um, stellte sich dann vor ihn hin, die Pfoten beidseits seiner Beine, und leckte ihm das Gesicht.
»Hilfe!«, rief er. »Sie wird mir die ganze Haut abschmirgeln wie ein Bimsstein. Und außerdem riecht ihr Atmen nach Mäusen!«
»Na ja, du sagtest doch, du hast Hunger. Vielleicht bringt sie dir ja die nächste.«
Er rubbelte der Wölfin die Brust. »Ich würde eine Maus nicht verachten und auch sonst nichts Fleischiges. Ich fühle mich so schwach wie ein Wieseljunges bei seinem ersten Ausflug im Schnee. Aber es wäre doch bestimmt leichter für uns, ein, zwei Vögel mit dem Pfeil zu erwischen, als Mäuse auszugraben. Wenn Vaqana hoch genug springen könnte, würde sie hier in der Gegend alle Vögel von den Bäumen holen, bevor sie sich herablassen würde, auch nur eine einzige Maus zu fressen.«
»Du bekommst Suppe, und du wirst sie aufessen«, sagte Sisqi, während sie Totholz nachlegte und einen Stein im Feuer platzierte, um ihn zu erhitzen. »Wenn du kräftig genug bist, um dir selbst ein paar Vögel herunterzuschießen, kannst du dir von mir aus den Bauch mit geflügelten Kreaturen vollschlagen.«
»Habe ich dir schon mal gesagt, dass du grausam bist?« Sein Ton war munter, aber Sisqi sah ihn wissend an.
»Ja, schon oft. Und ich sehe, dass du bereits müde bist, auch wenn du dir’s nicht anmerken lassen willst. Das Gift hätte dich beinahe getötet, also leg dich wieder hin, und ich werde dich füttern wie ein kleines Kind.«
»Pff«, sagte er. »Schneegänseblümchensuppe. Selbst Vogeljunge werden mit Würmern gefüttert.«
»Na gut. Dann kaue ich dir eben auch ein paar vor.«
In einem winterlichen Wald voller hungriger Bären und Wölfe waren Schlangen das Letzte gewesen, was die Trolle fürchteten. Doch am Tag, an dem sie Geloës See verlassen wollten, war Binabik auf eine im Laub versteckte Halsband-Viper getreten, und sie hatte ihm die Zähne ins Bein gegraben.
Zuerst hatte es nicht weiter schlimm gewirkt. Er kehrte zu Sisqi zurück und bat sie, ihm zu helfen, die Bisswunde zu behandeln. Doch beim Kramen in seiner Packtasche bekam Binabik plötzlich Atemprobleme und beklagte sich, seine Zunge sei größer geworden. Sisqi sah, dass auch seine Lippen und sein Hals stark geschwollen und seine Augen so rot wie die eines Uhus waren, und es machte ihr große Angst. Sie hatte am Blauschlammsee einige schlimme Schlangenbisse gesehen, also schnitt sie den Biss mit ihrem Messer auf und saugte so viel von dem Gift heraus, wie sie konnte. Sie ignorierte den scheußlichen, blutig-bitteren Geschmack und die Taubheit ihres eigenen Munds, die stundenlang anhielt. Solange Binabik noch sprechen konnte, wies er sie an, mehrere Päckchen mit Kräutern aus seiner Packtasche zu nehmen und den Inhalt zu zerstoßen, bevor sie ihn ihm verabreichte. Das Letzte, was sie noch verstehen konnte, war, dass sie einen Aufguss von Buchweizen und Süßholz machen und ihm davon so viel einflößen sollte, wie er noch irgend schlucken konnte.
Tagelang hatte ihn Sisqi mehr oder weniger kontinuierlich in schlimmem Fieber dahindämmern sehen, und obwohl sie die Wunden mehrmals am Tag sorgfältig gespült und neu verbunden hatte, war keine Besserung erkennbar gewesen und sie war allmählich verzweifelt. Das Plätzchen am See war jetzt ihr ständiges Biwak geworden und sie hatte täglich nicht nur ihren Mann pflegen, sondern auch etwas zu essen für sich auftreiben müssen. Ihr Widder Ooki hatte mit der neuen Situation ganz zufrieden gewirkt, war am Seeufer entlangspaziert und hatte abgeweidet, was er an Fressbarem fand. Vaqana hingegen war offenbar so besorgt gewesen wie Sisqi selbst; sie hatte stundenlang an Binabiks Seite geschlafen, sich, wenn das Fieber besonders hoch war, aufgesetzt und ihn beobachtet, ihm den Schweiß vom Gesicht geleckt und gejault, als wollte sie ihn dazu bringen, den Unsinn zu lassen und aufzustehen.
Noch in der Nacht, bevor er wieder zu sich gekommen war, hatte er dermaßen geglüht und so schwach geatmet, dass Sisqi ihren Mund auf seinen gesetzt und ihren Atem in seine Brust gepresst hatte, als könnte ihn ihre Liebe selbst in Form ungreifbarer Luft retten. Dann hatte sie geweint, obwohl es ihm ein bisschen besser zu gehen schien, und sich zum Schlafen neben ihn gelegt, ihren Kopf an seinem, und seinem unregelmäßigen Atem gelauscht, noch lange, nachdem der Mond den Himmel hinabgeglitten war.
Erst drei Tage nachdem das Fieber gesunken war, ließ Sisqi wieder zu, dass Binabik auf Vaqana ritt, doch auch da noch erlaubte sie es ihm nur für eine Stunde und bestand dann darauf, in den Vorhügeln des südlichen Waldhelm Halt zu machen und zu übernachten.
»Aber wir haben doch so viele Tage verloren!«, beschwerte er sich. »Bevor mich die Schlange gebissen hat, waren wir mit dringenden Nachrichten für unsere Freunde Simon und Miriamel unterwegs. Jetzt müssen wir uns erst recht beeilen!«
»Wenn du dich beeilst, wirst du nur wieder krank«, sagte sie trocken. »Und das lasse ich nicht zu. Vergiss nicht, du bist zwar ein Freund der Erkynländer, aber du bist auch Vater und der Singende Mann unseres Volkes. Du hast kein Recht, achtlos mit deinem Leben umzugehen.«
Er zog eine Grimasse. »Mein Leben bedeutet wenig, gemessen an den Gefahren, die uns drohen, und nicht nur für die Erkynländer wird es schlimm, wenn die Nornen angreifen. Aber vor allem will ich meinen Freunden unnötiges Leid ersparen. Deshalb müssen wir dem Hochhorst die Nachricht bringen, dass Morgan noch lebt.«
»Mag sein. Aber diese Nachricht ist jetzt schon fast einen Monat alt.« Sie konnte ihn nicht ansehen. »Vielleicht stimmt sie ja gar nicht mehr.«
Binabik setzte sich auf und schlug sich mit der Faust an die Brust. »Bete zu den Vorfahren, dass sie noch stimmt!«, sagte er. »Meinst du, Prinz Morgan ist etwas Schlimmes widerfahren?«
»Woher soll ich das wissen?« Sie sorgte dafür, dass er sich wieder hinlegte. »Ich war die ganze Zeit, in der es dir schlecht ging, nur an deiner Seite oder auf der Suche nach Schafgarbe und Süßholz und anderen schwer zu findenden Dingen, jetzt, da Herbstkälte über diesem ganzen Wald liegt. Ich meine ja nur, dass du dich beeilen willst, eine Nachricht zu überbringen, die schon sehr alt ist, und dass das kein triftiger Grund ist, dein Fieber wieder heraufzubeschwören.«
Am Ende fügte sich Binabik, wenn auch nicht ohne Knurren. »Aber ich werde allemal weiterreiten können, wenn die Sonne wiederkommt«, verkündete er.
»Wir werden sehen. Aber bis du wieder völlig gesund bist, bin ich dein Singender Mann, und ich sage, was du kannst oder nicht kannst.« Doch wenn sie auch nicht seiner Meinung war und seine Sturheit manchmal satthatte, liebte ihn Sisqi doch für die Treue zu seinen Freunden.
Weil Sisqi darauf bestand, ritten sie langsam, obwohl es Vaqana offensichtlich frustrierte, nicht ihr übliches lebhaftes Tempo laufen zu dürfen. Zwei Tage lang durchquerten sie die Vorhügel des Waldhelm, jetzt wirklich im Griff der Herbstkälte. Schneeflocken wirbelten im Nordwind und häuften sich auf den Ästen der Nadelbäume.
»Das ist doch angenehmeres Wetter.« Sisqi wischte Schnee vom Pelz ihrer Kapuze. »Es ist wie am Blauschlammsee in der Zeit der Wiederkehr. Vielleicht finden wir sogar ein Schneehuhn!«
Binabik lächelte über ihren Scherz, aber die gefrorenen Schweißtropfen auf seiner Stirn besagten, dass ihn sein Bein immer noch sehr schmerzte, und Sisqi beendete den Tagesritt schon früh. Sie wählten einen Lagerplatz an einem der Bäche, die geräuschvoll die Hügel hinabflossen, und sie machte ein Feuer und bestand darauf, dass Binabik in dessen Wärme sitzen blieb, während sie auf die Suche nach etwas zu essen ging. Vaqana legte sich neben ihn, die Zunge aus dem breiten Wolfsgrinsen hängend, sodass Sisqi ihren Mann ohne Bedenken allein lassen konnte.
Sie war nur ein kurzes Stück vom Lagerplatz weggeritten und hatte gerade begonnen, am Rand eines kleinen Teichs nach Schneegänseblümchen und Nesselblättern zu suchen, als sie unverkennbar Stimmen hörte. Sie nahm Ookis Zügel und führte den Widder ein Stückchen bergauf, um sich mit ihm hinter ein paar dichten Dornbüschen zu verstecken und Ausschau zu halten. Sie hielt das krumme Griffende ihres Stachelstocks – er hatte am anderen Ende eine Art Speerspitze – fest umfasst, bereit, zu kämpfen oder zu flüchten.
Die erste der Gestalten war so klein und ihre Hautfarbe der der Qanuc so ähnlich, dass Sisqi sie einen Moment lang schon fast für eine Art Waldtroll hielt, ein Mitglied einer vergessenen Untergruppe ihres eigenen Volkes. Als ein halbes Dutzend weitere Gestalten der ersten zum Rand des Teichs folgten, merkte sie, dass diese deshalb so klein war, weil es sich um ein Kind handelte. Binnen Augenblicken wusste sie die langen Arme und abfallenden Schultern der Erwachsenen einzuordnen.
Die größeren Mitglieder der Niskie-Familie – denn eine solche war es eindeutig, wenn Sisqi sich auch nicht denken konnte, was diese Leute hier wollten, so fern von jedem Meer – beobachteten aufmerksam, wie die vier Kleinen im Tümpel plantschten. Fasziniert vom Anblick der Niskie-Kinder, die in dem kalten Wasser schwammen und spielten wie Fische, merkte Sisqi gar nicht, dass sie den dritten Erwachsenen aus den Augen verloren hatte, bis sie plötzlich eine Stimme unmittelbar neben sich hörte.
»Ist das Euer Teich?«, fragte jemand auf Westerling.
Sisqi schreckte zusammen. Eine schlanke Gestalt stand am Rand des Gebüschs und sah sie mit großen, ruhigen Augen an. Sie hob ihren Stachelstab, um sich zu verteidigen, doch als der Niskie keine Bewegung machte, senkte sie ihn wieder.
»Ist das Euer Teich?«, fragte der Niskie wieder. Er hatte einen blassgrauen Haarkranz und die ledrige, faltige Haut von jemandem, der viele Jahre in unerbittlicher Sonne verbracht hat, und schien älter zu sein als die anderen beiden Erwachsenen.
»Nicht mein«, sagte sie; sie hatte Schwierigkeiten, sich an die Westerling-Wörter zu erinnern, nachdem sie über einen Monat nur Qanuc gesprochen hatte.
»Ah.« Der Niskie nickte. »Gut. Die Kleinen sind müde und durstig, und wir sind heute weit gewandert.«
Nachdem sie noch ein Weilchen auf die im Teich tollenden Kinder geblickt hatte, ging Sisqi ein kalkuliertes Risiko ein. »Wenn frisches Wasser Ihr wollt, mein Mann und ich haben Lager an Bach. Besser für Trinken.«
Der Niskie nickte wieder. »Ihr seid freundlich.« Er hob den Kopf und rief den anderen mit krächzender Stimme etwas zu. Die Kinder im Teich beachteten es nicht, aber die anderen beiden Erwachsenen schauten her, und ihre Augen weiteten sich, als sie schließlich Sisqi und ihren Widder bei den Dornbüschen sahen. Sie riefen ihre Kinder, die sich immer noch nicht beeilten, das Wasser zu verlassen, aber schließlich doch herauskamen, triefend und scheu, das nasse Haar im Gesicht. Das größte von ihnen war kaum halb so groß wie die Erwachsenen, das kleinste hatte die molligen Arme und Beine eines Kinds, das gerade erst dem Säuglingsalter entwachsen ist.
»Ich bin Han Goda«, sagte der älteste Niskie zu Sisqi. »Das ist meine Familie. Seid gegrüßt.«
»Ich bin Sisqinanamook vom Mintahoq«, sagte sie, noch immer nicht ganz sicher, dass sie das Richtige getan hatte. »Mein Mann hat krank von Schlangenbiss. Kommt in unser Lager trinken. Der Bach ist gut.«
Binabik hatte sein Hosenbein hochgezogen und schmierte gerade Schafgarbenpaste auf seine Wunde. Er war überrascht, aber offenbar nicht beunruhigt, als er sie mit den Niskies zurückkommen sah. Nachdem er und Han Goda, sein Enkel Yem Suju und dessen Frau Yem Gili einander vorgestellt hatten, setzten sie sich alle ums Feuer. Während die Kinder vom Bach tranken und sich lachend und quietschend mit kaltem Wasser bespritzten, gab Sisqi, was sie an Wurzeln und Blättern hatte finden können, in einen Topf. Yem Gili entnahm einem Beutel eine Handvoll kleiner getrockneter Fische und bot sie schüchtern Sisqi an, die sie ebenfalls in den Topf warf. Han Goda inspizierte Binabiks Wunde und sagte: »Ihr seid gut versorgt worden. Viele andere wären an diesem Biss gestorben.«
»Ich weiß. Ich habe immer viel Glück gehabt, aber mein größter Glücksfall sitzt da neben Euch – meine Frau.«
»Woher seid Ihr?«, fragte Sisqi vorsichtig. »Sage ich richtig – ihr seid Niskies?«
Han Goda nickte. »Wir kommen aus Melcolis, einem kleinen Hafen am Nordende der Emettinsbucht. Wir sind Zurück-Fische.«
Sisqi sah ihn ratlos an. »Zurück-Fische?«
»Meine Frau ist mit Eurer Sprache nicht so vertraut wie ich«, sagte Binabik. »Aber ich gestehe, ich kenne dieses Wort auch nicht.«
Han Goda lächelte, wobei man nur Zahnfleisch sah – er war so zahnlos wie eine Schildkröte. »Es ist ein Wort, mit dem wir uns selbst bezeichnen – Fische, die so klein sind, dass man sie ins Wasser zurückwirft. Wir dienen nicht auf den großen Schiffen, nur auf den kleinen Fischerbooten, und auch nur in der Jahreszeit, wenn die Boote weit hinausfahren müssen, um Thunfische zu fangen.«
»Seid ihr deshalb von zu Hause weggegangen? Weil ihr zu wenig Arbeit hattet?«
Der alte Niskie sah ihn aufrichtig erstaunt an. »Nein, nein. Meine Eltern und ihre Eltern und Generationen vor ihnen haben schon so gelebt. Nein, wir sind weggegangen, weil die Herrin uns gerufen hat.«
Sein Sohn und seine Schwiegertochter nickten. »Sie ruft uns zu einem besseren Leben«, sagte Yem Gili mit leiser, aber fester Stimme.
Binabik sah Sisqi an, dann wieder Han Goda. »Ich verstehe gar nichts. Wer ist diese Herrin, die euch ruft?«
Han Goda erzählte ihnen von den Träumen, die er und seine ganze Familie gehabt hatten, wenn auch die Kinder ihre nicht so gut hatten beschreiben können. »Und sie sagt immer zu uns: ›Kommt in den Norden! Folgt meinem Ruf!‹ Und darum sind wir weit von unserem Meer und unserem Zuhause weggegangen.«
»Wer auch immer euch ruft«, sagte Binabik, »wir wünschen Euch und Eurer Familie eine gute und erfolgreiche Reise.«
»Das ist nett von Euch«, sagte Han Goda. »Wir waren schon vielen Gefahren ausgesetzt. Wer hätte gedacht, dass das Wiesenland und der Wald genauso gefährlich sein können wie das Meer?«
»Wir haben ein großes Heer südwärts ziehen sehen«, sagte sein Enkel. Er beugte sich vor und schnupperte am Topf. »Ah! Allmählich habe ich richtig Hunger!«
»Erklärt uns bitte diese Heer-Sehung«, sagte Binabik und seine Miene verdüsterte sich. »Die Suppe ist gleich fertig, aber bitte erzählt uns zuerst noch von diesem Heer.«
»Wir haben es vor fast zwei Wochen gesehen«, sagte Han Goda. »Es war eine Armee der Nornen. Daran besteht kein Zweifel – die Weißhäute waren früher unsere Herren, und wir erinnern uns mit Bitterkeit an jene Zeit. Wir hatten große Angst, als wir Reihen und Reihen ihrer Soldaten bei Nacht die große Straße entlangkommen sahen, darum haben wir uns versteckt. Wir mussten uns sehr lange verstecken, als sie vorbeizogen, weil es so viele waren.«
»Moment, damit ich es richtig verstehe«, sagte Binabik. »Dieses Nornenheer zog nach Süden?« Er zeigte in die betreffende Richtung. »Oder nach Norden?«
»Süden«, sagte Han Goda. »Sie füllten die ganze Straße nach beiden Seiten, so weit wir sehen konnten, viele auf Pferden, aber noch mehr zu Fuß. Sie hatten auch viele große Wagen. Einer von meinen Urenkeln hat gesagt, er hat die Königin mit der Silbermaske auf dem größten Wagen gesehen, aber ich glaube, das kann nicht stimmen. Jeder weiß ja, dass die Nornenkönigin ihren Berg nie verlässt.«
»Erzählt mir bitte noch mehr darüber«, sagte Binabik, die Stirn besorgt gerunzelt. »Ihr sagt, da waren viele Nornensoldaten?«
»Mehr, als ich jemals zählen könnte«, versicherte ihm Han Goda. »Mehr, als Sprotten in einer Meerwolke sind.«
»Ist da sonst noch etwas in Eurer Erinnerung?«
»Ich habe etwas gesehen«, verkündete Yem Suju. »Ich habe einen Wagen gesehen, der aussah, als ob er brannte, aber nicht gebrannt hat.«
»Aber wie kann das sein?«, wollte seine Frau wissen. Ihre Stimme war zart, aber es war klar, dass sie jederzeit sagen würde, was sie für nötig hielt. »Wie kann etwas aussehen, als ob es brennt, aber nicht brennen? Du warst müde. Wir waren alle müde.«
»Erzählt noch mehr darüber, bitte«, sagte Binabik.
»Es war, wie ich sage. Aus einem Wagen, der weit hinter den anderen fuhr, aber vor den vordersten Nornensoldaten, kam ein starkes rotes Licht wie von einem Schmiedefeuer. Es kam nicht nur von einer Laterne – es drang grell ins Dunkel hinaus, durch die Wagenfenster und die Tür und sogar durch die Ritzen zwischen den Brettern.«
»Ah.« Binabik ließ es jetzt gut sein. »Irgendeine üble Hexerei zweifellos. Das macht mir noch mehr Angst um unsere Freunde auf dem Hochhorst.«
»Hexerei, genau!«, sagte Yem Suju fast schon triumphierend. »Wie ich gesagt habe! Dieser Mann weiß, dass ich es wirklich gesehen habe.«
Seine Frau schüttelte den Kopf, widersprach aber nicht.
Sisqi nahm den Topf vom Feuer, ließ den Inhalt etwas abkühlen und bot dann allen davon an. Sie selbst nahm sich nicht viel, weil sie sichergehen wollte, dass Binabik eine ordentliche Portion bekam.
Han Goda und seine Familie blieben in jener Nacht im Lager der Trolle und schliefen eng zusammengedrängt nah am Feuer. Mäntel schienen die Niskies nicht zu haben, und als sie sich am Morgen von ihren Gastgebern verabschiedeten und sich wieder auf den Weg durch den Wald nach Norden machten, schüttelte Sisqi besorgt den Kopf.
»Ich fürchte für sie. Der Winter ist nah, und sie sind nicht dafür gekleidet.«
Binabik war schon seit dem Aufwachen still gewesen und hatte sein Schweigen nur gebrochen, um den Gästen eine gute Reise zu wünschen. Jetzt ergriff er die Hand seiner Frau. »Ich mache mir auch Sorgen um sie, aber sie haben ihr Schicksal wenigstens selbst in die Hand genommen. Was sie da erzählt haben, ist allerdings sehr beängstigend. Ein Nornenheer! Angeführt vielleicht sogar von der Königin persönlich und auf dem Weg nach Süden, zum Hochhorst – zu Simon und Miriamel.«
»Das war schon vor vielen Tagen«, gab Sisqi zu bedenken. »Und selbst zu so vielen ziehen die Nornen schnell. Wir können nicht hoffen, die Burg vor ihnen zu erreichen. Schon gar nicht, solange dein Bein noch heilen muss.«
»Mag sein.« Binabik mühte sich auf die Beine. Sisqi wollte ihn am Ellbogen stützen, aber er entzog sich ihr. »Ich kann mich nicht länger wie ein krankes Kind benehmen. Du hast recht, Liebste, wir können nicht hoffen, vor ihnen dort zu sein, aber wir müssen ihnen folgen, so schnell wir können.«
»Warum?«, fragte sie. »Mein lieber Ehemann, ich weiß, du hast Simon gern. Wir mögen ihn beide sehr und Miriamel auch. Aber was können zwei Qanuc wie wir gegen eine Armee von Tausenden ausrichten?«
»Sie besiegen natürlich nicht. Aber vielleicht können wir ja etwas anderes tun, und das werden wir erst wissen, wenn wir dort sind. Wenn wir wissen, dass Freunden solches Unheil droht, können wir doch nicht einfach nichts tun.«
Sisqi schwieg eine ganze Weile. »Und unser eigenes Kind?«, sagte sie schließlich. »Sie ist immer noch mit Klein-Snenneq in diesem Wald unterwegs, auf der Suche nach Prinz Morgan. Was ist mit ihnen?«
»Sie sind beide klug und tapfer«, sagte Binabik. »Wir haben doch schon unseren Frieden damit gemacht, sie allein zu lassen. Und selbst wenn wir es versuchen würden, wir könnten sie jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr finden – es ist fast einen Monat her, dass wir uns getrennt haben.«
»Dann lassen wir also unser eigen Fleisch und Blut hier im Wald zurück, um einer Armee zu folgen, die wir unmöglich schlagen können?«
»Nenn mir eine andere Möglichkeit«, sagte Binabik, der trotz der frühen Stunde jetzt schon müde aussah. »Nenn mir eine, und wir werden sie zusammen erwägen, meine liebe Frau.«
Aber Sisqi fiel keine andere Möglichkeit ein. Schweigend packten sie ihre wenigen Habseligkeiten zusammen und machten Widder und Wölfin reitfertig.
◆
Die starke Strömung des T’si Suhyasei verlangsamte sich, als der Fluss sich verbreiterte, und Tanahaya konnte endlich ans Ufer schwimmen. Dort legte sie sich in ein Fleckchen von schwacher Wintersonne, um sich auszuruhen und zu trocknen. Beides war noch längst nicht getan, als ein Gefühl der Verletzlichkeit sie dazu trieb, sich aufzusetzen und umzublicken. Jeder, der auf dem Fluss vorbeikäme, könnte sie sehen, und sie war nur etwa eine halbe Meile von Da’ai Chikiza und seiner Besatzung von Opfermutigen-Soldaten entfernt. Sie zwang sich, aufzustehen und sich ein besseres Plätzchen zum Ausruhen zu suchen.
Sie konnte sich kaum vorstellen, dass ihresgleichen einst an diesem wilden, trostlosen Ort gelebt hatten. Sie drang tiefer in das grüne Schattendunkel vor, bis sie sich sicher fühlte, doch selbst in dieser Entfernung vom Herzen Da’ai Chikizas sah sie noch Stücke zerbrochener Steinfliesen im Moos unter ihren Füßen schimmern.
Noch keine zehn Großjahre ist es her, dass sich die Stadt namens Baum des Singenden Windes geleert hat, sinnierte sie traurig, aber wenn man nicht genau hinsieht, käme man nie auf die Idee, dass mein Volk einmal hier gelebt hat, dass es geliebt und gefeiert und Gedichte verfasst hat, die noch heute in unserem Denken nachhallen.
Sie zog sich aus, wrang ihre Kleider aus, so gut sie konnte, und zog sie dann wieder an, beschloss aber, ihre Stiefel erst einmal trocknen zu lassen. Es wurde dunkel, was hieß, dass die Soldaten aus der besetzten Stadt bald auf Patrouille gehen würden, und sie war müde bis in jeden Muskel und jede Sehne. Sie entschied sich dafür, sich an einem sicheren, versteckten Plätzchen bis zum Morgen auszuruhen. Außerdem hatte sie schon während des ganzen letzten Tags und der letzten Nacht ihrer Suche nach Morgan ein Gedanke umgetrieben, aber da war die Gefahr zu groß gewesen, als dass sie ihm richtig hätte nachgehen können.
Tanahaya war zu methodischem Denken erzogen worden, zuerst von ihrer leidenden, aber klugen Mutter und dann von der Schwester ihres Vaters, die in jungen Jahren eine Schülerin Meister Himanos gewesen war. Das hatte dazu geführt, dass Tanahaya selbst Schülerin des hochgeschätzten Gelehrten von den Blühenden Hügeln geworden war – und ihre ersten Schritte auf einem Weg getan hatte, der ihr damals so beliebig vorgekommen war, jetzt aber unausweichlich erschien.
Himanos Methode zu denken begann damit, den eigenen Körper und Geist so ruhig werden zu lassen wie einen glatten Teich. Erst wenn diese Ruhe erreicht war – er hatte das den »Frieden des Sammlers« genannt –, war es wirklich möglich, einen einzelnen Gedanken zu verfolgen. Tanahaya selbst stellte sich die schwer zu fassenden Gedanken inzwischen als winzige Fische vor, die im Gewirr der Teichpflanzen umherschwammen, in Schatten eintauchten und wieder hervorkamen.
Aber diese entscheidende Ruhe zu finden, war schwer, zumal, wenn man gerade dem Tod durch Pfeile oder Ertrinken entronnen war. Tanahaya war zutiefst beunruhigt wegen des jungen Morgan und wünschte, sie könnte weiter nach ihm suchen, aber sie musste auch berücksichtigen, was das Beste für das Kind war, das in ihr wuchs, das kostbare, heilige Leben, das sie und Jiriki gezeugt hatten. Und noch mehr war sie wegen Himanos Pergament beunruhigt und dem, was es über den Hochhorst und die Hexenholzkrone sagte – und was sie Jiriki mitgeteilt hatte, unmittelbar bevor ihr die Kontrolle über den Zeugen entrissen worden war. So viele Dinge, die angegangen werden wollten, alte und neue – es kam ihr so vor, als ob ungeduldige Stimmen sie von allen Seiten riefen und ihre Aufmerksamkeit forderten.
Ruhe, rief sie sich in Erinnerung, finde Ruhe. Lass die Wellenringe sich verlaufen, hatte Meister Himano immer gesagt. Erst dann kannst du den Grund sehen.
Ihr Lehrer war der Erste gewesen, der ihr erklärt hatte, dass Denken genauso wichtig sei wie alles, was sie sonst tun könnte, so wichtig wie zu kämpfen, wie Liebe zu finden, wie Leben zu schenken. Das schien eine sehr zugespitzte Formulierung zu sein, jetzt, da ein Kind in ihr wuchs, aber die Lehre ihres Meisters galt immer noch, so schwer sie auch umzusetzen sein mochte.
Ruhe. Lass das Wasser ruhig werden.
Sie hatte kaum Zeit gehabt, über all das nachzudenken, was in jüngerer Zeit passiert war, und irgendwo in dieser Masse von unbearbeitetem Erleben versteckte sich ein irritierendes kleines Etwas, ein Fremdkörper, wie das Sandkorn, um das sich eine Perle bildet. Es hatte sich schon bemerkbar gemacht, während sie sich aus den Säulentrümmern der Stätte der Himmelsbeobachtung befreit hatte, und es war auch da gewesen, als sie Morgans Geruchsfährte durch die Ruinen von Da’ai Chikiza gefolgt war und sich vor Opfermutigen-Patrouillen versteckt hatte. Doch obwohl es sie jetzt schon eine ganze Zeitlang irritierte, konnte sie immer noch nicht sagen, was es war. Aber Tanahaya wusste: Wahre Ruhe würde sie erst finden, wenn sie herausbekommen hatte, was dieses störende Sandkorn war.
Warum hatten die Hikeda’ya Himano getötet? Um ihn zum Schweigen zu bringen, das schien klar – warum sonst sollte man jemanden töten, der kein Krieger war, dessen Bedeutung in seiner Weisheit lag? Dass all die Bücher im Haus ihres Meisters verbrannt worden waren, deutete doch wohl auf einen solchen Grund hin – es war ein Glück, dass er das Pergament über die Hexenholzkrone noch hatte retten können, ehe sie ihn töteten. War es dieses Wissen, das Utuk’ku fürchtete? Doch selbst wenn die Herrin von Nakkiga nicht wollte, dass die Existenz von Hexenholzsamen ans Licht kam, ehe sie diese an sich gebracht hatte, erklärte das doch noch nicht, warum so viele Opfermutigen-Soldaten nach Da’ai Chikiza geschickt worden waren, um eine Stadt einzunehmen, die so gut wie verlassen war. Oder war Da’ai Chikiza gar nicht Utuk’kus Eroberungsziel, sondern nur eine Zwischenstation?
Der Fisch, den sie durch die Wasser ihrer Erinnerung verfolgt hatte, war wieder in einer Gruppe ähnlicher schwimmender Wesen aufgegangen.
Ich schaffe es nicht, Ruhe zu finden, stellte sie traurig fest. Ich muss das Rätsel loslassen, bis der rechte Moment gekommen ist. Sie seufzte, nahm Himanos Pergament aus dem Öltuch, in das sie es in Da’ai Chikiza eingewickelt hatte, und dankte den wachsamen Sternen des Verlorenen Gartens dafür, dass sie es beim Angriff der Hikeda’ya am Körper getragen hatte. Sonst läge es jetzt unter den Trümmern der Stätte der Himmelsbeobachtung, für immer unter herabgebrochenem Stein begraben wie Vinyedu und so viele der Reinen.
Tanahaya hatte nicht viel Zeit mit dem Studium von Hikeda’ya-Chroniken verbracht, aber Vinyedu hatte gesagt, das Siegel sei das von Utuk’ku, was bedeutete, dass die Herrscherin von Nakkiga dieses Dokument gesehen und dann ins Archiv hatte überstellen lassen. Sie hielt das Pergament vor die Spätnachmittagssonne, um es auf eine eventuelle versteckte Geheimschrift zu prüfen, und studierte es dann systematisch auf jede kleinste Hinzufügung hin, angefangen mit der persönlichen Rune der Königin und weiter mit jedem einzelnen, kaum leserlichen Vermerk irgendeines Klerikers, der mit seiner Einordnung in die Bestände des Archivs von Nakkiga befasst gewesen war. Vinyedu hatte bestätigt, dass es echt war und aus der weit zurückliegenden Zeit des Zehnten Zelebranten stammte.
Plötzlich sprang ihr etwas ins Auge. Ihr Blick war schon öfter darüber hinweggeglitten, aber jetzt fragte sie sich plötzlich, ob sie das Ganze von der falschen Seite angegangen war. Als sie es noch einmal genau inspizierte, regte sich etwas in ihrem Gedächtnis, und es folgte ein Schock, Bestürzung. Es erschien als so unwirklich. Konnte es sein, dass sie, Tanahaya, die bloße Schülerin eines Gelehrten, als Einzige dieses seltsame Detail bemerkt hatte, während es sowohl ihrem Lehrer als auch der berühmten Gelehrten Vinyedu entgangen war?
Wenn ihr Verdacht richtig war, ergaben sich daraus so viele schreckliche Möglichkeiten, dass es jetzt noch als viel bedeutsamer erschien, wohin sie sich von hier aus wandte. Sie wünschte sich verzweifelt, mit Jiriki über ihre Befürchtungen reden zu können, aber sie hatte ja keine Ahnung, wo er war, und Vinyedus Zeuge lag unter einer Masse von Steintrümmern begraben. Konnte sie eine andere Möglichkeit finden, mit ihm zu sprechen?
Anvi’janya. Jetzt, da Da’ai Chikiza von Hikeda’ya überrannt ist, ist diese Stadt in den Bergen meine beste Chance. Das Ende des alten Großjahres war nahe – der Geruch der Winterluft sagte ihr, dass es kaum mehr als zwanzig Tage bis zum Erscheinen der Jahresfackel sein konnten –, und da ihr Volk Jao é-Tinukai’i aufgegeben hatte, würde die Feier diesmal in Anvi’janya stattfinden. Das uralte Jahrtanz-Ritual hatte jetzt, da es praktisch kein Hexenholz mehr gab, nicht mehr eine so große Bedeutung, aber Tanahaya wusste, es würden viele von ihren Leuten dort sein, darunter auch Gelehrte und Zelebranten. Und vor allem befand sich in Anvi’janya eins der letzten intakten Archive zur Geschichte ihres Volkes, wo sie vielleicht Antwort auf die Fragen, die sie quälten, finden konnte.
Aber Anvi’janya lag viele Meilen nördlich von da, wo sie jetzt war, und sie hatte kein Pferd. Kurz dachte sie daran, einer Opfermutigen-Patrouille ein Pferd zu stehlen, aber das schien ein so törichtes Risiko zu sein, dass sie die Idee rasch wieder verwarf. Niedergeschlagen wickelte sie Himanos Pergament wieder in das Öltuch.
Seit vor dem Angriff auf Da’ai Chikiza hatte Tanahaya keine ganze Stunde geschlafen. Sie fand ein Plätzchen in einer Erdmulde ein Stück vom Fluss entfernt und suchte sich einen herabgefallenen Ast mit vielen gelben Blättern daran. Sie wickelte sich in ihren Mantel, legte sich hin und zog den Ast über sich. So würde niemand sie sehen, wenn er nicht ganz nah herankam.
Noch immer tief besorgt, den Kopf voller verwirrender, beängstigender Gedanken und niedergedrückt von der Last ihrer eigenen Unzulänglichkeiten, gab sie schließlich doch der Erschöpfung nach und sie schlief ein.
Als sie aufwachte, war die Sonne schon da, winterlich und fern. Tanahaya ging an den Fluss hinunter, um Wasser zu trinken. Sie war einen Gutteil des Vortags von der Strömung des Kaltblutflusses dahingeschwemmt worden und hatte es deshalb nicht nötig, sich zu waschen. Also musterte sie beide Ufer gründlich, kniete sich dann hin und trank, bis sie genug hatte. Als sie gerade wieder zu ihrem Schlafplatz hinaufsteigen wollte, fiel ihr etwas ins Auge. Das matschige Ufer war mit Tierfährten überzogen – offensichtlich war es ein vielbenutzter Wildwechsel –, und es waren Spuren verschiedener Tiere, aber die Trittsiegel, die am frischesten schienen, waren erstaunlich groß und tief, die Spuren eines sehr großen Hirschs, die Abdrücke der halbmondförmigen Vorderzehen und der Afterzehen zusammen jeweils so lang wie ihre Hand von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk.
Das brachte sie auf eine Idee, und sie ging ihre Packtasche holen. Rasch verwischte sie alle Spuren ihrer Anwesenheit am Boden, kehrte dann zu der Fährte zurück und folgte ihr tiefer in den Wald.
Schon bald fand sie frische Losung, was sie ermutigte, und sie ging weiter, bis sie auf eine Lichtung stieß, die von einer riesigen Eiche dominiert wurde. Deren Rinde wies frische Fegespuren von einem Geweih auf, und diese befanden sich so hoch überm Boden, dass sie sicher war, das Tier gefunden zu haben, das sie suchte, und dass es groß genug für ihre Zwecke sein würde. Tanahaya erklomm den Baum bis zum Sechs- oder Siebenfachen ihrer Körpergröße, machte es sich auf einem Ast bequem und wartete dann mit der ganzen Geduld, die eine Zida’ya-Gelehrte aufbringen konnte, und die war beträchtlich.
Endlich, als die Sonne dem Mittagspunkt entgegenstieg, hörte sie etwas Großes durch den Farn am Rand der Lichtung nahen. Sie nahm ihr aufgerolltes Seil in die Hand und hielt den Atem an. Sie war immer noch keine zwei Meilen außerhalb der Ruinen von Da’ai Chikiza, also konnte das Geräusch auch von einer umherstreifenden Opfermutigen-Patrouille kommen. Sie roch zwar keine Soldaten, aber wenn sie sich täuschte, wäre sie in schrecklicher Gefahr. Dennoch, sie musste schneller nach Hoch-Anvi’janya gelangen, als es ihr zu Fuß möglich war, also musste sie das Risiko eingehen.
Schließlich trat zu ihrer enormen Erleichterung ein mächtiger Hirsch aus den Bäumen hervor. Sein rötliches Fell war winterlang und mit Grau durchsetzt, und er hatte ein majestätisches Geweih. Tanahaya jubelte im Stillen.
Der Hirsch mochte sie gewittert haben oder war vielleicht auch einfach nur vorsichtig, nachdem er auf vergleichsweise freies Gelände herausgetreten war: Er erstarrte, nur die Ohren zuckten, und Tanahaya wählte diesen Moment, um ihm eine Seilschlinge übers Geweih fallen zu lassen. Das erschrockene Tier schnaubte laut und versuchte sofort zu flüchten, doch sobald die Schlinge das ausladende Geweih erfasst hatte, befestigte Tanahaya das Seil am Stamm des Baums und kletterte dann schnell auf den Boden hinab, während der Hirsch sich aufbäumte und gegen das Seil ankämpfte. Den Feind jetzt vor Augen, schlug das Tier mit den Hufen, aber Tanahaya blieb außerhalb seiner Reichweite. Sie wusste, sie musste schnell machen, es war spät im Jahr, und der Hirsch war vielleicht bald schon so weit, sein Geweih abzuwerfen, daher war es womöglich nicht mehr stabil. Sie hatte nicht stundenlang auf einem Baum gesessen, um ihre Beute entkommen zu lassen, also ging sie vorsichtig näher heran und schaffte es, dem Tier eine weitere Schlinge des Seils um die Hinterbeine zu legen. Sie zog diese zu, sodass die Sprünge des Hirschs immer kleiner, wenn auch nicht weniger wild wurden. Nach kurzem, aber kraftraubendem Bemühen gelang es ihr, das Seil um den Stamm eines anderen Baums zu binden, und sie wartete, während der Hirsch weiterkämpfte.
Tanahaya begann zu singen. Es war kein besonders mächtiger Gesang – kein Befehl oder auch nur etwas Spezielles zur Beeinflussung von Tieren –, sondern lediglich ein beruhigendes Lied, das sie von der Schwester ihres Vaters gelernt hatte, und sie sang es immer wieder von vorn. Sei es wegen des Gesangs oder einfach, weil er ermattet war – schließlich gab der Hirsch seine heftige Gegenwehr auf. Sie band das andere Ende des Seils los, ging dann um das gefangene Tier herum und sang noch immer in der uralten Sprache des Gartens.
Äste wachsen, Blätter werden,
Sprosse sprießen aus der Erden,
Das ist alles, was wir wissen,
die wir leben im Dazwischen.
Die in des Lebens kurzem Glühn
Ermüden von des Kämpfens Mühn
Das sieht die Sterne steigen leis,
Wir sind, und endet es, wer weiß.
Wir harren unterm Himmelskreisen
Des Wimpernschlags des kurzen, leisen,
vom letzten bis zum ersten Schimmer,
so bald sind wir und so bald nimmer.
So früh sind wir und unser Sang,
So spät sind wir und sind so lang,
So schwach sind wir, so stark dabei,
Wir singen, damit alles sei.
Wir singen, damit Blätter werden
Und Sprosse sprießen aus der Erden …
Langsam umkreiste sie den unglücklichen Hirsch, und sooft sie am Ende des Lieds ankam, begann sie von Neuem. Sie wusste nicht, wie oft sie es gesungen hatte, als das erschöpfte Tier schließlich aufgab und in seinen Fesseln erschlaffte, mit hängender Zunge und bebenden Flanken.
Tanahaya näherte sich ihm vorsichtig, die Hufe und das mächtige Geweih fest im Blick, für den Fall, dass der Hirsch sich wieder zu wehren begann. Doch er rollte nur verzweifelt mit den Augen, als sie die Hand ausstreckte und sie ihm auf die Stirn legte. Er erschauerte unter ihrer Berührung, noch immer voll Furcht, also begann sie einen neuen Gesang, einen leiseren, mit Worten, die so alt waren, dass nicht einmal Tanahaya wusste, was sie bedeuteten. Sie legte ihm die Hand über die Augen und sang weiter, bis der mächtige Hirsch sich schließlich nicht mehr sträubte.
Es war wohl der größte Hirsch, den Tanahaya je gesehen oder von dem sie auch nur gehört hatte, seine Schulter war auf Höhe ihres Kopfs. Sie tat ihr Bestes, seine Gedanken zu erspüren, und während sie leise weitersang, fühlte sie sogar etwas von seinen Gefühlen – Wut und Angst – und auch ein bisschen von seiner Geschichte.
»Du bist alt, aber immer noch stark«, flüsterte sie ihm zwischen Liedstrophen ins Ohr. »Hab keine Angst – ich tu dir nichts. Ich brauche nur deine Hilfe. Hilf mir, und ich werde dich wieder freilassen.« Sie fühlte eine Abwehr, nichts in Worte Fassbares, nur einen Schub von Widerstand, und sie konnte nicht umhin, die Entschlossenheit des Tiers zu bewundern.
»Du hast viele Kämpfe gekämpft – das fühle ich«, sagte sie ruhig. »Du hast dich nie in irgendetwas ergeben, und du wirst immer schnell wütend. Jetzt, da du durch meinen Gesang gebunden bist, nenne ich dich ›Streit‹, und solange du mit mir unterwegs bist, wird das dein Name sein.« Sie sang noch ein bisschen weiter, die Hand weiterhin auf dem Kopf des Tiers zwischen den mächtigen Geweihstangen. Schließlich fiel es erschauernd vor ihr auf die Knie. Sie befreite seine Hinterbeine von diesem Ende des Seils und machte dann aus dem Teil, der sein Geweih festgehalten hatte, ein improvisiertes Reitgeschirr, mit einer Schlinge um den breiten Hals und einer weiteren hinter den Vorderbeinen. Sie stieg auf den Rücken des Hirschs. Sie fühlte, wie sich der mächtige Brustkorb unter ihr blähte und zusammenzog.
»Auf, Streit.« Sie zog sachte an dem neuen Reitgeschirr. Der Hirsch schnaubte wieder, aber es klang mehr nach Erschöpfung als nach Widerstand. »Nun gut«, sagte sie. »Ruh dich noch ein bisschen aus.«
Sie sang wieder ihren Beruhigungsgesang. Als sie das Gefühl hatte, dem Hirsch genug Zeit gegeben zu haben, zu Kräften zu kommen, befahl sie ihm aufzustehen. Er tat es, und sie wurde schwankend in eine Höhe gehoben, wie sie sie im Sattel eines Schlachtrosses erreicht hätte.
»Jetzt zeige ich dir, wo du hinlaufen sollst.« Sie zog sachte am Geschirr, und der große Hirsch drehte sich ein wenig nach der betreffenden Seite. »Gut«, sagte sie und berührte seinen Brustkorb sanft mit den Fersen. »Lauf, Streit!«
Das mächtige Tier jagte los, mit Tanahaya, die sich an seinem Rücken festklammerte, durch den Wald nordwärts in Richtung Hoch-Anvi’janya.
23
Eine Lektion und ihre Folgen
Morgan spürte mehr, als dass er sie hörte, die leisen Schritte gleich außerhalb des Eibenstamms – Nornensoldaten auf der Suche nach Überlebenden ihres Angriffs auf Da’ai Chikiza, wie er einer war. Doch es fiel ihm schwer, der Gefahr die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Das lag daran, dass er und die Nornendeserteurin Nezeru in diesem hohlen, alten Eibenstamm so hinabgerutscht waren, dass sie jetzt darin festklemmten, Gesicht an Gesicht und Körper an Körper.
Morgan wusste, ihre Lage könnte nicht prekärer sein, hätten sie sich in ein Fass einnageln und mitten in ein feindliches Lager rollen lassen. Sein Herz raste vor Angst, doch gleichzeitig war er sich Nezerus Körpers an seinem und ihres Atems an seiner Wange – sie roch nach wildem Süßholz – nur allzu bewusst, fürchtete aber, jede Bewegung, um den Kontakt etwas weniger eng zu gestalten, könnte sie beide noch tiefer in den Stamm hineinrutschen lassen.
Wir könnten hier endgültig festsitzen, dachte er. Wir könnten in dieser alten Eibe gefangen bleiben, bis wir nur noch Skelette sind.
Schließlich flüsterte sie: »Ich höre sie nicht mehr. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen.«
Sie mühten sich, fanden aber in dem bröckeligen, weitgehend toten Baumstamminneren nicht genug Halt, um sich aus ihrer Zwangslage zu befreien, und das ganze Rangeln führte nur dazu, dass Morgan noch abgelenkter war. Nezeru war schlank, aber ihre Muskeln fühlten sich so hart an wie Holz, und das erinnerte ihn wieder an ihre kämpferischen Fähigkeiten, ihre Schnelligkeit und Beweglichkeit.
»Hör auf«, flüsterte sie rau. »Wir sind zu laut. Und du machst mir ein komisches Gefühl.«
»Ich dachte, du hörst sie nicht mehr.«
»Ja, aber ihr Gehör ist so fein wie meins, und wenn wir genug Lärm machen, wird ihn jemand hören.«
Jetzt erst kam bei ihm an, was sie gesagt hatte. »Was meinst du mit ›komisches Gefühl‹?«
»Dieses ganze Reiben. Es bewirkt, dass ich mich paaren will. Also sei jetzt still und beweg dich nicht.«
Paaren? Bedeutete das, was er glaubte, dass es bedeutete? Jetzt konnte Morgan gar nicht umhin, daran zu denken, und das Ergebnis zog wiederum Nezerus Aufmerksamkeit auf sich.
»Was ist das?«, flüsterte sie. Es klang ärgerlich.
»Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte er.
»Das.« Sie schob die Hand zwischen ihre Körper und drückte ihn.
»Oh. Oh, beim Erlöser.« Die Unkontrollierbarkeit des Gefühls wurde noch dadurch verstärkt, dass er sich der Berührung in dem Eibenstamm nicht entziehen konnte. »Tu das nicht!«
»Warum?« Sie klang aufrichtig überrascht. Sie drückte wieder zu. »Tut das weh?«
»Aaah!«
»Ich hab doch gesagt, sei still.«
»Dann lass das!«
Langsam zog sie ihre Hand wieder weg. »So viel Getue wegen eines nei«, sagte sie, aber sie klang eher spöttisch als unwirsch.
»Was heißt das – nei?«
»Das kannst du dir ja wohl denken. Aber das Wort bedeutet ›Wurzel‹.«
»Hast du nicht gesagt, dein Schwert heißt ›Kaltwurz‹?«
»So heißt es auch.«
»Das ist … ganz schön merkwürdig.«
Sie lachte, nahezu lautlose kleine Luftstöße an seinem Ohr. »Sei leise, Sterblicher. Der Name des Schwerts beruht auf einer anderen Bedeutung des Worts, das ist alles. Haben Wörter in eurer Sterblichensprache nicht auch manchmal mehr als nur eine Bedeutung?«
»Doch. Lass uns nicht mehr davon sprechen.« Das Problem, das ihr enger Körperkontakt verursacht und Nezerus zupackender Umgang damit noch verschärft hatte, bestand weiterhin. »Wenn wir noch leise weiterreden können, erzähl mir, warum du die Nornen verlassen hast.«
Jetzt schwieg sie eine ganze Weile. »Ich wollte, ich könnte sagen, dass sie mich verlassen haben«, sagte sie schließlich, »dass meine guten Absichten gegen mich gewendet wurden – denn zumindest zum Teil stimmt das. Aber wichtiger noch ist, dass ich blind war, als ich alles klar zu sehen glaubte.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Dann schätze dich glücklich, junger Sterblicher, und bete zum Garten, dass du nicht das Gleiche eines Tages auch erkennen musst.«
Morgan ignorierte das beleidigende »junger Sterblicher« – jetzt, da er erfahren hatte, dass sie nicht älter war als er, traf es ihn nicht mehr so. Er wusste, was der Verlorene Garten war, weil Tanahaya davon gesprochen hatte, aber er verstand trotzdem nicht recht, was Nezeru meinte. Blind, wenn man denkt, man sieht? Doch dann dachte er daran, wie viele Gewissheiten ihm abhandengekommen oder regelrecht geraubt worden waren, seit er den Hochhorst verlassen hatte, und er befand, dass er das, was sie da beklagte, vielleicht doch ein bisschen nachvollziehen konnte. »Wir lernen alle dazu«, sagte er. »Dafür braucht man sich doch nicht zu schämen.«
»Nein, aber es kann beschämend sein zu wissen, was man getan hat, während man die Wahrheit immer noch verleugnet hat.«
»Welche Wahrheit?« Die Ablenkungsstrategie schien zu funktionieren. Seine Erregung legte sich, und er war begierig darauf, zu hören, wie diese Nornenkriegerin ihre innersten Gedanken offenlegte.
»Die Wahrheit, dass ich dazu erzogen wurde, nicht selbst zu denken. Dass man mir seit meiner Kindheit auf alle zweifelnden Fragen die immergleichen simplen Antworten gegeben hat und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass simple Antworten oft schlechte Antworten sind.«
»Deine Oberen haben dich betrogen.«
»Aber sie wurden selbst auch betrogen. Wir wurden alle dazu erzogen, unsere Königin für unfehlbar zu halten, und ein Teil von mir glaubt immer noch, dass sie es vielleicht wirklich ist. Aber inzwischen ist mir klar, dass, so weise unsere unsterbliche Königin auch sein mag, ihre Unterlinge allemal fehlbar sind. Manche interessiert nur ihr eigener Aufstieg. Manche haben solche Angst, falsch zu liegen, dass sie töten würden, um ihre Ignoranz aufrechtzuerhalten.«
Morgan fand, das klang wie die Umstände an jedem Hof in Osten Ard, sogar an dem seiner Großeltern, obwohl er bezweifelte, dass irgendjemand von den Höflingen dort fähig wäre zu morden. Warum sollten sie auch? Die Adligen hatten doch alles, was sie wollten – Land, Bedienstete, Ruhm und Ehre. Was brauchte denn irgendjemand noch?
Es war so gut wie stockfinster in dem Baum. Nezeru schwieg, und er fragte sich, ob sie es bereute, ihm von ihren Zweifeln erzählt zu haben.
»Warum küssen sich Sterbliche?«, fragte sie.
Mit dieser Frage hatte er nicht gerechnet. »Küssen? Wieso? Küssen sich Nornen nicht?«
»Wenn du Hikeda’ya meinst, doch, aber nur in der Liebe. Nach dem, was ich gehört habe, küssen Sterbliche andauernd so ziemlich alle, Alte, Junge, Männlein, Weiblein. Ich habe gehört, manche küssen sogar Hunde und Pferde.« Sie lachte wieder lautlos.
Er fühlte ihre Brust an seinem Brustkorb beben.
»Hast du schon mal jemanden geküsst?«, fragte sie.
»Guter Gott, ja, klar.«
»In der Liebe?«
Er atmete tief durch. Wo er sich gerade wieder unter Kontrolle hatte …!
»Ja, in der Liebe. Aber auch Großeltern, Eltern, Freunde. Es gibt viele Arten von Küssen. Manche sind einfach nur eine Form der Begrüßung, andere sind Ausdruck von Respekt, wenn man zum Beispiel einem Bischof den Ring küsst.«
»Ring?«
»Es heißt genau das, was es heißt«, sagte er ein bisschen knurrig. »Oder bedeutet es in der Nornensprache noch was anderes? Ich meine einen Ring am Finger.«
»Nein, nein, ich verstehe schon.« Sie schwieg wieder kurz. »Kannst du mir zeigen, wie Sterbliche küssen?«
Jetzt war es Morgan, der eine Weile nichts sagte. Er schämte sich immer noch für seinen Fehler Tanahaya gegenüber. »Du meinst, ich soll dich küssen?«
»Ist das falsch? Bist du einer anderen versprochen, oder küsst du lieber andere Männer? Oder findest du Hikeda’ya einfach widerlich?«
»Nein! Ich meine, ich weiß nicht. Ja, ich finde die Mitglieder deines Volks, die mich umbringen und meine Familie töten wollen, widerlich, wie du es ausdrückst. Aber du hast mir das Leben gerettet, und ich … ich nehme an, wir sind Verbündete, wenn nicht sogar Freunde.«
»Nein«, sagte sie schnell. »Freunde nicht. Aber Verbündete, jedenfalls im Moment.«
Das gefiel ihm nicht sonderlich, doch er war nicht in der Position, Streit anzufangen. »Aber warum? Warum soll ich dich dann küssen?«
»Weil ich neugierig bin. Ich habe schon mal einen Sterblichen geküsst, und es war … seltsam.«
»Ach, dann bin ich nicht dein Erster?« Er amüsierte sich selbst über diesen kleinen Eifersuchtsstich. Du bist wirklich verrückt, Morgan, sagte er sich, in einem solchen Moment so zu empfinden. »Warum hast du einen Sterblichen geküsst? Gott, du hast ihn doch nicht getötet, oder?«
»Nein. Sei nicht albern. Das wäre Zeitverschwendung.« Aber sie erklärte ihm nicht, warum. »Ich war eine Zeitlang mit einem Sterblichen unterwegs. Er brachte mich mit seinen vielen Fragen durcheinander und bewirkte, dass ich an Dingen zweifelte, derer ich mir ganz sicher gewesen war. Ich fühlte mich wohl auf eine seltsame Art zu ihm hingezogen, obwohl ich ihn hätte hassen sollen.« Sie zögerte, und als sie weitersprach, war ihr Flüstern schroffer. »Ich hasse ihn auch – aber nicht wegen seiner Fragen.« Sie schüttelte den Kopf, was er nicht sah, sondern spürte. »Aber ich will nicht über ihn sprechen. Er hat mich geküsst, aber sein Herz war nicht dabei, wie wir sagen.«
»Das sagen wir auch. Aber warum hat es dich überrascht, dass ein Sterblicher, dein Feind, es nicht genossen hat, dich zu küssen?«
»Weil ich nicht dachte, dass er so wäre. Ich dachte, dass ich etwas in ihm spürte …« Sie verstummte kurz. »Ich hatte mich getäuscht, das ist mir jetzt klar. Aber trotzdem frage ich mich immer noch, ob ihn irgendetwas an mir abgestoßen hat. Jetzt verstehst du wohl, warum ich neugierig bin.«
In so vielerlei Hinsicht schien es eine schreckliche Dummheit zu sein, aber Morgan war klar, dass dies eine einmalige Situation war, eine Gelegenheit, die vielleicht nie wiederkommen würde.
Was kann schon passieren?, fragte er sich. Wenn sie mich totbeißen wollte, hätte sie es schon ein Dutzend Mal tun können. »Komm mit deinem Gesicht näher an meins«, sagte er nur.
Sie tat es, und zum ersten Mal spürte er ein Zögern in ihren sonst so forschen Bewegungen: Sie näherte sich ihm sehr viel vorsichtiger, als sie zuvor nach seiner Männlichkeit gegriffen hatte. Sie roch nicht nur nach Süßholz, sondern auch nach Kiefernharz und anderen Dingen, die er nicht genau identifizieren konnte, aber nichts davon war unangenehm.
»Zeig mir, was du mit diesem Sterblichen gemacht hast.« Morgan sprach noch leiser, jetzt, da sich ihre Köpfe so nah waren.
»Ich sagte doch, es schien ihm nicht zu gefallen –!«
»Psst. Es ist ein Fehler, zu viel zu reden, wenn man jemanden küsst. Es lenkt ab. Und es könnte dazu führen, dass jemand aus Versehen gebissen wird.«
»Wenn du mich beißt, Sterblichenjunge, beiße ich zurück!«
Er ignorierte es. »Näher.« Und dann presste er seine Lippen vorsichtig auf ihre.
Im ersten Moment war es, als küsste er eine scheue Schäferin oder ein unerfahrenes Kammermädchen. Ihr Mund empfing seinen, als erwartete sie, dass er sie fütterte wie ein Vogeljunges. Doch dieser nicht sehr erotische Gedanke hielt nur kurz an, dann wurde ihr Mund weicher, und ihre Lippen bewegten sich unter seinen. Gleich darauf fühlte er, wie ihre Zunge sich zwischen seinen Zähnen hindurchschob, und er hätte beinah überrascht aufgelacht. Ganz ohne Lerneffekt war Nezerus vorherige Begegnung mit einem Sterblichen offenbar nicht gewesen.
Und dann wurde der Kuss zu etwas, das mehr war als nur Unterweisung, wenn auch kein Wort gefallen war. Sie presste ihren Körper noch enger an seinen, obwohl sie sich durch die Umstände schon fast so nah gewesen waren, wie zwei Menschen sich nur sein konnten, und begann dann, ihren Bauch auf eine schläfrige, fast schon traumverlorene Weise an seinem zu reiben, immer auf und ab. Und bald drängte auch ihr Unterleib gegen seinen, und er merkte, wie er reagierte.
Was will sie?, fragte er sich. Ist ihr nicht klar, was sie mit mir macht? Aber einen weichen Mund an seinem zu fühlen und zu schmecken, war etwas, was ihm schon eine ganze Zeitlang nicht mehr zuteilgeworden war, und er merkte jetzt erst, wie sehr er es vermisst hatte.
Nezeru war inzwischen in einen regelmäßigen Rhythmus verfallen, nutzte das ganze bisschen Raum, das ihnen blieb, um ihr Becken an seinem zu bewegen. Wenn unsere Hosen nicht wären, dachte er, müsste ich sie jetzt vor dem Risiko warnen, den Bastard eines Prinzen aufziehen zu müssen. Sie schien einen Höhepunkt der Erregung zu erreichen, der sie erschauern ließ, und kurz löste sich ihr Mund von seinem, und er hörte sie keuchend atmen, fühlte dann, wie ein Zucken durch ihren ganzen Körper ging, als kämpfte sie mit einem Fieber. Als die Zuckungen nachließen, nahm sie sein Gesicht zwischen ihre Hände und küsste ihn wieder, mit einer Gründlichkeit, die er nur genießen konnte. Dann berührten ihre Finger etwas hinter seinem Kopf, und sie zog ihren Kopf jäh zurück.
»Dein Schwert«, sagte sie atemlos.
»Wir haben keinen Platz«, sagte er.
»Nein, Dummkopf, dein Schwert. Dein richtiges, echtes Schwert. Es hängt auf deinem Rücken.«
Überwältigt von dem, was gerade geschehen war, konnte Morgan ihren Worten keinen Sinn entnehmen. »Was?«, fragte er schließlich.
»Es trägt dazu bei, dass wir hier festklemmen.« Plötzlich war sie wieder so klar und ernsthaft, als wäre nichts Ungewöhnliches geschehen. »Aber im Unterschied zu allem anderen, was uns hier verkeilt, können wir dein Schwert und die Scheide hinter dir entfernen. Das verschafft uns vielleicht genug Platz, um wieder hinaufzuklettern.«
Endlich begriff er, was sie meinte. »Wenn du es hinter mir hervorholst, sei vorsichtig. Es ist das Schwert meines Vaters und bedeutet mir viel. Wenn du es fallen lässt, fällt es bis auf den Grund dieses Baumstamms, und ich bekomme es nie wieder.«