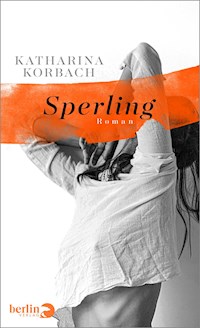
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Blick, dem etwas folgen wird … Als Charlotte überraschend vor der eigenen Haustür ihrem Dozenten in die Arme läuft, ahnt sie nicht, dass dieser sie bereits seit Wochen aus der gegenüberliegenden Wohnung des Berliner Mietshauses beobachtet. Wolfgang hingegen sieht in ihr das Mädchen aus einem Vermeer-Gemälde und fühlt sich inspiriert. Katharina Korbach erzählt eine hinreißende Geschichte von einsamen Seelen, die das Glück in der Großstadt suchen und eine fragile Verbindung miteinander eingehen. Das souveräne Debüt einer beeindruckenden neuen Stimme – es handelt von Menschen, die wir besser kennen, als wir zugeben würden. »Ein leuchtender Großstadtroman über Liebe, Scham und Wegfindung, von der – wie man sie später vielleicht nennen wird – großen ›Epikerin der Selbstachtung‹, der poetischen Fürsprecherin all jener, die sich selbst in ihr eigenes bestgehütetes Geheimnis verwandelt haben.« Clemens J. Setz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für T.
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Ivan Ozerov/Stocksy
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
Epilog
Nachweise
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Ob nun der schöpferische Glaube in mir versiegt ist oder die Wirklichkeit sich nur aus der Erinnerung formt, jedenfalls kommen mir Blumen, die man mir heute zum erstenmal zeigt, nicht mehr wie richtige Blumen vor.«
Marcel Proust – Unterwegs zu Swann
I.
Letztlich entschließt Charlotte sich doch dazu, noch einmal eine Therapie zu beginnen: bei Doktor Szabó. Marietta hat ihn ihr empfohlen. Das war im November, als Charlotte ins Wanken geriet, sie abermals drohte die Balance zu verlieren.
Ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann, sagt Marietta zu ihr an einem Abend, an dem Charlotte es nur mit Mühe geschafft hat, sich das Gesicht zu waschen, die Haare zu kämmen, die Wohnung zu verlassen. Marietta sagt, dass sie selbst eine Phase gehabt habe, in der es ihr alles andere als gut gegangen sei, wirklich gar nicht gut, im Grunde genommen: beschissen. Sie sei dann zu Doktor Szabó gegangen, ein erstes Mal und danach immer wieder, insgesamt fast zwei Jahre lang. Er sei Psychoanalytiker, aber praktiziere keine Analyse im klassischen Sinn. Er hat, sagt sie, seine ganz eigenen Methoden. Sie sagt: Ich kann ihn dir aber sehr empfehlen. Und Charlotte bedankt sich. Sie steckt den Zettel ein, auf den Marietta Doktor Szabós Telefonnummer geschrieben hat, obwohl sie nicht vorhat, ihn anzurufen. Weniger als zu allem anderen hat sie Lust, sich jemandem anzuvertrauen, sich einem Dritten zu erklären.
Der Zettel liegt eine ganze Weile auf dem Regalbrett in ihrer Küche. Manchmal, wenn ihr Blick darauf fällt, spricht sie Doktor Szabós Namen leise vor sich hin. Er erscheint ihr umso unwirklicher, je öfter sie ihn ausspricht. Szabó. Szabó. Der Name eines Zauberers. Aber dann, kurz vor Weihnachten, in einer der vielen Nächte, die Charlotte schlaflos verbringt, frierend, den Rücken an den Heizkörper gepresst, ruft sie ihn doch an. Die Leuchtziffern der digitalen Uhr über dem Ofen zeigen kurz nach drei. Unwahrscheinlich, dass Doktor Szabó um diese Zeit an sein Telefon geht. Sie stellt ihn sich vor, hinter dem geschlossenen Fenster, in einem der zahllosen Betten dieser Stadt liegend, schlafend. Nichts ahnend. Ohne eine Ahnung davon, dass sie in diesem Moment seine Nummer wählt, horcht, wartet, bis das Freizeichen ertönt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Sie braucht ein paar Sekunden, bis sie sich sortiert, die Worte zu etwas aneinandergefügt hat, das mit ein wenig Glück sogar Sinn ergibt. Am Ende bringt sie nur einen einzigen Satz zustande: Aus irgendwelchen Gründen weiß ich nicht mehr weiter.
Doktor Szabós Praxis befindet sich im Dachgeschoss eines Neuköllner Hinterhauses. Charlotte durchquert den Hof zum ersten Mal im Januar an einem Tag, der hell ist, klirrend kalt. Sie betritt die Praxis durch die angelehnte Tür. Hängt ihren Mantel an den Garderobenständer neben ein kariertes Tuch, einen Regenschirm. Blick nach links, in eine Teeküche hinein: ein Wasserkocher, eine Schale mit kleinen grünen Äpfeln. Verstreute Kassenzettel. Eine aufgerissene Tüte Pistazien.
Sie wagt sich vor, späht ins Behandlungszimmer. Doktor Szabó hat ihr den Rücken zugewandt. Er steht über einen Sekretär gebeugt, scheint etwas zu suchen, öffnet eine Schublade, schließt sie wieder. Gedämpftes Murmeln, Rascheln von Papier. Während Charlotte wartet, sieht sie sich um. Die Wand zu ihrer Linken ist ganz von einem Regal eingenommen, passgenau eingelassen zwischen die Dachschrägen. Eine unermessliche Menge Bücher darin, dicht gedrängt in lückenlosen Reihen.
Als Doktor Szabó sich umdreht, zuckt sie zusammen. Sie könnte nicht sagen, wie sie ihn sich vorgestellt hat, wie genau. Möglicherweise hat sie ihn sich überhaupt nicht vorgestellt, hat sich im Vorfeld keinerlei Bild von ihm gemacht. Und vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass sein Anblick sie jetzt aus der Bahn wirft. Sie ist unfähig, sich vom Fleck zu bewegen, steht da, ein Reh im Scheinwerferlicht, erstarrt. Doktor Szabó kommt auf sie zu. Er greift nach ihrer Hand und drückt sie, kurz und fest. Dann deutet er auf die beiden Korbstühle vor der Fensterfront. Dazwischen ein runder Glastisch, auf dem ein schwarzes Notizbuch liegt, ein Füller, das filigrane Gestell einer Lesebrille. Charlotte fühlt sich noch immer nicht imstande, sich zu rühren, aber Doktor Szabó bleibt geduldig mit ihr oder nachsichtig. Er lächelt, zeigt ein zweites Mal auf die Stühle. Eine Geste exakt über die Stuhllehnen hinweg, die offenbar deutlich machen soll, dass es an ihr ist, sich zu entscheiden. Links oder rechts. Auf diesen Stuhl oder auf den anderen. Charlotte ahnt, dass es wichtig ist, für welchen Platz sie sich entscheidet, dass ihre Entscheidung bereits etwas Wesentliches über sie verrät.
Sie wählt den Stuhl mit Blick auf das Regal. Erst jetzt bemerkt sie die Figur davor, ein Pferd, geschnitzt aus dunklem Holz, das sich aufbäumt. Rote Punkte anstelle von Pupillen. Glühende Pferdeaugen, die sie fixieren. Sie dreht sich weg, blickt über ihre Schulter. Doktor Szabó steht erneut vor dem Sekretär, auf dem sich Papiere in schiefen Türmen stapeln. Er führt eine hellbraune Teetasse an die Lippen, trinkt daraus, einen Schluck, einen zweiten, bevor er die Tasse auf der Fensterbank abstellt und sich setzt, Charlotte gegenüber. Er schlägt die Beine übereinander, hebt erwartungsvoll die Brauen. Fast so, denkt sie, als hätten wir gar keinen Termin. Als wäre ich völlig unerwartet in seiner Praxis erschienen, aus dem Nichts, eine Fremde, ein ungebetener Gast.
Vor diesem ersten Gespräch hat sie sich einige Sätze zurechtgelegt. Eine Art Selbstanalyse, halbwegs schlüssige Erklärung ihres Zustands. Nun versucht sie, sich an diese Sätze zu erinnern. Sie sagt, dass es ihr nicht gut ging in den vergangenen Wochen. Dass sie nicht sicher ist, wann genau es begonnen habe. Im Herbst sei sie hergezogen, in eine Einzimmerwohnung, nach Kreuzberg. Wahrscheinlich habe sie das Alleinewohnen unterschätzt, sei sie nicht gefasst gewesen auf den Berliner Winter. Vielleicht habe es aber auch später erst begonnen. Einige Wochen darauf, nach der Ausstellungseröffnung, unmittelbar nachdem ihre Eltern sie besucht hätten. Letztendlich habe wohl eine Mischung aus alldem dazu geführt, dass sie nicht weitergewusst habe; eine im Nachhinein nicht entschlüsselbare Kombination von Faktoren.
Doktor Szabó unterbricht sie nicht. Dann und wann wirft er einzelne Wörter in den Raum oder wiederholt etwas, das sie gesagt hat. Als sie erzählt, dass sie im Oktober noch einmal begonnen habe zu studieren, sagt er: Studieren, Charlotte sagt: Literaturwissenschaft. Als sie von Weihnachten spricht, von den Feiertagen zu Hause, während derer ihre Schwester auch den Eltern verkündet hat, dass sie heiraten werde, sagt er: Zuhause. Und Charlotte, unsicher, ob es sich um eine Rückfrage handelt oder um die Aufforderung, das Wort als solches zu überdenken, sagt: Zuhause, ja, im weitesten Sinne. Dort, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Frankfurt. Eigentlich, sagt sie, sei sie davon ausgegangen, dass diese Dinge längst hinter ihr lägen.
Diese Dinge, wiederholt Doktor Szabó.
Sie sagt: Na ja – die Krankheit eben. Gegen Ende des letzten Jahres habe sie deutlich gespürt, wie sie sich wieder eingeschlichen habe, angepirscht. Für die einfachsten Dinge habe ihr die Kraft gefehlt. Sie sei nicht mehr zur Universität gefahren, habe Verabredungen abgesagt. Sie habe nicht schlafen können, nicht essen, nicht zeichnen. Vor allem nicht zeichnen. Es ist ihr wichtig, das zu betonen: Nicht mehr zeichnen zu können, sei von all diesen Verlusten bei Weitem der schmerzlichste gewesen. Ich habe gedacht, dass eine Therapie nicht schaden könnte. Dass es nicht schaden könnte, mit jemandem zu sprechen. Einen Ort zu haben, an dem ich das aussprechen kann, ungefiltert, einen geschützten Raum.
Charlotte sieht zu Doktor Szabó, in sein gleichermaßen aufmerksames wie reserviertes Gesicht. Ein Gesicht, denkt sie, in das hinein man alles, auch das Allerschrecklichste, sagen könnte. Er nimmt das Notizbuch vom Tisch, schlägt die erste Seite auf. Notiert das Datum und darunter etwas, das sie nicht entziffern kann, möglicherweise ihren Namen. Dann hebt er den Kopf, sieht sie auffordernd an.
Charlotte zögert. Vermutlich erwartet er von ihr, dass sie über ihre Vergangenheit spricht, ihre Kindheit, familiäre Konflikte und Strukturen. Sie sagt, dass sie schon einmal eine Therapie gemacht hat, in der sie all das hinreichend aufgearbeitet habe, auseinandergenommen und analysiert. Dass sie eher über das Hier und Jetzt sprechen wolle, ihre akute, ganz konkrete Situation. Doktor Szabó erhebt keinen Einspruch, aber er verzieht bedauernd das Gesicht. Mehr ist auch nicht notwendig, um sie einsehen zu lassen, dass er, um ihr helfen zu können, ihre Vorgeschichte kennen muss, die Hintergründe, zumindest in groben Zügen. Sie denkt, dass sie ihm eben nur das Nötigste erzählen wird; nur, was er unbedingt zu wissen braucht, um sich ein Bild zu machen, ihre Lage zu verstehen.
Doktor Szabó nickt ihr aufmunternd zu, die Spitze seines Füllers schwebt über dem Papier. Erzählen Sie, sagt er.
Und also erzählt Charlotte.
Sie beginnt mit dem Naheliegenden, dem Dorf ihrer Kindheit. Fachwerkhäuser und eine Kirchturmuhr, die täglich zweimal schlägt. Eine Altstadt, in der es in der Nacht totenstill ist. Nur ab und an stolpert eine Gestalt aus der Wirtschaft, hallt ein Grölen durch die leeren Gassen. Im Rücken des Dorfes erstreckt sich der Hang. Parallele, wie an lange Schnüre gespannte Weinstöcke, durch die im Spätsommer die Erntehelfer laufen, Körbe geschultert, in die sie die abgeschnittenen Reben werfen. Die Aussichtsplattform am höchsten Punkt des Hügels, der unverstellte Blick bis hinunter zum Fluss. Alle paar Stunden entlässt die Fähre Touristen in den Ort. Männer und Frauen in Trekkingschuhen und asiatische Reisegruppen, die mit gezückten Kameras durch den Ortskern spazieren, Giebel fotografieren, die geschnitzten Fassaden. Ein letztes Foto vor dem Brunnen am Marktplatz, bevor es Zeit wird, zum Anleger zurückzukehren, das Schiff wieder zu besteigen, weiterzufahren.
Wir leben dort, wo andere Urlaub machen, sagt Charlottes Vater oft. Er ist Zahnarzt, arbeitet seit über dreißig Jahren in einer Gemeinschaftspraxis in der nächstgrößeren Stadt. Wenn man ihn nach dem Kennenlernen mit Charlottes Mutter fragt, erzählt er bereitwillig, was sich im Frühjahr des Jahres 1986 angeblich zugetragen hat. Er spricht emphatisch, die Mutter sitzt daneben, unterbricht ihn hin und wieder, wirft etwas ein. Seine Frau, beginnt der Vater zu erzählen, sei an einem Nachmittag in die Praxis gestürmt, wutentbrannt und mit einem von ihm ausgestellten Rezept wedelnd. Sie habe die Sprechstundenhilfe angeschrien.
Ich habe sie nicht angeschrien.
Der Vater sagt: Du hast jedenfalls sehr laut gesprochen. Die Mutter habe die Sprechstundenhilfe gebeten, dem verehrten Herrn Doktor auszurichten, dass heutzutage kein Mensch mehr Rezepte per Hand ausfülle. Erst recht nicht, wenn man mit einer derart unlesbaren Handschrift gestraft sei wie ihr Chef. Deine Sauklaue, sagt die Mutter, sie schüttelt den Kopf. Unmöglich zu entziffern, was du verschrieben hast. Der Vater sagt, als die Mutter die Praxis betreten habe, sei er dabei gewesen, einem Jungen die Weisheitszähne zu ziehen. Selbst durch die geschlossene Tür hindurch habe er sie im Vorzimmer zetern hören. So laut und so anhaltend, dass er die Spritze schließlich aus der Hand gelegt, die Operation unterbrochen habe. Er habe die Mutter nach Feierabend auf ein Glas Wein eingeladen. Um die Sache in Ruhe zu besprechen. Der Vater sagt: Und der Rest ist Geschichte. Es ist der Satz, mit dem er seine Schilderung jedes Mal enden lässt, bevor er dann seine Frau ansieht. Ihr einen Blick zuwirft, der fast verschwörerisch wirkt, der wohl Zuneigung ausdrücken soll, eine Verbundenheit. Ein Blick, den die Mutter nie erwidert.
Charlotte weiß nicht, warum sie Doktor Szabó diese Anekdote der ersten Begegnung ihrer Eltern erzählt. Sie spürt, wie das Erzählen ihr entgleitet, sie die Kontrolle darüber zu verlieren beginnt. In ihrem Innern steigen immer mehr Bilder auf, und mit einem Mal überkommt sie das starke Bedürfnis, Worte für ebendiese Bilder zu finden, die Erinnerungen auszusprechen, sie mit Doktor Szabó zu teilen. Also spricht sie weiter, unzusammenhängend. Von den Wochenenden, den Besuchen bei ihren Tanten und bei der Großmutter, die seit ihrem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt, nicht sprechen kann, Charlotte nicht mehr erkennt. Die ihr so verhassten Familienausflüge. Wanderungen durch die Weinberge, gefolgt von der Einkehr in die immer gleichen Gaststätten und Straußwirtschaften. Das Sitzen unter Efeu, Flammkuchen und Jägerschnitzel. Waffeln mit heißen Kirschen oder Eisbecher zum Nachtisch, jeweils drei Kugeln für ihre Schwester und sie selbst.
II.
Wolfgang zieht im Frühjahr nach Berlin, ins Vorderhaus eines Kreuzberger Altbaus. Hellgraue Fassade, Gründerzeit. Im Treppenhaus riecht es nach Waschmittel, nassem Hundehaar. Er trägt seine Koffer die drei Stockwerke hinauf, steht dann schwer atmend im kühlen Flur. Rauschen der Rohre. Kindergeschrei, hörbar trotz der geschlossenen Fenster. Die Schlüssel für den Fahrradschuppen liegen auf dem Küchentisch. Wolfgang registriert das mit einem Blick. Er friert, läuft durch die Räume und dreht in jedem die Heizung auf, stellt den Regler jeweils auf die maximale Stufe. In der Kommode im Flur findet er ein Bettlaken, graue Bezüge für Kopfkissen und Decke. Der Stoff riecht ungewaschen, riecht nach dem Brasilianer. Er legt das Bettzeug in die Schublade zurück. Im Zimmer lässt er sich auf die nackte Matratze fallen, liegt so auf dem Rücken, die Arme von sich gestreckt. Schließt die Augen und merkt erst jetzt, wie erschöpft er ist.
Auch die darauffolgenden Wochen sind überschattet von einer bleiernen Müdigkeit. Wolfgang fühlt sich nicht wohl, etwas sitzt ihm in den Knochen. Jeder Morgen ist ein kaum zu bewältigender Kraftakt. Dennoch zwingt er sich, aufzustehen, zur Universität zu fahren. Das Büro teilt er mit einer weiteren Doktorandin, Thea, die ihre Promotion vor Kurzem erst begonnen hat.
Steckt in den Kinderschuhen, sagt sie, wenn sie nebeneinander vor der Kaffeemaschine stehen, in der Teeküche des Instituts. Während sie darauf warten, dass ihre Tassen sich füllen, ist es Thea, die redet, die fortwährend erzählt. Sie promoviert zu Rilke, Rilkes Stundenbuch, wenn Wolfgang es richtig verstanden hat. Er hat den Moment verpasst, in dem es noch legitim gewesen wäre, nachzufragen. Inzwischen ist Thea zu ganz anderem übergegangen, spricht von Rilkes Nachlass, der umstrittenen Quellenlage, der unübersichtlichen Menge an Sekundärliteratur. Normalerweise ist er kein exzessiver Kaffeetrinker, in diesen ersten Wochen in Berlin jedoch trinkt Wolfgang Kaffee wie Wasser. Er überbrückt so die Morgenstunden, rettet sich in den Nachmittag, fünfzehn Uhr, eine vierte Tasse, eine letzte noch, und Feierabend. Danach immer dieselben Wege: vom Universitätsgelände zur U-Bahn. Diese Station und diese und die, umsteigen, sich öffnende, sich schließende Türen. Telefongespräche. Ansagen, die an ihm vorüberziehen, die übertönt werden von einem doppelten Rauschen: eines in seinen Ohren und eines in seinem Blickfeld. Bildrauschen. Ein stetiges Flackern. Fluoreszierende Punkte in Schwarz-Weiß.
Er schafft es gerade noch, die Wohnungstür zu schließen. Streift die Stiefel ab und geht ins Schlafzimmer hinüber, vergräbt das Gesicht im weichen Baumwollstoff des Kissens. Wenn er wach wird, sind die Lichtflecke an den Zimmerwänden verschwunden. Der Verkehr ist abgeebbt, das Viertel angenehm still. Im türkischen Markt an der Ecke kauft er das Nötigste: Kaffeefilter, Brot und Bananen. Wasser mit Kohlensäure in zwei Liter fassenden Flaschen. Später zwingt er sich noch einmal an den Schreibtisch. Nur ein paar Kapitel lesen, wenigstens ein Kapitel, ein paar Seiten. Doch es hat keinen Zweck, die Sätze verschwimmen ihm vor den Augen, verkommen zu langen Reihen kryptischer Zeichen. Bevor er aufgibt, liest er den ersten Satz der Recherche, müsste ihn nicht lesen, kann ihn längst auswendig: Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Wolfgang beschließt, es dem Erzähler gleichzutun. Er löscht alle Lichter. Geht früh zu Bett.
Dieser Zustand der Erschöpfung hält noch eine Weile an. Dann lichtet sich endlich der Schleier der Müdigkeit, gewinnen die Dinge allmählich wieder an Kontur. Im kommenden Semester wird er zwei Seminare geben. Einen Einführungskurs in die Vergleichende Literaturwissenschaft und einen weiteren, der an seine Doktorarbeit anknüpft. Zu Proust, zu literarischen Erinnerungskonzeptionen. Wolfgang freut sich auf die Lehre, aber er ist auch nervös. Zur ersten Sitzung erscheint er zu früh. Kippt alle Fenster und packt seine Ordner aus, schiebt sie sinnlos von einer Tischseite zur anderen und zurück. Minuten später ist der Seminarraum bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Raum, viel zu klein für vierzig Studierende. Einige hocken im Schneidersitz auf dem Linoleumboden, andere auf den Heizkörpern, Briefblöcke im Schoß. Ein Mädchen mit einem schwarzen, sehr exakt geschnittenen Pony malt Blumen und Ranken in ihren Kalender. Der Kommilitone neben ihr hält den Kopf gesenkt, das Telefon halbherzig unter der Tischplatte verborgen. Wolfgang teilt den Seminarplan aus, fragt nach den allgemeinen Erwartungen an den Kurs. Vielleicht möchten ein paar von Ihnen ihre Ideen im Plenum teilen. Mehr Bitte als Frage. Er sieht sich um. Gesichter wie leere Gläser, die er nicht zu deuten weiß.
Im Seminar zu Proust läuft es besser. Die Gruppe ist kleiner, nur knapp über zwanzig Personen. Auf seine erneute Frage hin, was die Studierenden sich von dem Kurs versprächen, gibt es gleich mehrere Wortmeldungen. Die Beschäftigung mit der literarischen Abbildung von Erinnerung, ihrem fiktionalen Gehalt, den Grenzen ihrer Darstellung. Einen Überblick über Prousts Werk, sofern das denn möglich sei, zumindest einen Einblick in einen Ausschnitt davon. Wolfgang ist erleichtert, er atmet merklich auf. Und doch bleibt eine Spannung in ihm zurück. Eine ganz grundsätzliche, unhintergehbare Anspannung, die sich weniger auf das Gelingen des Seminars bezieht als auf ihn, auf Wolfgang als Person. Viele der Kursteilnehmer sind kaum jünger als er, einige im selben Alter oder älter. Jedes Lachen deutet er als eines, das ihm gilt. Finden sie mich lächerlich, fragt er sich, machen sie sich lustig? Über meinen Akzent, dass ich mir anmaße, sie etwas lehren zu wollen. Er bemüht sich, diese Selbstzweifel abzuschütteln, so gut es geht. Sagt sich, dass es eben dauern wird, bis er sich daran gewöhnt hat. An seine Rolle als vermeintlicher Experte, diese ihm so fremde Autorität.
III.
Seit der ersten Sitzung bei Doktor Szabó sind zwei Monate vergangen. Es ist Ende Februar, und noch immer ist Charlotte zu keinem Ende gekommen, ist sie damit befasst, ihm ihre Erinnerungen zu erzählen. In jeder Woche teilt sie eine neue Episode, Bilder ihrer Vergangenheit, Szenen. Sie ist sich sicher, dass das nicht dem Ablauf entspricht, dem die Sitzungen üblicherweise folgen. Aber Doktor Szabó scheint diesen Ablauf dennoch zu befürworten. Er greift nicht ein, unterbricht sie nicht. Generell ist er schweigsam, hält das Notizbuch im Schoß. Seine Schrift ist zu klein, als dass Charlotte sie entziffern könnte. Gut möglich auch, denkt sie, dass er auf Ungarisch schreibt. Einmal, als sie im Flur der Praxis ihren Mantel anzieht, sieht sie durch die halb geöffnete Tür, wie Doktor Szabó vor das Regal tritt. Er hält das Notizbuch in der Hand, lässt den Blick über die Reihen gleiten, verharrt eine Weile so, bevor er das Buch gezielt hineinstellt. In der kommenden Woche achtet sie darauf: ein ganzes Regalsegment, acht volle Borde, auf denen ausschließlich Notizbücher stehen. Die Bücher gleichen einander, sind auf den ersten Blick identisch, anonyme Rücken, schwarz und unbeschriftet. Was ist das System dahinter, was die Ordnung? Möglicherweise, denkt sie, gibt es keine Ordnung. Macht Doktor Szabó sich einen Spaß daraus, vor jeder Sitzung ein beliebiges Buch aus dem Regal zu ziehen; so zu tun, als notiere er darin, halte fest, was die Patientin, der Patient ihm erzählt. Tatsächlich aber schreibt er etwas ganz anderes: Einkaufslisten, Tagebuch, einen Fantasietext.
Und selbst wenn, denkt Charlotte. Die Gespräche tun ihr gut, so oder so. Im Grunde sind es ja keine richtigen Gespräche; ein Monolog vielmehr, den sie hält, von dem sie aber meint, ihn in dieser Form nur in Doktor Szabós Gegenwart führen zu können. Die Sitzungen finden immer montags statt, um siebzehn Uhr, und dauern fünfzig Minuten. Bevor sie die Praxis betritt, ist der Tag noch hell. Eine Stunde später dämmert es bereits, verfängt sich letztes Licht in Streifen bläulicher Wolken. Trotz der Kälte geht sie zu Fuß. Langes Warten am Zebrastreifen. Hupen, genervtes Kuppeln. Sie fühlt sich leicht an diesen Abenden, mit jeder Woche ein wenig leichter. Als hätte sie Ballast bei Doktor Szabó abgeworfen, sich einmal mehr von etwas befreit.
Charlotte sammelt sich, gibt ihrem Leben die alte Struktur, fügt die Bausteine nach und nach wieder ein in ihre Tage. Philippe sagt sie, er könne sie in den Schichtplan eintragen, und sie hält sich daran, sie sagt diese Schichten nicht ab. Sie fährt zur Universität, wagt sich unter Menschen. Und sie isst, sie zwingt sich dazu. So lange, bis das Essen sie fast nicht mehr anstrengt, bis es beinahe wieder Routine, Normalität geworden ist.
Im März hat sie Semesterferien. Sie wird vierundzwanzig am Elften des Monats und hat eigentlich nicht vor, diesen Geburtstag zu feiern. Sie muss auch arbeiten am Vorabend, in der Buvette. Ist überrascht, als kurz vor Mitternacht Andrej aus der Küche tritt und ein Schälchen auf den Tresen stellt. Eine Crème brûlée. Er zündet die Wunderkerze an, die in der Karamellschicht steckt, und Vera, die gerade dabei ist, Gläser abzuspülen, trocknet sich die Hände. Auch Philippe kommt dazu.
Joyeux anniversaire, sagt Andrej. Charlotte weiß, dass er es absichtlich auf diese Weise ausspricht, kaum verständlich, sehr falsch betont.
Der Blick, den Philippe ihm zuwirft, ist derart schockiert, dass sie lachen muss. Philippe schüttelt den Kopf. Alors, on chante! Er ruft es in den Gastraum, stimmt an: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire!
Und obwohl die Gäste der Buvette sie nicht kennen, nicht wissen, wer diejenige ist, die da Geburtstag hat, fallen die meisten von ihnen in den Gesang mit ein. Charlotte ist es erst unangenehm, so im Mittelpunkt zu stehen, aber dann, im Nachhinein, freut sie sich darüber. Über die Sache an sich, über die Geste.
Am Ende des Monats fährt sie nach Utrecht. Um Johannes zu besuchen, der dort ein Auslandssemester macht. Für diese Reise muss sie eine Sitzung bei Doktor Szabó ausfallen lassen, und es erschreckt sie selbst, wie stark sie das trifft. Aus der einen Stunde am Montag, in der sie mit ihm spricht, zieht sie ihre Kraft für die restliche Woche. Nun aber stauen die Erinnerungen sich an, verfolgen sie noch bis in ihre Träume. Sobald Johannes schläft, sucht sie im Koffer nach dem Buch. Dem Skizzenbuch, das sie eingepackt hat, in der vorausschauenden Annahme, es unterwegs zu brauchen. Charlotte zögert, bevor sie beginnt, die Bilder aufs Papier zu bringen, eines nach dem anderen: Marie-Christin schaukelnd, ihr wippender Zopf. Der Leopard auf seinem Sockel. Amir und Paul. Sie versucht auch, die Akkordeonspielerin zu zeichnen, ihre feinen, wie in Stein gemeißelten Züge. Wird wehmütig, als es nicht gelingen will. Charlotte besitzt kein Foto von ihr. Sie denkt: Dieses Gesicht habe ich also verloren.
Irgendwann bemerkt Johannes, dass sie wach ist. Er setzt sich im Bett auf. Ist alles in Ordnung?
Charlotte klappt das Skizzenbuch zu, obwohl es ohnehin zu dunkel im Raum ist, als dass Johannes etwas erkennen könnte.
Ja, sagt sie. Alles in Ordnung.
Johannes sagt: Du kannst immer noch nicht schlafen.
Sie sehen einander an, durch die Dunkelheit, und denken in diesem Moment wohl an dasselbe: an die Küche der Wohngemeinschaft und wie sie auch damals zusammensaßen, während die anderen schliefen. Die anderen Mitbewohner: Ole und Jasper. So lange, bis Jasper sein Studium beendete und stattdessen Sina bei ihnen einzog. Sina, mit der Ole sich so heftig zerstritt, dass sie ihre Zimmer fast zeitgleich räumten. Merve und Eliah nahmen ihre Plätze ein, für Merve kam Astrid, für Astrid Mareike und für Mareike schließlich Judith, ein halbes Jahr darauf. Das Leben in der Wohngemeinschaft ist unübersichtlich. Niemandem fällt auf, wenn Charlotte ihr Zimmer, oft über Tage, so gut wie nicht verlässt. Keiner fragt sich, wann er sie das letzte Mal hat essen sehen, ob sie den Kühlschrank nur geöffnet und geschlossen oder tatsächlich etwas herausgenommen hat. Niemand kümmert sich darum. Johannes schon. Johannes lässt die eigene Zimmertür angelehnt, um nicht zu verpassen, wenn ihre Tür sich öffnet. Mitten in der Nacht, drei oder vier Uhr am Morgen.
Er leistet ihr Gesellschaft in diesen Nächten. Es gab Zeiten, da war seine Anwesenheit die einzige, die Charlotte ertrug. Sie sitzen beieinander, schweigen, rauchen. Machen sich nicht die Mühe, das Küchenfenster zu öffnen. Wenn sie reden, dann nie über das Wesentliche, über das, was Charlotte Doktor Szabó gegenüber die Krankheit nennt. Vermutlich ahnt Johannes etwas. Hat er eigene Worte für ihren Zustand gefunden. Depression. Anorexie. Aber er verlangt nicht von ihr, dass sie sich erklärt oder rechtfertigt. Drängt sie nicht, zu erzählen von ihren dunklen Tagen. Vom Rausch, in den der Hunger sie nach wie vor versetzt.
Charlotte sagt: Doch, eigentlich kann ich wieder schlafen. Viel besser als früher. Nur heute eben nicht. Sie überlegt, Johannes von Doktor Szabó zu erzählen, verwirft den Gedanken dann aber wieder. In Berlin hat sie auch niemandem von ihm erzählt, warum sollte sie jetzt eine Ausnahme machen. Sie wüsste auch gar nicht, was sie sagen sollte: Ich habe übrigens eine Therapie begonnen. Und weiter? Wie sollte sie benennen, wie beschreiben, was Doktor Szabó und sie zusammen tun. Wie sehr sie ihn braucht, wie sehr sie angewiesen ist auf sein Horchen und Schweigen und ständiges Notieren.
IV.
Nach und nach lernt Wolfgang die Routinen seiner Nachbarschaft kennen, die alltäglichen Abläufe und Gewohnheiten derer, die in unmittelbarer Nähe wohnen, in den angrenzenden Wohnungen, über und unter ihm. Er stimmt den eigenen Rhythmus auf sie ab, wird selbst zu einem Zahnrad im Getriebe des Hauses. Frühmorgens hört er über sich eine Wohnungstür ins Schloss fallen, das Kratzen von Hundepfoten auf den Stufen im Treppenhaus. Die Nachbarin ruft den Hund, sie lockt ihn: Komm, Effie, komm! Und Wolfgang dreht sich noch einmal um. Er weiß, dass es, da die Nachbarin ihren Tag nun beginnt, nicht mehr lange dauert, bis auch sein Wecker klingelt. Fünf Minuten, zehn vielleicht.
Am späten Nachmittag trifft er gelegentlich auf einen jungen Mann, ebenfalls ein Nachbar, der sein Fahrrad den Hügel hinaufschiebt. Sein Sohn sitzt auf dem Gepäckträger, im Kindersitz. Beide, Vater wie Sohn, tragen Helme, über die sich gelbe, reflektierende Hüllen spannen. Wenn Wolfgang die beiden kommen sieht, wartet er kurz. Bleibt in der Haustür stehen und hält sie ihnen auf. Der Vater bedankt sich nie dafür, fragt stattdessen das Kind: Und, Jonas, was sagen wir, wenn jemand uns die Tür aufhält? Der Junge sieht Wolfgang mit großen Augen an. Immer hat er etwas Essbares in der Hand, ein Apfelstück, den halbrunden Bogen einer Brezel. Jonas bleibt stumm, der Vater lacht. Bisher ist jede ihrer Begegnungen so verlaufen, und Wolfgang vermutet, dass es dabei auch bleiben wird. So lange, bis der Junge eine Antwort gefunden, bis er gelernt hat, Danke zu sagen.
Um an seiner Dissertation zu arbeiten, bleiben ihm unter der Woche nur die Abende und Nächte. Wenn er sich in der Wohnung an den Schreibtisch setzt, zerfasert der Tag, ist zumeist schon früher Abend geworden. Seine Ausgabe der Recherche steht vor ihm auf dem Fensterbrett. Alle sieben Bände, die Buchrücken ihm zugewandt. Oft verpasst er, in die Texte vertieft, den Moment, in dem der Himmel über den Dächern sich verdunkelt. Die wenigen Minuten, in denen er die Farbe wechselt, von blassblau zu rosa, dunkelblau zu schwarz.
So auch an diesem Abend. Wolfgang steht auf. Er schließt die Vorhänge, geht hinüber in die Küche. Unentschlossen, ob er Kaffee kochen oder doch gleich eine Flasche Rotwein öffnen soll. Er entscheidet sich für den Wein. Weniger aus einer Lust heraus als im Bemühen, einem Bild zu entsprechen: er, Wolfgang, der junge Akademiker, der Intellektuelle, der nachts noch immer schreibt. Ein Glas Rotwein in Reichweite, an dem er andächtig nippt, in der Pause zwischen zwei Gedanken. Da der Brasilianer offenbar keine Weingläser besitzt, hat er eigene Gläser gekauft, außerdem Kerzen. Breite, cremefarbene Wachszylinder, die seither unbenutzt auf dem Küchentisch stehen. Als sein Blick darauf fällt, entschließt er sich, seinen Arbeitsplatz in die Küche zu verlegen. Er stellt eine Kerze auf den Tisch, eine zweite auf die Fensterbank. In der Besteckschublade sucht er nach einem Feuerzeug, findet stattdessen eine Packung Streichhölzer im Küchenschrank. Der herbe Geruch des ausgeblasenen Zündkopfs versetzt etwas in ihm in Schwingung, wirbelt verschüttete Bilder auf: die Winter seiner Kindheit, Kerzenständer im Eingangsbereich der Villa der Großeltern. Adventskränze, eine bestimmte Gemütlichkeit. Wolfgang bleibt noch eine Weile am Fenster stehen. Er platziert das Weinglas neben der brennenden Kerze. Sieht abwechselnd in die Flamme und hinaus in den Hof.
An der Fassade des Hinterhauses die üblichen Muster: das unruhige Flackern des Fernsehers im Dachgeschoss. Das Bügelbrett, ein Stockwerk tiefer. Ein Stapel Wäsche liegt darauf, schon seit Tagen, es könnte jedes Mal ein anderer sein oder immer derselbe. Ein Fenster wird aufgestoßen, dritter Stock. Töpfe und Siebe über einem Spülbecken. Der gleiche hässliche Sicherungskasten, der auch in seiner Küche hängt. Eine Frau steht rauchend am offenen Fenster. Ein Scherenschnitt, in den Rahmen gelehnt. Das Klicken eines Feuerzeugs, der Glimmpunkt der Zigarette. Die Nachbarin stößt den Rauch lange aus. Ihr Blick ist auf einen Punkt unter Wolfgang gerichtet, auf eine Szene vielleicht in den unteren Wohnungen, die ihm selbst verborgen bleibt. Schatten hinter den vergitterten Fenstern der Kellerwohnung. Kinderstimmen, die mahnende Stimme eines Erwachsenen. Zwei Jungen in Pyjamas, die hinter den Stäben auf und ab rennen. Die Geduld ihrer Eltern auf eine letzte Probe stellen, bevor es endgültig an der Zeit ist, schlafen zu gehen. Als das Geschrei der Kinder verstummt, wendet er sich ab. Dreht dem Fenster den Rücken zu. Setzt sich und liest weiter.
Nachdem er einen Absatz mehrmals gelesen hat, ohne zu begreifen, beschließt Wolfgang, es genug sein zu lassen. Er stellt das leere Weinglas ins Spülbecken, sieht auf die Uhr. Kurz nach Mitternacht. Das Hinterhaus liegt inzwischen im Dunkeln. Schläft, denkt er, wie auch seine Bewohner. Nur die Nachbarin aus dem dritten Stock ist noch wach. Sitzt im schwachen Schein einer Lichterkette, die sich von einem Ende der Küchenschränke zum anderen spannt. Er sieht ihr Gesicht im Halbprofil. Sie beugt sich über die Tischplatte, über etwas in ihrer Mitte, einen Block, ein Papier. Immer wieder richtet sie sich auf, betrachtet das Blatt prüfend, streicht mit den Fingerspitzen darüber. Fügt Striche hinzu, sehr gezielt, einen hierhin, einen dort. Auf Wolfgang wirkt sie versunken, selbstvergessen, und mit einem Mal fühlt er sich unwohl, als Voyeur. Die Frau aber scheint ihn gar nicht zu bemerken. Ahnt nicht, dass sie beobachtet wird, oder denkt sich, dass es ihr ja egal sein kann. Dass sie schließlich nichts zu verbergen hat.
Das alles wird zur Routine: das nächtliche Schreiben, der Rotwein, die Kerzen. Wann immer Wolfgang spürt, dass er nicht weiterkommt, seine Gedanken sich zusehends verhaken, klappt er den Laptop zu und tritt ans Fenster. Weil die Frau aus dem dritten Stock weder Vorhänge hat noch Jalousien, ist der Blick auf sie der für ihn am wenigsten verstellte. Er sieht ihr zu. Wie sie die Kräuter auf der Fensterbank gießt. Tee kocht, den Wasserkessel von der Herdplatte nimmt. Das Geräusch des Kessels ist bis über den Hof zu hören, ein lang anhaltendes, ekstatisches Pfeifen. Die Nachbarin zeichnet, Nacht für Nacht. Ihr Vertieftsein, ihre Hingabe motivieren ihn. So sehr, dass er einen Pakt mit sich selbst schließt: nicht aufzuhören, solange auch sie noch am Werk ist. Sich erst zu erlauben, seine Arbeit zu beenden, wenn das Licht auch in der Küche gegenüber erlischt.
Über der Lehne des Küchenstuhls hängt der Mantel der Nachbarin. Ein blauer Mantel, hellblau. Oder taubenblau? Wolfgang kann sich zu dem Wort keine Farbe vorstellen. Gibt es das denn, fragt er sich, eine blaue Taube?
V.
In Berlin fährt Charlotte fort, ihre Erinnerungen zu zeichnen. Meist dauert es lange, bis die Bilder gereift sind. Wenn sie zu schnell ist, eine Erinnerung zu früh abzubilden versucht, entwischt sie ihr. Ist es ein fremdes Bild, das auf dem Papier entsteht, ein anderes als das, das sie im Kopf hatte. Sie muss geduldig sein. Muss warten, bis die Motive sich scharf stellen, sich aus dem Nebel befreit haben, der sie umgibt und der nicht unbedingt dichter wird mit der Zahl der Jahre, die ein bestimmtes Ereignis zurückliegt.
Charlotte zeichnet bei jeder sich bietenden Gelegenheit. An der Universität, im Café, in der Bahn. Und nachts, am Tisch in ihrer Küche, wo sie ganz ungestört ist, sich in den Bildern verlieren kann.
Auch zu Doktor Szabó nimmt sie das Skizzenbuch mit. Sie denkt, dass sie ihm die Zeichnungen zeigen, ihre Schilderungen so illustrieren könnte. Doch dann vergisst sie das Buch im Rucksack, wird einmal mehr mitgerissen vom Strom ihrer Erzählung. Doktor Szabó hat seine Zurückhaltung nach wie vor nicht aufgegeben. Er schweigt, lässt sie reden, schreibt mit. Selten nickt er, bekräftigend oder als Zeichen, dass er ihr weiterhin folgt. Ab und an legt er den Kopf schief, lächelt. Auf eine kaum merkliche, nach innen gewandte Weise.
Charlotte arbeitet sich langsam vor. Legt Schicht um Schicht ihrer Vergangenheit frei, ein umgekehrtes Graben, ein Auftauchen eher, von der entferntesten Erinnerung bis an die Oberfläche, ins Jetzt. Sie fragt sich, was passieren wird, wenn sie die Gegenwart erreicht. Wenn die Quelle der Bilder in ihr versiegt, es nichts mehr gibt, das sie noch erzählen könnte. Vielleicht aber wird es dazu gar nicht kommen. Wird Doktor Szabó ihre Gespräche zuvor bereits beenden. Sobald das Notizbuch vollständig gefüllt ist, sämtliche Seiten beschrieben sind. Es tut mir leid, wird er sagen, das war’s. Meine Mittel sind ausgeschöpft, ich kann nichts weiter für Sie tun. Er wird das Buch zwischen all die anderen ins Regal stellen. Charlotte mit einem letzten, festen Händedruck entlassen.
Sie versucht, in ihrer Erzählung chronologisch vorzugehen. Das gelingt nicht immer. Manchmal fällt ihr im Laufe der Woche noch etwas ein, eine Begebenheit, die ihr plötzlich so wichtig erscheint, dass sie in der nächsten Sitzung darauf zurückkommt. Die Anekdote mit dem bunten Pferd ist eine solche Geschichte. Eine von denen, die Charlotte nachträgt, obwohl sie eigentlich längst zu anderem übergegangen ist. Sie muss daran denken, als ihr Blick auf die Figur fällt. Auf das Pferd mit den glühend roten Augen, das sich aufbäumt wie ihre Erinnerung in diesem Moment. Mit einem Mal scheint ihr diese Geschichte etwas zu verdeutlichen; etwas Wesentliches, von dem sie meint, es in anderen Worten nicht in derselben Exaktheit beschreiben zu können. Das war in der vierten Klasse, beginnt sie also. Ich habe damals einen Wettbewerb gewonnen. Einen Malwettbewerb, mit dem Bild von einem Pferd. Es klingt komisch, das zu sagen: ein Bild von einem Pferd. Sie erzählt, wie sie während Marie-Christins Reitstunde am Rand der Koppel gesessen hat, den Zeichenblock auf den Knien. Wie sie sich beeilt hat, das Pferd hinter dem Zaun zu zeichnen, in ständiger Sorge, es könnte sich vom Fleck bewegen. Später malt sie ihm blaue Hufe, einen gelb, orange und rot gescheckten Hals. Eine Wiese dahinter, ein weitläufiges Blumenmeer. Bäume und Berge, violette Wolken.
Ende der Leseprobe





























