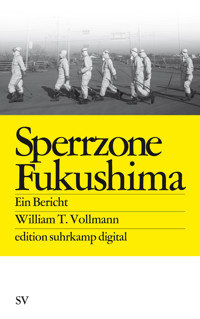
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Angesichts der Havarie in Fukushima tappten alle wochenlang im dunkeln: Was passierte wirklich in den Reaktorblöcken? War die Kernschmelze bereits eingetreten? Und ganz praktisch: Wie rechnet man eigentlich Sievert in Becquerel um? Kraftwerksbetreiber und Verwaltung schienen überfordert, Medienberichte waren widersprüchlich, selbst den Geigerzählern war nicht zu trauen. In dieser Situation machte sich William T. Vollmann, ausgestattet mit einem Dosimeter und Jodtabletten aus dem Kalten Krieg, Anfang April auf den Weg ins japanische Katastrophengebiet. »Vollmann reist durch ein zerstörtes, doppelt und dreifach heimgesuchtes Land, weil er mit eigenen Augen sehen will, was geschehen ist. Weil er es aufschreiben und so das Unbegreifbare, das Unsichtbare sichtbar machen will. Und dieses Unsichtbare ist nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Es heißt Radioaktivität. Deswegen muss Vollmann bis zum Äußersten gehen, bis an die Grenze, in die Sperrzone eben.« (Richard Kämmerlings in der Welt am Sonntag)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
William T. Vollmann
SPERRZONE FUKUSHIMA
Ein Bericht
Aus dem Englischen von Robin Detje
Suhrkamp
Coverfoto: ddp images /AP Photo/David Guttenfelder
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Into The Forbidden Zone – A Trip Through Hell and High Water in Post-Earthquake Japan im Verlag Byliner, Inc., San Francisco, USA
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© 2011 by William T. Vollmann
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Bureau Johannes Erler
eISBN 978-3-518-77080-1
www.suhrkamp.de
Angesichts der Havarie im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi tappten alle wochenlang im Dunkeln: Was passierte wirklich in den Reaktorblöcken? War die Kernschmelze bereits eingetreten? Und ganz praktisch: Wie rechnet man eigentlich Sievert in Becquerel um? Kraftwerksbetreiber und Regierungsbehörden schienen überfordert, Medienberichte waren widersprüchlich, selbst den Geigerzählern war nicht zu trauen. In dieser Situation machte sich William T. Vollmann, ausgestattet mit einem Dosimeter und Jodtabletten aus dem Kalten Krieg, Anfang April auf den Weg ins japanische Katastrophengebiet.
»Vollmann reist durch ein zerstörtes, doppelt und dreifach heimgesuchtes Land, weil er mit eigenen Augen sehen will, was geschehen ist. Weil er es aufschreiben und so das Unbegreifbare, das Unsichtbare sichtbar machen will. Und dieses Unsichtbare ist nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Es heißt Radioaktivität. Deswegen muss Vollmann bis zum Äußersten gehen, bis an die Grenze, in die Sperrzone eben.« (Richard Kämmerlings in der Welt am Sonntag)
William T. Vollmann, geboren 1959 in Los Angeles, lebt in Sacramento, Kalifornien. Er ist Autor zahlreicher Romane, Erzählbände und Sachbücher, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Regelmäßige Veröffentlichungen in The New Yorker, Esquire, Harper’s und anderen Zeitschriften. Zuletzt erschienen von ihm Hobo Blues. Ein amerikanisches Nachtbild (2008), Afghanistan Picture Show oder Wie ich die Welt rettete (suhrkamp taschenbuch, 2008) und der Roman Huren für Gloria (2006).
Inhalt
I. Pikareske Irrfahrten eines Dosimeters
II. Eine Geschichte von Dingen, die kaum zu glauben sind und zu verstehen schon gar nicht
III. In die verbotene Zone
IV. Kirschblüte
I. PIKARESKE IRRFAHRTEN EINES DOSIMETERS
ICH HATTE DIE GOLDENE REGEL des Journalismus – Zahnarzttermine einhalten! – schon ein paar Jahre lang vernachlässigt, aber nun fügte ich mich den aktuellen Gegebenheiten Japans und nahm eilig die Beziehungen zu meiner Dentalhygienikerin wieder auf, die ihren Patienten den Rüssel einer Röntgenkamera an die Backenknochen drückte und daher ein Dosimeter am blassrosa Kittel trug. Ihr verdanke ich die Bekanntschaft mit der Telefonnummer von Carol (bei späteren Anrufen hob Ginger ab), die mir eine Verbindung zu einem Händler namens Bob herstellte, der durchblicken ließ, dass er noch einen Geigerzähler auf Lager hatte – oder, genauer gesagt, ein post-Geiger-Müller-artiges Teil, das Bob zufolge (der es nicht selbst in der Hand gehabt hatte, sondern Daten von irgendeinem Bildschirm zu interpolieren schien) ein bisschen wie ein Taschenrechner aussah. Aktuelle und kumulierte Belastung, Röntgen und Gamma, programmierbarer Belastungsalarm – richtig klasse! Egal, dass es weder Alpha- noch Beta-Strahlung nachweisen konnte; wäre die nicht praktisch harmlos, solange ich keine verstrahlte Materie aufnahm? (Im Körperinneren, hieß es in meinem Handbuch für radioaktive Störfälle, seien »Partikel, die Alpha- und Beta-Strahlung abgeben, die gefährlichsten«, da sie »ionisierende Strahlung auf das umgebende Gewebe übertragen und die DNA oder anderes Zellmaterial schädigen können«.)1
Fünfhundert Dollar zuzüglich Versandkosten, Zahlung nur per Kreditkarte; so das Wort Bobs, der gewusst haben muss, dass er gut lachen hatte, denn die anderen Firmen, die ich anrief, nahmen, da nach dem Reaktorunfall schon zwei Wochen ins Land gegangen waren, nur noch Vorbestellungen entgegen. In Japan, so hörte ich, waren überhaupt keine Dosimeter mehr zu bekommen. Ich fragte mich laut, ob Bobs Produkt über einen Messstab verfüge, den ich in mein Sashimi stecken könnte, das wäre doch lustig. Bob wollte nichts von lustig wissen (er habe eine lange, schwere Woche hinter sich, erklärte er) und versicherte mir, ich könne den Apparat beispielsweise 15 Zentimeter vor ein Glas Trinkwasser halten, dann wisse ich wirklich Bescheid. Da es in großen Teilen des Katastrophengebiets kein Trinkwasser gab und die Wasserversorgung in Tokio mit schwankenden Graden von Radioaktivität gewürzt war, fand ich es sehr gewitzt, mich auf diese Möglichkeit punktgenauer Kontrolle zu stürzen.
In dieser Phase vor dem Abschluss hätte jeder Gebrauchtwagenkäufer, der auf sich hielt, an einen Reifen getreten und vielsagend genickt; mein Äquivalent dazu war die Frage, welche Maßeinheiten das Ding verwende. Millisievert und Millirem, antwortete Bob. Ich gestehe, dass ich mir bei seiner Antwort nicht mehr ganz frisch vorkam, denn zu meiner Zeit hatte man alles in Röntgen gemessen. Als ich meinen Freund, den pensionierten Röntgenologen, anrief, war er ganz auf meiner Seite und verkündete: »Ich bin zu alt, mich noch mit Millisievert abzugeben.« Aus meinen Uni-Tagen erinnerte ich mich dumpf, dass eine Dosis von 400 Röntgen tödlich war, und staubte mein Exemplar Physical Chemistry von 1966 ab, das mir verriet, die »Entwicklung des Atomreaktors, der eine wichtige Energiequelle zu werden verspricht«, bringe »viele komplizierte chemische Probleme mit sich«.2 Wie hübsch. Und die »tödliche radioaktive Ganzkörper-Einzeldosis« für einen Menschen betrage ungefähr 500 Röntgen3; jetzt fiel mir alles wieder ein; nur dass ich mir besser die Umrechnung in Sievert angewöhnen sollte.
Mein hagerer schwedischer Nachbar erbot sich, mir seinen Geigerzähler zu leihen, ein Souvenir von seinen Geschäftsreisen in den Jüdischen Autonomen Oblast der Sowjetunion, aber ich konnte ihm nicht garantieren, dass ich ihn würde zurückbringen können. Auf meine Bitte nahm er direkt auf meinem Autostellplatz eine Messung vor, gut zehn Tage nachdem die radioaktive Wolke aus Japan offiziell unsere Stadt erreicht hatte. Der Zeiger auf der Skala verharrte bei null. Nun, hatte man uns nicht in der Zeitung versprochen, dass die Belastung praktisch nicht spürbar sein würde? Seufzend fragte mein Nachbar sich, ob sein Spielzeug noch geeicht war. Er steckte es wieder in die abgenutzte Lederhülle, und weil ich sah, wie sehr er es liebte, wusste ich, dass ich Recht daran getan hatte, es in seiner Obhut zu belassen.
Mein neues Dosimeter (dessen Marke und Modellnummer ich so lange nicht einfüge, bis der Hersteller mich dafür bezahlt) erinnerte tatsächlich an einen Taschenrechner. Es war ein dickes blaues, langweiliges kleines Plastikteil mit Gürtelclip. Nach etwa einer Stunde hatte ich kapiert, wie man es einschaltet. Und wer hätte das gedacht? Die Zahl im kleinen Fenster war eine Null. Woher sollte ich wissen, ob es überhaupt funktionierte? Allerdings lag ein handsigniertes Eichzertifikat bei; und die Hintergrundstrahlung in Sacramento sollte sogar jetzt zu vernachlässigen sein, also war die Tatsache, dass im kleinen Fenster eine Null erschien und nichts als eine Null, kein Grund zum Misstrauen; trotzdem wollte ich mein Leben nicht einem Eichzertifikat anvertrauen.
Und so brachte mir eine freundliche Nachbarin mit Verbindungen zur örtlichen Feuerwache einen gepolsterten Umschlag mit der handgeschriebenen Warnung VORSICHT – STRAHLUNG ins Wohnzimmer. Meine zwölfjährige Tochter verzog vor Schreck das Gesicht; sie blieb lieber in der Küche. Heraus kam eine Plastikdose mit einer radioaktiven Punktquelle von unbekannter Strahlungsintensität, die meine Nachbarin nun mit bloßen Händen von ihrer Seite des Sofas auf meine beförderte. Meine Nachbarin versicherte mir, die Strahlung sei schwach und das gelte auch für die Überraschung, die es als Dreingabe dazu gab: einen orangeglasierten Essteller von ihrer Großtante Lou; eine Rarität, seit unsere Regierung diese orangefarbene Glasur für ihr Manhattan-Projekt beschlagnahmt hatte. Ich ließ mein Dosimeter an die Punktquelle und den Teller scheppern, jeweils gute fünf Sekunden lang, und auf dem Display erstrahlte zuverlässig weiter die Null. Zu gegebener Zeit sollte mir klarwerden, dass Bob den Leistungsumfang des Geräts falsch dargestellt hatte; von extremen Fällen abgesehen, konnte es ausschließlich radioaktive Einstrahlung messen, also die Radioaktivität, die einen umgibt wie die Luft. Der Unbedenklichkeit des Trinkwassers von Tokio würde ich blind vertrauen müssen. Missmutig hockte ich neben meiner Nachbarin, fragte mich, ob mein Spielzeug defekt geliefert worden war, und malte mir aus, wie die Strahlung mir das Bein verbrutzelte. Warum nahm sie nicht wenigstens den Teller weg?
Ich ließ mein Dosimeter die ganze Nacht über am Bett liegen, und am Morgen stand es noch immer auf null. Aber dann war es der Ratschluss der Strahlungsgötter, mir ein Zeichen zu senden. Da der Hirntumor meines besten Freundes wieder zu wachsen begonnen hatte (oder auch nicht, je nachdem, welchen Arzt man fragte), war die Zeit für die OP mit dem Gamma-Messer gekommen. Seine Frau und ich begleiteten ihn in die Cybermesser-Kammer, wo man ihn festschnallte. Dann setzten wir uns wieder ins Wartezimmer und machten uns Sorgen um ihn. In dieser Zeitspanne von zehn Minuten registrierte das Dosimeter 0,1 Millirem. Bedeutete das, dass hier Streustrahlung in der Luft war, oder einfach, dass mein Dosimeter in 0,1-Millirem-Schritten anzeigte? Egal, das Leben sah schon rosiger aus. Ich beschloss, Millisievert zu vergessen und ganz in Millirem zu machen.
Mein Handbuch für radioaktive Störfälle (ein Geschenk der Nachbarin mit dem orangefarbenen Teller) belehrte mich, 0,05 Millirem oder weniger pro Stunde fielen unter normale Hintergrundstrahlung; auch 0,1 Millirem seien noch nichts Außergewöhnliches; die Durchschnittsdosis (in den USA, wie ich vermute) liege bei 360 Millirem pro Jahr – ein erschreckend hoher Wert, denn bei 365 Tagen mit 0,1 Millirem kommt man nur auf 36,5 Millirem. Bestimmt hat unser Autor ein Paar Röntgenaufnahmen des Thorax, Langstreckenflüge und Pyjamaparties in Ritterburgen voller Radon mit eingerechnet. Ein Messwert von über 0,1 Millirem pro Stunde, erfuhr ich, sei besorgniserregend.4 Ich war nicht besorgt, denn meine Messwerte in San Francisco und Sacramento lagen in der Größenordnung von 0,1 Millirem pro Tag.
Das Handbuch für radioaktive Störfälle riet mir, meine Dosis als Angehöriger von »Einsatzkräften« der besten offiziellen Sorte jederzeit auf 5 Rem zu begrenzen; das sollte also meine Obergrenze für Japan sein. 5 Rem, geteilt durch zehn Tage, das machte 500 Millirem pro Tag oder das Fünftausendfache dessen, dem ich in San Francisco ausgesetzt war. Der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde zufolge konnten erste leichte Symptome bei 30 Rem auftreten. Strahlenkrankheit zeige sich bei 70 bis 100 Rem. Bei über 350 Rem seien Rückfälle nach der Gesundung wahrscheinlich. 250 bis 500 Rem seien für 50 Prozent der Menschen innerhalb von 60 Tagen tödlich. (Klingt Rem nicht ein wenig nach Röntgen? Stimmt, »rem« ist die Abkürzung für »roentgen equivalent in man«.) Bei 5000 Rem (oder auch 50 Sievert) sterben alle Patienten innerhalb von 48 Stunden.5
In Japan sprangen die Behörden fröhlich zwischen Millisievert pro Stunde für Luft und Becquerel für Trinkwasser hin und her. Ersteres ist eine Einheit für biologische Schädigung; Letzteres hat mit dem radioaktiven Zerfall von Atomkernen pro Sekunde zu tun. Mir ist dort drüben niemand begegnet, der beide auseinanderhalten konnte.
Meinem Freund Dave Golden, der überall mitmischt, gelang es irgendwie, mir einen Termin bei Dr. Jean Pouliot zu verschaffen, dem stellvertretenden Leiter der Onkologie am Mount Zion Hospital in San Francisco. Dr. Pouliot war ein sympathischer Mann mittleren Alters. Eine unaufgeregt kompetente, hübsche junge Physikerin namens Josephine Chen begleitete ihn. Dr. Pouliot schloss die Tür eines fensterlosen Raums auf, nahm ein Messgerät von der Größe eines kleinen Laptops und näherte sich einem Stahlschrank mit einer Strahlungswarnung an der Tür. Das Messgerät schlug nicht aus. Mein Dosimeter auch nicht. Seufzend schloss er den Schrank auf, schob ein Häuflein Bleiziegel beiseite und zog einen zylindrischen Gegenstand hervor. Noch immer zeigte sein Messgerät nichts an; offenbar war der Akku leer. Josephine hielt mein Dosimeter nah an den Gegenstand, und das Alarmgeräusch ertönte. Ich war zufrieden. In unserer Viertelstunde in diesem Raum bescherte uns Gott himmlische 0,6 Millirem!
»Nun, das ist ein bisschen viel«, sagte Dr. Pouliot. »Vielleicht legen wir es besser wieder weg.«
Da sein Messgerät kaputt war, konnte ich mein Dosimeter nicht daran kalibrieren. Meine Erfahrung mit dem orangefarbenen Teller meiner Nachbarin hatte mir Grund zu der Vermutung gegeben, dass es im unteren Bereich unempfindlich oder ungenau war. Aber es regte sich doch wenigstens irgendwie. Ich hatte meine Hausaufgaben vielleicht nicht gut gemacht, aber ich hoffte auf eine Eins für Fleiß.
Dr. Pouliot fand meine Dosis von 5 Rem als Obergrenze ein wenig gefährlich. Als ich ihm die Seite in meinem Handbuch für radioaktive Störfälle mit der Empfehlung der Umweltbehörde zeigte, sagte er dann großzügig, die würden schon wissen, was sie tun.
Tags darauf flog ich nach Japan und setzte mich in elfeinhalb Stunden 1,2 Millirem aus (ungefähr einem Achtel einer Röntgenaufnahme des Thorax).6
II. EINE GESCHICHTE VON DINGEN, DIE KAUM ZU GLAUBEN SIND UND ZU VERSTEHEN SCHON GAR NICHT
AM 11. MÄRZ 2011 WURDE DIE Ostküste der japanischen Hauptinsel von einem Erdbeben der Stärke 9 getroffen. Ein Tsunami folgte. Am Tag bevor ich aus Tokio ins Katastrophengebiet aufbrach, summierten sich die Opferzahlen wie folgt: 12 175 Tote; 15 489 Vermisste; 2 858 Verletzte.7





























