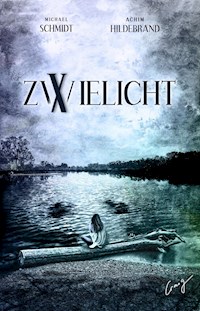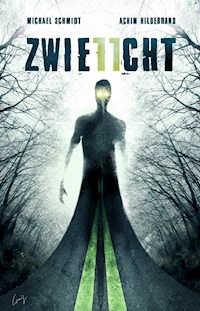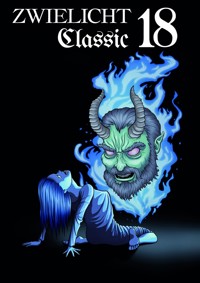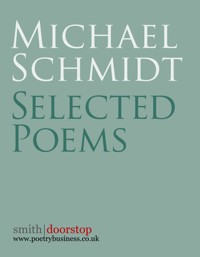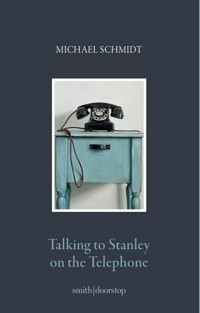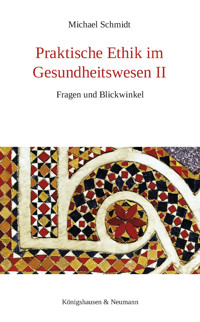Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In Murmansk, im Nordpolarmeer, liegen die radioaktiven Überreste des Kalten Krieges: die abgewrackten U-Boote der Sowjetflotte. Auch die Überreste der "Kursk" sind hier gelagert. Was tun mit all dem Atom-Müll, zumal in Russland Geld und Fachkräfte für die Entsorgung fehlten? Die Russen machten sich kundig, um Know-how und Fachleute zu finden. Und wurden fündig in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde das einstige DDR-Kernkraftwerk Nord als erstes der Welt wirklich entsorgt – nicht nur verlagert. Und so beginnt vor rund einem Jahrzehnt eines der größten deutsch-russischen Gemeinschaftsprojekte. Der Autor, Journalist beim NDR, begleitete jahrelang die Arbeiten und berichtet in seinem Buch über diese sehr spezielle und nicht ungefährliche Abrüstung und über eine deutsch-russische Erfolgsgeschichte abseits der herrschenden Russland-Meinung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Abbildungen: Robert Allertz, Archiv EWN GmbH, Screenshot Russisches Fernsehen »Nowosti«
ISBN E-Book 978-3-360-50149-3ISBN Buch 978-3-360-01330-9
© 2018 Verlag Das Neue Berlin, BerlinUmschlaggestaltung: Verlag, Peter Tiefmann
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlinerscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel.com
Das BuchDie Langzeitbeobachtung des Autors ist eigentlich eine Weltsensation. Die Russen ließen einen westlichen Journalisten zwölf Jahre lang in eine Sperrzone, die nicht einmal Landsleute betreten dürfen. Nicht minder spektakulär die Tatsache, dass ein deutsches Unternehmen der Großmacht Russland hilft, helfen darf, sein atomares Erbe so zu entsorgen, dass eine Umweltkatastrophe verhindert wird. Und schließlich: Das ostdeutsche Unternehmen aus Lubmin erwarb dort Erfahrungen, die es inzwischen weltweit führend auf diesem Felde macht. Neue Aufgaben warten. Schmidt beweist mit dem Report überdies, dass eine konstruktive Zusammenarbeit mit Russland auch in schwieriger Zeit möglich, nötig und für beide Seiten profitabel ist.
Der AutorMichael Schmidt, geboren 1954 in Schwerin, Diplomjournalist, Redakteur für Publizistik beim Deutschen Fernsehfunk in Berlin-Adlershof, seit 1992 Redakteur beim NDR und Chef vom Dienst des Studios Meckenlenburg-Vorpommern in Schwerin. Im Verlag erschien in mehreren Auflagen »Der Fall Beluga. Ein Unglück auf der Ostsee und wie es vertuscht wurde«.
Obwohl ich Detlef Mietann und Nikolai Kniwel mit meiner Fragerei ab und zu bestimmt genervt habe, ließen sie es sich nicht anmerken. Herzlichen Dank für die Geduld. Michael Schmidt
Inhalt
Matthias Platzeck: Erfolgreiche und stille Kooperation
Auf dem weltgrößten atomaren Schrottplatz
Von Kananaskis an den Rocky Mountains nach Jekaterinburg am Ural
Die Dialektik von Aufbauen und Abreißen
Vom Kernkraftwerk Nord zu den Energiewerken Nord
Ein Moskauer Institut schreibt Weltgeschichte
Der Schiffsfriedhof im Angesicht von Marx und Lenin
Dieter Rittscher – Castor-Erfinder mit Faible für Atom-U-Boote
Der Kommilitone aus dem U-Boot
Krieg und nochmals Krieg und Frieden in Murmansk
Auf Kontrollgang mit Detlef Mietann und Nikolai Kniwel
Sneshnogorsk ganz privat
Besuch eines deutschen Ministers, Ärger mit einer deutschen Zeitschrift und Fragen russischer Umweltschützer
Von der Schwierigkeit, gute Nachrichten zu überbringen
Eine Rechtsanwältin für eintausend Verträge
So viel Natur war hier lange nicht
Eine Terrasse mit Blick auf die Krim und den unbegreiflichen Putin
Am Ende üben sich Kanzlerin und Präsident in Zurückhaltung
Die neue Aufgabe: Nowaja Semlja
Erfolgreiche und stille Kooperation
Der Krieg im Norden begann am 29. Juni 1941. Gegen 3 Uhr überquerten deutsche Gebirgsjäger und ihre finnischen Verbündeten die finnisch-sowjetische Grenze bei Petsamo. Ihr Ziel war die Stadt Murmansk. Hitler gab ihnen mit auf den Weg, »die lächerlichen hundert Kilometer von Petsamo nach Murmansk zu bezwingen«. Dreimal sollten es die Gebirgsjäger in kurzen Intervallen versuchen, dann gaben sie auf. Die Operationen »Platinfuchs« und »Silberfuchs« endeten jeweils in einer Niederlage. Nie kamen die deutschen Truppen näher als vierzig Kilometer an Murmansk heran.
Warum wurde die Stadt so hartnäckig verteidigt? Die Kola-Halbinsel nördlich des Polarkreises besaß überlebenswichtige und strategische Bedeutung. Der Hafen von Murmansk war ganzjährig eisfrei und für die Sowjetunion das Tor zum Nordatlantik. Mit dem Wasser des Golfstroms kamen bald auch die Versorgungsschiffe, beladen mit Rüstungsgütern, Lastwagen und Lebensmitteln aus den USA, die im Rahmen des »Lend Lease Act« geliefert wurden. »Die zweite Front« nannten die Rotarmisten die Corned-Beef-Dosen, die über Murmansk ins Land kamen. Die Sowjetunion leistete, auf diese Weise unterstützt von ihren Verbündeten, in der Antihitlerkoalition einen wesentlichen Beitrag zur Befreiung Europas vom Faschismus.
Als der heiße Krieg 1945 endete, begann jedoch bald der Kalte Krieg zwischen den einstigen Alliierten. Für Murmansk änderte sich nichts: Es blieb militärisches Sperrgebiet. In den vielen Buchten der Kola-Halbinsel entstanden weitere Werften und Basen der sowjetischen Nordmeerflotte. Forciert wurde der Ausbau noch, nachdem die Bundesrepublik der NATO beigetreten war und die Ostsee-Ausgänge für sowjetische U-Boote und Kampfschiffe im Ernstfall unsicher wurden. Bald schon konzentrierte sich dort oben der größte Teil der strategischen Unterseeboote der sowjetischen Flotte: atomar angetrieben und mit Nuklearwaffen bestückt.
Allerdings verschleißen auch Atomreaktoren. Doch im Unterschied zu einem Schiffsdiesel, den man verschrotten kann, strahlt ein Reaktor noch eine Ewigkeit. Die unendliche Weite des Landes und die Abgeschiedenheit der Region verführten dazu, die außer Dienst gestellten Unterwasserschiffe einfach zu vertäuen und vor sich hinstrahlen zu lassen. So entstand in Jahrzehnten ein gewaltiger Schiffsfriedhof, die wohl größte atomare Müllkippe der Welt.
Dessen waren sich sowohl die russische Führung, die das Erbe der 1991 untergegangenen Sowjetunion angetreten hatte, als auch der Westen bewusst. Wie eben auch der ökologischen Konsequenzen für die Welt, die sich daraus ergaben. Es bedurfte nicht erst der Katastrophe von Tschernobyl, um allen begreiflich zu machen, dass strahlendes Material sich nicht von geografischen, politischen oder ideologischen Grenzen aufhalten lässt. Von Murmansk und Umgebung ging eine globale Bedrohung aus. Ihr musste auch international beigekommen werden.
Dieser richtigen Erkenntnis standen nationale und Sicherheitsinteressen entgegen: Noch immer war in dieser Region Russlands strategische Nordmeerflotte stationiert, weshalb man sich nicht in die Karten schauen lassen mochte. Und wenn die Großmacht Ausländern die Demontage übertrug, bewies sie, dass sie zwar Atomreaktoren bauen, diese aber nicht entsorgen konnte. Diese Blöße wollte sich, verständlicherweise, der Kreml nicht geben. Zumal nicht auszuschließen war, dass diese Tatsache propagandistisch ausgeschlachtet werden könnte.
Über sogenannte Männerfreundschaften wird oft gehöhnt. Fakt ist, wie Ostdeutsche zu sagen pflegen, dass Gerhard Schröder und Wladimir Putin im Oktober 2003 in Jekaterinburg auch über dieses Problem miteinander sprachen und wie es zu beseitigen wäre. Daraus wurde dann im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft ein deutsch-russisches Vertragswerk von etwa tausend Einzelverträgen. Dieses Regierungsabkommen lief 2004 an. Verkürzt formuliert sah es vor: Deutschland liefert das Know-how und die finanziellen Mittel, um gemeinsam mit russischen Partnern ein Langzeitzwischenlager für Reaktorsektionen nach internationalen Sicherheitsstandards in der Saida-Bucht zu errichten. Das nützte nicht nur der Welt, sondern auch den vielen einst in der Sowjetunion ausgebildeten deutschen Reaktorspezialisten, die in den 1990er Jahren das Kernkraftwerk Nord in Lubmin und das KKW Rheinsberg demontiert hatten. Sie waren die ersten weltweit, die Atomkraftwerke zerlegt und dabei Erfahrungen gesammelt hatten wie kein anderes Unternehmen auf der Welt.
Das Ganze war (und ist) also eine klassische Win-Win-Situation.
Die seinerzeit entspannten und vernünftigen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland – zum Beispiel hatte Präsident Putin 2001 im Deutschen Bundestag über deren Perspektiven gesprochen – gingen alsbald verloren. An Partnerschaften sind immer zwei Seiten beteiligt, und wenn etwas in die Brüche geht, ist nie nur eine Seite schuld.
Doch trotz der Sanktionen wurde und wird dieses Vorhaben auf der Kola-Halbinsel erfolgreich realisiert, wie Michael Schmidt in seinem Buch dokumentiert. Der NDR-Mitarbeiter war zwölf Jahre lang regelmäßig vor Ort und begleitete publizistisch dieses Vorhaben, er war der einzige deutsche Fernsehjournalist, dem die russische Seite dies über eine so lange Zeit hinweg erlaubte – wohl auch um die legitime deutsche Neugier zu bedienen, ob die vielen hundert Millionen Euro auch tatsächlich für den Zweck ausgegeben wurden, für den sie gedacht waren. Nun, daran besteht nicht der geringste Zweifel.
Matthias Platzeck ist Mitglied des Deutsch-Russischen Forums, das sich seit 1993 für einen breiten gesellschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und Russland engagiert. Ihm gehören über 400 Persönlichkeiten in leitender Position in Konzernen, in kleinen und mittleren Unternehmen wie auch in Politik, Medien, Wissenschaft und Kultur an
Für mich ist diese erfolgreiche, wenngleich stille Kooperation ein überzeugender Beweis, dass einerseits auch bei Interessengegensätzen und Konflikten mit Russland eine Zusammenarbeit grundsätzlich möglich ist. Und dass andererseits davon alle Beteiligten profitieren. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, so muss man nüchtern konstatieren, dass es dem Frieden und dem Wohlstand auf unserem Kontinent immer zuträglich war, wenn Russen und Deutsche und Deutsche und Russen sich verbündeten und vernünftig miteinander umgingen. Und dass sich die Völker nicht aus ideologischen Gründen aufeinanderhetzen lassen dürfen wie während des Zweiten Weltkrieges oder im Kalten Krieg. Die Schäden sind gewaltig, sie zu beheben kostet noch einmal so viel. Und diese Mittel fehlen bei der Lösung anderer, vordringlicher Weltprobleme.
Matthias Platzeck
Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums e.V.
Auf dem weltgrößten atomaren Schrottplatz
Was für ein Tag. Minus 15Grad, Sonnenschein, ein leuchtend blauer Himmel. Die weite Landschaft makellos bedeckt von Schnee. Schön und beruhigend. Wenigstens hier gibt es ihn noch, den richtigen Winter. Genau so muss er aussehen. Ich habe vergessen, wann so eine weiße Pracht das letzte Mal zu Hause zu bewundern war. In Deutschland, zumal an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern, sind knarzender, dicker Schnee und knackende Eisschollen seltene Erlebnisse geworden. Darum weiter verträumt aus dem Autofenster schauen. Ich sitze in einem Kleinbus und bin unterwegs von der Hafenstadt Murmansk weiter in Richtung Norden. Die Straße verläuft parallel zum Kola-Fjord, der benannt ist nach der gleichnamigen Halbinsel im äußersten Nordwesten Russlands. Die schmale Bucht windet sich von Murmansk aus über 57 Kilometer durch die teils felsige Tundra und mündet in die Barentssee. Die imaginäre Linie des Polarkreises liegt weit, weit im Süden. Dennoch ist der Kola-Fjord das ganze Jahr über ein offenes und für den Schiffsverkehr freies Gewässer. Dafür sorgt der wärmende Golfstrom.
Der Kleinbus gehört zu einem langen Autokonvoi. Vorneweg ein Lada-Niva-Jeep der Polizei, der während der gesamten Strecke mit blinkendem Blaulicht für freie Fahrt sorgt. An Bord der Fahrzeuge dahinter sind Leute des Moskauer Kurtschatow-Instituts, der Energiewerke Nord aus dem vorpommerschen Lubmin und des Bundeswirtschaftsministeriums. Und mittendrin wir, deutsche und russische Journalisten und Kamerateams. Mit jedem Kilometer, den die Kolonne auf der von Schnee und Eis bedeckten Straße zurücklegt, steigt die Spannung. Denn natürlich unternehmen wir keine Wintersafari durch die russische Polarregion. Die Russen haben eigene und deutsche Medien eingeladen, um eine neue Offenheit zu demonstrieren. Erstmals darf ein streng abgeriegeltes militärisches Sperrgebiet besichtigt werden. Ein Städtchen namens Sneshnogorsk. Dieser Ort steht immer noch auf der Liste der Geschlossenen Städte Russlands und dürfte bisher nur Militärs, Werftarbeitern und Atomphysikern bekannt sein. Und – nicht zu vergessen – den Geheimdienstlern des Föderalen Dienstes für Sicherheit der Russischen Föderation, kurz FSB. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass US-amerikanische Militärs mittels ihrer Spionagesatelliten vom Weltraum aus garantiert ebenfalls mit aufmerksamen Augen auf diesen abgelegenen Landstrich starren. Wegen einer dazu gehörenden Reparaturwerft für U-Boote ist Sneshnogorsk ein Standort für die strategische Atom-U-Boot-Flotte Russlands. Vor allem aber gehört diese komplett abgeschottete Gegend zur wohl größten und gefährlichsten atomaren Schrottkippe. Fast jeder fünfte Kernreaktor der Welt befindet sich auf der Kola-Halbinsel – in Kraftwerken, Eisbrechern und U-Booten. »Die Nordmeerflotte alleine verfügt über 142 U-Boote und drei Kreuzer, die von mehr als 300 Reaktoren angetrieben werden. Hinzuzuzählen sind noch 10 Eisbrecher und ein Containerschiff. Die durchschnittliche Betriebszeit eines Atom-U-Bootes beträgt ca. 20 Jahre.«1
Was danach übrig bleibt, sind riesige Mengen nuklearen Abfalls. Eine tickende Zeitbombe von gewaltigem Ausmaß bedroht Mensch und Natur. In der abgeschirmten Sperrzone von Sneshnogorsk wollen Russen und Deutsche erstmals öffentlich zeigen, ob und wie man dieser todbringenden Gefahr Herr werden kann. Dieser 30. März 2004 darf deshalb getrost als eine Zäsur im Umgang Russlands mit seinen nuklearen und militärischen Hinterlassenschaften angesehen werden. Denn was sind schon Satellitenbilder aus 300 Kilometern Entfernung im Orbit gegen einen Besuch an Ort und Stelle? Nicht mehr als ein verklemmter Blick durchs Schlüsselloch gegen das reale Leben.
Filmkameras und Fotoapparate werden ausgepackt. Gleich wird sich zeigen, ob die russischen Behörden ihre Zusage einhalten und was ein wochenlanger Schriftverkehr, Dutzende Telefonate, offizielle Einladungsschreiben, pompöse Amtsstempel, Journalistenvisa und Akkreditierungskärtchen des russischen Außenministeriums tatsächlich wert sind. Ob sich Glasnost gegen Geheimniskrämerei durchsetzt.
Nach einer dreiviertelstündigen Fahrt halten die Autos am Kontrollpunkt. Jeweils links und rechts der Straße ein Flachbau, überspannt von einer flachen Dachkonstruktion, darauf prangt in großen Buchstaben das Ziel unserer Reise – Sneshnogorsk. Wir sind tatsächlich angekommen. Die Wachposten sammeln Reisepässe und Akkreditierungen ein und verschwinden damit in den Bürocontainern. Ausnahmslos alle Ankömmlinge werden überprüft – egal, ob russische Spezialisten, Mitarbeiter der Lubminer Energiewerke oder deutsche Journalisten. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Unwillkürlich male ich mir aus, wie wohl ein Durchchecken an den Toren des geheimen Stützpunktes Area51 Groom Lake der US Air Force in Nevada ausfallen würde. Nachlässiger oder lascher auf keinen Fall.
Viel Zeit zum Rauchen oder Beinevertreten ist nicht. Nach ein paar Minuten schon sind alle amtlich gecheckt. Niemand muss draußen bleiben, alle dürfen rein ins Sperrgebiet. Von einer Stadt ist nichts zu sehen. Keine Siedlung, kein Wohnhaus. Wahrscheinlich befindet sich das eigentliche Sneshnogorsk hinter einem der felsigen Hügel. Nächster Halt – das Schiffsreparaturwerk Nerpa, eine Reparaturwerft vor allem für U-Boote. »Nerpa« ist auch das russische Wort für Ringelrobbe. Diese Tiere bewohnen weite Teile der Nordpolarregion. Hier sind sie nicht zu sehen. Das Raunen, das durch unseren Kleinbus geht, wird von anderen Dingen hervorgerufen. Große U-Boote, die an Land festgemacht haben, sind zu erkennen. Einige liegen wie gewaltige gestrandete Wale im halb vereisten Werftbecken. Dahinter dümpeln zivile Fischtrawler. Unschwer ist deren Herkunft zu erkennen – die Stralsunder Volkswerft/DDR. Ramponiert, wie die Schiffe jetzt aussehen, muss ihre letzte Ausfahrt auf hoher See schon Jahre zurückliegen. Mehr als ein erster flüchtiger Blick auf die Werft ist nicht möglich. Alle Besucher werden in einen Konferenzraum des Verwaltungsgebäudes gebeten. An einem langen Tisch nehmen die russischen und deutschen Verantwortlichen für das Projekt »Entsorgung von Atom-U-Booten« Platz. Die versammelte Runde – zumeist sind es Herren – hat sich vor über einem Jahr zum ersten Mal getroffen. Es sind Experten, die sich auskennen mit der Atomenergie und mit der Marine. Die Deutschen aus Lubmin und Berlin wissen besonders Bescheid, wenn es um den Aufbau und mehr noch um den Abbau von Atomreaktoren geht. Die Russen aus Sneshnogorsk und Moskau befassen sich hauptsächlich mit der Konstruktion und der Demontage von Atom-U-Booten.
Es folgen Vorträge voller technischer Einzelheiten, mit Zahlen, Planungsetappen und Millionensummen. Zu viel für ungeduldige Journalisten. Nur ein Eindruck, der bleibt hängen: auf ein derart ehrgeiziges gemeinsames Unterfangen haben sich Deutschland und Russland schon lange nicht mehr eingelassen. Das Drumherum ist entsprechend. Nach dem großen, ganzen Überblick gibt man uns nicht minder wichtige Kleinigkeiten auf den Weg. Das übernimmt der hauseigene Direktor für Sicherheit, der schon auf uns wartet. Er stellt sich kurz vor – Wladimir Panjow. Wir Journalisten erhalten von ihm klare Ansagen, wie wir uns von jetzt an zu verhalten haben. Was wir tun dürfen und was zu unterlassen ist. Freundlich, aber bestimmt. Die dazu passende Mimik und Gestik von ihm und seinen Sicherheitsleuten lässt keinen Zweifel aufkommen – wer sich nicht an die Verhaltensregeln hält, kann einpacken. Aber auch die offiziellen und geheimen Ordnungshüter scheinen nervös zu sein. Diese quirlige und neugierige Journalistenmeute ist bestimmt unberechenbar. Obendrein sind Ausländer dabei. So etwas gab es hier noch nie. Was sind das für Zeiten? Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Aber wenn die Natschalniki, die Chefs in Moskau, meinen …
Schneebedeckter U-Boot-Rumpf in der Bucht von Saida
Die Befürchtungen der vielen Herren von der Sicherheitsabteilung und vom FSB sind so abwegig nicht. Denn kaum kommen wir auf dem eigentlichen Betriebsgelände der Nerpa-Werft an, hält sich niemand mehr an die gestrengen Anweisungen. Das wäre von uns Journalisten auch zu viel verlangt. Betreten wir doch gerade eine andere Welt. Überall Schrottberge und ausrangiertes Metall. Ein Bagger, ausgestattet mit einer monströsen Zange am Ausleger, macht sich an bizarren Eisenskeletten zu schaffen und belädt LKW. Hier ein lädierter Schiffspropeller, dort ein Knäuel von Eisenrohren. Arbeiter versuchen, den Unmengen von altem Stahl und Eisen mit Schneidbrennern und stoischer Gelassenheit beizukommen. Die immer noch bedrohlich wirkenden Rümpfe angerosteter U-Boote recken sich den Kameras und Fotoapparaten entgegen. Das sind Motive, das sind Bilder! Die leblose und rostbraune Endzeit-Welt eines Mad Max hat sich in der Arktis breitgemacht.
Wir Journalisten sind ausgeschwärmt. Es wird gefilmt, notiert und interviewt. Unsere Aufpasser laufen anfänglich aufgeregt umher und wollen die Fernsehteams irgendwie dirigieren. Dann winken Wladimir Panjow und seine Leute ab. Der vorbereitete und geordnete Rundgang hat sich erledigt. Was soll’s, irgendwann werden alle Aufnahmen im Kasten sein und die Medienleute sind wieder ansprechbar. Wsjo budjet – das wird schon. Mehr als vierzig Jahre lang war dieser Zipfel am Rande Russlands von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist Betreten ausdrücklich erlaubt.
Holger Schmidt schaut sich das Treiben an, lächelt verschmitzt und wiegt fast ungläubig sein von einer dicken Pelztschapka bedecktes Haupt. »Das ist schon eine kleine Sensation, was wir heute hier erleben«, sagt er. Der Mann muss es wissen. Seit über einem Jahr reist er gemeinsam mit anderen Kollegen der Energiewerke Nord Lubmin regelmäßig an die Barentssee. Schmidt ist der deutsche Leiter des Projektes »Entsorgung von Atom-U-Booten«. Anfangs durften er und die anderen Deutschen einen Fotoapparat ins Sperrgebiet nicht mal mitnehmen, geschweige denn benutzen. Aber seitdem ist Vertrauen gewachsen. »Wir haben von unseren russischen Partnern solche Besuche wie den heute sogar gefordert. Hier muss einfach Öffentlichkeit her. Damit wir in fünf oder sechs Jahren wirklich klarmachen können, was geleistet wurde, müssen wir heute die Ausgangssituation zeigen. Erst dann wird die Größe unserer Aufgabe wirklich klar.« Und man solle auch nicht vergessen, dass die vielen Millionen Euro, die Deutschland dafür ausgeben wird, Steuergelder sind. »Die Leute zu Hause haben also einen Anspruch darauf zu erfahren, wohin das Geld geht.« Deutsches Steuergeld für Abrüstung – nicht die schlechteste Idee.
»Dort drüben«, redet Schmidt weiter und zeigt auf große Stahlzylinder hinter einer mit Stacheldraht bedeckten Mauer, »liegen die sogenannten Reaktorsektionen der U-Boote. In jeder arbeiteten seinerzeit zwei Kernreaktoren und lieferten Energie.« Jeder einzelne dieser nuklearen Energieerzeuger war so stark wie der des DDR-Kernkraftwerkes in Rheinsberg. Permanente Energie für monatelange Einsätze der Schiffe rund um den Globus in allen Ozeanen. Schmidt gibt noch andere technische Erläuterungen. Die U-Boote sind demnach in einzelne Sektionen aufgeteilt. Die Reaktoren, also die Mini-Atomkraftwerke, befanden sich zumeist im hinteren Drittel der Unterwasserschiffe, in eben jener Reaktorsektion. Wird ein U-Boot ausgemustert und verschrottet, werden zuerst Reaktoren und Brennstäbe ausgebaut. Doch die nun leeren Stahlzylinder, die aussehen wie große dicke Röhren, sind natürlich kontaminiert. Von ihnen geht eine gefährliche radioaktive Strahlung aus. Deshalb die Mauer, deshalb Stacheldraht und Warnschilder.
Das alles macht – zugegeben – nicht unbedingt einen vertrauenswürdigen Eindruck. Die Absperrung ist nicht sehr hoch, und wer es unbedingt will, käme ohne weiteres dicht heran. Zu dicht. Trotzdem lasse sich an dieser irgendwie beängstigend provisorisch anmutenden Ausmusterung die große gemeinsame Aufgabe von Deutschen und Russen verdeutlichen, meint Schmidt.
Sein Stellvertreter ist hinzugekommen, Detlef Mietann. Die beiden Männer holen Planungspapiere aus einer Mappe, blättern sie auf und erklären, wie sich die Werft und diese ganze Zone am Nordpolarmeer bald verändern werden. Die Art, wie sie reden und wie sie dabei konzentriert bei der Sache sind, erlaubt außenstehenden Beobachtern nur einen Schluss: Hier, am frostigen Ende Europas, wird eine Riesenaufgabe angepackt. Zwei weitere Männer treten heran und mischen sich ins Gespräch. Es sind der russische Projektleiter und sein Stellvertreter – Anatoli Warnawin und Nikolai Kniwel vom Kurtschatow-Institut. Unvermittelt gleitet das Gespräch ins Russische über. Die vier sind seit über einem Jahr zu Partnern geworden, das Sperrgebiet an der Barentssee ist ihr gemeinsamer Arbeitsort.
Sie berichten über die ersten Schritte zur Abrüstung der Nordmeerflotte. Den Anfang haben die Russen allein gemacht und die ersten 40 ausrangierten Atom-U-Boote zerlegt. Selbstverständlich wurden die Atomreaktoren und Brennstäbe ausgebaut. Die kontaminierten Reaktorsektionen schwimmen jedoch höchst unsicher in einer kleinen Bucht der Barentssee, ein paar Kilometer von der Nerpa-Werft entfernt. Es sind die lebensbedrohenden Reste der nuklear betriebenen Unterwasserschiffe, und sie rosten von Jahr zu Jahr mehr dem endgültigen Verfall entgegen. Für die Umwelt und nicht minder für das nahegelegene Murmansk stellen sie eine ständige Bedrohung dar. Die vergammelten Stahlkolosse müssen also schleunigst aus dem Wasser geholt und für eine abgeschirmte, sichere Lagerung an Land präpariert werden. Etwa siebzig Jahre lang geht von den Reaktorsektionen dann immer noch eine tödliche Gefahr aus. Erst danach können die Stahlkonstruktionen ganz normal verschrottet werden. Das heißt: ein Langzeitzwischenlager muss gebaut werden. Allerdings nicht nur für die paar U-Boot-Röhren, die wir gerade auf dem Werftgelände sehen. Nein – wir sind in Russland. Und da wird bekanntlich geklotzt und nicht gekleckert: Weitere 80 Atom-U-Boote warten dringend auf ihre Entsorgung. Jedoch tut sich da nichts. Niemand weiß, wohin mit den gewaltigen Mengen an strahlendem Schrott. Dessen Dimensionen sprengen die landläufigen Vorstellungen von gefährlichem Abfall. Ein einziges Atom-U-Boot ist 150 bis fast 170 Meter lang, eine Reaktorsektion mindestens 12 bis 14 Meter. Dafür fehlt es an Land und auf dem Wasser schlicht an Platz. Mit den bisherigen technischen Lösungen ist kein Weiterkommen möglich. Das mussten auch die Russen wohl oder übel einsehen.
Ist man einmal dabei, soll das Großreinemachen auf die gesamte Kola-Halbinsel ausgedehnt werden. Es wird endlich Zeit, nicht nur dem radioaktiv verseuchten Schrott der großen Art zu Leibe zu rücken. Ein Entsorgungszentrum für kleinere radioaktive Abfälle soll das übernehmen. Vorerst ist das alles Zukunftsmusik. Heute ist es Werftdirektor Alexander Gorbunow wichtig, seinen Gästen vor allem Gegenwärtiges zu präsentieren. Er sieht auf seine Uhr und drängt zur Eile. Die große Schiffbauhalle soll besichtigt werden. Die Russen haben sich entschieden – wenn schon Offenheit, dann richtig. Besonders die Ausländer sollen auf keinen Fall den Eindruck mitnehmen, man würde unangenehme Sachen verschweigen. Was im Übrigen bei der Menge angesammelter Probleme auf Dauer ohnehin kaum gelingen dürfte.
Im Inneren der Halle zerlegen Arbeiter ein U-Boot. Teilweise haben sie die Außenhaut schon entfernt. Auf dem Boden liegen Stahlteile aller Art und Größe umher. Die dominierende Farbe ist dieselbe wie draußen – ein ausgeprägtes Rostbraun. Darf das gefilmt werden? Dürfen wir da näher ran? Bitte. Selbstverständlich. Kein Problem. Sicherheitschef Panjow wirkt mittlerweile entspannt. Sogar an neugierige Journalisten kann man sich gewöhnen.
Ein hochrangiger Offizier in der schwarzen Uniform der Nordmeerflotte steht mit uns in der Halle und blickt nachdenklich auf das ausgeschlachtete U-Boot. Die Schulterstücke weisen ihn als Kapitän Ersten Ranges aus. Er stellt sich vor – Juri Kulepow, Leiter der Staatlichen Überwachung der nuklearen und radioaktiven Sicherheit im Verteidigungsministerium und in dieser Funktion zuständig für den Nordwesten Russlands. Kurz, er ist einer, der sich auskennt. Wie sich herausstellt, ist er selbst etliche Jahre auf Atom-U-Booten gefahren. Ich frage ihn nach seiner Gemütslage. Kommt da bei ihm, dem langgedienten Militär, Wehmut auf?
Innereien eines Atom-U-Bootes bei der Zerlegung
»Nein, überhaupt nicht«, erwidert er. »Wissen Sie, diese Schiffe hatten ihre Zeit. Sie sind 25, 30 und mehr Jahre alt und nicht mehr geeignet, um heutzutage noch durch die Meere zu fahren. Deshalb wurden sie ja auch außer Dienst gestellt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ich kann die Ingenieure hier auf der Werft deshalb gut verstehen. Was die U-Boote angeht, haben sie jetzt das Kommando.«
Als in der Ära des Kalten Krieges zwischen Ost und West die Aufrüstung auf dem Land, zu Wasser und in der Luft zu einem aberwitzigen Wettrennen ausartete, scherten sich weder Militärs noch Politiker um die Entsorgung des atomaren Mülls. In den Kriegsflotten »galt das Hauptinteresse dem Entwurf und der Konstruktion von Atom-U-Booten und verschiedenen Raketensystemen. Während das erste sowjetrussische Atom-U-Boote bereits 1957 vom Stapel lief, wurden Einrichtungen zur Handhabung und Lagerung radioaktiven Abfalls erst Anfang der 60er Jahre fertiggestellt.«2
Wir steigen wieder in die kleinen Busse. Holger Schmidt informiert, dass nun die Saida-Bucht besichtigt werde. Der Ort, wo Dutzende Reaktorsektionen der Atom-U-Boote im Wasser liegen. Nach gut drei Kilometern ist unser Auto-Konvoi da. Die Landschaft bietet ein grandioses Bild. Sanfte, schneebedeckte Hügel, deren felsiges Gestein immer mal wieder durchscheint. Die Vegetation ist erst recht im Winter kümmerlich, klein gehalten von einem rauen Klima. Nördlich, in grau-blauer Ferne, ist die Barentssee zu erahnen. Einer ihrer zahlreichen kleinen Ausläufer ist die Saida-Bucht. Eher ein verzweigter Fjord, aus dessen Wasser hier und da winzige Inseln und Felsköpfe ragen. Unverkennbar – das ist die Natur der Arktis. Also tief die saubere Luft einatmen und den Anblick genießen.
Leider wird die eisige Idylle massiv gestört. Vom Ufer aus reichen Piers hinaus auf das Wasser. Eine vertrauenserweckende Stabilität vermitteln sie nicht. Seitlich an ihnen sind die Reaktorsektionen der Atom-U-Boote festgemacht. So wie sie da im Wasser schwimmen, sehen sie aus wie riesige Fässer. Ein rotbrauner Schutzanstrich soll eine allzu schnelle Korrosion verhindern. Das ist nicht mehr als ein bisschen Kosmetik, die die rasche Korrosion der Hinterlassenschaft atomarer Waffensysteme nie und nimmer aufhalten kann. Die Zeit ist reif für eine gründliche Notoperation. Denn auf Dauer wird die empfindliche Natur der Arktis den Schiffsfriedhof, den die Menschen ihr aufgenötigt haben, nicht widerstandslos dulden.
Holger Schmidt, Anatoli Warnawin und ihre Kollegen sind sich dessen bewusst. Sie wissen auch, dass die klimatischen und naturgegebenen Eigenheiten des hohen Nordens zusätzlich ein schnelles Handeln gebieten. Urplötzliche Wetterumschwünge und ein rasanter Wechsel von Regen, Schnee und Sturm sind in dieser Region normal. Den im Wasser liegenden U-Boot-Sektionen setzt das außerordentlich zu. Von Jahr zu Jahr wird ihr Zustand bedenklicher. Überdies herrscht an der Küste der Barentssee ein starker Zyklus der Gezeiten. Die Spanne zwischen Ebbe und Flut, der sogenannte Tidenhub, beträgt mehrere Meter und bringt eine starke Tiefenflut mit sich.3