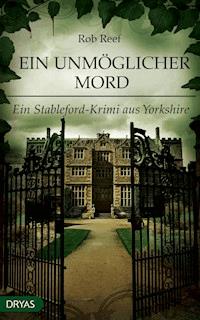Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Stableford-Krimi
- Sprache: Deutsch
England 1936. Acht Golfer folgen der Einladung des Bankhauses Milford & Barnes zu einem Golf-Wochenende in Cornwall. Obwohl von ihrem Gastgeber jede Spur fehlt, beschließen sie, das Turnier auszutragen. Doch es endet vorzeitig - mit einem Mord. Durch ein Unwetter von der Außenwelt abgeschnitten, beginnen sie, den Mörder auf eigene Faust zu suchen. Der Literaturprofessor Stableford, ein eifriger Leser von Kriminalromanen, übernimmt die Rolle des Detektivs nur allzu gern. Doch es gibt ein Problem: Er hat sich Hals über Kopf in die Hauptverdächtige verliebt. Für ihn steht fest, dass sie es nicht gewesen sein kann, aber sollte er sich wirklich auf sein Gefühl verlassen? Da geschieht ein zweiter Mord … Ein klassischer Detektivroman im Stil der 1920er und 1930er Jahre! Agatha Christie und Dorothy L. Sayers lassen grüßen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STABLEFORD
Ein Krimi aus Cornwall
von Rob Reef
Eine „Skizze des Petershead Golf Club“ sowie den „Plan des ersten Stockwerkes von Peters Inn – Grimpen Manor“ finden Sie am Ende des Buches.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Bilder
Impressum
Lesetipps
Die Suche nach dem Mörder wird in jedem Detektivroman ungemein dadurch vereinfacht, dass in jedem Fall der Autor der Täter ist. Elliot Paul
KAPITEL 1: 10 Uhr 30 ab Paddington
Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch, dachte John Stableford, Professor für Literatur am Londoner Lazarus College, als er sich einen Weg durch die graue Menschenmasse in der gewaltigen Halle der Paddington Station bahnte. Sein Ziel war der Zehnuhrdreißig nach Penzance, der berühmte Cornish Riviera Express. Es war ein kalter Oktobermorgen im Jahr 1936 und die Menschen, die sich an ihm vorbeischoben, trugen dicke Mäntel und Schals. Stablefords Gepäck bestand aus einem kleinen Reisekoffer und einer Golftasche aus Segeltuch. Fröstelnd tastete er nach dem Ticket in der Innentasche seines alten Tweedanzuges, den er dem Anlass entsprechend trug. Über diesen Anlass wusste er reichlich wenig. Die Einladungskarte, die er nur eine Woche zuvor mit der Nachmittagspost erhalten hatte, war knapp gefasst:
„Das Bankhaus Milford & Barnes gibt sich die Ehre, Sie, John Wickham Stableford, als langjährigen Kunden zu einem Golf-Wochenende in Peters Peter (Cornwall) einzuladen.
Wir haben uns erlaubt, für Sie ein Zimmer im Peters Inn (bei Peters Peter) zu reservieren. Das Turnier beginnt am Samstag um 8.30 Uhr. Gespielt wird Stableford.“
Obwohl er tatsächlich ein langjähriger Kunde dieses Bankhauses war, hatte Stableford das Schreiben zunächst für einen dummen Scherz gehalten, denn Witze über seine Namensgleichheit mit Dr Frank Stableford, dem Mediziner und Erfinder der im ganzen Land immer populärer werdenden Golfzählmethode, hörte er nicht nur in seinem Golfclub. Sprüche wie „Stableford spielt Stableford“ oder „Hey, Stableford, wie steht’s?“ waren auch unter seinen Studenten sehr beliebt. So war er nicht wenig überrascht gewesen, als nur einen Tag nach der Einladung und ohne Zusage seinerseits ein Brief mit einem Zugticket erster Klasse eingetroffen war. Da er allein lebte und ihn die Studien für sein neuestes akademisches Buchprojekt, „Die abenteuerliche Reise (Quest) als philosophischer Erkenntnisweg im Werke Joseph Conrads“, über viele Wochen an seinen Schreibtisch gefesselt hatten, war ihm die Entscheidung für Peters Peter letztlich nicht schwergefallen. Trotz seiner tiefen Abneigung gegenüber gesellschaftlichen Anlässen jeder Art erschien ihm das Wochenende auf dem Lande als eine willkommene Abwechslung und ein geeignetes Mittel, seine geistige Erschöpfung zu überwinden.
Die große, dreiteilige Bahnhofsuhr der Paddington Station zeigte Viertel nach zehn. Am Bahnsteig Nr. 1 angelangt, wo der Express schon bereitstand, machte Stableford sich auf die Suche nach dem St.-Ives-Kurswagen erster Klasse. Er fand ihn im hinteren Teil des Zuges, klopfte die kurze Bulldog-Pfeife aus, die stets zwischen seinen Zähnen steckte, stieg ein und las – nun vollends von der Echtheit der Einladung überzeugt – seinen Namen an einer Abteiltür. Koffer und Golftasche waren schnell in den Gepäcknetzen des noch leeren Coupés verstaut, und bereits bevor sich der Zug in Bewegung setzte, saß Stableford an einem Tisch im Speisewagen. So begann seine abenteuerliche Reise.
KAPITEL 2: Die Dame im Zug
„Verzeihung, ist dieser Platz noch frei?“
Stableford sah von seinem Frühstück auf und verlor sich in einem graublauen Augenpaar. Vor ihm stand eine junge Frau von sieben- oder achtundzwanzig Jahren. Sie war schlank, trug ein grünes Tweedkostüm, dunkle Strümpfe und flache Schuhe. Ihr ovales, von kupferfarbenen Locken umrahmtes Gesicht war das Schönste, was er seit Langem gesehen hatte. Während er noch ungläubig darüber nachdachte, ob sich die oft besungene Liebe auf den ersten Blick so anfühlen mochte, bemerkte er, wie sich ihr zunächst freundlicher Gesichtsausdruck zusehends in Empörung verwandelte.
„Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ist dieser Platz noch frei oder ist der Tisch für Sie und Ihre schlechten Manieren reserviert?“
Der scharfe Ton ließ ihn aus seiner Starre erwachen.
„Entschuldigung, nein – ich meine ja, der Platz ist noch frei“, stammelte er. Dabei spürte er, wie Wut in ihm aufstieg. Wer war dieses schnippische Geschöpf, das ihm jetzt gegenübersaß und ihn gegen seinen Willen so verzauberte? Aber geschah es tatsächlich gegen seinen Willen? Während Stableford dieser Frage nachhing, begann sich sein Ärger zu legen. Er hatte – nun vollends verwirrt – das brennende Bedürfnis, den missglückten Erstkontakt durch eine leichte Unterhaltung wiedergutzumachen, obwohl das seichte Geplauder definitiv nicht seine Stärke war. Von ihrer barschen Art und seinen eigenen Gefühlen verunsichert, verwarf er nacheinander „das Wetter“, „das Reisen mit der Eisenbahn“ und „die neuesten West-End-Produktionen“ als mögliche Themen und zog es schließlich doch vor zu schweigen.
Das war seit Jahren seine sichere Festung, ein Ort, an dem er sich wohlfühlte und den er nur selten verließ. Und doch ertappte er sich jetzt dabei, wie er die junge Frau gebannt beobachtete. Erst als sie aus ihrer Tasche ein Buch hervorholte und – ihn demonstrativ ignorierend – darin zu lesen begann, eröffnete sich ihm ganz unverhofft die Chance auf ein Gesprächsthema, bei dem er sich sicher fühlte. Es war ein Detektivroman, den er kannte, denn Detektivromane waren seine heimliche Leidenschaft.
„‚Der Mord am Viadukt‘, ein gutes Buch“, begann er vorsichtig und etwas mühsam. „Wussten Sie, dass der Autor ein katholischer Priester ist?“
„Nein, das wusste ich nicht, aber sicherlich wird mir dieser wertvolle Hinweis helfen, die ethisch-moralische Dimension eines völlig banalen Rätselromans besser zu begreifen. Sie müssen sich nicht mit mir unterhalten, nur weil ich an Ihrem Tisch sitze.“
„Ich unterhalte mich eigentlich gern“, log Stableford, dann ergänzte er gereizt: „Und, nebenbei bemerkt, ein wenig ethisch-moralische Dimension würde Ihren Manieren sicherlich nicht schaden.“
Sie sah auf und für einen Moment hatte er das instinktive Bedürfnis, in Deckung zu gehen. Doch der erwartete Angriff blieb aus. Stattdessen musste sie lachen und Stableford stimmte erleichtert ein.
„Wollen wir Frieden schließen?“, fragte er. „Mein Name ist John Stableford, und nur für den Fall, dass Sie mich weiter ignorieren wollen, möchte ich noch anmerken, dass das Rührei hier nicht zu empfehlen ist.“
„Nennen wir es zunächst einen Waffenstillstand, wenn Sie einverstanden sind. Mein Name ist Harriet Taylor. Ist das Rührei wirklich so schlecht?“
Harriet Stableford – ja, das würde gut klingen, dachte er und erschrak. Dann riss er sich zusammen und sagte mit fester Stimme: „Ja.“
Erst jetzt schien die junge Frau ihn etwas genauer zu betrachten. Offenbar fand sie ihn nicht unsympathisch. Ihre Anspannung legte sich zusehends, und als ihr Tee serviert wurde, begann sie ganz unvermittelt von ihrer Familie in Yorkshire zu erzählen: von ihrer über alles geliebten Mutter, ihren drei jüngeren Schwestern und ihrem Vater, dem Vikar von Upper Biggins, einem kleinen Dorf in den North York Moors. Und da Stableford ihre Geschichten sichtlich genoss, erzählte sie weiter – von ihrer abenteuerlichen Ankunft in London, ihrem ersten Job als Verkäuferin in einem Hutladen in der Oxford Street, dem zweiten als Garderobiere in einem Nachtclub nahe der Tottenham Court Road und von ihrer letzten Beschäftigung, dem Modellsitzen für eine Gruppe junger Künstler, die ihre Ateliers größtenteils in Chelsea hatten. Dann schwieg sie plötzlich und schien ihren Gedanken nachzuhängen, sodass schließlich Stableford nach einem kurzen Zögern ins Erzählen geriet: von seinem Studium in Oxford und seiner anachronistischen Existenz als Literaturprofessor in einer Zeit, die die Naturwissenschaften und ihre Anwendung, die Technik, vergötterte.
„Und wie kommt es, dass sich ein Literaturprofessor für ein so triviales Genre wie den Detektivroman interessiert?“, fragte Harriet und deutete auf ihr Buch.
„Nun, meine Beschäftigung damit liegt näher, als Sie vielleicht ahnen“, antwortete Stableford lächelnd. „Fragen Sie den nicht mehr ganz nüchternen Dekan eines x-beliebigen Colleges in Oxford oder Cambridge nach dem interessantesten Buch der letzten Jahrzehnte und er wird Ihnen erklären, dass er sich nicht zwischen ‚Trents letzter Fall‘ und ‚Roger Ackroyd und seine Mörder‘ entscheiden kann. Früher spielten die Gelehrten in ihrer Freizeit Schach, heute messen sie ihre intellektuellen Fähigkeiten im Wettstreit mit den Autoren von Detektivromanen. Der obligatorische Mord zu Beginn dieser Geschichten ist, um im Schach-Jargon zu bleiben, der Eröffnungszug des Autors, auf den hin der Leser seine erste Schlussfolgerung ziehen muss, bis schließlich einer der beiden Kontrahenten den König, also den Mörder, schachmatt setzen kann. Das Ganze hat schon an sich einen hohen intellektuellen Reiz, der eigentliche Clou liegt für mich allerdings in der strukturellen Nähe der typischen Handlungsmuster dieser Romane zum philosophisch-wissenschaftlichen Denken selbst.“
„Jetzt wollen Sie mich aber veralbern!“, rief Harriet lachend.
„Nichts liegt mir ferner! Ich halte den Detektivroman tatsächlich für die letzte Form des reinen spekulativen Denkens in unserem säkularisierten Zeitalter. Er hat, wenn Sie so wollen, eine metaphysische Grundstruktur, obwohl das zu lösende Problem, also der Mord, stets ein immanentes ist. Aber ich langweile Sie bestimmt mit meinem trockenen akademischen Gerede.“
„Ganz und gar nicht! Mein Vater hat meine Schwestern und mich früh an die klassischen Denker herangeführt. Wenn ich Sie richtig verstehe, fasziniert die Gelehrtenwelt am Detektivroman das freie Spiel mit logischen Schlüssen, die durch die Abkehr von den großen philosophischen Fragen in der Welt der Wissenschaft kaum mehr von Belang sind.“
„Ganz genau, Miss Taylor“, sagte Stableford beeindruckt und verliebte sich gleich noch ein bisschen mehr in die junge Dame. „Der Detektiv stellt wie der Philosoph Hypothesen in einer für ihn unerklärbaren Welt auf. Er betritt sozusagen ein Labyrinth, wenn er mit der Aufklärung des Falls beginnt. Dort folgt er verwirrenden Hinweisen, Spuren und Aussagen, die er logisch ordnen muss, um dem Zentrum näher zu kommen.“
„Wo ihn dann der Minotaurus erwartet?“, fragte Harriet mit einem leicht ironischen Unterton.
„Eher ein zeitgemäßeres Monster, Miss Taylor – der Mörder, den er überwältigen oder zumindest überführen muss. Der glückliche Theseus hatte den Ariadnefaden zu seiner Unterstützung, der moderne Held aber muss sich seinen eigenen Faden spinnen, um dem Labyrinth zu entkommen. Dazu knüpft er aus Beobachtungen und Befragungen den Tathergang zusammen und bringt so die Wahrheit mit ans Licht.“
„Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Mr Stableford, aber Ihr Ariadnefaden erscheint mir doch eher als das Seemannsgarn alter Sagen. Ist nicht vielmehr die Rationalität der Leitfaden, an den sich die populären Ermittler in Ihren Detektivromanen halten?“
„Sie denken vermutlich an Doyles Sherlock Holmes und Poes Dupin, die ihre Fälle nach strengen rationalen Methoden aufklären. Nun, es mag Sie überraschen, aber von den etwa zweihundertdreißig Schlüssen, die Sherlock Holmes in seinen Abenteuern nach seiner deduktiven Methode zieht, erfüllen nur knapp dreißig die Kriterien einer wissenschaftlich fundierten logischen Deduktion. Nur in diesen wenigen Fällen nimmt er es auf sich, die Gültigkeit seiner Hypothesen empirisch zu prüfen. Holmes ist durchaus vielseitiger, als uns sein Chronist Dr Watson glauben machen will. Er schließt deduktiv und induktiv, also sowohl vom Allgemeinen auf das Besondere als auch von beobachteten Phänomenen auf eine allgemeine Erkenntnis. Aber vorrangig stellt er Hypothesen im Sinne der Abduktion auf, das heißt, er folgt seiner Intuition, wird kreativ und rät. Tatsächlich sind seine Nachforschungen so erfolgreich, weil er das Raten perfekt beherrscht. Natürlich nutzt er auch hin und wieder naturwissenschaftliche Methoden, aber wenn Sie Holmes einmal näher betrachten, führt er, sieht man von seinen Lastern ab, das asketische Leben eines gelehrten Mönchs. Selbst Dr Watson passt in diesen Interpretationsansatz: Holmes hat keine Familie, dafür einen ewigen Novizen, der die Taten seines Lehrers preist und für die Nachwelt niederschreibt.“
„Ich fand Dr Watson immer sehr sympathisch“, sagte Harriet nachdenklich. „Und das nicht nur, weil Watson der Mädchenname meiner Mutter ist. Er mag naiv erscheinen, aber er verleiht den Geschichten Menschlichkeit und hält den gesunden Menschenverstand trotz all seiner Schwächen in Ehren.“
„Da haben Sie vollkommen recht! Holmes wäre allein nicht zu ertragen. Und doch wünschte ich mir, ein Mal in seine Fußstapfen treten zu können. Mir muss ja nicht gleich ein Mörder über den Weg laufen. Ein Diebstahl oder die Jagd nach einem Erpresser würden mir für den Anfang schon genügen“, gestand Stableford. „Ich verbringe dieses Wochenende übrigens auf einem Golfplatz, ganz so wie die Protagonisten in Ihrem Detektivroman. Vielleicht kommt die Gelegenheit zur Aufklärung eines Verbrechens ja ganz unverhofft in Peters Peter. So heißt der Ort, an dem das Turnier stattfindet.“
Harriet blickte ihn fassungslos an. Dann stand sie ohne ein weiteres Wort auf und verließ hastig den Speisewagen.
Stableford starrte ihr hinterher und fragte sich, was er falsch gemacht hatte. Frauen waren für ihn wie ein Buch mit sieben Siegeln. Er fühlte sich fraglos zu ihnen hingezogen, aber er verstand sie nicht. Bei Harriet schien es anders gewesen zu sein, aber hatte er sich nicht schon einmal gründlich getäuscht?
Obwohl er keinen Alkohol vertrug, bestellte er sich einen Whisky, entzündete seine alte Pfeife und betrachtete, seinen düsteren Gedanken nachhängend, die vorbeiziehende Landschaft. Als der Zug ein Waldstück durchquerte, sah er sich plötzlich selbst in der Fensterscheibe und musterte sein Spiegelbild. Er war schlank, mittelgroß und sicher kein Adonis. Trotz seiner zweiundvierzig Jahre wirkte er eher wie Mitte dreißig. Die Narbe über seiner rechten Augenbraue verlieh seinem Gesicht etwas Düsteres, aber seine lebendigen braunen Augen, seine schmalen Hände und seine intelligente, leicht melancholische Ausstrahlung erschienen ihm nicht unattraktiv. Doch wer wusste schon, was Frauen an Männern attraktiv fanden?
Mit dem dritten Whisky brachte ihm der besorgt dreinblickende Kellner unaufgefordert die Rechnung. Resigniert kam Stableford zu dem Schluss, dass er wohl genauso flirtete, wie er Golf spielte: Er machte einfach zu viele dumme Fehler. Wie war er nur dazu gekommen, einer vollkommen fremden Dame beim ersten Aufeinandertreffen seinen albernen Pennälerwunsch zu offenbaren, ein Mal Sherlock Holmes spielen zu dürfen? Kein Wunder, dass sie verschreckt das Weite gesucht hatte! Vielleicht war es besser so, versuchte er sich selbst einzureden und merkte doch sofort, dass er über das abrupte Ende dieses unverhofften Tête-à-Têtes noch lange nicht hinwegkommen würde.
Erst jetzt fiel ihm auf, dass Harriet ihr Buch auf dem Tisch vergessen hatte. Er nahm es an sich und öffnete es. Auf der Innenseite des Buchdeckels befand sich ein kunstvoll gestaltetes Exlibris: An einer dorischen Säule lehnte eine griechische Göttin, die eindeutig Harriets Gesichtszüge trug. Unter der Abbildung stand mit roter Tinte geschrieben: „Eigentum von William Slocum“.
KAPITEL 3: Ein missgelauntes Trio
Zurück in seinem Abteil fand Stableford die drei Plätze gegenüber seiner Bankreihe belegt. Er grüßte und ließ sich am Fenster nieder – froh, wieder zu sitzen, denn der Whisky wirkte jetzt deutlich. Ihm gegenüber blätterte eine junge Frau von vielleicht zweiundzwanzig Jahren sichtlich gelangweilt in einem Magazin, das sie ungeschickt in einer Ausgabe der Vogue versteckt hielt. Sie trug ihr kurzes dunkelbraunes Haar wie die Dame auf dem Titelblatt und ein elegant geschnittenes rubinrotes Kleid mit Pelzbesatz am Kragen, das nach Stablefords Einschätzung ein kleines Vermögen gekostet haben musste. Als der Zug über eine Weiche fuhr, verrutschten ihr die beiden Zeitschriften für einen Moment, sodass Stableford den Titel ihrer wirklichen Lektüre erkennen konnte: „Ich gestehe. Wahre Geschichten um Liebe und Leidenschaft.“
Sieh an!, dachte Stableford amüsiert und sank noch etwas tiefer in den gemütlich gepolsterten Sitz des Erste-Klasse-Coupés.
Ihm blieb nicht lange verborgen, dass die Stimmung im Abteil nicht die beste war. Der groß gewachsene korpulente Mittfünfziger im dunklen Anzug, der neben der jungen Dame saß, hatte Stablefords Gruß bei seinem Eintreten gänzlich ignoriert. Nun blickte er von seiner Zeitung auf, nickte ihm, mehr drohend als grüßend, zu, um gleich darauf wieder hinter dem Wirtschaftsteil der Times zu verschwinden.
Verwundert wandte sich Stableford der dritten Person im Abteil zu. Sie wirkte wie eine reifere Version der jungen Frau am Fenster. Ganz offensichtlich handelte es sich bei dem Trio also um eine Familie. Die Dame war etwa Anfang vierzig und schön, in einem erwachsenen Sinn des Wortes. Unter ihrem Pelzmantel trug sie ein durchaus gewagt geschnittenes schwarzes Kleid, an dessen Kragen eine große goldene Brosche in Form eines Skarabäus prangte. In ihrem Blick entdeckte Stableford nach einiger Zeit etwas, womit er nicht gerechnet hatte – Angst.
Er fühlte sich unwohl, denn die drei mussten sich kurz vor seinem Eintreten gestritten haben.
Mit der Spannung, die in diesem Abteil herrscht, könnte man halb London illuminieren, dachte er und stellte sich schlafend, bis ihn der Schlaf tatsächlich übermannte. Kurz vorher aber hörte er noch eine Frau flüstern.
„Ich habe ihn gesehen, Arthur, hier im Zug. Arthur, ich habe Angst.“
Und die leise, aber scharfe Antwort eines Mannes: „Halt den Mund, Helen!“
KAPITEL 4: Den Anschluss verloren
„Sir! Hören Sie, Sir! Wir haben die Endstation erreicht. St. Ives, Cornwall. Sie müssen den Zug jetzt verlassen.“
Stableford erwachte aus einem tiefen traumlosen Schlaf. In der Tür stand ein Schaffner. Das Abteil war leer.
„Wie lange stehen wir hier schon?“, fragte Stableford verwundert.
„Nun, der Zug traf pünktlich um fünf Uhr fünfundvierzig hier in St. Ives ein“, erwiderte der Schaffner und verschwand ohne ein weiteres Wort im Gang.
Stableford gähnte herzhaft und rieb sich die Augen. Dann erhob er sich, nahm sein Gepäck aus dem Netz über seinem Platz und stand wenig später auf dem völlig menschenleeren Bahnsteig, der nur schwach von zwei Gaslaternen beleuchtet wurde. Die Bahnhofsuhr zeigte sieben an. Ihre Zeiger waren das Einzige, was sich an diesem Ort bewegte.
In dem kleinen Gebäude hinter dem Bahnsteig fand Stableford zu seiner großen Erleichterung den Bahnhofsvorsteher. „Entschuldigen Sie, ich muss noch heute Abend nach Peters Peter weiterreisen. Wie mache ich das am besten?“
Der Mann sah ihn mitleidig an. „Peters Peter? Da haben Sie aber wirklich Pech. Vor dem Bahnhof warteten drei große Limousinen, die Gäste aus London nach Peters Peter bringen sollten. Sie sind allerdings schon lange weg. Aber ich kenne da jemanden, der Sie fahren könnte. Mein Schwager hat eine Garage am anderen Ende der Stadt. Wenn Sie wollen, rufe ich ihn an.“
„Wenn Sie das organisieren könnten, wäre ich Ihnen wirklich dankbar. Wie viele Gäste waren es denn?“
„Drei Frauen und drei Männer, wobei die Frauen deutlich hübscher waren“, erwiderte der Mann lachend und verschwand in seinem Büro, um zu telefonieren. Kurze Zeit später kehrte er zurück. „Sie haben Glück! Mein Schwager ist in zwanzig Minuten vor dem Bahnhof. Das Ziel Ihrer Reise hat ihn zwar ziemlich überrascht, aber so eine Fuhre kann er sich nicht entgehen lassen. Über den Preis müssen Sie selbst mit ihm verhandeln.“
Stableford dankte dem Mann und trat wenig später auf den kleinen Bahnhofsvorplatz hinaus.
„Haben Sie Feuer?“, fragte eine Stimme hinter ihm, als er gerade damit begonnen hatte, seine Pfeife zu stopfen.
Stableford fuhr herum. Auf einer Bank neben dem Eingang saß ein groß gewachsener Mann, vielleicht fünfundvierzig Jahre alt und von auffällig athletischer Statur. Er stand auf und kam langsam auf Stableford zu.
„Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt haben sollte“, sagte er, sah aber selbst aus, als ob er gerade einem Geist begegnet wäre.
Stableford holte seine Streichhölzer hervor, gab dem anderen Feuer und zündete anschließend seine eigene Pfeife an. Sie rauchten eine Weile schweigend. Da sich kein Gespräch zu entwickeln schien, ließ Stableford seinen Blick schweifen und entdeckte neben der Bank, auf der der Fremde gesessen hatte, eine Art Seesack und – eine Golftasche.
„Verzeihen Sie meine Neugierde, aber könnte es sein, dass Sie auch nach Peters Peter müssen?“
Der Mann musterte ihn misstrauisch. „Ja“, sagte er schließlich müde, um dann, als wenn er gerade eine schwere Entscheidung getroffen hätte, fortzufahren: „Aber ich glaube nicht, dass wir diesen Ort heute noch erreichen werden.“
„Nun, ich glaube, Sie haben Glück“, entgegnete Stableford. „Ich warte auf einen Wagen, der mich dorthin bringen soll. Wenn Sie wollen, können wir gemeinsam fahren.“
Der andere zögerte erneut, nahm das Angebot aber schließlich an. „Thomas Fitzpatrick, Reiseschriftsteller aus London“, stellte er sich vor.
Kurz darauf kam ein Wagen in Sicht, der sehr dynamisch auf dem Bahnhofsvorplatz gewendet wurde und mit äußerst wenig Spielraum vor den beiden Männern zum Halten kam. Auf der Seite des betagten hellblauen Vauxhall 14/40 stand in goldenen Lettern: „E.R. Finch & Son. Taxi Services & Motor Engineers“.
KAPITEL 5: Reise in die Unterwelt
Mr Finch, ein älterer Mann, von dem Stableford inständig hoffte, dass er die schmalen Straßen, die sie mit atemberaubender Geschwindigkeit Richtung Westen entlangjagten, besser kannte als die englische Grammatik, war vor Begeisterung für seine kornische Heimat kaum zu bremsen. Nach einem kurzen Ausflug in die Geschichte der Artus-Legende, die er wie jeder waschechte Bewohner Cornwalls mit den Ruinen von Tintagel Castle verband, kam er auf den Bergbau zu sprechen, der die Region über Jahrhunderte geprägt hatte. Die Dunkelheit ignorierend, zeigte er mit ausladenden Bewegungen auf jede noch so unbedeutende, vom fahlen Mondlicht beschienene Zinn- oder Kupfermine, die sie passierten, und brachte sich und seine Passagiere dabei fast jedes Mal ernsthaft in Gefahr. Erst als Zennor hinter ihnen lag und Finch die Bergmannsgeschichten langsam ausgingen, kam er auf das Ziel ihrer Fahrt zu sprechen. Die beiden Männer erfuhren, dass Peters Peter auf Petershead nordöstlich von Cape Cornwall lag.
„Das Eigentümliche an dieser Landzunge ist übrigens seine Trennung vom Festland, müssen Sie wissen“, schrie Finch gegen das Motorengeheul an. „Da fließt ’n Bach am Boden von so was wie ’ner kleinen Schlucht. Es gibt bloß eine Brücke, und die ist älter als wie wir drei zusammen, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben tun. Der Bach ist manchmal auch ’n Fluss, kommt auf die Jahreszeit und das Wetter an. Heißt übrigens Acron oder so, der Bach mein ich.“
Acheron, dachte Stableford düster, denn natürlich kannte er den Fluss, der in der griechischen Mythologie in die Unterwelt führte. Ich hoffe, dass wir ihn zwei Mal überqueren werden.
Nach gut eineinhalb Stunden Fahrt erreichten sie die besagte Brücke, eine wenig Vertrauen einflößende Holzkonstruktion, die zur Gegend passend Petersbridge hieß und tatsächlich uralt sein musste. Sie passierten sie im Schritttempo, und selbst ihr todesmutiger Chauffeur atmete hörbar auf, als sie wieder festen Boden unter den Rädern hatten. Danach kamen sie nur noch langsam voran, denn die Straße war nicht mehr befestigt und voller tückischer Bodenwellen und Schlaglöcher. Nach etwa zwanzig Minuten durchfuhren sie ein Dorf mit nicht mehr als zehn oder fünfzehn Häusern und einer kleinen Kirche. Die Gebäude, allesamt aus grauem Granit errichtet, wirkten ärmlich und verfallen. Nicht ein Mensch war auf der Straße zu sehen und hinter keinem der kleinen Fenster brannte Licht.
„Wie heißt dieser Ort?“, fragte Stableford etwas beklommen.
„Peters Peter“, antwortete Finch fröhlich. „Ist seit über zehn Jahren verlassen. ’ne echte Geisterstadt.“
„Gibt es denn noch andere Dörfer auf Petershead?“
„Nö, und ehrlich gesagt dachte ich, dass auch das Peters Inn mit der Schließung vom Golfplatz dichtgemacht hätte. Ist nämlich sozusagen das Clubhaus gewesen. Aber da hab ich mich wohl getäuscht. Wäre zumindest besser für Sie, nicht wahr?“
Stableford und sein Begleiter sahen sich unsicher an. Die Frage blieb unbeantwortet.
„Das gefällt mir nicht“, sagte Fitzpatrick leise. „Das gefällt mir ganz und gar nicht. Am liebsten würde ich umkehren.“
Auch Stableford gefiel das Ganze nicht wirklich. Sie hatten den Acheron überquert und waren nun scheinbar tatsächlich in der Unterwelt, dem Reich der Toten, gelandet. Doch immerhin hatte das Peters Inn nicht „dichtgemacht“. Schon aus einiger Entfernung sah Stableford ein fahles Licht, das sich beim Näherkommen als eine starke Laterne über dem Eingang des Hauses entpuppte, vor dem der Wagen wenig später zum Halten kam. Das große, zweistöckige Gebäude aus grauem Granit hatte ganz und gar nichts mit einem Inn zu tun. Es war reich mit elisabethanischen Stilelementen versehen, allerdings wohl erst im späten achtzehnten Jahrhundert errichtet worden. Das Seeklima hatte deutliche Spuren an der Fassade hinterlassen, was dem Haus einen morbiden Charme gab.
Finch blieben Stablefords bewundernde Blicke offenbar nicht verborgen. „Das haben Sie nicht erwartet, was? Der Kasten hieß früher Grimpen Manor. Ist ’ne merkwürdige Geschichte. Die Talbots, die hier lebten, haben das Haus vor langer Zeit nach mehreren Unglücksfällen in der Familie verlassen. Früher erzählte man sich ’ne Menge Spukgeschichten darüber. Der alte Talbot soll ...“
„Danke, Mr Finch“, schnitt ihm Stableford entnervt das Wort ab. Eine Spukgeschichte war das Letzte, was er zu dieser Stunde und an diesem Ort hören wollte.
Die beiden Reisenden bezahlten den Fahrer und warteten vor dem Eingang des Peters Inn, bis der Vauxhall nicht mehr zu hören war. Stableford blickte sich um. Das Haus lag anscheinend völlig einsam auf einem flachen Hügel in der Nähe des Meeres. Sehen konnte man nichts, doch die Luft war frisch und roch salzig und das Rauschen der Atlantikbrandung war deutlich zu hören. Die Szenerie erinnerte Stableford an die Schauerromane, die er als Junge gelesen hatte: ein verwittertes Gemäuer inmitten einer menschenleeren, wild-erhabenen Moorlandschaft. Aber gab es hier auch eine junge Heldin, die von dunklen Mächten bedrängt und der Ohnmacht nahe auf Rettung harrte? Er musste an Harriet denken, und das brachte ihn zurück in die Gegenwart.
„Es gibt wohl kein Zurück mehr“, stellte er nüchtern fest und griff nach seinem Gepäck. „Wollen wir hineingehen, Mr Fitzpatrick?“
Sie betraten eine große Halle, die mit dunklem Holz getäfelt war. Das spärliche Licht, das von der Außenlaterne durch die Fenster schien, warf lange gespenstische Schatten gegen die Wände. Auf der rechten Seite befand sich eine Art Rezeption, die wohl gleichzeitig als Bar diente, denn sie wurde durch zwei Zapfhähne ergänzt. Links von ihnen waren drei schwere Ledersessel vor einem riesigen Kamin gruppiert, in dem die letzten Glutreste eines großen Feuers glimmten. Auf einem Beistelltischchen nahe den Sesseln konnte Stableford mehrere leere Pint- und Cocktailgläser ausmachen. Am Ende der Halle führte eine breite Holztreppe in das obere Stockwerk.
Plötzlich öffnete sich eine Tür links neben dem Kamin. Stableford und sein Begleiter zuckten zusammen. Aus der Dunkelheit kam ihnen ein großer, grobschlächtig wirkender Mann um die sechzig entgegen.
„Willkommen im Peters Inn“, sagte er schwerfällig. „Mein Name ist Crabtree und ich begrüße Sie im Namen des Bankhauses Milford & Barnes im Petershead Golf Club.“ Er trat hinter den Tresen, entzündete umständlich eine Petroleumlampe und holte ein bereits geöffnetes Gästebuch hervor. Mit seiner großen Hand, die schwere körperliche Arbeit vermuten ließ, strich er die aufgeschlagene Seite glatt und fuhr mit einem dicken, schmutzigen Finger darüber. Offenbar suchte er die Einträge ab. „Sie müssen J. Stableford und T. Fitzpatrick sein“, stellte er schließlich fest.
„So ist es“, bestätigte Fitzpatrick leise.
„Sie kommen spät“, sagte Crabtree, schien aber keine Antwort oder gar eine Entschuldigung zu erwarten. „Ihre Zimmer befinden sich im ersten Stock, Nummer fünf und sechs, die Schlüssel stecken außen im Schloss. Soll ich Ihnen mit dem Gepäck helfen?“
„Nein, vielen Dank“, erwiderte Fitzpatrick, der schon auf dem Weg zur Treppe war.
Stableford sagte nichts. Wie versteinert stand er vor dem Tresen und blickte auf das aufgeschlagene Gästebuch. Über seinem Namen hatte er den Eintrag für Zimmer Nummer vier gelesen: W. Slocum und Begleitung, London. Konnte das wahr sein?
Wie benommen ging er schließlich die Treppe hinauf. In dem breiten dunklen Gang oben blieb er stehen. Fitzpatrick war verschwunden. Stableford entzündete ein Streichholz und blickte sich um. Der Gang war völlig symmetrisch angelegt. Vor ihm befanden sich sechs Zimmertüren, auf denen große Messingzahlen prangten. An den beiden Enden des Gangs gab es jeweils eine weitere Tür ohne Nummerierung. Gegenüber den Zimmern eins und sechs befanden sich die Bäder. Daneben hingen links und rechts von der Treppe schwere Vorhänge.
Neugierig schob Stableford den Vorhang zu seiner Rechten ein wenig zur Seite. Sein Streichholz war inzwischen erloschen, also zündete er ein weiteres an. Es beleuchtete eine Bettnische, in der zu Zeiten der Talbots vielleicht Dienstboten geschlafen hatten. Jetzt war der Alkoven leer.
Nachdem auch das zweite Streichholz ausgegangen war, lief Stableford mit schweren Schritten den Gang entlang bis zur Tür Nummer fünf. Er betrat sein Zimmer und schaltete das Licht ein. Als er sich erschöpft in einen am Fenster stehenden Sessel fallen ließ, spürte er den Detektivroman in seiner Sakkotasche. Er zog ihn hervor, öffnete ihn und betrachtete lange das Bild der griechischen Göttin.
Ein bisschen zu viel griechische Mythologie für einen Tag im guten alten England, dachte er, schlug das Buch zu und entzündete seine Pfeife.
Bald stiegen Rauchringe zur Zimmerdecke auf. Stableford beobachtete sie versonnen. Die Begegnung mit Harriet hatte ihn verwirrt. Immer wieder schlich sie sich seit ihrer Begegnung im Speisewagen in seine Gedanken. Dabei hatte er sich doch längst mit seinem Leben als Junggeselle abgefunden! Mit der Einsamkeit, für die er gute Gründe hatte. Von außen betrachtet führte er ein Leben für die Wissenschaft, die Literatur und die Philosophie. Ein ruhiges, zurückgezogenes Leben, um das ihn viele beneiden mochten. Niemand in seinem Umfeld ahnte, dass dieser Rückzug nicht wirklich frei gewählt war. Und hin und wieder verspürte er eine merkwürdige Unruhe. War das wirklich schon alles?, fragte er sich in diesen Momenten. Mit einer Frau wie Harriet hätte er vielleicht den Mut gefunden, neue Wege zu gehen. Aber Harriet war wortlos verschwunden.
Erst jetzt fiel sein Blick auf eine Durchgangstür, die durch einen Kleiderschrank halb verstellt war. Sie führte in das Zimmer Nummer vier. Vielleicht lag Harriet in diesem Moment nicht einmal fünf Yards von ihm entfernt in den Armen eines anderen.
Missmutig klopfte Stableford seine Pfeife aus und begann seinen Koffer auszupacken. Seine Abendgarderobe verstaute er im Schrank, die mitgebrachten Bücher und Medikamente fanden auf dem Nachttisch Platz. Auf dem Fensterbrett stand eine kleine Wasserkaraffe. Er nahm das Glas von ihrem Hals und goss es fast voll. Dann ging er zum Nachttisch, öffnete eine kleine blaue Flasche und schüttete etwa zwei Teelöffel eines weißen Pulvers in das Glas. Als er den Inhalt mit dem Zeigefinger umrührte, färbte sich das Wasser milchig weiß. Nun holte er ein Papierbriefchen aus einer kleinen Schachtel, öffnete es vorsichtig und gab den Inhalt ebenfalls in das Glas, das er anschließend in einem Zug leerte.
Ein paar Briefchen mehr, und das Versteckspielen hätte ein Ende, dachte er düster und ging zu Bett. Kurze Zeit später löschte er das Licht. Im Haus war es totenstill.
KAPITEL 6: Eine schlaflose Nacht
Harriet lag wach. Zum Glück hatte das Doppelbett zwei Decken. Sie hätte eine – wenn auch nur zufällige – Berührung Williams heute Nacht nicht ertragen. Es war immer eine Qual, aber heute hätte sie sich ihm verweigert, egal welche Konsequenzen er ihr angedroht hätte!
Er hatte wieder getrunken. Auf seinem Nachttisch stand die halb leere Glaskaraffe seines Barsets. Wenn er trank, war er noch unerträglicher als sonst, aber dafür schlief er schneller ein.
In der Hölle geht das Glück auf Zehenspitzen, dachte sie traurig und schloss die Augen. Die letzten Monate waren ein Albtraum gewesen, doch irgendwie hatte sie es geschafft, sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren. Gab es erste Anzeichen, dass er ihrer bald überdrüssig werden würde, oder war das nur ihr Wunschdenken?
Sie verbrachte ihre Tage mit William in einer fast hypnotischen Teilnahmslosigkeit, nur manchmal wurde ihr alles zu viel – so wie heute Morgen! Sie hatte sich mit ihm gestritten und war, kurz nachdem der Zug die Paddington Station verlassen hatte, aus ihrem Abteil geflüchtet. Aber warum musste sie sich im Speisewagen ausgerechnet zu diesem Sonderling setzen? Und warum ging ihr dieser philosophierende Hobby-Sherlock-Holmes mit der verwegenen Narbe über der Augenbraue nicht mehr aus dem Kopf? Zugegeben: Er war nett und die Vertrautheit, die sie spürte, war etwas ganz Besonderes. Sie hatte ihm ungefragt ihre Lebensgeschichte erzählt. Andererseits hatte sie kaum etwas von ihm erfahren, obwohl sie sich lange unterhalten hatten. Er hatte merkwürdig verschlossen gewirkt, fast ein wenig geheimnisvoll, und war erst aufgetaut, als er über den Detektivroman zu dozieren begonnen hatte.
Eigentlich war er gar nicht ihr Typ! Wie wenig entsprach dieser düster dreinblickende Professor ihren Leinwandhelden. William Powell, Jack Buchanan, Clark Gable, das waren Männer! Und doch musste sie sich eingestehen, dass sie fast ein wenig enttäuscht gewesen war, als er sich nicht auf dem Bahnhofsvorplatz bei den drei großen Limousinen eingefunden hatte, die sie nach Peters Peter gebracht hatten.
Was waren sie für ein bizarrer Haufen gewesen: William und sie, die Fenshaws, eine gutbürgerliche Familie, die wohl nur hinter zugezogenen Vorhängen lachte, sowie ein humpelnder Herr, dessen Name – Holmes – John entzückt und dessen bissige Bemerkungen Oscar Wilde zum Lachen gebracht hätten. Hatte sie ihn gerade „John“ genannt? Warum verschwendete sie überhaupt auch nur einen Gedanken an diesen Mann? Sie war die Geliebte eines anderen und es stand nicht in ihrer Macht, dies zu ändern. Oder doch? Hatte William die Fotografien mit nach Peters Peter gebracht? Waren sie vielleicht hier in diesem Zimmer?
Sie richtete sich vorsichtig auf und betrachtete den Mann, der neben ihr mit offenem Mund schnarchte. Sollte sie es wagen, jetzt seine Sachen zu durchsuchen? Doch sie fand nicht den Mut und ließ sich zurück auf ihr Kissen fallen. Dann schloss sie abermals die Augen und versuchte zu schlafen. Vergeblich. Wieder musste sie an den vergangenen Abend denken.
Der Begrüßungsdrink in der Halle war ein Desaster gewesen, und das hatte nicht allein an der Abwesenheit des Gastgebers gelegen. Mrs Fenshaw hatte sich direkt nach der Ankunft wegen einer Migräne entschuldigt und war zu Bett gegangen. Ihr Mann und William hatten mit einer spürbaren gegenseitigen Abneigung höflich über Golf gesprochen und die Tochter der Fenshaws hatte sich nach ihrem eigenen auch noch den Martini ihrer Mutter genehmigt. Holmes hatte mit ihr und Harriet gescherzt, als ob er für ein neues Noël-Coward-Stück proben würde.